Seit etwa zwanzig Jahren beschaeftigen sich einige Ethnologen/Anthropologen mit dem Thema Zeit, nicht nur weil Zeit ein interessanter Forschungsgegenstand ist, sondern weil uns – im Zusammenhang mit der postkolonialen Kritik unserer Disziplin – aufgegangen ist, dass Zeit wesentlich, konstituierend ist, sowohl in unseren Forschungspraktiken als auch in dem Diskurs ueber andere Kulturen (also auch deren Zeiten
), den wir auf Grund unserer Forschungen formulieren. Mit anderen Worten, nicht ueber die Zeit der Anderen als Vorstellung moechte ich an dieser Stelle sprechen, sondern darueber, wie wir Ethnologie als Wissen von anderen in der Zeit und durch Zeit gewinnen (oder verspielen). Sich ueber diese Fragen Klarheit zu verschaffen, scheint mir ein dringendes Anliegen, ja eine Bedingung, produktiven Nachdenkens ueber globale Entwicklungspolitik und interkulturelle Kommunikation
zu sein. weiterlesen »
- An/Greifbar: Warum BerlinerInnen gegen die digitale Kolonialisierung ihrer St…
- Hacking Women: Ein Blick über den Tellerrand der männlich dominierten Compu…
- Abschaffung der Arbeit? Künstliche Intelligenz, Kapitalismus und Transhumani…
- SILENT WORKS: Berliner Gazette Jahresprojekt zu verborgener Arbeit im KI-getr…
- Gemeinsam machen: Wie die feministischen Prinzipien des Internets entstanden …
- In der Schneekugel: Wie Literatur virtuelle Räume erinnern, erschaffen und n…
- Klimawandel und Selbstkritik: "Wir gedeihen, uneingeladen, wo wir nie wachsen…
- Bild des Monats: Warum wir im Jahr 2020 noch viel mehr Gretas brauchen werden…
- Am Ground Zero des Klimawandels: Green Grabbing, Massenmigration und die Roll…
- Jenseits des Menschengemachten: Indigene Kosmologien als Roadmap für die Kli…
-
Verweigerte Zeitgenossenschaft
-
Wahrnehmungsjogging
Frueher, als Kind und Jugendliche, war Zeit fuer mich eine Ewigkeit. Die Tage gingen manchmal gar nicht vorbei. Immer wieder habe ich auf die Uhr geschaut, aber die Zeit blieb scheinbar stehen. Das lag wohl zum grossen Teil daran, das mein Kopf schon frueh weiter war, als sich meine koerperlichen und gesellschaftlichen Moeglichkeiten ausgebildet hatten. weiterlesen »
-
Nirgends endgültig ankommen
In einem nachgelassenen Fragment
Die Zeit bedenken
sinniert Vilem Flusser ueber die Zeitform der Informationsgesellschaft. Er unterscheidet dabei drei Formen der Zeit, naemlich die Zeit des Bildes, die Zeit des Buches und die Zeit des Bits, geometrisch ausgedrueckt, die flaechenhafte Zeit, die lineare Zeit und die punktuelle Zeit. Die Zeit des Bildes gehoert zur mythischen Zeit. Hier herrscht eine ueberschaubare Ordnung. Jedes Ding hat seinen unverrueckbaren Platz. Entfernt es sich von ihm, so wird es zurechtgerueckt. Die Zeit des Buches gehoert zur geschichtlichen Zeit. Ihr wohnt die geschichtliche Linearitaet inne. Sie ist ein Strom, der aus der Vergangenheit fliesst und der Zukunft zustrebt. Jedes Geschehen verweist auf den Fortschritt oder auf den Verfall. weiterlesen » -
Musik ist weder Zeit noch Geld
Ich habe mich eigentlich nie mit Zeit beschaeftigt, bis ich mit 18 Jahren als untauglich fuer den Wehrdienst befunden wurde und meine Mutter mir erzaehlte, dass ich ja jetzt zwei Jahre gewonnen haette, die ich unbedingt fuer eine schnelle Beendigung einer Ausbildung oder eines Studiums nutzen solle. Diese Art von Logik konnte ich nicht wirklich nachvollziehen und brach die Schule ab, um forthin rumzugammeln und Musik zu machen. Da meine Eltern davon nicht so begeistert waren wie ich, stellten sie abrupt jegliche finanzielle und moralische Unterstuetzung ein, woraufhin ich angefangen habe, mich mit Jobs als Lkw-Fahrer, Schraubenlegierer, Marktforscher, Buecherkommissionierer etc. ueber Wasser zu halten. Das allerdings stahl mir sehr viel Zeit zum rumgammeln und Musik machen und ich beschloss, fortan nur noch Musik zu machen, aber auch etwas weniger rumzugammeln, damit ich vor mir selbst ethisch vertreten konnte, in Zukunft fuer Musik bezahlt zu werden. Zeit und Geld schienen auf einmal zusamenzuhaengen. Jetzt interessiere ich mich eher fuer die Brueche in diesem Zusammenhang. weiterlesen »
-
Offene Prozesse
Ich komme aus Santiago de Chile, seit 2004 lebe ich in Berlin. Eigentlich wollte ich Schriftstellerin werden. Als 1989 die in Chile die Diktatur endete, wurde die Kulturpolitik neu strukturiert. Mit einem Mal flossen viele oeffentliche Gelder in den Kunstbetrieb. Das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass Kunst etwas Visuelles ist. Das Schriftstellerische verschwand dahinter. Zahlreiche Institutionen, Kunstschulen wurden gegruendet, Ausstellungen, Kataloge produziert. weiterlesen »
-
Keine Atempause
Mit dem Webprojekt Single-Generation fuehre ich meine Singleforschung fort, die ich im Zuge meines sozialwissenschaftlichen Studiums und meiner Magisterarbeit ueber das Single-Dasein begonnen habe. Seit zirka vier Jahren betreibe ich die Website www.single-generation.de, die eine Weiterentwicklung von www.single-dasein.de ist, mit der ich im April 2000 meine Dokumentation der Single-Debatte begonnen habe. Warum Single-Generation? Der Begriff, so wie ich ihn gebrauche, akzentuiert den vorherrschenden Zeitgeist neu, der um die Jahrtausendwende mittels Begriffen wie
Single-Gesellschaft
oderSpass-Gesellschaft
kritisiert wurde. weiterlesen » -
Zum Stillstand kommen
Vor kurzem las ich im Wirtschaftsmagazin
brand eins
einen Artikel ueber die Elektronikkette Best Buy und ihr vermeintlich revolutionaeres Arbeitszeitsmodell. Die Angestellten des US-amerikanischen Unternehmens duerfen sich ihre Tage offenbar vollkommen frei einteilen und muessen waehrend der Arbeit nicht einmal im Buero anwesend sein.Results-only work environments
lautet der Fachbegriff fuer diese Art von Arbeitsorganisation, bei der allein die Ergebnisse zaehlen. weiterlesen » -
Arbeit und Zeit: “Schon wieder Sommer”
“Nun lauf doch nicht schon wieder so schnell. Du immer mit Deinem Berliner Schritt.” Unzaehlige Male hat Sebastian Sooth diesen Satz in Leipzig schon gehoert. Sein Alltag in der Projektberatung und -umsetzung besteht darin, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Als selbststaendig taetiger Mensch schafft er sich seine Beschleunigungszwaenge leider selbst. Zehn Minuten auf etwas zu warten, dauert natuerlich laenger, als nur noch zehn Minuten zu haben, bis ein Projekt erledigt sein muss. Und so bewegt sich sein Leben zwischen den beiden Polen “Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich” und “Koennt ich doch die Zeit vordrehen!”. weiterlesen »
-
Wallraff reloaded
Was ist das Eigene und was das Andere? Die Grenzen zwischen beiden sind immer fliessend, so dass man sagen koennte, eine Beschaeftigung mit dem Anderen bedeutet auch eine Beschaeftigung mit dem Eigenen. Hier geht es um eine Horizontenverschmelzung und eine Horizontenueberlappung. Das wurde mir bewusst, als ich begann, Biographien zu schreiben. weiterlesen »








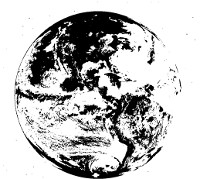





 KOMPLIZEN
KOMPLIZEN
