Zunächst einmal ist der Unterschied zwischen lernen und sich bilden nicht sehr groß. Beides kann absichtlich und unabsichtlich geschehen. Beides kann man zuweilen erst feststellen, wenn es bereits zu spät ist, also nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Ich glaube, ein entscheidender Unterschied liegt darin, dass “sich bilden” ohne das Reflexivpronomen nicht funktioniert. Bei der Bildung läuft die Referenz auf denjenigen, der sich bildet, mit. Das gibt der Sache den Akzent, es bis zu einem gewissen Punkt mit einer Entscheidung zu tun zu haben (jenseits dieses Punkts verweist Bildung nach wie vor auf etwas Transzendentes). Lernen hingegen kann automatisch geschehen, ohne Beteiligung einer Selbstbeobachtung.
Einer meiner wichtigsten Lehrer war mein Deutschlehrer im Gymnasium. Er hat uns Texte (von Adorno) zugemutet, die wir nicht verstehen konnten. Seither wusste ich, was ich einmal werden wollte: Jemand, der sich mit diesem Typ von Texten beschäftigen kann.
Texte für das Radio
Ich selbst schreibe solche schwierigen Texte nicht. Aber ich habe Spaß daran, den Realverwicklungen und Realwidersprüchen der Phänomene auch einen einigermaßen angemessenen sprachlichen Ausdruck zu geben. Ich nehme an, die Texte sind das Ergebnis meiner Arbeit an der Sache.
Ich schreibe Texte, mit deren Hilfe ich herauszufinden versuche, welche Möglichkeiten ich habe, Fragen zu stellen, die mir erst im Zuge des Schreibens des Textes deutlich werden. Ich versuche niemanden zu erreichen geschweige denn herauszufordern. Aber ich mache ein Angebot, von dem ich hoffe, dass es auch für andere interessant ist.
Meine ersten Texte mit größerer Breitenwirkung habe ich für den Rundfunk geschrieben. Mir war klar, dass die meisten dieser Texte nahezu ungehört im Äther verhallten (bei einer Quote von durchschnittlich 50.000 Hörern pro Sendung).
Ich sagte mir damals und sage mir dies auch noch heute, dass ich meinen Beitrag in dem Moment geleistet habe, in dem es mir gelingt, einen Tonfall vorzuführen, der es anderen erschwert, die Dinge simplistisch darzustellen. Es ging um Sprachpflege fast noch mehr als um bestimmte Mitteilungen über Sachverhalte. Die Sprache ist der wichtigste “Rechner”, den wir in der Gesellschaft haben. Es kostet Arbeit, diesem Rechner eine bestimmte Bandbreite zu erhalten.
Radiohören und lernen
Ich hörte immer sehr gerne und auch sehr häufig Radio und tue das noch heute, vornehmlich die sogenannten Kultursender. Das Radio hat für mich bei Wort- und Musikbeiträgen den großen Vorteil, mich mit Dingen zu konfrontieren, die ich mir nicht selber ausgesucht habe. So erfahre ich von Themen, für die ich mich freiwillig vielleicht nicht interessieren würde, und höre Musik, die ich noch nicht kannte.
Insofern kann man von unfreiwiliger Bildung im/mit Radio sprechen. Freiwillig unfreiwillig, denn wo sonst hat man die Möglichkeit, nach Belieben einsteigen und aussteigen zu können und dennoch anspruchsvoll bedient zu werden?
Der Unterschied zwischen Radio und Schule besteht eben darin, dass man in der Schule nicht einsteigen und aussteigen kann, wann man will und auch nicht immer sehr anspruchsvoll bedient wird. Außerdem drängt sich in der Schule die Absicht der Erziehung ziemlich unangenehm in den Vordergrund.
Forscher auf der Schulbank
Das Internet ist die perfekte Mischung beider Formen von Bildung. Ich surfe und recherchiere freiwillig, stoße aber unfreiwillig immer wieder auf neue, interessante Links. Es macht mich schneller und umfassender mit den Kompetenzen anderer Leute bekannt als andere Medien.
Tatsächlich denke ich gegenwärtig zum ersten Mal seit langer Zeit über Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Mathematik komplexer Systeme nach. Als Forscher hat man ja dieses wunderbare Privileg, sich jederzeit noch einmal auf die Schulbank setzen zu können. Man muss nur die Zeit dafür finden.
(Anm. d. Red.: Der Verfasser des Protokolls ist Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und -analyse an der Zeppelin University, sein Blog heißt Social Calculus, zuletzt erschien von ihm Die Sache mit der Führung.)



 MORE WORLD
MORE WORLD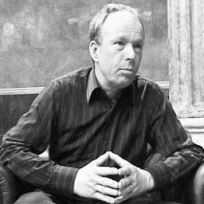

15 Kommentare zu
http://bit.ly/c1tgCV
Oft sind gerade die Sendungen am interessantesten, die im "normalen" Radio keinen Platz bekommen würden, aber heute kann jeder der möchte seine Sendung bringen, alles was er braucht ist ein Internet-Zugang und ein Mikro.
So wie das Fernsehen nicht der Tod des Kinos war (was damals viele befürchteten) sondern im Gegenteil, eigentlich der Retter der Kinofilme wurde (alte Filme könnte man sonst heute kaum mehr sehen), ist das Internet-Zeitalter nicht das Ende des Radios sondern eher eine Art Wiedergeburt - so eine Art Phönix aus der Asche ...
(http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=9108)
@Ben: Was du ansprichst lässt sich in dem von Michel Foucault geprägten Begriff der Gouvernementalität wiederfinden, als das Prinzip von (teils epitemologischen) Verschiebungen von Rationalitäten, z.B. von dem was du sehr schön als "Wachstumslogik" beschreibst, als ein wirtschaftliches (bzw. kapialistisches) Denken, welches sich auf die Regierung und letztendlich auf den Alltag eines jeden Menschen ausweitet. Hier könnte man dann auch die Debatte um den Eingriff der Regierung in die freie Marktwirtschaft führen.