Wir sind irgendwo in Paris und in einem Teil der Roman-Trilogie The Rosy Crucifixion: Der Ich-Erzähler, angelehnt an Henry Miller himself, befindet sich bei einer öffentlichen Lesung, einem Vortrag oder einer Diskussion. Plötzlich meldet er sich zu Wort, steht auf und beginnt unvermittelt zu sprechen. Als er sich nach einigen Minuten wieder setzt und seinen Blick wieder nach vorne richtet, hat er kaum noch eine Erinnerung daran, was er gesagt hat, geschweige denn, was ihn dazu bewegt hat, sich so gehen zu lassen. Nur eines ist ihm im Gedächtnis geblieben: Seine Rede war rauschhaft, eloquent und elektrisierend.
Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, in welchem der drei Bände sich diese Szene ereignet: Sexus, Plexus und Nexus? Ich glaube Nexus. Aber ich kann mich wie kaum an etwas im Werk von Henry Miller an eben diese Szene erinnern, weil die Szene selbst so beschrieben wird, wie der Ich-Erzähler seine Rede erinnert: rauschhaft, eloquent und elektrisierend. Und weil sie bei mir einen bestimmten Nerv trifft.
Als ich das lese, bin ich ungefähr 18 Jahre alt und habe so meine Schwierigkeiten mit der öffentlichen Rede. In den Jahren zuvor hatte ich stets gelitten, wenn ich an der Reihe war, um in der Schule vor der versammelten Klasse ein Referat zu halten. Mir wurde schwindelig, ich bekam Kreislaufprobleme. Man könnte auch sagen: ich wurde Seekrank.
Öffentliche Rede, keine Selbstverständlichkeit – oder doch?
Mehr als 20 Jahre später kann ich die Ursachen nur schwerlich nachvollziehen. Auch kaum zu rekonstruieren ist, wie ich die Seekrankheit überwand. Heute äußere ich mich sehr gern und teils leidenschaftlich in der Öffentlichkeit. Ich habe dazu keine Kurse besucht, keine Ratgeber gelesen. Es klappt dennoch. Meistens.
Wenn das Reden in der Öffentlichkeit nicht so gut klappt, wie neulich auf einer Tagung, für die ich im internationalen Flugverkehr viele Wartestunden investieren musste, werde ich nachdenklich: Was ermöglicht die öffentliche Rede? Was verhindert sie? Was für Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden? Welche Aufgaben hat die Moderation?
Diese Fragen stellte ich mir auch bei einer Tagung, die ich diese Woche in Berlin besuchte: Mit Community Medien in die Zukunft: Wie gemeinsamer Journalismus Neues schafft. Hier wurde viel über soziale Medien, Bürgerjournalismus und Blogs gesprochen. Über ein mediales Milieu also, in dem öffentliche Äußerungen selbstverständlich geworden sind.
So konnte Solana Larsen von Global Voices bei ihrer Eröffnungsrede auch immer wieder betonen, dass sich in ihrer durch und durch vernetzten Welt Menschen ohne größere Hindernisse äußern und ihre Meinung sagen können. Ihr Slogan: “The World is talking. Are you listening?”
Unablässige Teilnahme am endlosen Gespräch
Richtig: “Man muss nicht erst einmal sechs Jahre Journalismus studieren, um einen geraden, wahren und wichtigen Satz aufschreiben zu können.” (Daniel Erk) Okay, im Netz ergreifen die Menschen einfach so das Wort. Sie sprechen, regen sich auf, packen aus, nerven, kritisieren, opponieren, etc. Da dies so gut und scheinbar reibungslos passiert und da dies – also diese unablässige Teilnahme aller am Gespräch mit allen – eine Qualität in sich zu sein scheint, schaut kein Mensch auf das Ungesagte, das Ungebloggte.
Darüber hinaus entsteht häufig der Eindruck, man könne alles einer virtuellen Selbstregulierung überlassen. Doch: Das Netz denkt nicht. Und damit meine ich: Das Netz als Maschine und das Netz als sozialer Zusammenhang denkt nicht. Gut, es gibt so etwas wie kollektive Intelligenz. Aber was ist das eigentlich? Und: Wird diese Intelligenz wirksam, wenn eine große Zahl von Menschen einer Person und ihren Äußerungen Gehör schenkt?
Sascha Lobo hat so etwas in seinem viel diskutierten Spiegel-Artikel angedeutet und auf dieser Basis die Idee eines post-redaktionellen Filterns durch das Netz entwickelt. Was gut ist, was Aufmerksamkeit verdient, entscheide die Masse, indem sie, post-konsensuell, einem Gegenstand, einer Person, einer Aussage, Aufmerksamkeit schenke. 500 mal Daumen hoch (“Gefällt mir”), 3.000 Kommentare, 15.000 Follower. Zahlen, so scheint es, sprechen für sich.
Gerade Leute wie Lobo haben diesbezüglich gut reden: Sie sind Stars im Netz, sie werden gehört, und wenn nicht, dann sprechen sie einfach lauter – bis man sie hört. Doch die Frage, die bleibt, die wirklich wichtig ist: “Are you listening?” wenn “The World is talking.” Kurz: bei der öffentlichen Rede kommt es nicht nur darauf an, ob es die richtigen Rahmenbedingungen für das Sprechen gibt, sondern auch und vor allem die richtigen Rahmenbedingungen für das Zuhören.



 MORE WORLD
MORE WORLD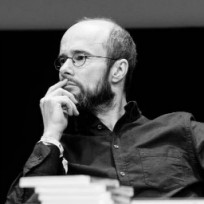

19 Kommentare zu
Und was Rahmenbedingungen für das Zuhören anbetrifft: Ich meine damit etwas mehr, oder etwas anderes als die richtige Körperhaltung oder Stimmung. Sondern wie Menschen zu einander stehen, positioniert werden, in einem Raum: Gibt es Hierarchien? Gibt es eine Ordnung, die Kommunikation vorstrukturiert? Kann diese Ordnung korrigiert werden? Gibt es Filter-Mechanismen, die es mir erlauben, grundsätzlich selektiv vorzugehen, damit mir nicht ständig der schwirrt vor lauter Daten und Impressionen? All diese Dinge und vieles mehr wirken auf das Individuum und seine Kapazität zum Sprechen und Zuhören ein.
Damit entscheidet nicht mehr die Masse, sondern die Qualitätsansprüche des Einzelnen, die ich persönlich durch Auswahl bestimme und ständig korrigiere/erweitere. Das Netz denkt nicht, aber ich lege fest, welchen Teil des Netzes ich für mich nutzbar mache.
Twitter wird ganz häufig verwandt, um auf Blogs hinzuweisen. Damit ist Twitter der verlängerte Arm der Blogs und der Informationen aus diesem immens wichtigen Bereich der Journalisten, der sich um die immer zahlreicher werdenden Autodidakten erweitert.
Qualität des Gesagten und Gehörten bildet sich über diese Netztfilter zunehmend von unten. In diesem System dominiert mehr und mehr der Empfänger, der entscheidet, was er anklickt und liest/hört/sieht.
Fazit: So geriet ich an diesen Gazette-Beitrag durch Twitter, reflektiere ihn und trete mit diesem Kommentar hier in einen Dialog mit K. Woznicki.
Und was Twitter anbetrifft: Für gewisse Zwecke ist Twitter gut und brauchbar, etwa wenn es um Live-Nachrichten im Umfeld von Events geht (Wahlen im Irak, transmediale, etc.), oder um Firmenkommunikation mit Kunden. Im letzteren Fall ist das Verhältnis von "Followern" und "Following" ausgeglichen und ermöglicht dialogische Kommunikation. Die dialogischen Möglichkeiten sind bei Twitter jedoch bei weitem nicht so gut entwickelt wie sie sein sollten oder könnten, da ist bspw. facebook viel weiter.
Twitter ist der heutige Stand. Ich bin sicher, das "Werkzeug" wird sich weiter vervollkommnen. Aber Twitter ist für mich schon sehr beachtlich. Bloggen vermochte das nicht, denn Bloggen ist dafür viel zu schwerfällig. Twitter macht Bloggen aber erneut sehr interessant. Twitter ist vor allem ein Medium für Blogger. Sehr viele Tweets werden nur geschrieben, um auf Blog-Beiträge zu verlinken, wodurch diese dann erst breiter im Netz bekannt werden.
Eine solche Kommunikation gab es bisher nicht. Sie ist erst im Netz und durch das "Werkzeug" Twitter möglich.
So werde ich anschließend zu "Hörst Du mir überhaupt zu?" einen Tweet twittern.
Die Vielfalt der Verweise und die Fülle der Zugriffsmöglichkeiten im Netz eröffnen Dialoge in Räume, die bisher dem Einzelnen verschlossen blieben - aus welchen Gründen auch immer. Der Einzelne unterliegt heute nicht mehr früheren gesellschaftlichen Ausgrenzungen. Im Netz, diesem virtuellen Raum, sind wie kaum wo anders alle Menschen gleich.
Und so hat Twitter m.E. eine bahnbrechende Funktion. Erst Twitter ermöglicht aufgrund seiner Selektions-Funktion und Begrenztheit auf 140 Zeichen Wege in ungeahnte Dialoge. Sie fanden bisher nur in engen Räumen "woauchimmer" statt. Twitter macht sie offen und für alle zugänglich. Sie sind in der Welt präsent, denn das Internet ist heute die "Welt", zumindest ein wichtiger Teil von ihr, der an Bedeutung und Umfang rasant zunimmt. Und damit gewinnen Dialoge an sich eine andere/neue Substanz.