Komplexe Technologien wie das Internet werden meistens unhinterfragt genutzt. Sie müssen einfach nur funktionieren. Wie ein Toaster. Wer anfängt über sie nachzudenken, wird schnell zum Warner – vor den bedrohlichen Konsequenzen für die Menschheit. Denker, die nicht als Kulturpessimisten auftreten, sind rar. In dieser Sache gibt es einen Stimme aus Japan, dem wir Gehör schenken sollten. Berliner Gazette-Herausgeber Krystian Woznicki hat ihn getroffen.
*
Wie viele Informationen brauche ich? Wie viele Informationen vertrage ich? Diese Fragen tauchen meistens dann auf, wenn ich mich überfordert fühle oder wenn ich erschöpft bin. Also denke ich über Möglichkeiten der Begrenzung nach, lese dazu Bücher von Frank Schirrmacher oder Miriam Meckel. Bücher, die mich vor Informationsüberflutung warnen und die mir zeigen, wie ich aus dem Datenstrudel wieder heraus komme.
Doch es ist auch an der Zeit, Ratgeber aus Japan heranzuziehen, die mir sagen: Lerne, die Informationsfluten zu lieben! Ich spreche von Büchern, die einen Menschentypus feiern, der an den Informationsfluten nicht leidet, sondern im harmonischen Einklang mit ihnen lebt.
Was ist ein Otaku?
Dieser Menschentypus wird Otaku genannt. In Japan versteht man darunter etwas mehr als die westliche Interpretation des Otaku als fanatischer Fan, Nerd oder Geek. Schon richtig: Ein Otaku kennt sich bestens mit Informationstechnologien aus. Auch nicht falsch ist, dass sich ein Otaku seiner Sache mit großer Leidenschaft und Konzentration verschreibt: Ein Otaku will alles über sein Objekt der Begierde wissen und sammelt alle damit in Verbindung stehenden Informationen.
Vielleicht musste erst ein Otaku-Philosoph wie Hiroki Azuma kommen, um dem Westen zu erklären, dass ein Otaku mehr ist als ein Fan, Nerd oder Geek. Azuma zeigt in seinem Buch über die Otaku-Kultur, das zuerst ins Französische und dann ins Englische übersetzt wurde, dass die ganzen apokalyptischen Szenarien der Informationsüberflutung verblassen, sobald man den Otaku als Menschenbild aufruft.
Der in Japans Massenmedien als neues Wunderkind gefeierte Professor für Philosophie und Kulturwissenschaften, ist gerade mal Ende 30 und sieht sich selbst als Kind der Otaku-Kultur. Das El Dorado dieser Kultur sind Zeichentrickfilme, Comicfiguren, Rollenspiele und viele andere populäre Formate aus Japan, die zusehends via Internet-gestützte Handys wahrgenommen werden. Und wie diese Formate, die seit den 1990er Jahren in zahlreichen Wellenbewegungen aus Japan in den Westen geschwappt sind, so steht auch der Otaku vor seinem großen Sprung auf die internationale Bühne. Behauptet jedenfalls Professor Azuma.
Umbau des Gehirns
In seinem in Japan zum Besteller avancierten Otaku-Buch verknüpft er Ideen von Jean Beaudrillard, Peter Sloterdijk und Walter Benjamin, um eine allgemeine Theorie des Otaku zu formulieren. Es ist eine Theorie, die Ja sagt zum in Deutschland vielfach beschworenen “Umbau des Gehirns” (Schirrmacher). Dabei geht es nicht darum, die Herrschaft der Maschinen über den Menschen zu legitimieren. Im Gegenteil: Wir müssen, so Azuma, das Potenzial der Informationsfluten zur Befreiung des Menschen erkennen.
Sein Paradebeispiel: In der zeitgenössischen Otaku-Kultur geht es nicht mehr um zusammenhängende Geschichten und kohärente Charaktere. Sondern um die Bausteine, aus denen sie gemacht werden können. Haarfarbe, Nasenformen, Frisur- alles und alle werden auf Merkmale und Elemente heruntergebrochen, damit ein Otaku sie zusammensetzen kann, je nach Belieben.
Insofern kann die Frage niemals lauten: Wie viele Informationen brauche ich? Wie viele Informationen vertrage ich? Ein Otaku kann nie zuviel Informationen bekommen. Er oder sie lebt von dem Überfluss, weil nur so die Vielfalt und der kombinatorische Reichtum der Otaku-Welt Gestalt annehmen kann.



 MORE WORLD
MORE WORLD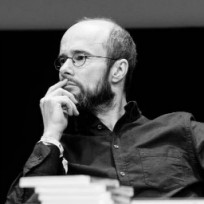

15 Kommentare zu
Ich behaupte: Otaku als Survivial-Modell für den Datenozean ist spannend - aber funktioniert es auch ohne Fanatischer Fan zu sein, ohne die Gier nach mehr Infos über die liebsten Figuren.
Ich frage: Ist es letztlich doch nur ein bequemes philosophisches Modell für Nerds?
Danke für den Text in jedem Falle, ich hatte noch keine Ahnung von Azuma und Otaku!
( http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9802/msg00101.html )
@Salvy: Verkümmerung sozialer Kompetenzen wird von vielen Experten nicht befürchtet, denn das Motto der Otaku lautet, um einen Volker Grassmuck-Essay zum Thema zu paraphrasieren: Alone, but not lonely.
( http://waste.informatik.hu-berlin.de/grassmuck/texts/otaku.e.html )
Das bedeutet: Man isoliert von unmittelbaren sozialen Umfeld, aber vernetzt sich intensiv mit like-minded people, tritt in intensiven Austausch mit kongenialen Subjekten, auch via Internet, aber nicht nur: auf Messen, Conventions, etc.
Azuma selbst sieht, durchaus daraus folgernd, ganz neue soziale Kompetenzen entstehen, die der gegenwärtigen Gesellschaft auch einen Hinweis/Impuls auf eine mögliche Weiterentwicklung geben.
@Ichmachmirnichtsausdeminternet: Nerds - das klingt wie ein Schimpfwort. Aber wir sollten uns genauer anschauen, was hinter diesen Modellen steht: 1) was für eine soziologische Realität und 2) was für eine ontologische Existenzform. Azuma macht das für die Figur des Nerds.
Azuma und Schirrmacher zusammenzubringen in einem Round Table - das ist durch eine gute Idee. Sollte man ihn nach Deutschland holen, dann aber auf jeden Fall für ein etwas größeres Programm der Dialoge.
@Brunopolik: Schwimmen lernen in den Fluten! ist ein gutes Stichwort. Denn es ist exakt dies die Herausforderung und etwas, dass gelernt sein will - inkl. Überwindung von Ängsten!
Man muss sich lösen von der Vorstellung des Otaku als Extremfan von Zeichentrickfilmen und man muss diese Figur als Modell für Individualität herunterbrechen auf die Ebene eines Subjekts, das sich via Information konstituiert.