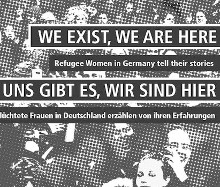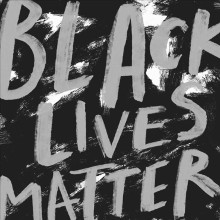Blogs sind in aller Munde. Blogs polarisieren. Sollten wir sie lieben oder hassen? Krystian Woznicki meint, dass es um etwas anderes geht. weiterlesen »
- Entlang der X-Achse: Führen uns nervöse Kurvenlandschaften zurück zur Norm…
- Schöne neue Logistik-Welt? Warum Arbeiter*innen in Erzählungen über Liefer…
- Stadt und Pandemie: Gibt es Arbeit im vermeintlich vollautomatisierten Silico…
- Der dritte Weg: Warum eine differenzierte Kritik der "Corona-Maßnahmen" gera…
- Schreien, Weinen, leises Lachen: Acht Mütter über ihr Leben in der Covid-19…
- Stadt und Pandemie: Silicon-Valley-Urbanismus, kritische Infrastruktur und "S…
- Unsichtbar gemachte Entscheider*innen: Content-Moderation, KI und Arbeitskäm…
- Kritisieren, Träumen und Gestalten: Wie gegen den KI-Kapitalismus ankämpfen…
- Die "Caring Crowd": Wenn hinter dem Label KI eigentlich digitale Heimarbeit …
- Verpasst und verpatzt: Was 1990 in der BRD und Europa hätte passieren könne…
-
Die Opposition innerhalb der Opposition
-
Trendsetter Militaer
>Das sind die Maenner, die bis hierhin mit ihren Panzern gekommen sind. Kolobkov.net enthuellt, dass es sich bei der Behauptung, moderne Panzer koennten sich in jedem Gelaende problemlos bewegen, um einen Mythos handelt.< Soweit die Uebersetzung der Bildunterschrift aus dem Russischen. Die Form und Praesentation des Fotos in einer Bildergalerie, die verunglueckte Panzer zeigt, werfen Fragen auf: Welche Botschaft verbirgt sich hinter dieser vermeintlichen Kritik? Die Antwort russischer Patrioten auf amerikanische Misserfolge im Irak?
Die Palmen im Hintergrund des Bildes deuten jedenfalls darauf hin, dass es sich nicht um eine Satire auf russische Streitkraefte handelt. Doch es koennte Russland sein: Die russische Regierung setzt bei der Ausruestung der Streitkraefte auf Masse und die Ausruestung des Militaers soll erbaermlich sein. >Die Zeit< berichtete etwa, die russischen Truppen seien >oft nicht einmal bedingt abwehrbereit<. In der Oeffentlichkeit praesentiert sich das russische Militaer natuerlich anders. Auf ueberdimensionierten Plakaten wirbt es in eigener Sache mit Bildern von gepanzerter Freundschaft – und dies scheinbar mit Erfolg.
Die Militarisierung der russischen Gesellschaft wird in der gelenkten Demokratie zu einem Selbstlaeufer: Neben einfachen Polizisten, Verkehrspolizisten und Angehoerigen des Militaers gehoeren in Sibirien auch Zivilisten in Militaerkluft zum Strassenbild – ob jung oder alt. Sogar Kinder werden in Tarnbekleidung gesteckt und mit kleinen Kampfflugzeugen bewaffnet. Auch vor den Mauern einer buddhistischen Klosterschule in Darzan macht die Militarisierung nicht halt: Dort sitzen angehende Lamas in ihrer Freizeit in Armee-Uniformen vor dem DVD-Rekorder und schauen Gewaltvideos. Was macht eigentlich Gorbi?
-
Sherlock Holmes der Medizin
Ihre Frau betruegt Sie, Sie Idiot!
So lautet eine der vielen Diagnosen, die Dr. House (Hugh Laurie) Dienstags auf dem US-Fernsehsender Fox (in Deutschland auf RTL) stellt. Manchmal laesst er sogar eine Spezialeinheit im Privatleben seiner Klienten schnueffeln, um Licht ins Dunkel zu bringen. Doch ist House weder Bulle noch Psychologe, sondern Experte fuer Infektionskrankheiten. Mit seinem hochqualifizierten Team loest er medizinische Raetsel im Modus eines Schachcomputers: Gefuehlskalt und effizient. House koennte das Vorbild eines jeden Arztes werden. Waere da nicht dieses eine Problem: Er ist ein Misanthrop und drangsaliert seine Mitmenschen am liebsten mit verbalen Mittelfingern. weiterlesen » -
Das Private
…ist politisch. Es mag in der Vergangenheit gute Gruende gegeben haben, diesem Leitspruch der 68er nicht mehr zu folgen. Zu sehr ist damit in den letzten Jahren Schindluder getrieben worden. Vor allem von einer
verluderten
Presse, die mit derlei Meldungen ueber privateVorlieben
von Politikern und anderen oeffentlichen Personen Kasse gemacht hat. Was aber nun den >Fall Seehofer< angeht, verhaelt es sich doch ein bisschen anders. Auf alle Faelle anders, wie es das offizielle Deutschland hier und da verlautbaren laesst. Dass Herr Seehofer, Familienvater mit drei Kindern in Ingolstadt, seit drei Jahren ein fast dreissig Jahre juengeresPferdchen
am Zuegel hat und anscheinend ungewollt Vater wird, ist doch hoechst interessant.Nicht die Tatsache als solche. Das kommt in den besten Familien vor. Oder die Tatsache, dass er Politiker und in der CSU ist. Auch das geht die Oeffentlichkeit wenig an. Sie geht es aber sehr wohl an, wenn Seehofer vorher sein Familienleben fuer eigene Zwecke selbst instrumentalisiert und damit politisiert hat. Keiner hatte ihn gezwungen, Statements darueber abzugeben, inmitten seiner Familie zu posieren und flotte Sprueche ueber die Bedeutung von Familie, Ehe und glueckliches Zusammenleben abzugeben. Nicht die Presse, er selbst hat sich ihr aufgedraengt und sie vor seine Kandare gespannt.
Wenn dieser Oberheuchler nun als ebensolcher enttarnt wird, ist das sehr wohl im oeffentlichen Interesse. In diesem Zusammenhang muss man wieder mal den irischen Schriftsteller, Staatsphilosophen und Politiker Edmund Burke zitieren, der jede Tugendaeusserung fuer verachtenswert fand, die sich nicht mit der Probe auf die Praxis verbindet. Seehofer, der auch das soziale Gewissen seiner Partei verkoerpern will, hat diese Pruefung nicht bestanden. Er ist der Doppelmoral ueberfuehrt. Allein das ist von oeffentlichen Interesse.
-
Das Versprechen
Sebastian Deisler ist gestorben, wenn nicht als Mensch, so doch als Spieler und Star. Aufgrund von Verbrennungen im Getriebe der Wunschmaschine Fussball. So ist die groesste Hoffnung Deutschlands, die fuer die Nationalmannschaft nie so recht in Fahrt kam, ein uneingeloestes Versprechen geblieben. Eine Baustelle – wie seine eigene Homepage. Das Drama begann irgendwann Anfang der Nuller Jahre. Millionenpoker und Bruderstreit. Uli Hoeness (Bayern-Manager) und Dieter Hoeness (Hertha-Manager) kaempfen um den Wunderknaben. Der ist gerade mal 21. Ein Vollbluttalent. Einer fuers Mittelfeld.
Voll die Zukunft.
Ein wahrer Regisseur. Fuehlt sich wohl in Berlin, Hertha ist seine Heimat, die Leute lieben ihn hier. Doch Bayern stellt ihm das Paradies auf Erden in Aussicht. Ein so grosses Talent koenne nur im Bayern-Himmel zu wirklicher Groesse heranreifen – muessten doch alle wissen. Irgendwann wusste es auch Deisler. Irgendwann hatten sie ihn soweit… ueberzeugt. 18 Millionen DM!Nach der Sensationsmeldung waren selbst Gegner des Transfers gespannt. Deisler war mehr als irgendein Vereinsspieler. Er war ein kleiner Gott, der ueber jede Marke erhaben schien. Bayern Muenchen war offenbar jedoch auch fuer ihn zuviel Erwartungsdruck, Leistungsdruck, Druck von allen Ecken und Enden. Vor allem aber auch selbstgemachter Druck, ein ganz Grosser zu sein, einer der Groessten im deutschen Fussball ueberhaupt. Dabei blieb er immer bescheiden und sympathisch. Nebenwirkungen: Depressionen und Verletzungen. Schnell war von Deisler nur noch in Sondermeldungen zu hoeren.
Es geht ihm schon wieder besser.
>Bald wird er entlassen.<Jetzt kann er wieder spielen.
Und dann gleich wieder ein Rueckfall. So gings Jahre. Bis Dienstag letzter Woche. Bis er vermutlich die einzig richtige Entscheidung in diesem nimmerendenden Zustand traf und dem gedopten Profizirkus den Ruecken zukehrte.Es gibt zahlreiche Fussball-Ikonen, ueber die ich in den letzten Jahren geschrieben habe. Zuletzt ueber Ronaldo und Maradona, Ronaldinho und Ballack, Beckham und die Real Madrid-Allstars. Als Beckham neulich seinen Wechsel nach Los Angeles bekannt gab, war ich versucht einen Kommentar zu schreiben. Aber das mit Deisler ist anders – das beruehrt mich. Neulich schrieb ich in einem Fussball-Buch darueber, wie die Starmaschine des Fussballs ein
Frankensteins Monster
nach dem anderen gebiert, weil sie die Spieler als Superhelden eines Hollywood-Films ueberzeichnet und damit Erwartungen weckt, die sie niemals erfuellen koennen. Deisler hat dafuer sichtbarer als jeder andere mit seinem Geist und Koerper bezahlt. Als Fussball-Ikone verkoerpert er die Grausamkeit einer Maschine, die selbst nach seinem eskapistischen Rueckzug ins Private die Pforten offen haelt – wie das Maul eines gefraessigen Monsters, deren Mundgeruch einen selbst noch im selbsterwaehlten Exil ereilt. -
Wann kommt die naechste Welle?
Dass es in der Schule so etwas wie Pflichtlektuere gibt, verdraengen die meisten Erwachsen irgendwann. Doch sobald sie Kinder bekommen, faellt es ihnen wieder ein. An den Schulen wird das Buecherlesen (immer noch) als Pflicht gehandelt. Vielen Schuelern, und da zaehle ich mich durchaus dazu, gefaellt das nicht. Denn wer liest schon gerne Buecher ueber Sprachwissenschaften wie Viktor Klemperers LTI oder die recht sperrigen Klassiker von Goethe und Schiller? Ein Buch, das an meiner Schule pflichtgemaess jedoch so gut wie alle gerne gelesen haben, ist Morton Rhues
Die Welle
.Bei mir war das anders. Ich hatte in der 10. Klasse nicht das Glueck, das Buch lesen zu muessen. Also las ich es vor kurzem aus eigenem Interesse. Das Buch handelt von einem Experiment an einer Highschool in den USA und basiert auf einer wahren Geschichte, die sich in den 1980-er Jahren ereignet hat. Der Geschichtslehrer Ben Ross zeigt seinen Schuelern einen Film ueber das nationalsozialistische Deutschland. Ergriffen denken die Schueler sowas sei einmalig. Doch Ross beweist ihnen mit Hilfe eines Experiments und der Erschaffung einer Bewegung namens
Die Welle
das Gegenteil.Ross beginnt einen Fuehrerkult um sich herum zu praegen und formt eine neue Art von Schueler. Man sieht, dass die Moeglichkeit eine Diktatur entstehen zu lassen, immer und ueberall vorhanden ist. Es mag eine vage Annahme sein, aber ich denke, dass wir irgendwann wieder unter einer Diktatur leben koennten. Denn sowie sich der Konjunkturzyklus oder der Wechsel der Jahreszeiten vollstreckt, so wiederholt sich auch die Geschichte immer wieder. Was sich aendert, ist allein ihr Gewand. Der naechste Sommer kommt bestimmt. Auch die naechste Diktatur?
-
Charlotte Chronicles.21 [accelerated evolution]
Dass Charlotte, North Carolina, nach New York, Tokio und London die viertwichtigste Bankenmetropole der Welt ist, duerfte nur den wenigsten bekannt sein. Vermutlich haengt es damit zusammen, dass Charlotte nicht auf eine aehnlich bedeutende Historie wie die anderen genannten Staedte zurueckblicken kann, sondern erst in den letzten zwei Jahrzehnten eine rasante Entwicklung durchmachte. Vor etwa 30 Jahren, hatte das heutige Downtown Charlotte nicht viel mehr als eine Tankstelle und ein paar Geschaefte zu bieten. Alles veraenderte sich, als die >Bank of America< und >Wachovia< durch Zusammenschluesse und Zukaeufe zu zwei der groessten Banken der Vereinigten Staaten aufstiegen. Zusammen mit einigen anderen >Fortune 500<-Unternehmen, die ebenfalls ihren Hauptsitz in Charlotte haben, brachte diese Entwicklung die entscheidende Zutat fuer die zukuenftige Stadtentwicklung: Geld in rauen Mengen.
Mit dem vielen Geld kamen zunaechst neue Jobs und damit unzaehlige Menschen auf der Suche nach einer (besser bezahlten) Arbeit. Die Geschwindigkeit des Wachstums laesst sich durch folgende Zahlen veranschaulichen: Im Jahr 2005 wuchs die >Charlotte Metropolitain Area< (inklusive der umliegenden Vororte, die mittlerweile bis in den naechsten Staat, South Carolina, reichen) um 80.000 Einwohner auf eine Gesamtzahl von 2,5 Millionen. Jaehrlich fressen sich die Vororte um ca. einen Kilometer weiter ins Umland. Auf die vielen Menschen folgten diverse Moeglichkeiten, das in immer groesseren Mengen verdiente Geld auszugeben: Als erstes schossen riesige Malls aus dem Boden, deren groesste ueber 200 >Outlet stores< umfasst. Dazu kamen als weiterer Wirtschafts- und Prestigefaktor professionelle Sportteams wie die Carolina Panthers (American Football) und die Charlotte Bobcats (Basketball). Einige Zeit nach den zwei liebsten Hobbies der Amerikaner (Shopping und Sport) stieg auch die Nachfrage nach einer gehobenen Kulturszene, was sich im Aufbau diverser Museen und Kulturfoerderungseinrichtungen widerspiegelt.
Doch auch die Schattenseiten sollen nicht verschwiegen werden, denn Geld lockt bekanntlich nicht nur Jobsuchende, sondern auch Kriminelle an. Nachdem es immer schon ein paar schlechte Viertel mit gelegentlichen Morden gab, haelt seit etwa einem Jahr die organisierte Bandenkriminalitaet in Charlotte Einzug. Die Polizei, die mit der dafuer erforderlichen Art der Verbrechensbekaempfung bis dato gaenzlich unvertraut war, wurde durch ganze Spezialteams aus klassischen >crime cities< verstaerkt. Zudem ist eine weitsichtige Stadtplanung nur in Ansaetzen zu erkennen, so als wuerden die Stadtplaner eine fruehe Version von >Sim City< spielen. Neuen Firmen werden grosszuegige Steuererlasse gewaehrt, damit sie sich so schnell wie moeglich in den noch freien Flaechen ansiedeln. Ein Leben ohne Auto ist aufgrund der grossen Entfernungen und der praktisch nicht vorhandenen oeffentlichen Verkehrsmittel unmoeglich und die Luftqualitaet gehoert zu den schlechtesten der USA. Fuer mich als Europaeer bleibt die Stadt hauptsaechlich Eins: Ein Musterbeispiel der beschleunigten urbanen Evolution, in der vornehmlich innerhalb kuerzester Zeit soviel Geld wie moeglich umgesetzt werden soll.
-
Zeitverknuepfungsnetzwerke
11. April 2088, Talahassee, Florida. Trotz seiner Uneinigkeit bestaetigte das Oberlandesgericht Floridas heute die Verurteilung des zweijaehrigen Jake Fritter wegen Mordes. Dieses Urteil erlaubt dem Staat Florida nun, mit den Plaenen fuer seine Exekution am 1. Mai um 12:01 fortzufahren. weiterlesen »
-
Beenden wir die Diktatuhr! [Ideenwettbewerb]
Argh! Ich muss es zugeben. Mein Experiment ist fehlgeschlagen. Ich meine mein neues Zeitkonzept, den Tag nicht in Stunden und Minuten zu unterteilen, sondern in Mahlzeiten. Nachdem ich zweimal zu spaet zur Arbeit gekommen, beziehungsweise ueberhaupt nicht aufgetaucht bin (es laesst sich so schlecht zwischen Arbeitstag und Wochenende unterscheiden bei der Mahlzeitrechnung), musste ich mein Selbstexperiment leider aufgeben.
Nun bin ich dem Zeitstress wieder ausgesetzt, wie alle anderen Menschen (wenn man sie ueberhaupt noch so nennen kann!). Wenig Schlaf, immer Termindruck, immer alles schnell, schnell, schnell. Die Diktatur der Uhr, oder kurz: die Diktatuhr. Es ist einfach zum Haare ausbeissen! Deshalb moechte ich jetzt einen Ideenwettbewerb in der Berliner Gazette starten. Ich suche smarte Entschleunigungsstrategien. Verstehen Sie mich recht: nicht Zeitsparstrategien, wie etwa gleichzeitig Fernsehen gucken, essen und Logbuchtraege schreiben, aeh ich glaube das nennt man Multitasking, zumindest, wenn man dabei dann auch noch Zehennaegel kaut.
Nein, der Leser oder die Leserin mit der eindeutig besten Strategie zur Verlangsamung erhaelt ein Exemplar von Guenter Grasss Buchhit
Beim Zwiebelschaelen
. (Eine schicke Papierausgabe.) Sie denken jetzt bestimmt: Ich interessiere mich nur fuer den Besten, damit ich den ganzen anderen Mist nicht auch noch lesen muss. Aber nein: Je mehr Konzepte, desto besser. Ich will endlich wieder in einem Berg von Texten baden und dabei die Zeit vergessen. -
Daytripping in Tokio
Menschen, wie Wasser. Strassen, wie Kanaele. Ampeln, wie Schleusen. Alles fliesst im innerstaedtischen Tokio. Es gibt so gut wie keine Sitzbaenke im innerstaedtischen Raum, kaum oeffentliche Orte, an denen man verharrt, innehaelt, den Blick zu Ruhe kommen laesst. Man ist immer in Bewegung, genau wie all das, was einen umgibt. Menschentrauben, Neonschilder, Werbung, Verkehrszeichen. Alles loest sich auf, wird Information.
Die Dichte ist immens. Laerm und Rauschen verdichten sich, werden zu einem Ton, einem Bild, einem Signal. Je mehr die Frequenz zunimmt, desto naeher darf man sich seinem Ziel waehnen einer Hauptstrasse, einer Kreuzung oder einem Bahnhof. Wer Shibuya, eines der groessten Zentren Tokios, betritt, spuert, wie die Informationsdichte gleich um ein Vielfaches zunimmt. Waeren die menschlichen Wahrnehmungsorgane wie Messgeraete ausgestattet, wuerden alle Displays Werte im roten Bereich anzeigen.
Man hat das Gefuehl, eine kuenstliche Sphaere betreten zu haben, die in sich geschlossen ein Eigenleben fuehrt. Nicht alles dient hier der Orientierung. Nein, mitunter wird der umherschweifende Blick des Betrachters in einen immateriellen Raum hineinnavigiert. Dann tut sich ein Zeitloch auf. Die Welt um einen herum kommt zum Stillstand und ein Film im Kopf beginnt. Gigantische Monitore, dreidimensionale Werbetafeln mit Koerpern in rasanter Bewegung, perfekt choreographierte Neonlichtspiele oder verspiegelte Haeuserfassaden vermoegen solche
Mindclips
auszuloesen. -
Spaziergangswissenschaft
Als Freiburgerin radele ich jeden Tag eine viertel Stunde entlang der Dreisam zur Uni. Bei Kettensprung, Platten oder Schlimmerem bleibt nur die Wahl zwischen Bahn und Bus oder einem ausgedehnten Spaziergang. Letzterer waere koerperlich und vor allem, was den zeitlichen Parameter anbelangt, die wohl natuerlichste Option, jedoch bei einer Strecke von fuenf Kilometern die zugleich unwahrscheinlichste. Doch welche Konsequenzen hat die Wahl des Fortbewegungsmittels auf meine Wahrnehmung? Was passiert, wenn ich in der Grossstadt in die U-Bahn steige und sie zehn Minuten spaeter aus dem Dunkeln wieder verlasse? Welchen visuellen Einbussungen ist der Auto-, Bus-, und Strassenbahnfahrer ausgesetzt?
Lucius Burckhardt und Helmut Holzapfel haben sich mit diesen Fragen eingehend beschaeftigt. Um auf die unterschiedlichen Wahrnehmungsmodi der heutigen Landschaft aufmerksam zu machen, fuehrten sie 1992/93 diverse Spaziergangsexperi- mente durch. So simulierten sie etwa die Perspektive eines Autofahrers: Ausgestattet mit Windschutzscheiben gingen sie durch die Stadt und beobachteten, wie sich dies auf ihr Seherlebnis auswirkt. Ihre Schlussfolgerungen verdichteten sie in Texten, die den theoretischen Ueberbau der von Burckhardt in den 1980er Jahren begruendeten Spaziergangswissenschaft bilden. Nun hat Martin Schmitz in seinem Verlag dieser noch wenig bekannten Disziplin, die ueberigens auch als Promenadologie bekannt ist, ein Buch gewidmet.
Burckhardt darin:
Nie hat man sich so sehr um die Aesthetik der Umwelt gekuemmert wie heute; nie waren so viele Kommissionen mit Bewilligungsverfahren beschaeftigt, nie gab es so potente Vereinigungen zum Schutz der Umwelt, der Landschaft, der Heimat, der Denkmaeler ( ). Aber trotz aller Schutzbestimmungen, Verfahren und abgelehnter Baugesuche waechst staendig die Klage ueber die Verhaesslichung der Umwelt und die Zerstoerung der Landschaft.
Anhand zahlreicher Beispiele, die dem Leser und der Leserin das reinste Vergnuegen bereiten, geht der 2003 Verstorbene unterschiedlichsten Phaenomenen auf den Grund. Martin Schmitz indes versucht die Spaziergangswissenschaft einem breiteren Publikum in Vortraegen naeher zu bringen. Zum Beispiel am 14. Februar in der Hochschule fuer Gestaltung Karlsruhe und am 8. Maerz im Goettinger Literarischen Zentrum. -
Sitcom der Globalisierungsverlierer
Trailer Park Boys
ist das perfekte Gegenwarts- naemlich: Unterschichts-Fernsehen. Die fiktive Dokumentar-Serie ueber den Alltag in einer kanadischen Wohnwagensiedlung zeigt eine Parallelgesellschaft derart fortgeschrittenen Zustands, dass die individuellen Dramen und kollektiven Katastrophen, in denen das Totalversagen sozialer Fremd- wie Selbstkontrolle alle paar Minuten kulminiert (Gewaltausbrueche, Haushaltsunfaelle und zahllose Verstoesse gegen Bewaehrungsauflagen) zur neben Alkohol und Drogen einzigen Unterhaltungs- und wichtigsten Erkenntnisquelle geworden sind: Selbstreflexion als eine am eigenen Ruin gutgelaunt und scharfsinning teilnehmende Beobachtung.Trashigstmoegliche Aufklaerung gesellschaftlicher Zustaende betreibt die Serie aber nicht nur bei Themenwahl, Dramaturgie und Besetzung – in den Hauptrollen Julian (der in jeder – wirklich jeder – Einstellung einen Drink in der Hand haelt, sogar noch beim Aussteigen aus einem qualmenden Autowrack) und Ricky (der in einem solchen Autowrack wohnt und auch in der englischen Sprache nicht wirklich bei sich oder zu Hause ist) – sondern auch beim Einsatz formaler Mittel: im Verlauf der zahlreichen Schiessereien kann es schon mal passieren, dass versehentlich der Sound-Assistent angeschossen wird und die ohnehin bereits ueberforderten Protagonisten fuer den Rest der Szene den Ton selber angeln muessen.
Trailer Park Boys
ist sowas wie die Rache der Realitaet, getarnt als Fiktion, am Reality-TV.Uebrigens bin ich nicht ueber das Fernsehen auf dieses vermutlich zweit- bis drittbeste Fernsehformat der letzten fuenf Jahre aufmerksam geworden, sondern erst durch einen ausdruecklichen Hinweis dreier schwedischer Raubkopierer, deren BitTorrent-Tracker fuer einen nicht unerheblichen Teil des schwedischen Internet-Traffics verantwortlich ist.



 MORE WORLD
MORE WORLD