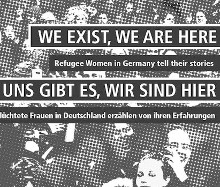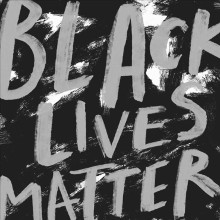Nein, das ist nichts Leckeres zu essen, sondern das wohl bekannteste Lied in Suedwestfrankreich. Es wurde vor mehr als 60 Jahren von dem nahe Alicante geborenen Gustavo Pascual Falco komponiert und wird bis heute vor allem auf Strassenfesten, Ferias und Fetes gespielt. Manchmal jedoch sogar in Teenie-Discos! Jeder dort kennt den Paquito. Doch viel wichtiger als der Wiedererkennungswert der Melodie ist der Effekt, den das Lied auf die zuhoerenden Menschen hat.
Sobald die ersten Toene erklingen, jubelt die Menge und ein unglaubliches Szenario entwickelt sich: Alle, ob jung oder alt, setzen sich hintereinander in einer langen Schlange auf den Boden dabei ist es egal, ob man sich im Club oder auf einer verregneten Strasse befindet. Alle werfen ihre Arme in die Luft, wiegen sie im Takt nach rechts und links, vorne und hinten und singen dabei lautstark mit. Doch damit noch nicht genug: Diejenigen, die nicht auf dem Boden sitzen, reihen sich nun vorne vor dem Ersten auf und werfen sich dann stagediving-maessig auf die ausgestreckten Arme der anderen.
So schweben sie die gesamte Schlange entlang, bis sie am Ende erschoepft auf den Boden fallen, waehrend die naechsten bereits nahen. Eine voellige folie
, wie der Franzose sagen wuerde. Die Stimmung aber ist unglaublich und alle feiern gemeinsam wie gute Freunde. Fuer mich eine unvergessliche Erfahrung. Jedesmal, wenn das Lied anklingt, fuehle ich mich zurueckversetzt in das sommerliche Suedwest- frankreich des vergangenen Jahres.



 MORE WORLD
MORE WORLD