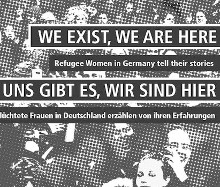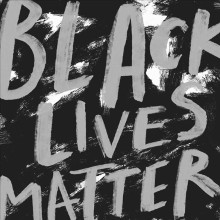Guten Morgen geneigter Berliner Gazette-Leser. Heute ist es endlich soweit. Nein, es ist noch nicht Weihnachten, aber der Tag des McDeutsch-Symposiums ist endlich da! Heute Abend um 20 Uhr im Berliner Museum fuer Kommunikation. weiterlesen »
- Entlang der X-Achse: Führen uns nervöse Kurvenlandschaften zurück zur Norm…
- Schöne neue Logistik-Welt? Warum Arbeiter*innen in Erzählungen über Liefer…
- Stadt und Pandemie: Gibt es Arbeit im vermeintlich vollautomatisierten Silico…
- Der dritte Weg: Warum eine differenzierte Kritik der "Corona-Maßnahmen" gera…
- Schreien, Weinen, leises Lachen: Acht Mütter über ihr Leben in der Covid-19…
- Stadt und Pandemie: Silicon-Valley-Urbanismus, kritische Infrastruktur und "S…
- Unsichtbar gemachte Entscheider*innen: Content-Moderation, KI und Arbeitskäm…
- Kritisieren, Träumen und Gestalten: Wie gegen den KI-Kapitalismus ankämpfen…
- Die "Caring Crowd": Wenn hinter dem Label KI eigentlich digitale Heimarbeit …
- Verpasst und verpatzt: Was 1990 in der BRD und Europa hätte passieren könne…
-
Symposium im Museum für Kommunikation
-
Kaffeepaussi in Finnland
Deutschland ist
Exportweltmeister
– erinnert sich noch jemand an diese Formel, die von Wirtschaftspolitikern gebetsmuehlenartig wiederholt wurde, um die konjunkturelle Lage der Bundesrepublik schoenzureden? Seit der Aufschwung da ist und das vermeintlichezweite Wirtschaftswunder
gefeiert wird, scheint das oeffentliche Interesse an Exporten hingegen nachgelassen zu haben. Anders in der Kulturpolitik. Der deutsche Sprachrat hat sich juengst mit Exportschlagern des Deutschen mit >ausgewanderten Woertern< – beschaeftigt.In einem Sammelband, den das Goethe-Institut nun veroeffentlicht hat, werden rund 6000 Woerter deutschen Ursprungs dokumentiert, die im Rahmen des Wettbewerbs
Woerterwanderung
in der ganzen Welt gesammelt wurden. In Kanada trifft man sich beispielsweise zumkaffeklatsching
, in Finnland hingegen machen Busfahrer einekaffepaussi
. Der am haeufigsten eingereichte Begriff war das in Frankreich verwendete AllzweckwortVasistdas
, das fuer Dachfenster, Oberlicht oder Tuerspion stehen kann.Zwar wollte das Projekt in erster Linie zeigen, dass es neben Begriffen wie
Kindergarten
undSauerkraut
noch viele weitere Worrter deutschen Ursprungs gibt. Doch was auch deutlich wurde, ist, dass viele der entlehnten Woerter auch Besonderheiten der jeweiligen Laender widerspiegeln. In Japan etwa hat der Begriffarbeito
Verbreitung gefunden, in Russland das WortBruederschaft
. Zwar enthaelt die russische Variante keinen Umlaut, doch als Trinkspruch funktioniert sie bestens. -
Germanische Genossenschaft
Ich lebe in Oslo, Norwegen, und arbeite als bildender Kuenstler. Ich veroeffentliche auch Prosa. Mit meiner Freundin und meinen beiden Kindern lebe ich in einer buergerlichen Gegend. Werktags gehe ich in mein Buero und arbeite dort. Am Wochenende haenge ich mit meiner Familie herum oder ich betrinke mich zusammen mit Freunden. Der Sommer in Norwegen ist hell und heiss, aber trotzdem irgendwie frisch, crisp. Der Winter ist sehr dunkel. Die Gesundheitsversorgung ist mehr oder weniger kostenfrei, und in den Kindergaerten soll es fuer jedes Kind einen Platz geben. weiterlesen »
-
Radio Babylon
Wir schreiben das Jahr 1961. Die deutsche Wirtschaft in der Westzone boomt. Man redet nicht von Arbeitslosigkeit, sondern beklagt einen Mangel an Arbeitskraeften. Immer mehr Arbeiter aus anderen Laendern stroemen in die BRD. Zunaechst vor allem aus Italien. Conny Froboess landet einen Charterfolg mit
Zwei kleine Italiener
. Doch so lustig das Getraeller auch sein mag, dieItaliener
, die in dem Song vorkommen, sind, wie die echten Italiener, ganz allein in Deutschland. Ihnen fehlen gemeinsame Treffpunkte, sie sind von Heimweh geplagt und einsam. Der saarlaendische Rundfunk ist der erste Radiosender, der versucht Abhilfe zu schaffen. Am 21. Oktober 1961 beginnt er samstags die SendungMezz’ora Italiana
auszustrahlen, in Zusammenarbeit mit dem italienischen Konsulat und der katholischen Kirche. Es ist die erste Sendung fuerGastarbeiter
in Deutschland und ein riesiger Erfolg. Immer mehr Rundfunkanstalten bieten nun Programme fuer die Zugezogenen an. Vor allem Radiosprachkurse sind gefragt.Deutsch ist gar nicht so schwer
ist der erste Kurs, den der Bayerische Rundfunk 1965 sendet. Am 2. Januar 1966 laeuft im hessischen Rundfunk die sechssprachige Sonntagssendung >Rendezvous in Deutschland< an. Als die 1970er Jahre anbrechen, leben nicht nur viele Italiener in Deutschland, sondern auch Tuerken, Griechen, Jugoslawen und viele mehr. Und eines wird immer deutlicher: DieGastarbeiter
werden zu Mitbuergern. Sie bekommen Kinder in Deutschland und gruenden Familien. Der gesellschaftliche Wandel stellt die Radioprogramme vor neue Herausforderungen: Wie kann man eigentlich die deutsche Hoererschaft in die Programme fuerAuslaender
integrieren? 1994 geht Radio Multikulti auf Sendung. Der Sender stellt sich genau dieser Herausforderung und bringt Programme auf Deutsch und in 18 anderen Sprachen. Hier zeigt sich nicht zuletzt, wie wandlungsfaehig die deutsche Sprache ist. Sie taucht nicht nur in verschiedenen Dialekten auf, sondern wird auch mit den mannigfaltigsten Akzenten gesprochen. -
Frankreichs neu erwachtes Sendungsbewusstsein
Die Franzosen wollen immer alles auf Franzoesisch haben, sagt man. Ferner: Die Franzosen hassen Englisch. Da ist noch etwas: Die Franzosen sind so stolz auf ihre Kultur, dass sie nicht im Traum auf die Idee kommen wuerden, deren Export in einer anderen Sprache als der Franzoesischen zu betreiben. Letzteres duerfte man auch in Deutschland verstehen. Doch waehrend es hierzulande nicht nur Goethe Institute, sondern auch die Deutsche Welle gibt, die die deutschsprachige Kultur in unterschiedlichen anderen Sprachen in die Welt hinaustraegt, war in Frankreich ein internationales Sprachrohr der nationalen Kultur lange Zeit nicht existent. Nun hat das Land aber endlich einen
internationalen
Fernsehsender: >France 24<, seit dem 8. Dezember auf Sendung. Waehrend Praesident Chirac Jahre nur davon traeumte, wird der Welt jetzt eine franzoesische Perspektive auf das globale Geschehen zu Teil. Wohlgemerkt auf Englisch!Die internationale Fernsehwelt wurde lange Zeit von angelsaechsischen Sendern dominiert
, wie der Geschaeftsfuehrer des Senders zu verstehen gibt. Nicht zuletzt waehrend des Irak-Kriegs hatte dieser Umstand negative Folgen: (US-)Fernsehbilder halfen die (US-)Invasion zu legitimieren. Die Position der Gegner – u.a. Frankreich fiel medial so gut wie nicht ins Gewicht. Damit soll Schluss sein. Der Trailer des Senders ist seit laengerem bei >YouTube< zu sehen, ueberzeugt wie ich finde jedoch nicht wirklich: Eine zu rasche Bildabfolge von meist aus Katastrophengebieten entnommenen Szenen. Da broeckelt das Image des ernst zu nehmenden Journalismus. Ist Gegen-Propaganda wirklich das angemessene Mittel? Warten wir ab und hoeren den in nahezu akzentfreiem Englisch berichtenden Sprechern erstmal zu. Es wird allerdings nicht nur in englischer, sondern auch in franzoesischer Sprache gesendet; ab Sommer 2007 vorraussichtlich auch auf Arabisch. Desweiteren ist eine Kooperation mit der Deutschen Welle geplant. -
Das Windgeile, Taenzelnde und Schluepfrige des Deutschen
Mit kaum zwanzig Jahren hatte der 1943 im Hohen Altai der Sowjetrepublik Tuwa geborene Galsan Tschinag seine erste Begegnung mit der deutschen Sprache: als Stipendiat der Universitaet Ulan Bator kam er als Germanistikstudent nach Leipzig und blieb dort bis zum Abschluss seiner Diplomarbeit. Die neue Sprache, die auf ihn einstroemte, die fremden Woerter, die es zu lernen galt, beschrieb er spaeter in
Wie ich Deutsch lernte
alsscheuer als die Wildpferde in den Mongolensteppen. Vor allem die Substantive aehneln verteufelt den windgeilen Stuten, die an der Spitze der Herde hin und her taenzeln. Jedes hat so etwas wie ein Fohlen bei sich, den Artikel. Und ein Fohlen, so muss man wissen, ist schluepfrig wie ein Fisch.
Doch das Schluepfrige schien ihm nichts auszumachen – das Deutsche nutzte der Mongole fortan als Werkzeug fuer sein literarisches Schaffen. Gegenstand seines Schreibens: Die Verbundenheit mit seiner Heimat sowie die alten Geschichten seines Stammes. In seinem 1997 publizierten BuchDie Karawane
erzaehlt er von dem grossen Ereignis, wie er als Stammesoberhaupt zwei Jahre zuvor die infolge der mongolischen Minderheitspolitik im ganzen Land verstreuten Tuwiner wieder vereinte. Im Maerz und im Mai wird Galsan Tschinag wieder mit Lesungen in Deutschland weilen, genaue Termine gibts demnaechst. -
Alice ist schuld
Werter Leser, Sie haben zu frueher Stunde Ihren Computer hochgefahren und mussten feststellen, dass Ihre Startseite, die Berliner Gazette, noch nicht aktualisiert ist? Sie waren irritiert? Alice ist schuld. Nein, nicht die Feministin Schwarzer, sondern das Blondchen, das von allen Berliner Plakatwaenden herablaechelt. >Wie konntet ihr auch einen Telefonanbieter waehlen, der mit frauenfeindlichen Bildern fuer sich wirbt?<, fragte ein Freund, der ebenfalls ein engagierter Verfechter von Frauenrechten ist. Ich kann beim besten Willen keinen Zusammenhang sehen zwischen der Tatsache, dass wir in unserer neuen Wohnung in Neukoelln seit nunmehr sechs Wochen ohne Telefon und Internet sind, und der frauenfeindlichen Reklame des billigsten Telefonanbieters der Republik. Geiz ist geil, denke ich. Die Firma Alice engagiert eine billige Werbeagentur, die billige Plakate entwirft. Und der Service ist ohnehin bei allen gleich schlecht. Die Telekom ist ja auch nicht besser. Ein Werbeplakat des Magentariesen haengt in unserer Nachbarschaft, das ein Paeaerchen im Schlafzimmer zeigt: Sie traegt ein Negligee, er einen Rollkragenpullover. Er wendet ihr den Ruecken zu, um ungestoert telefonieren zu koennen – wahrscheinlich mit seiner Ex-Freundin. >Als Ihr dann fuenf Wochen nach der Anmeldung bei Alice noch kein Telefon hattet, habt Ihr aufgegeben und seid zur Telekom gerannt?< Zum sexistischsten Telefonanbieter Europas?, entgegne ich. >Ihr haettet die VerbraucherInnenzentrale einschalten sollen.< Da ich keine Lust auf eine Endlosdiskussion hatte, machte ich mich lieber gleich auf Weg zum Internetcafé.
-
Dem Fahnatismus auf der Spur
Im letzten Sommer flatterten sie noch ueberall; sie hingen in Fenstern, schauten von Balkonen hinunter oder zierten Kneipeneingaenge: Die Deutschlandfahnen. Die
Nation
taumelte vor Glueck und feierte dieDeutschlandparty
(Der Spiegel) in schwarz-rot-gold. Nun ist Dezember und der heisse Sommer der deutschen Leidenschaft ist vorbei. Oder doch nicht? Der Medienkuenstler Florian Thalhofer hat sich auf die Suche nach den vergessenen Fahnen der WM gemacht und reist dafuer schon seit acht Tagen durch Deutschland. Seine Eindruecke haelt er in einem Blog fest. Vorlaeufiges Fazit: Die Gruppe derer, die immer noch Deutschlandfahnen zur Schau stellen, ist keinesfalls homogen. Ein Mann aus Wienhausen zum Beispiel hat inzwischen schon die dritte Deutschlandfahne an seinem roten Passat angebracht und die vierte liegt schon auf der Rueckbank bereit.Weil ich stolz bin, ein Deutscher zu sein. Und jetzt kann man es auch sagen.
, meint er dazu. Dann gibt es da Frau von Doehren, eine Altaebtissin vom Kloster Wienhausen. Sie assoziert ganz andere Dinge mit den symboltraechtigen Fahnen. Zwar hat sie nichts mit Fussball am Hut, dafuer fallen ihr aber Lieder aus ihrer Jugend wieder ein, wenn sie die Fahnen sieht. Nanu? Was moegen das wohl fuer Lieder sein? Der VernuenftigsteFahnatiker
scheint Herr Neuburger aus Berlin-Neukoelln zu sein. Zur Weltmeisterschaft wurden die Fahnen unschlagbar billig und da hat er sich kurzerhand eingedeckt. Nun hat er den ganzen Balkon voll mit Deutschlanfahnen, Weihnachtsmaennern und Lichterketten. Da freuen sich die Touristen vom Hotel gegenueber. Fuer manche ist eben immer Weltmeisterschaft, oder Weihnachten, oder beides. Florian Thalhofer ist noch fuer drei Tage unterwegs und sucht nach den vergessenen Fahnen. -
Die Globalisierung des Schwitzerduetschen
Im virtuellen Zuerich gibt es eine
konstitutionelle Monarchie
– das mag vielleicht zunaechst befremden. Der Blog >Wortreich. Die linguistische Monarchie< scheint jedoch recht harmlos zu sein. Ihr selbsternannter Monarch, ein gewisser Michael Staub, beschraenkt sich darauf, seine Untertanen (in diesem Fall Leser) auf Verwerfungen und Neuschoepfungen des Deutschen, insbesondere seiner schweizerischen Variante, aufmerksam zu machen. Im Pluralis Majestatis kommentiert Staub skurrile Beitraege aus deutschsprachigen Print- und Onlinemedien und greift Hinweise seiner Untertanen sowie Beobachtungen anderer Journalisten auf. Als etwa Autoren des Tagblatts sich ueber die Entwicklung des Schwitzerduetschen besorgt zeigten, reagierte Staub mit einer Kolumne. Die Zeitung berichtete ueber den Anglizismenwahn; ihre Horrorvorstellung: McSchwitzerisch. Staub dazu: >Der Zuercher Hype um smarte Ausdruecke heisst laut Tagblatt ganz einfach Zwinglisch. Dies ein Zusammenzug aus Zwingli und Englisch, der sogar lautlich Sinn ergibt.< Und dafuer begeistert sich der Monarch. Das bizarr Klingende und abwegig Entstandene zieht ihn magisch an. Insofern ist Staubs kleines Blog-Reich in der Naehe der hierzulande entstandenen Zwiebelfisch– und Wortistik-Imperien anzusiedeln. Vielleicht wird es infolge dessen auch Untertanen in Deutschland finden, die sich fuer kreative Sprachirrungen- und Wirrungen des Nachbarlandes interessieren. -
Charlotte Chronicles.19
Als Expatriate in einem englischsprachigen Umfeld stoesst man mit klassischem Schulenglisch schnell an Grenzen und muss sich insbesondere fuer den informellen Smalltalk ein breites Vokabular an Slang-Ausdruecken zulegen. Ich werde taeglich mit einer ordentlichen Dosis an >country grammar<, einer eher abseits der grossen Staedte verwendeten, hochgradig von Slang durchzogenen Ausdrucksweise, konfrontiert. Dabei scheint gleichzeitig das in laendlichen Gegenden vorherrschende Weltbild durch, denn dort herrscht weiterhin eine strenge klassische Rollenverteilung fuer das Grossziehen der Kinder. Sollte ein Vater dennoch tatsaechlich Erziehungsurlaub nehmen und zu Hause bleiben, wird er umgangssprachlich als >Mr. Mom< verspottet und verliert augenblicklich seinen >tough guy status<. Desweiteren hegen US-Amerikaner eine ausgepraegte Vorliebe fuer Kurzformen und nutzen diese auch in Lebensbereichen, in denen Deutsche sie nicht unbedingt anwenden wuerden. Waehrend hiesige Weinkenner von einem >98 cab< oder einem >04 chard< sprechen, wuerden es sich deutsche Weinliebhaber zum Ausweis ihrer Kennerschaft vermutlich nicht nehmen lassen, den gesamten >1998er Cabernet Sauvignon< oder >2004er Chardonnay< mit moeglichst franzoesischem Zungenschlag auszusprechen.
Besonders viele Slang-Ausdruecke gibt es im allgemeinen fuer Tabuthemen oder Bereiche, in denen zur Wahrung politisch korrekter Ausdrucksformen eine gewisse Sprachzensur herrscht. Obwohl es in den USA von >kraeftigen bis staemmigen< Menschen wimmelt, duerfte man dort niemals jemanden als >fett< bezeichnen. Stattdessen behilft man sich mit Metaphern aus der lokalen Esskultur und beschreibt den ueberquellenden Teil der Huefte bei zu engen Hosen oder Roecken sehr anschaulich als >muffin top<. Ein Beispiel aus dem deutschen Slang, das in aehnlichen Koerperregionen angesiedelt ist, waere das beruehmte >Arschgeweih< fuer Tattoos direkt ueber dem Hosenbund (US-Slang hierfuer: whale tail, longhorn). Hingegen ist mir im Deutschen leider noch keine Entsprechung fuer den Ausdruck >nastygram< begegnet. Dieser bezeichnet eine unfreundliche schriftliche Nachricht und ist ein Beispiel fuer den kreativen und – aus einer sprachoekonomischen Perspektive betrachtet- zugleich Nutzen stiftenden Umgang mit der Sprache, da er bei gleicher Wortlaenge wie das zugrunde liegende >telegram< einen Mehrwert an Information liefert. Dass die deutsche Sprache durchaus ebenfalls der kreativen Wortschoepfung im New Economy Zeitalter faehig ist, verdeutlicht der Begriff >Mausbeutung<: Er beschreibt das Prinzip, junge, motivierte Berufseinsteiger in meist IT-intensiven Jobs (mit ihrer Maus vorm Computer klickend) auszunutzen, indem man sie jede Menge unbezahlter Ueberstunden machen laesst. -
Vietnam spricht Deutsch
Deutsch ist fuer uns Asiaten eine schwere Sprache. Angefangen es zu lernen habe ich mit 18 Jahren, also nach dem Abitur. Ich nahm ein Jahr lang Unterricht an der Hochschule fuer Fremdsprachen in Hanoi. Im August 1985 bin ich dann in die ehemalige DDR geflogen, um in Dresden Schienenfahrzeugtechnik zu studieren. Nach dem Studium arbeitete ich als Dolmetscher fuer die Polizei und fuer das Gericht in Sachsen. Im Maerz 2003 kehrte ich aus familiaeren Gruenden nach Vietnam zurueck. weiterlesen »
-
Magdeburger Boygroup infiziert die Welt mit Deutschvirus
Schraiii! / Biest dy dy selbst biest / Schraiii! / Ynd wenn es das letzte iest / Schraiii! / Au wenn es weh tyt / Schraiii so laut dy konnst
. Chloe und Camille bruellen jede Zeile von Tokio Hotels Hitsingle mit. Dabei halten sich die beiden Teenies aus einem Pariser Vorort ganz fest an den Haenden und heulen und schwitzen gleichzeitig. Tokio Hotel hat jetzt auch eine Rezeption in Frankreich! Die Jungs aus Magdeburg sind der erfolgreichste deutsche Exportschlager im Nachbarland.Wie eine Bombe ist ihr Album
Schrei
auf Platz 19 der franzoesischen Charts eingeschlagen und hat somit den deutschen Chart-Rekord da drueben gebrochen – so erfolgreich waren noch nicht mal Rammstein oder Nena. Das erstaunlichste ist: Tokio Hotel sind mit ihren deutschen Songtexten erfolgreich und das in dem Land der Radioquote.Die Fans konnten jede Textzeile auf Deutsch mitsingen. Es war der absolute Wahnsinn!
, so Bill Kaulitz, der Bandleader, unlaengst auf der Bambi-Verleihung ueber die ausverkauften Tokio-Hotel-Konzerte in F. Einundsechzig Jahre und zwei Monate lang ist nichts passiert, dann hat es Booooom gemacht. Vorher bildete man mit Deutschland eine Schicksalsgemeinschaft, liessuns
in die Europaeische Union – immerhin brachtenwir
Kohle mit.Jetzt aber schafft eine Boygroup aus der ehemaligen DDR, was Politiker, Menschenrechtler und Pastoren bislang vergeblich versuchten. Endlich oeffnen sich die Franzmaenner und -frauen wieder der deutschsprachigen Kultur. Und vielleicht lernen sie auch ein bisschen Deutsch, wenn sie bei Hits wie
Schrei
(schraiii) undDurch den Monsun
(dysch dehn monsyn) mitsingen. Koennen Sie sich die geo-kulturellen Konsequenzen vorstellen, wenn der zunehmende Erfolg dieser Band in Russland sich zu einem Hype wie in Frankreich auswaechst?



 MORE WORLD
MORE WORLD