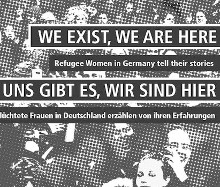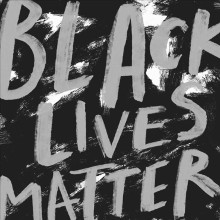Joschka Fischer und Peter Sloterdijk haben sich am Samstag im Haus der Kulturen der Welt ueber Diplomatie unterhalten. Nicht gestritten? Nicht wirklich, und zum Teil wuerde ich das auf eine beiderseitige Abgrenzung von den geradezu talkshowhaft stichelnden und zugleich unertraeglich vagen Fragen des Moderators zurueckfuehren: Herr Fischer, Herr Sloterdijk hat eben den Diplomaten und damit Sie einen >Hypokrit
genannt, was sagen Sie dazu?< Professor Sloterdijk, der politische Diskurs in Deutschland als Sandkastenspiel denken Sie, Fischer tut Ihnen damit unrecht?
>Herr Fischer, meinen Sie auch, dass Sie persoenlich nur ein Verwalter waren, kein Akteur?< Sloterdijk fasste in seinem Beitrag einige Begriffsschoepfungen und Ueberlegungen aus seinem letzten Buch >Zorn und Zeit< nachvollziehbar und anregend zusammen. Fischer, der inzwischen in Princeton lehrt, unterschied zwei Arten der Diplomatie: Waehrend die Diplomatie zunaechst vielleicht primaer darauf abzielte, die jeweilige Seite fuer den bereits beschlossenen Krieg in eine moeglichst vorteilhafte Position zu bringen, trat spaeter eher das Krisenmanagement in den Vordergrund, nachdem angesichts der Moeglichkeit eines Nuklearschlags Krieg nicht mehr als Fortsetzung der Politik verstanden werden konnte. Diese zweite Konzeption von Diplomatie geraet Fischer zufolge in der Gegenwart allerdings durch die fortschreitende Proliferation selbst in die Krise. Diese relativ klare Analyse umwob Fischer allerdings mit zahlreichen Andeutungen, die durchaus einer Nachfrage bedurft haetten, und vielleicht sogar einer Gegenstimme. Es blieben viele Fragen und das Gefuehl, nicht eingeweiht zu sein. Wenn, wie Fischer uns beschied, selbst die duemmsten Diplomaten all die hochkodifizierten Aussagen der staatlichen Repraesentanten verstehen, fragt man sich doch, ob ein Diplomat sie nicht auch an seinen Souveraen, die Buergerinnen und Buerger uebermitteln koennte.
- Entlang der X-Achse: Führen uns nervöse Kurvenlandschaften zurück zur Norm…
- Schöne neue Logistik-Welt? Warum Arbeiter*innen in Erzählungen über Liefer…
- Stadt und Pandemie: Gibt es Arbeit im vermeintlich vollautomatisierten Silico…
- Der dritte Weg: Warum eine differenzierte Kritik der "Corona-Maßnahmen" gera…
- Schreien, Weinen, leises Lachen: Acht Mütter über ihr Leben in der Covid-19…
- Stadt und Pandemie: Silicon-Valley-Urbanismus, kritische Infrastruktur und "S…
- Unsichtbar gemachte Entscheider*innen: Content-Moderation, KI und Arbeitskäm…
- Kritisieren, Träumen und Gestalten: Wie gegen den KI-Kapitalismus ankämpfen…
- Die "Caring Crowd": Wenn hinter dem Label KI eigentlich digitale Heimarbeit …
- Verpasst und verpatzt: Was 1990 in der BRD und Europa hätte passieren könne…
-
Die Sprache der Diplomatie
-
Aufruf zur Gotteslaesterung
Eine insbesondere im Science Fiction-Film kannonisierte Szene: Der Protagonist blickt hinter die Oberflaeche und erkennt erstmals, dass alles, was er bisher als seine natuerliche Umwelt erlebt hat, nur Simulation ist. Symptomatisch gilt diese Szene fuer eine Gesellschaft, in der alles medial vermittelt wird. In der die virtuelle Realitaet der Bildschirme und Infobahnen, die materielle Realitaet quasi-diktatorisch beherrscht. Zumindest jedoch ersetzt hat. Doch ist jene Szene nicht vielmehr symptomatisch fuer eine Gesellschaft, in der die Idee nach einer anderen Realitaet als der gesellschaftlich produzierten, gestorben ist? Dass keiner mehr was davon hoeren will, dass es auch noch etwas anderes gibt, als das, was wir taeglich in performativen Akten ko-produzieren und durch Rollenspiel und Regelkonformitaet entstehen lassen? Dass es scheissegal geworden ist, dass all das lediglich das Notwendige ist, damit das Kartenhaus nicht ins sich zusammenfaellt und damit wir unsere Existenzgrundlage sichern koennen? Das Wahre – und das legt die besagte Szene aus dem Science Fiction-Film unzweifelhaft nahe – liegt hinter der Oberflaeche, hinter der Kulisse, hinter dem Schall und Rauch der Kommunikation. Dass es das Wahre gibt, vielleicht auch sowas wie Wahrheit – ein romantischer Gedanke. Doch da ist mehr: Die Tatsache, dass es das Unwahre gibt, scheint mir entscheidender. Rollenspiel und Regelkonfornitaet in Zeiten der Marktdiktatur sind bestenfalls Mittel zum Zweck. Unser Anspruch muss darin bestehen, innerhalb der sozialen Kommunikation die Option der Auto-Kritik zu etablieren. Die Option, auf Distanz zum Vorherrschenden Code zu gehen. Diese Option sollte kein Luxus der Priveligierten sein, sondern eine soziale Norm. Jeder sollte wissen, dass die quasi-religioes verehrte Ordnung der Dinge jederzeit in Frage gestellt werden kann. Wichtiger noch: Jeder kann dazu beitragen, indem er Gotteslaesterung zu seiner Tugend macht. Es geht mir um politisches Handeln im Hier und Jetzt.
-
In der Warteschleife des Uebermorgen
Ich stuerme Hals ueber Kopf die Treppe hinunter, denn das Telefon klingelt. Ich fuehre blitzschnell den Hoerer an mein Ohr und stelle mich wie gewohnt mit Vor und Nachnamen vor. Ich lausche kurz der Stille und lege den Hoerer wieder so schnell auf, wie ich ihn an mich genommen habe. Es war wieder bloss so ein nervtoetender Werbeanruf bei dem eine Stimme wie aus einem schlechten Sci-Fi-Film versucht mir irgendein Praesent anzudrehen. Leider weiss man immer erst nach Annahme des Gespraechs, wer am anderen Ende der Leitung sitzt. Genau so wenig wie man es sich aussuchen kann welcher Flyer durch den Briefkastenschlitz gelangt, welche Spam-Mail im Posteingang landet, welches Popup sich als naechstes oeffnet oder auch, welcher Werbebanner die gerade laufende TV-Sendung durch Uebergroesse und laestige Nebengeraeusche zu einem einzigen Propagandaprogramm macht. Die Werbung hat mittlerweile ein Ausmass erreicht, das uns regelrecht zu erdruecken droht. Ein Streifzug durch das World Wide Web gleicht einem mit Werbeminen zugepflastertem Feld. Einem Dauergast im Internet wird diese Entwicklung kaum Auffallen, da sich bei ihm eine Routine herausbildet, sich staendig oeffnende Popups zu schliessen. Zunehmend entwickelt sich bei einem erfahrenen Surfer eine Art Sichtblockade, die systematisch Banner, die auf einer Website integriert sind, ausblendet. Fuer jemanden, der eher selten im Internet unterwegs ist, wird diese Zupflasterung mit Werbung ein groesseres Problem darstellen, denn er oder sie besitzt keine Routine und wird somit durch die gewaltige Informationswelle ueberschwemmt. Dieser Person wird es mit zunehmender Reklame immer weniger gelingen, wichtige von unwichtigen Informationen zu trennen. Ein geuebter Umgang mit Werbung – er wird unausweichlich sein oder wir fangen an, eine Firewall zu entwickeln, die uns nicht nur vor Viren sondern auch vor der Werbelawine schuetzt. Ohne es zu wissen, warte ich schon heute ganz ungeduldig auf jene Stimme aus dem schlechten Sci-Fi-Film, die mir das passende Produkt anbietet…
-
Kleben geblieben
Die Provinz ist ein Ort, der eigentlich nur eine Bewegung kennt: Raus! So geht es zumindest den meisten, die im sogenannten Hinterland aufwachsen – sie wollen bloss weg. Was aber, wenn man mit dreissig die heissgeliebte Grossstadt mitsamt ihren Unsicherheiten wieder verlassen muss, weil im Heimatkaff ein guter, festbezahlter Job wartet? Das ist das Problem von Jan, dem Hauptdarsteller in George Lindts Roman Provinzglueck.
Er denkt die ganze Zeit darueber nach: Gehe ich, oder gehe ich nicht? Sein Leitsatz:
Ich liebe den Geruch von frisch geschnit- tenem Gras
. Ist ja auch klar. Bei Provinz denkt der Berliner anProvence
, an laue Sommerabende und Rotwein auf dem Marktplatz. Und Lindt bedient die kollektive Vorstellung der Grossstaedter von der Provinz als einen Mix aus Idylle und Langeweile. Die Realitaet der Gegenwartsprovinz bleibt in diesem locker-fluffigen Roman in Folge dessen auf der Strecke.Obwohl der Autor selbst aus der Provinz kommt, bleibt er an den gaengigen Klischees ueber eben jene kleben. Er gibt sich lieber popliterarisch als realistisch. Frei nach dem Motto:
Jetzt singe ich gerade bei einem Tocotronic-Song mit
. Bei Lieblingslied Records ist nun eine aufwaendige Hoerbuch-Box erschienen, auf der Christian Ulmen den Roman einliest. Ganz nett fuer raue Oktobertage, an denen man verschnupft im Bett liegt. -
Mit dieser Musik im Kopf
Sonnenbaden an einem schwarzen Strand der Galapagosinseln. Sandaufwirbeln bei einer Ballonfahrt ueber den Boden des atlantischen Ozeans. Schlafwandeln in einer Nacht aus Blei. Hanno Leichtmanns >Nuit Du Plomb< bringt die weichen Knochen des Fortschritts zum Schwingen, versetzt die Fantasie in Bewegung. Sein Old-School-Ambient bietet griffige Klangkonfigurationen, ohne auf den noetigen Drall der Abstraktion zu verzichten. Flaechig, kreisend, surrend wird das sonorische Gewebe manifest, nistet sich im Ohr ein und formt darin eine Klangskulptur, die dem Organ schmeichelt, die Erinnerungen wachruft an Dinge, die man nie erlebt hat, die den Koerper, mit dem Raum, den der Sound multidimensional ausfuellt, eins werden laesst. Mit dieser Musik im Kopf moechte man lesen, was Hans Henny Jahnn der Nachwelt hinterliess:
Die Nacht aus Blei
. Der auch als Orgelbauer und Musikverleger taetige Schriftsteller hatte mit seiner Erzaehlung aus dem Jahre 1956 auch schon einige vor Leichtmann inspiriert: Hans-Juergen von Bose Mitte der 70er Jahre oder Asmus Tietchens in den 90er Jahren. Doch was der Berliner Komponist aus der literarischen Vorlage gemacht hat, sollte nicht bloss als Musik, die Dichtung begleitet, abklassifiziert werden. Nein, sie sollte definitiv auch jenseits der szenischen Lesung gehoert werden. Mindestens auch beim Sonnenbaden an einem schwarzen Strand der Galapagosinseln. Der ein oder andere koennte mit dieser Musik im Kopf jedenfalls Berge versetzen. Vielleicht auch imwirklichen
Leben. -
Budet sdelano!
Mein Kollege ist ein Englaender. Er passt vollkommen in meine Schublade von einem Englaender. Das einzige, was ich mit ihm gemeinsam habe, ist folgendes: wir beide trinken schwarzen Tee mit Milch. So machen wir es naemlich in Baschkortostan, einer Provinz Russlands. Die hiesigen Tuerken, die mit uns – Baschkiren und Tataren – ethnologisch verwandt sind, trinken Tee ohne Milch. Die Niederlaender, meinte mein Kollege, lachen diesbezueglich die Englaender aus, es sei wohl kindisch, meinen die.
Kartoschka
heisst auf DeutschKartoffel
, jedoch bei ihmKatze
. Sein Lieblingsspruch auf Russisch istBudet sdelano!
, was eigentlich die SoldatenantwortWird erledigt!
auf den Befehl des Vorgesetzten ist. Den Spruch kennt er aus irgendeinem Computerspiel. Befehligt er da russische Soldaten oder kaempft gegen die? Eigentlich ist er ein geiler Typ und wohnt in einem Bauernhof in der Umgebung von Berlin. Dort werden ab und zu Bauernpartys mit Wildschweinerschiessung und anschliessendem Braten veranstaltet. Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens sehnen sich zutiefst danach, zu solch einer Party eingeladen zu werden. Sie wollen einen solchen Betriebsausflug unbedingt erleben. In ihrem Namen fuehre ich diesbezueglich Verhandlungen mit dem Kollegen. Bisher vergebens. Einmal hat dieser Landsmann des King James zu mit gesagt, Gott sei eine Katze. Warum kommt denn so was zutage? Warum glauben die Juengeren kaum an Gott? Unmodisch? Altmodisch? Schade. Jetzt aber verstehe ich, wieso die besten Schaetze Aegyptens in London ihren Hauptsitz haben. -
Charlotte Chronicles.12
Eine Amerikanerin in meinem Umfeld hier bezeichnet alles, was sie unamerikanisch – und damit dumm – findet, als >communist<. Beispielsweise ist ihrer Meinung nach das Essen von Pommes Frites mit Mayonnaise anstatt Ketchup >kommunistisch<. Nun handelt es sich dabei sicherlich nicht um eine Erfindung Lenins, sondern zeigt vielmehr, wie unterschiedlich die Konnotation bestimmter Begriffe je nach Person und Kontext sein kann. Im Gegensatz zur Hauptbedeutung (Denotation) eines Wortes, handelt es sich bei der Konnotation um eine gewissermassen unsichtbar mitschwingende, semantische Ebene, die sich je nach Sprecher oder Kulturraum unterscheiden kann. So hat das Wort >Schatten< im deutschen Sprachraum oft einen negativen Beigeschmack, wohingegen es in Spanien eher positiv besetzt ist; Schattenplaetze sind dort bei Freiluftveranstaltungen haeufig begehrter und teurer. Diese >Beibedeutung< kann sich im Laufe der Zeit wandeln, auch wenn die Hauptbedeutung gleich bleibt. Das Wort >Weib< wurde urspruenglich als Paar-Begriff zu >Mann< gebraucht und ebenso oft verwendet. Seit der Uebernahme des hoefischen Begriffs >Dame< aus dem Franzoesischen im 19. Jahrhundert, wird >Weib< jedoch meist in abwertenden Zusammenhaengen gebraucht (im Bayerischen hat es diesen Bedeutungswandel noch nicht ganz hinter sich). Wie kontextabhaengig Woerter durch ihre Konnotation werden koennen, zeigt in der deutschen Sprache das Wort >Fuehrer<.
Auch in der Filmanalyse spricht man von Konnotation, wenn Bilder eine unterschwellig vorhandene Symbolik transportieren. Ueber ein freies Feld galoppierende Pferde stehen beispielsweise gemeinhin fuer Freiheit und Ungebundenheit. Insbesondere die Werbebranche zeigt Produkte haeufig in einem Umfeld ohne direkten Bezug zum Produkt und zielt auf die Assoziationen, die im Kopf des Betrachters durch die konnotative Bedeutung bestimmter Bilder entstehen, ab. So wird ein Auto, das mit seinem umweltfreundlichen Verbrauch beworben werden soll, sicherlich nicht durch eine Betonwueste, sondern durch saftig gruene Landschaften fahren. How communist! -
Deutschland ist überall
Ich lebe in Austin Texas, der Hauptstadt des Staats mit dem
Lonely Star
. Ich arbeite in Cedar Creek Texas auf dem Lande, ueber 35 Meilen von Austin entfernt, beim Hyatt Regency Lost Pines Resort and Spa, das am 1. Juni 2006 seine Pforten geoeffnet hat. weiterlesen » -
Hans und Karin wohnen in Berlin
Hans und Karin wohnen in Berlin
so lauten die ersten Worte einer Deutsch-Lernkassette aus unserem Deutschunterricht an meiner Universitaet in Ufa, Russland. Mit diesem Dialog fing ich mein Germanistikstudium an. >Wir kennen Hans und Karin, wir besuchen Hans und Karin< Inzwischen lebe ich mit meiner Frau seit einigen Jahren in Berlin und habe bisher diese mittlerweile unter uns Berliner Ufaern zum Mythos gewordenen Hans und Karin gar nicht getroffen weder einzeln, noch als Paar. Selbst die Namen sind unter den Deutschen, nach meinem Empfinden, selten. Jedes mal, wenn ich diese Lernsaetze in Erinnerung rufe, fuehle ich das besondere Aroma von 1995 der Anfangszeit meines Studiums. Als ich im Jahre 2000 zum ersten Mal nach Deutschland kam, war der Geruch des Landes, der Erde und der Luft hier anders als heute. Berlin ist da. Aber wo seid ihr, Hans und Karin? -
Umgangsbayrisch fuer Anfaenger
Griass aich, laidl, gfraid me, dass hergfundn habts.
So lautet die Begruessung auf der genialen Website von Bayrisch-lernen.de. Hier kann ein Zuagroasda (Fremder, Nichtbayer) alles ueber das Bayerische lernen, das freilich mehr ist, als nur ein Dialekt des Deutschen. Neben einem umfangreichen Wortschatz und einer Grammatik, hat diese Sprache auch eigene Rezepte zu bieten. Der/die Lernende kann sie sich schon in wenigen Lektionen aneignen. Freilich, das Umgangsbayrisch nur. Denn um das Hochbayrisch zu lernen, duerfte es – aehnlich dem Japanischen – ein Menschenleben dauern. Doch fuer Erstere stellt sich der Lernerfolg wirklich schnell ein. Ja, geradezu rasant wird man fit fuer den Alltag in Bayern. Lektion sechs des Online-Crash-Kurses ist ein wahres Sprungbrett. Sie heisstIm Biergarten
. Dort wird folgende wichtige Wendung vom Hochdeutschen ins Bayerische uebertragen. AusPapa, ich haette gern Pommes Frites mit Ketchup und ein Cola-Mix
wird >Babba, I dad gean Bommes hom mid am Kaetschab und am Spaezi<. Neben den Redewendungen ist natuerlich der Wortschatz enorm wichtig. Hier faellt auf, dass es einen Unterschied zwischen einer geschwaetzigen Frau (Ratschkattl) und einer sehr geschwaetzigen Frau (Quadratratschn) gibt. Ach ja und dann ist da ja noch der (oder das?) Oachkazlschwoaf, der Schwanz des Eichhoernchens. Wer dieses Wort richtig auszusprechen vermag, ist ein wirklicher Bayer. Auch gut sind schoasln (furzen) und aizipfen (Geschlechtsverkehr haben). Unbedingt selbstprobieren! -
Sprachen verbinden
Sie sind strahlend gelb; auf ihrer Vorderseite thront ein riesig grosses, blaues L; und sie kommen dann zum Einsatz, wenn Verstaendigungshindernisse beim Uebersetzen von einer Sprache in eine andere die Kommunikation blockieren: die Langenscheidt-Woerterbuecher. Seit nunmehr 150 Jahren (1856 – 2006) helfen Publikationen des urberlinerischen Langenscheidt-Verlages bei Uebersetzungsschwierigkeiten und anderen brenzligen Situationen. Wer erinnert sich nicht an die kleinen, gelben Mini-Woerterbuecher, die einem in der Englisch- oder Franzoesischklassenarbeit des oefteren das Leben gerettet haben?
Um das Jubilaeum mit einer Verlagschronik zu wuerdigen, hat die Journalistin Maria Ebert eine pointierte Auswahl der Firmengeschichte des traditionsreichen Familienunternehmens zusammengestellt, welches inzwischen in der vierten Generation von Langenscheidts gefuehrt wird. Klar gegliedert praesentiert das Buch die Zeitgeschichte sowie die unternehmerische Entwicklung des Verlages inklusive aller Verlagsneugruendungen, -einkaeufe und technischen Innovationen.
Schon 1905 brachte Langenscheidt ein erstes Hoerbuch in Form einer Grammophonplatte heraus, die das Lernen der englischen Sprache einfacher und lebensnaeher gestalten sollte. >150 Jahre Langenscheidt< eroeffnet einen fundierten Einblick in die Geschichte des von Gustav Langenscheidt gegruendeten Verlages und bietet private Einblicke in das Firmenarchiv des Hauses. Mit den 200 eigens fuer das Buch fotografierten Bilddokumenten eine lohnenswerte Anschaffung fuer alle Chronikliebhaber und ueberzeugte Langenscheidt-Woerterbuecherkaeufer.
-
Wagnerfestspiele
Kurt Wagner, ein Fliesenleger aus Nashville, erregt mit seinem Musikerkollektiv Lambchop seit den fruehen 1990er Jahren Aufsehen. Ich muss zugeben, dass ich zu dieser Zeit noch Beverly Hills 90210 geschaut habe und erst durch das Hitalbum
Is A Woman
(2002) auf Lambchop aufmerksam wurde. Aber besser spaet als nie! Nun hat die Combo ein neues Album vorgelegt. Es heisstDamaged
und ist bei City Slang erschienen. Hier zeigt sich Wagner in alter (Hoch)Form. Duester, melancholisch und immer mit einer seufzend-rettenden Harmonie am Ende. Gitarren, Streicher, Klavier und die Stimme Wagners schaukeln sich in jedem Stueck zu einem bizarren Hoehepunkt empor. Bizarr deshalb, weil Wagner den wirren und wuchtigen Klangteppich mit seiner abgrundtiefen aber zarten Stimme immer wieder aufloest. Das kann den Zuhoerer beim ersten Hoeren vielleicht ueberfordern, aber das macht nichts, man kann ja zum Glueck immer wieder auf den Repeat-Knopf druecken. Zum Album gibt es eine besondere Tour, die am 16.10. Halt in der Berliner Philharmonie macht. Wagner beschreibt den Anspruch des Konzertes so:Well, the idea is to try to represent the different elements of the record in a way which creates an evening where it becomes sort of cumulative. So, these elements seem sort of strange at first, but then, as they start to interact together, it all makes sense…
Das hoert sich schon mal vielversprechend an. Aber Wagner will noch mehr. Neben der Live-Perfomance, bei der die Gruppe nach und nach anwaechst, wird ein Film auf fuenf grosse Ballons projiziert. Das kann eigentlich nur gut werden.



 MORE WORLD
MORE WORLD