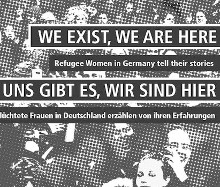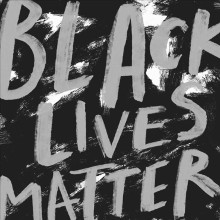Neulich dachte ich einmal ueber die Woerter, die es nicht gibt, nach. Gewissermassen Loecher in unserer Sprache, die wir umfahren koennen, was aber immer mit kleinen sprachlichen Umwegen verbunden ist. Zum Beispiel existiert kein Aequivalent zu dem Wort satt
, um das Gegenteil von durstig
auszudruecken. Versuche, ein Kunstwort zu erfinden und es als Bestandteil der Sprache zu etablieren, schlugen fehl. Ebenso gibt es kein visuelles Pendant zu Stille
, fuer die Beschreibung eines Zustands in dem es, was die optischen Eindruecke angeht, ruhig
ist. Fuer Letzteres habe ich auch in anderen Sprachen noch nie von der Existenz eines entsprechenden Begriffs gehoert. Es gibt allerdings eine Vielzahl von Woertern, die in bestimmten, aber nicht allen Sprachen existieren. Beispielsweise beschreibt das spanische Adjektiv alegal
etwas, das durch das Gesetz nicht geregelt ist und wird haeufig auch fuer nicht legale, jedoch von fast allen praktizierte und tolerierte Sachverhalte verwendet (z.B. Mieteinnahmen nicht zu versteuern). Im Deutschen benutzt man in solchen Kontexten meist Begriffe wie Grauzone
oder Kavaliersdelikt
. Ein spezifisches und praegnantes Adjektiv gibt es jedoch nicht. Das mag auch damit zusammenhaengen, dass in vielen spanischsprachigen Laendern diese Grauzonen etwas groesser sind und staerker das alltaegliche Leben praegen. Doch wie sieht es dann im Italienischen aus? Gibt es dort analog zu den viel zitierten 100 verschiedenen Begriffen fuer Schnee, die die New York Times der Sprache der Inuit nachsagte (was uebrigens bei genauer Betrachtung nicht stimmt), 100 verschiedene Abstufungen der Grauzone zwischen Legalitaet und Illegalitaet? Ich habe noch nicht nachgeforscht, aber es koennte natuerlich auch sein, dass im Rahmen der Berlusconisierung
das klassische legale Vokabular ausreicht.
Im Schwedischen und einigen anderen skandinavischen Sprachen gibt es uebrigens ein Gegenstueck zu >satt<: Otoerstig
laesst sich mit undurstig
uebersetzen. Ein Zustand, den ich bei schwedischen Touristen in Deutschland allerdings noch nicht beobachten konnte, doch vielleicht ist es ja auch nur die Beschreibung eines Ziels. Der angestrebte Endzustand der irdischen Existenz, analog zum Erreichen des Nirvanas, auf den die durstigen Schweden mit grossem Einsatz hinarbeiten.
- Entlang der X-Achse: Führen uns nervöse Kurvenlandschaften zurück zur Norm…
- Schöne neue Logistik-Welt? Warum Arbeiter*innen in Erzählungen über Liefer…
- Stadt und Pandemie: Gibt es Arbeit im vermeintlich vollautomatisierten Silico…
- Der dritte Weg: Warum eine differenzierte Kritik der "Corona-Maßnahmen" gera…
- Schreien, Weinen, leises Lachen: Acht Mütter über ihr Leben in der Covid-19…
- Stadt und Pandemie: Silicon-Valley-Urbanismus, kritische Infrastruktur und "S…
- Unsichtbar gemachte Entscheider*innen: Content-Moderation, KI und Arbeitskäm…
- Kritisieren, Träumen und Gestalten: Wie gegen den KI-Kapitalismus ankämpfen…
- Die "Caring Crowd": Wenn hinter dem Label KI eigentlich digitale Heimarbeit …
- Verpasst und verpatzt: Was 1990 in der BRD und Europa hätte passieren könne…
-
Charlotte Chronicles.10
-
Die Muttersprache der Zukunftsgesellschaft?
Boris Buden stellt diese Frage in seinem Vortrag am Maison de l’Europe, der am 12.10. stattfindet. Buden ist als Kulturkritiker bekannt, unter anderem aufgrund einer Veroeffentlichung zum Konzept der kulturellen Uebersetzung (Kadmos Verlag). In seinem Vortrag erlaeutert er dieses Konzept einmal mehr, das in seinen Augen eine Art Master-Modell der kulturellen Theorie zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist, immerhin stelle es die Loesung von kulturellen Konflikten in Aussicht und eine von ebensolchen Konflikte befreite Gesellschaft – eine Gesellschaft, in der Kulturen und Sprachen friedlich koexistieren. Doch Buden waere kein Kulturkritiker, wenn er die kulturelle Uebersetzung als Muttersprache der Zukunftsgesellschaft nicht in Frage stellen wuerde. Seine Bedenken und Kritikpunkte kommen ueberigens auch bestens in dem von ihm ko-initiierten Projekt translate zum Ausdruck. Ein Besuch der Homepage sei an dieser Stelle jedenfalls nachdruecklich empfohlen.
-
Schwindende Beruehrungspunkte
Ich pendle zwischen Mexiko Stadt und Los Angeles hin und her. Wenn ich in Mexiko Stadt bin, dann lebe ich in einer sehr zentralen und belebten Nachbarschaft, in der ich auch aufgewachsen bin. In diesem Viertel findet man alles, was man zum Leben braucht, weshalb ich meistens zu Fuss oder mit dem Rad unterwegs bin. Manchmal benutze ich auch oeffentliche Verkehrsmittel, wenn ich weiter weg muss. Mein Leben in dieser Stadt ist ziemlich gesellig. In Los Angeles hingegen, lebe ich recht isoliert in einem Haus da ich, um mich fortzubewegen, vollkommen abhaengig vom Auto bin. Zum Glueck habe ich ein Studio, das nicht weit von meinem Haus entfernt ist. Wenn ich in Los Angeles bin, dann verbringe ich die meiste Zeit damit, zusammen mit meiner Frau im Garten herumzuhaengen oder im Studio zu arbeiten. Ich gehe dort nicht sehr viel aus. weiterlesen »
-
Gehirnfrei durch die Globalisierung
Nun hat das Thema also auch Deutschlands groesstes Wochenmagazin erreicht: den Spiegel. Titelstory dieser Woche: Rettet dem Deutsch! Es geht hier um die deutsche Sprache, besser gesagt um deren Verlotterung, wie es das Deckblatt des Blattes reisserisch ankuendigt. Der Verfasser, Mathias Schreiber, malt ein Horrorszenario, wonach die deutsche Sprache noch im Verlauf dieses Jahrhunderts aussterben koennte. Und es geht hier immerhin um die Sprache von, Zitat Schreiber, Luther, Kant, Goethe, Kleist, Bismarck, Daimler, Werner von Siemens, Kafka, Rilke, Einstein, Brecht, Thomas Mann und Grass. Zitat Ende. Was soll der Scheiss?
Ist Deutsch vornehmlich Maennersprache (gewesen)? Und ueberhaupt nur deshalb unter Artenschutz zu stellen, weil sie von ein paar Wissenschaftlern und Schriftstellern benutzt wurde? Schreiber nimmt in der Diskussion um die deutsche Sprache genau jene Binnenperspektive ein, die dem Deutschen viel mehr schadet, als irgendwelche Einfluesse von Aussen es je koennten. Er sieht, ganz der deutsche Buchhalter, ein Missverhaeltnis von Import und Export von Woertern. Und fuehrt an, dass die Englaender aus dem Deutschen ja nur Woerter wie Bratwurst uebernaehmen, waehrend die Deutschen ja nun mehr als uebereifrig seien mit dem Einfuehren von Anglizismen.
Aber er sollte seine Buchhaltung mal den neuen Verhaeltnissen von Import und Export anpassen. Laengst ist alles nicht mehr so uebersichtlich, wie in Zeiten als Deutschland als Kulturnation und spaeterer Exportweltmeister sein Selbstwertgefuehl aufbauen konnte hierbei stimmen mir uebrigens auch andere Redakteure der Berliner Gazette zu. Schreiber ist darueber hinaus ein Grammatikwaechter erster Guete. Fuer ihn kommt Jugendsprache mit ihren Wortneuschoepfungen, Abkuerzungen und Denglisch-Floskeln dem Hirntot gleich. Zitat Schreiber: Popmusik flasht oft gehirnfrei durch die Sprache. Zitat Ende. Doch aus seiner Bauchnabelperspektive kann er vielleicht gerade mal eine Beobachtung beschreiben; erklaeren und verstehen helfen kann er die Entwicklungen der deutschen Sprache aus seiner Perspektive nicht.
Warum nicht mal fragen, welchen Einfluss das Deutsche in der Welt hat? Warum nicht mal gucken, wo es Deutsch ueberall gibt? Warum nicht mal die Ruecklaeufe aus dieser Expansion in Betracht ziehen geschweige denn als Bereicherung ansehen? Sprache ist kein starres Gefuege, sondern ein offenes System. Alles in allem koennen wir Schreiber dankbar sein: Sein Leitartikel im Spiegel bietet mir Anlass, auf das Berliner Gazette-Projekt McDeutsch hinzuweisen. Und was fuer ein Timing: Tag der deutschen Einheit. Und der Relaunch der Berliner Gazette Website steht. Das neue Design ermoeglicht einen guten Ueberblick ueber die zahlreichen Beitraege, die bislang zusammengetragen werden konnten. Mein Tipp: Einfach lesen und sich inspirieren lassen.
-
Brasiliens Disneyland der deutschen Einwanderung
Das Stichwort Tourismus beschwoert im Zusammenhang mit der Globalisierung der deutschen Sprache zahlreiche Bilder herauf. Nicht zuletzt sicherlich Bilder von Enklaven deutscher Aussiedler, die ihre Kultur und Sprache in einem fein umhegten Areal pflegen. Etwa wie in Nova Petropolis, das am 7. September 1853 in Brasilien gegruendet und von deutschen Einwanderern aus Pommern, Sachsen, Boehmen und Hunsrueck besiedelt wurde: Heute sind dort die meisten Einwohner Deutschstaemmige und sollen einen ganz eigenen deutschen Dialekt sprechen. Inspiriert durch diese Idylle wurde der gleichnamige Themenpark: Nova Petropolis, ein Einwandererpark, der die deutsche Besiedlung von Rio Grande do Sul simuliert. Auf einer Flaeche von zehn Hektar mit urspruenglichem Urwald, vielen Pinienbaeumen und zwei Teichen bewahrt der Park ausser der Oekologie auch die Erinnerung an die Einwanderer. Wie der deutschsprachigen Zeitung Brasil Post zu entnehmen ist, wird die typische Architektur jener Zeiten besonders in der Kapelle der Einwanderer und in dem eigenwilligen Gebaeude der Land-Kreditgenossenschaft sichtbar. Die Kapelle, die aus Linha Araripe dorthin versetzt wurde, ist die einzige in Brasilien, deren Turm und Schiff im Fachwerkbaustil errichtet wurden! Andere Sehenswuerdigkeiten sind der Biergarten und der Ballsalon. Ich hoffe sehr, dass zu den Ausstellungsstuecken auch Sprachskulpturen zaehlen, konnte bei meinen Recherechen allerdings keine Hinweise darauf finden.
-
Detlef Diederichsen in da Haus
Headhunter, Bunte-Leser und Musikfans mal aufgepasst: Detlef Diederichsen, auch bekannt als der aeltere Bruder von Pop-Guru Diedrich Diederichsen, hat in der deutschen Hauptstadt einen prestigetraechtigen Posten angenommen. Der ausgewiesene, aber nicht uebermaessig prominente Musikexperte (u.a. Spex) ist seit neustem neuer Bereichsleiter fuer Musik, Tanz und Theater im Haus der Kulturen der Welt. An seinem neuen Aufgabenbereich am HKW reizt ihn besonders, “Musikveranstaltungen realisieren zu koennen, die nicht von den gaengigen Genregrenzen und Formatvorgaben eingeengt werden. Durch die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Bereichen Literatur und Kunst lassen sich im HKW ausserdem groessere Themen bearbeiten und Debatten anstossen, wie es fuer gewoehnlich mit reinen Musikveranstaltungen nicht moeglich ist”, so Diederichsen. An dieser Nachricht reizt uns wiederum uns ganz besonders, dass ein so cooler Typ einen solchen Posten in einer so ehrwuerdigen Institution bekleidet. Ein Reizthema koennte kueftig werden, dass immer mehr Leute aus dem Spex-Umfeld der 1980er und 1990er Jahre, in Berlin an die Macht kommen… Christoph Gurk, ehemals Spex-Chefredakteur, heute Dramaturg an der Volksbuehne, ist der wohl prominenteste Praezedenzfall.
-
Duden Open
Gemeinsam mit seinen Partnern sucht der Dudenverlag wieder talentierte Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten bis 21 Jahre. In insgesamt drei Ausscheidungsrunden werden das Allgemeinwissen der Teilnehmenden sowie ihr Schreib- und Recherchetalent getestet und durch eine renommierte Jury bewertet. Die erste Runde startet am 1. September online auf Duden Open mit einen Fragebogen zur Allgemeinbildung, aehnlich wie auch bei der Aufnahmepruefung einer Journalistenschule. Wer dort zeigt, dass er sich in Politik, Kultur oder Sport auskennt, qualifiziert sich fuer die zweite Runde.
Dann muessen die Teilnehmenden bis Ende des Jahres einen selbst verfassten Artikel zu einem vorgegebenen Thema an die Duden-Open-Redaktion schicken. Alle eingereichten Beitraege werden von einer hochrangigen Jury bewertet. Die Autoren/innen der zehn bestbewerteten Artikel reisen dann im Mai/Juni 2007 zum grossen Finale und wetteifern bei der Endausscheidung um mehrwoechige Praktika bei verschiedenen Print-, Online- und TV-Medien.
-
Warum bist Du nach Berlin gekommen?
Es ist die schlichteste und zugleich komplexeste Frage überhaupt: Warum? Berliner Gazette-Autorin Antje Becker stellt zwei Künstler vor, die ihren Kollegen genau die Frage gestellt haben: Warum Berlin? weiterlesen »
-
War Mozart Kritiker des Islams?
Ich glaube nicht, dass er es war und falls er es doch gewesen ist hat das eigentlich nicht zu interessieren. Denn was gibt irgendeinem das Recht eine Oper namens Idomeneo ab zu setzen, weil sich dadurch Anhaenger des Islams diskriminiert fuehlen koennten. Sollten wir also in Zukunft auch die Presse- und Meinungsfreiheit einschraenken, damit wir bloss keinen Grund mehr liefern um Ziel eines, von fanatischen Moslems durch gefuehrten, terroristischem Anschlags zu sein. Wie weit muss Toleranz und Integration gehen, damit sich Immigranten auch wirklich integriert fuehlen? Man sollte sich nicht die Frage stellen ob man eine 200 Jahre alte Oper ab setzen muss, sondern eher viel eher ob man den Koran, der der seit fast 1400 Jahren die Rolle der Frau herabsetzt, in einer neuen ueberarbeiteten Ausgabe verlegt.
-
Kein Bravo fuer Bikini
Eine Ausstellung des Pazifik-Netzwerks e.V. und der Pazifik-Informationsstelle www.pazifik-infostelle.org zeigt auf neun grossformatigen Tafeln (bedruckte Stoffbahnen 1,80 x 1,00 m) die fuenfzigjaehrige Geschichte der Atombombentests im Pazifik und springt dabei auf jeder Tafel in ein Jahrzehnt. Des Weiteren klaert sie ueber die aktuelle militaerische Nutzung nuklearer Technologien auf. Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, wendet sich die Ausstellung insbesondere an Schueler und Jugendliche, dient aber gleichzeitig der Weiterbildung von Erwachsenen. Zum Weitersagen steht ausserdem drin: Sie kann gegen die Erstattung von Porto- und Versandkosten bei der Pazifik-Infostelle ausgeliehen werden.
-
Open Mike
Am 4. und 5. November ist es wieder so weit: der jaehrlich von der Literaturwerkstatt Berlin www.literaturwerkstatt.org ausgeschriebene deutschsprachige Literaturwettbewerb fuer junge Nachwuchsautoren
open mike
geht in die Endrunde. In der WABE werden die 18 besten Texte aus der Vorrunde von ihren Verfassern dem Publikum und einer dreikoepfigen Jury vorgestellt.Auf Initiative der Crespo Foundation www.crespo-foundation.de, die das Projekt auch finanziell unterstuetzt, wird
open mike
durch zwei Schreibwerkstaetten erweitert, in denen Jugendliche von ehemaligen Preistraegern begleitet und mit Tipps und munteren Worten versorgt werden. Fuer beide Seiten eine schoene Gelegenheit, die Bande zwischen den Generationen zu knuepfen und Hand in Hand in die Zukunft zu blicken. -
Andreas aus Deutschland
Seit ein paar Tagen bin ich zurueck in England und nach meinem sehr kurzem Aufenthalt in Spanien ist es spannend wieder hier zu sein.
In the South East
, was die englische Bezeichnung fuer das ist, das der Rest der Welt als Great London kennt: ein Netz von relativ kleinen Staedten, das sich von der Hauptstadt hinaus erstreckt. Mitten in dieser Region liegt Oxford, eine Stunde mit dem Zug von London entfernt. Die Stadt ist ziemlich merkwuerdig: Eine Mischung aus historischer Stadt (etwa das westdeutsche Nuernberg) mit ihrem typischen Architekturkitsch und einer provinziellen Stadt (wie beispielsweise so vieles in den Vereinigten Staaten). Die mittelalterlichen Gebaeude erheben sich neben komischen architektonischen Ungeheuern der 1960er und 70er Jahre. Furchtbar!Die vielleicht beste Beschreibung dieser Stadt ist jene, die ich irgendwann von einem Bekannten hoerte:
…wie ein riesiger Sainsbury’s Supermarkt mit Bibliotheken um sich rum
. Es sind aber nicht die Gebaeude, die aus Oxford einen sonderbaren Ort machen. Sondern die Menschen! Es gibt Theorien aller Art darueber, warum die Menschen an dieser Uni ein bisschen beaengstigend sind. Was auch immer der Grund sein mag, Tatsache ist, dass es nicht so viele Orte gibt, an denen man mit jemandem Mittag essen kann, der stolz darauf ist, einen Film ueber die Queen gesehen zu haben. Ich war anfangs ahnungslos.Ein Film… meinst du einen echten Film? ueber die Queen?
. Vielleicht bin ich ein bisschen intolerant gegenueber dieser Art Extravaganz, aber eine Begegnung mit jemandem zu erleben, dessen Augen glaenzen, wenn er ueber die Aussagen der Queen schwaermt, gehoert wirklich nicht meinem Alltag.Ausser in Oxford natuerlich… Der Typ hat die ganze Zeit ueber die grossartigen Augenblicke des Films gesprochen, der angeblich ein Spielfilm ueber ihre Reaktion auf den Tod einer gewissen Princess Diana ist www.thequeenmovie.co.uk. Beim essen eines unbestimmten Gerichts fuer Vegetarier hatte ich noch Zeit, um ihn zu fragen, was er in Oxford studierte: Er promoviert zum Thema
der Musik fuer die Kroenungszeremonien des britischen Koenigshauses seit dem 16. Jahrhundert
. Ich konnte kaum vermeiden, mich kaputtzulachen. Ein richtiger britischer Monarchist. Uebrigens, ich habe vergessen zu erzaehlen, dass er Andreas hiess und aus Kassel (Deutschland) kam.



 MORE WORLD
MORE WORLD