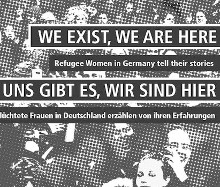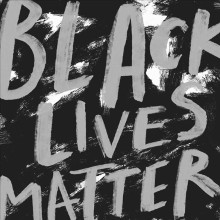What can I say? Mir fehlt manchmal das richtige Wort. Ich habe mich vor kurzem mit Freunden in einem mexikanischen Restaurant getroffen. Unter uns gab es zwei Mexikanerinnen, eine Deutsche, einen Chilenen, und mich, die Deutsche und Amerikanerin. Mit Isabel redete ich hauptsaechlich auf English, manchmal kurz auf Deutsch, mit Ursi meistens auf Deutsch, aber auch kurz auf Englisch, mit Isabels Schwester nur Englisch, mit Rodrigo nur Deutsch, und zur gleichen Zeit nahm ich mir vor, so viel wie moeglich auch die vielen spanischen Ausdruecke mitzubekommen. Zum Glueck haben wir nicht auch noch franzoesisch geuebt. weiterlesen »
- Entlang der X-Achse: Führen uns nervöse Kurvenlandschaften zurück zur Norm…
- Schöne neue Logistik-Welt? Warum Arbeiter*innen in Erzählungen über Liefer…
- Stadt und Pandemie: Gibt es Arbeit im vermeintlich vollautomatisierten Silico…
- Der dritte Weg: Warum eine differenzierte Kritik der "Corona-Maßnahmen" gera…
- Schreien, Weinen, leises Lachen: Acht Mütter über ihr Leben in der Covid-19…
- Stadt und Pandemie: Silicon-Valley-Urbanismus, kritische Infrastruktur und "S…
- Unsichtbar gemachte Entscheider*innen: Content-Moderation, KI und Arbeitskäm…
- Kritisieren, Träumen und Gestalten: Wie gegen den KI-Kapitalismus ankämpfen…
- Die "Caring Crowd": Wenn hinter dem Label KI eigentlich digitale Heimarbeit …
- Verpasst und verpatzt: Was 1990 in der BRD und Europa hätte passieren könne…
-
Lost in Translation
-
Transnationales Kulturarchiv
Wenn in deutschen Medien von Sprache und Globalisierung die Rede ist, geht es zumeist um die wachsende Dominanz des Englischen. Doch auch im Bereich der Sprache gilt, was Globalisierung im Ganzen charakterisiert, naemlich ihre gleichzeitige Tendenz zu Homogenisierung und Heterogenisierung, zur Vereinheitlichung und zur Ausdifferenzierung und Neuvermischung. Diese Tendenzen existieren gleichzeitig, ohne sich deshalb jedoch gegenseitig aufzuheben oder sich auszugleichen. Was dabei herauskommt, ist ein Spannungsfeld asymmetrischer Entwicklungen, an der auch die deutsche Sprache teilhat. weiterlesen »
-
Keine Heimat
Ich habe eine unbeschreibliche Sehnsucht danach, in diesem Land nicht mehr staendig nach
meiner Heimat
befragt zu werden. Warum koennen die Deutschen einfach nicht damit aufhoeren? Ja, ich weiss sehr wohl, dass in anderen europaeischen Laendern Migranten auch ihre taeglichen Herkunftsgeluebde abliefern muessen. Na, und? Was sagt uns das? Nichts. Ich lebe hier. Und wenn es die Neugier befriedigt, ich war dieses Jahr in folgenden Staedten/0rten. (Die Anzahl meiner Besuche habe ich in Klammern festgehalten): Frankfurt (8), Koeln (2), Ulm (1), Bremen (2), Istanbul (2), Dersim (1), London (4), Rom (0), Paris (7). Nun frage ich Sie: Wo ist meine Heimat? weiterlesen » -
Das Wortspiel als Lebenssinn
Ich wurde 1967 in Dresden geboren. Meine Mutter war Bulgarin und mein Vater Ungar. Beide waren Stipendiaten und haben an der TU in Dresden studiert. Mein Vater lebte seit elf Jahren in Dresden, meine Mutter seit neun. Sie haben sich hier kennen gelernt und schliesslich 1963 im Rathaus Pankow geheiratet. Da mein Vater kein Bulgarisch sprach und meine Mutter kein Wort Ungarisch, ist die deutsche Sprache die Sprache ihrer Liebe gewesen und wurde auch zu unserer Familiensprache. Als ich geboren wurde, kamen meine Grosseltern aus Sofia nach Dresden um zu helfen. Sie wohnten zwei Jahre lang in einer kleinen Wohnung im gleichen Haus. Hier war die Windelwaescherei und hier wurde der Brei fuer mich gekocht. Mit meinen Eltern sprach ich Deutsch, mit meinen Grosseltern Bulgarisch. Als ich zweieinhalb wurde fiel die Entscheidung, nach Budapest zu ziehen. Obwohl ich Ungarin war, sprach ich bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Wort Ungarisch. weiterlesen »
-
Subtiler Sprachsalat
Soweit ich mich an meine Kindheit erinnern kann, hiess es bei uns zu Hause – in einer industriellen Stadt der spanischen Kueste am Atlantik – vor dem Schlafengehen immer:
Gute Nacht! Schlaf gut!
Erst spaeter habe ich begriffen, warum meine Freunde, die bei uns uebernachtet haben, diese vier Woerter komisch gefunden haben. Es kam ihnen wahrscheinlich Spanisch vor. weiterlesen » -
Maschinen sprechen eigentlich Deutsch
Meine Muttersprache ist zwar Niederlaendisch, aber im Laufe der Jahre kamen immer mehr englische Woerter hinzu – bei uns Zuhause waren immer viele internationale Gaeste zu Besuch. Popmusik hat dabei auch eine wichtige Rolle gespielt, vor allem die fremden Klaenge der Schallplattensammlung meiner Eltern. In Amsterdam Mitte und Ende der 1960er Jahre als Kind aufzuwachsen, war etwas Besonderes: Die ganze Politik-, Drogen- und Sexrevolution vor der eigenen Tuer mitzuerleben, war schon sehr praegend. Mein Vater war damals viel unterwegs und lernte in dieser Zeit Russisch und Italienisch. Ich dagegen interessierte mich fuer Deutsch. weiterlesen »
-
Publizieren im Urlaubsland
Das DomRep-Magazin www.domrep-magazin.de wurde im September 1998 von Gerda Papenfuss gegruendet und ging erstmals im Januar 1999 als rein virtuelle Publikation online. Wie die Gruenderin rueckblickend bilanziert, gingen die urspruenglichen Plaene auf den Wunsch zurueck,
eine deutschsprachige Zeitung in einem Urlaubsland zu produzieren.
Nachdem Mallorca bereits sein Magazin hatte, die Kanaren nicht geeignet schienen, richtete sich der Blick in Richtung Karibik. Waehrend das kubanische Castro-Regime keine freie Presse zuliess, Venezuela und Mexiko nur von einer geringen Anzahl an deutschen Touristen angeflogen wurde, bot sich die Dominikanische Republik von seinen Moeglichkeiten der Machbarkeit sowie dem touristischen Zuspruch als Trendreiseziel foermlich an. Als die Macher rund um Papenfuss damit anfingen, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen, gab es lediglich eine Handvoll Infoflyer, die ueber Land und Leute informierten, meist mehrsprachig und zudem oft in einem unverstaendlichen Deutsch uebersetzt.
Tageszeitungen aus Deutschland waren, wenn ueberhaupt erhaeltlich, meist bereits einige Tage alt. Beste Voraussetzungen also, um mit einer Zielgruppe von damals 400.000 deutschen Urlaubern im Ruecken – Tendenz steigend -, an den Start zu gehen… Heute gilt das DomRep-Magazin als die aelteste deutsch-dominikanische Netzeitung.
-
Rhymen ohne Buecher
Ich bin in Berlin geboren und jetzt 14 Jahre alt. Mein Vater kommt aus Martinique, das ist so ’ne Kolonie von Frankreich gewesen und meine Mutter ist Deutsche. Ich hab zuerst Deutsch Zuhause gelernt. Mein Vater hat mit mir am Anfang immer auf Franzoesisch gesprochen und irgendwann nach ’ner Weile gar nicht mehr, dann nur noch auf Deutsch. Aber trotzdem hab ich Franzoesisch nicht vergessen. Ich hab oft meine Grosseltern in Frankreich besucht und ich war im Sommer immer im franzoesischen Ferienlager. Diesen Sommer werde ich meine Oma in der Karibik besuchen. Ich bleibe fuer’n paar Monate und werde da die ganze Zeit Franzoesisch sprechen. Dann geh ich noch fuer’n Jahr zu meiner Tante nach Frankreich und bekomm noch mehr Sprachpraxis. Im Augenblick sprechen wir Zuhause eigentlich nur Deutsch. Ausser mit meiner kleinen Schwester, mit der spreche ich manchmal auch Franzoesisch. weiterlesen »
-
Fremd im eigenen Land
Linguist, das bin ich. Sprache ist meine Leidenschaft, mein Daseinszweck. Meine Begegnung mit Hip Hop fand ueber Sprache statt. Meine Arbeit als Sprachwissenschaftler und Autor ist ganz stark durch meine Erfahrung als Wortkuenstler gepraegt. In meiner Arbeit als Menschenrechtsaktivist fuehre ich das Wort als Waffe. In Verhandlungen mit stoerrischen Regierungsbeamten, schmierigen Weltbankvertretern oder boesartigen Landbesitzern, die mittellosen Bauern das Land wegnehmen. weiterlesen »
-
Aus dem Leben eines Anpassschuelers
Ich bin als Sohn iranischer beziehungsweise persischer Eltern in Berlin geboren. Meinen ersten direkten Kontakt mit der deutschen Sprache hatte ich im Alter von zweieinhalb Jahren als ich zum ersten Mal in den Kindergarten gegangen bin. Wie ich Deutsch gelernt habe, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Zuhause wurde Persisch, Farsi, gesprochen und im Kindergarten und spaeter in der Schule Deutsch. Also bin ich gewissermassen ohne irgendwelche Probleme zweisprachig aufgewachsen. Von einem Integrationsprozess in der Kindheit kann nicht die Rede sein. In welcher Sprache ich mich heute an meine Kindheit erinnere, kann ich nicht genau sagen aber ich glaube, dass es beide Sprachen sind. weiterlesen »
-
Hände hoch!
Die deutsche Sprache gehoerte immer zu unseren Familienwerten. Mein Grossvater las Werke von Heine und Goethe im Original; meine Mutter arbeitete ein paar Jahre lang als Deutschlehrerin. Meine ersten Worte auf Deutsch waren leider – wie bei Tausenden russischer Kinder meiner Generation –
Haende hoch!
Wir spielten sehr haeufig Krieg, der Zweite Weltkrieg war unserSpielthema
. weiterlesen » -
Die Stunde des Auto-Examens
Es war Zufall, dass ich nach Deutschland kam. Ich wollte einen Erasmus-Austausch ueber meine Kunstakademie in Helsinki machen und eine neue Sprache erlernen. Zu den nicht englischsprachigen Austauschmoeglichkeiten zaehlten Paris und Frankfurt. Mit 21 Jahren habe ich noch ganz anders gearbeitet – ich malte damals und hatte eine ganz eigenwillige Vorstellung von der Kunst in Deutschland und Frankreich. Aus irgendeinem Grunde dachte ich damals, dass man in Frankreich sehr konzeptuell mit der Arbeit umgehe und Deutschland daher besser fuer mich sei, weil die Kunst hier mehr
Gefuehl
habe. weiterlesen »



 MORE WORLD
MORE WORLD