Der Philosoph Vilém Flusser hat einmal gesagt, dass die Welt in Programmierer und Programmierte zerfällt. Als die Gesellschaft noch nicht so umfassend im Zeichen des Computers stand wie heute, mag das noch so geklungen haben wie: Die Welt zerfällt in freie und unfreie Menschen. Zugespitzter formuliert: Die Welt zerfällt in Menschen, die das Leben anderer gestalten und Menschen, deren Leben gestaltet wird; letzte sind de facto Sklaven.
Natürlich war die Sklaverei zu diesem Zeitpunkt, wir schreiben die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, längst Geschichte. Doch sie kommt wieder, in neuem Gewand, in einer Ära, in der der Computer wie wohl kaum ein anderes Werkzeug das Leben dominiert. Die Sklaven sind die Programmierten; Sklaventreiber sind die Programmierer.
Programmiert statt alphabetisiert
Vielleicht muss man die Aufteilung der Welt auf diese Weise zuspitzen. Sonst wird nicht deutlich, dass wir in einer Zeit leben, in der laut Web 2.0-Philosophie der Computer zu einem Toaster geworden ist: Alles ist vorgefertigt, benutzerfreundlich und per Knopfdruck bedienbar. Wer kann den Computer und das Netz, an das er angeschlossen ist, nicht bedienen? Ich behaupte, es kann sich dabei eigentlich nur um Menschen handeln, die, aus welchen Gründen auch immer, Widerstand auf verlorenem Posten leisten.
Die digitale Kluft wird sich in den kommenden Jahren nicht auflösen. Es wird sicherlich noch dauern, bis die so genannte dritte Welt komplett verkabelt ist. Doch zu welchem Preis findet dieser Verkabelungsprozess statt? Peter Glaser hat bereits Ende 1990er darauf hingewiesen, dass sich Standards durchsetzen werden, die einen gewissen Analphabetismus fördern – im Gewand des Vereinfachens, Beschleunigens. Menschen, die nicht lesen können, bedienen Computer und ihre Netzwerke, weil es hier ausreicht, die Universalsprache der Icons zu verstehen.
In Anlehnung an Ulrich Beck, der die Vertreter der Generation Global nicht in der ersten, sondern in der dritten Welt sucht, würde ich an dieser Stelle sagen: Die Analphabeten in Afrika, die vermeintlich erfolgreich im Internet unterwegs sind, sind die Prototypen der im Flusser’schen Sinne Programmierten. Prototypen, die ich in Berlin im Café St. Oberholz wiederfinde und überall dort erblicke, wo sich eine Computerkultur Bahn bricht, in der nicht ansatzweise danach gefragt wird, wie die praktischen Benutzeroberflächen eigentlich gemacht sind.
Neue Kulturtechnik: Programmieren
Der Medienphilosoph Norbert Bolz, der den eingangs zitierten Ausspruch Flussers’ kürzlich in einem Interview mit dem medienpolitischen Fachmagazin promedia in den Raum stellte, meint, es sei “nicht ganz undenkbar, dass Programmieren einmal so selbstverständlich wird wie lesen und schreiben. Es ist eine Frage an die Pädagogik und das Selbstverständnis von Bildungsprozessen.”
Ersteres scheint mir in Anbetracht der gegenwärtigen Lage äußerst abwegig, wenngleich äußerst wünschenswert. Letzteres, also die Frage an die Pädagogik, äußerst zutreffend. Denn das “Selbstverständnis von Bildungsprozessen” artikuliert sich in dieser Epoche aus der Perspektive des Programmierers, der sich Züchtigung und Disziplinierung auf die Fahnen geschrieben hat. Die Programmierten müssten das eigentlich wissen, sofern sie wissen, dass sie die Programmierten sind.



 MORE WORLD
MORE WORLD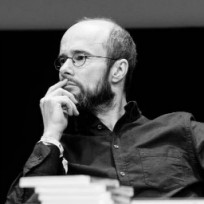

12 Kommentare zu