Der politische Vorstellungs- und Handlungsspielraum, der sich in dieser Zeit der Krisen aufgetan hat, muss für einen breiteren institutionellen und politischen Wandel genutzt werden. Zu diesem Zweck ist eine Degrowth-Politik, die in der Lage ist, eine breite Unterstützung zu mobilisieren, heute notwendiger denn je, argumentiert Bengi Akbulut in ihrem Beitrag zur BG-Textreihe “After Extractivism”.
*
Nicht, dass es einer Erinnerung bedurft hätte, aber vielleicht hat uns die COVID-19-Pandemie zuletzt vor Augen geführt, wie pervers unsere Volkswirtschaften aufgebaut sind. Vielleicht verblasst die Erinnerung an die ersten Tage der Pandemie, aber sie hat deutlich gemacht, dass unsere Volkswirtschaften nicht darauf ausgerichtet sind, den Bedarf zu decken oder diejenigen in den Mittelpunkt zu stellen, die die für das menschliche und nichtmenschliche Leben wichtigen Waren und Dienstleistungen herstellen. Und in diesen Tagen gibt es keinen Mangel an Krisen, die uns dieses böse Erwachen erneut vor Augen führen.
Doch die griechische Wurzel des Wortes “Krise” impliziert einen Wendepunkt, einen Bruch, durch den sich Möglichkeiten eröffnen. Krisen legen offen, was wir als “normal” zu akzeptieren gewohnt sind, und brechen mit dem gesunden Menschenverstand, der das “Normale” aufrechterhält. Durch diesen Bruch bergen sie das Potenzial für einen neuen Sinn für das, was möglich ist, und bieten einen Ansatzpunkt für die Vorstellung von Alternativen. Eine solche Alternative ist Degrowth.
“Das globale Gleichgewicht”, schrieb André Gorz 1972, “für das kein Wachstum – oder sogar ein Rückgang – der materiellen Produktion eine notwendige Bedingung ist, ist es mit dem Überleben des (kapitalistischen) Systems vereinbar?”. Seit dieser ersten Verwendung des Begriffs hat sich “degrowth” (décroissance) zu einem kraftvollen konzeptionellen Rahmen und Mobilisierungsmittel für die Vorstellung und Umsetzung alternativer Wege der Artikulation von Gesellschaft, Wirtschaft und Natur entwickelt.
Die Wirtschaft zurückgewinnen
Degrowth wird oft, wenn auch irreführend, mit einer technischen Angelegenheit des “Downscaling” gleichgesetzt, d. h. der Verringerung des Material- und Energieverbrauchs von Gesellschaften, oder schlimmer noch, mit einer Schrumpfung des BIP. Degrowth ist in der Tat ein Vorschlag für eine freiwillige, gerechte und demokratisch geführte Reduzierung der Materialien und Energie, die eine Gesellschaft gewinnt, verarbeitet und als Abfall entsorgt. Doch dieser Aufruf zum Downscaling ist nicht nur als Antwort auf eine biophysikalische Notwendigkeit gedacht – und in dieser Hinsicht haben die Degrowth-Anhänger*innen die unbegründeten Behauptungen von grünem Wachstum und technischen Lösungen energisch in Frage gestellt – und auch nicht als eine technische Frage des “Weniger”. Degrowth bezeichnet einen weitaus radikaleren Wandel, der die vorherrschenden Strukturen unserer Volkswirtschaften in mehr als einer Hinsicht ins Wanken bringt.
Erstens ist Degrowth ein Projekt, das mit der Dominanz des Wirtschaftswachstums als gesellschaftliches Ziel bricht, d.h. mit der Ideologie des Wachstums. Es ist ein Aufruf, die automatische Gleichsetzung von Wachstum mit “besser” zu dekonstruieren, um Raum für die Vorstellung anderer Ideale und Prinzipien bei der Organisation unserer wirtschaftlichen Beziehungen zu schaffen. Degrowth ist eine grundlegende Herausforderung an die ökonomische Logik, die, in Serge Latouches Worten, das Imaginäre kolonisiert – ein Ökonomismus, der andere (nicht-ökonomische) soziale Rationalitäten, Ziele und Darstellungen dominiert und erstickt.
In diesem Sinne zielt Degrowth darauf ab, das “Ökonomische” (wieder) zu politisieren – indem es die vermeintliche Objektivität wirtschaftlicher Imperative wie Effizienz oder Wachstum radikal in Frage stellt, sich ihre politische Dimension wieder aneignet und demokratische Entscheidungen bei der Gestaltung der wirtschaftlichen Sphäre in den Vordergrund stellt. Degrowth ist ein Projekt zur Rückeroberung der Wirtschaft.
Zweitens ist Degrowth eine Forderung nach “nicht nur weniger, sondern anders” – es geht nicht um eine quantitative Schrumpfung unserer bestehenden Volkswirtschaften, sondern darum, sie so umzugestalten, dass sie anderen Funktionen dienen. Degrowth ist ein Aufruf zur Umstrukturierung unserer Wirtschaftsbeziehungen und zu deren Neuausrichtung auf anderen Prinzipien – wie Care, Autonomie, Solidarität, Gerechtigkeit und Demokratie. Dies bedeutet unter anderem, dass alternative Wirtschaftssysteme aufgebaut und gestärkt werden müssen – Prozesse der Produktion, des Austauschs, der Arbeit/Entlohnung, des Finanzwesens und des Konsums, die sich bewusst von der herkömmlichen (kapitalistischen) Wirtschaftstätigkeit unterscheiden. In diesem Sinne schließt sich Degrowth anderen Denker*innen, Bewegungen und Praktiken an, die den Aufbau von Alternativen zum Kapitalismus als Strategie und konkrete Utopie begreifen.
Radikaler Wandel
Anders ausgedrückt: Degrowth ist in erster Linie ein Projekt der Neuorientierung, Umstrukturierung und Neuausrichtung unserer Wirtschaft. Eine solche Neuausrichtung kann verschiedene Formen annehmen: Sie bedeutet eine Verlagerung weg von extraktiven Aktivitäten, der Produktion fossiler Brennstoffe, dem Militär und der Werbung hin zu Aktivitäten, die das menschliche und nicht-menschliche Wohlergehen erhalten und regenerieren, wie z. B. Gesundheitsfürsorge, Bildung, ökologisch-restaurative Landwirtschaft und lokale Ernährungssysteme. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir die Subventionen für die erstgenannten Bereiche abschaffen und die öffentlichen Finanzen auf die letztgenannten Bereiche umlenken; dass wir die Steuersysteme so umstrukturieren, dass schädliche wirtschaftliche Aktivitäten bestraft und lebenserhaltende Aktivitäten belohnt werden, und dass wir die sozial-ökologische Zerstörung, die durch kapitalistische Wachstumswirtschaften verursacht wird, eindämmen, indem wir demokratisch festgelegte Obergrenzen für den Abbau von Ressourcen festlegen.
Dazu gehört auch eine gerechte Versorgung und die Gewährleistung des Zugangs zu grundlegenden Gütern und Dienstleistungen für alle. Mögliche Wege zu diesem Ziel sind die Dekommodifizierung von Grunddienstleistungen wie Gesundheitsfürsorge, Bildung und Wohnen und/oder Maßnahmen zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Wohlstand für alle, z. B. durch universelle Grundeinkommenssysteme. Die Entkopplung von bezahlter (Markt-)Arbeit und der Befriedigung von Grundbedürfnissen würde nicht nur den Zwang zur Arbeit in ausbeuterischen, entfremdenden und entwürdigenden Jobs aufheben. Sie würde auch die Verbindung zwischen Wohlstand, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum aufheben. Die Gewährleistung eines angemessenen Niveaus des Wohlbefindens für alle ist in der Tat eine Entscheidung für eine radikale Änderung der Verteilung der Mittel für den Lebensunterhalt in unseren Gesellschaften, eine Entscheidung, die von der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums für die Arbeitsplätze, die es angeblich schafft, abgekoppelt ist.
Politik der Arbeit: Soziale und ökologische Reproduktion
Für diese Neuausrichtung sind drei Achsen von grundlegender Bedeutung, die ich hervorheben möchte. Die erste ist eine umfassendere Vorstellung davon, was “Arbeit” ist und welche Arten von Arbeit für ein gutes Überleben notwendig sind. Das bedeutet, dass die Arten von unbezahlter und bezahlter Arbeit, die in verschiedenen Kontexten (Haushalte, Gemeinschaften, Ökosysteme) geleistet werden und die das menschliche und nicht-menschliche Leben erhalten, anerkannt und anerkannt werden müssen – was Ökofeministinnen und feministische politische Ökonominnen seit langem als soziale und ökologische Reproduktion theoretisieren: eine Form von Arbeit, die die Arbeitenden reproduziert und erhält, lebenserhaltende Güter und Dienstleistungen produziert und die ökologischen und sozialen Bedingungen der (Waren-)Produktion regeneriert.
Die Einführung eines Care-Einkommens zur Belohnung und Unterstützung dieser unsichtbar gemachten Form der Arbeit steht an der Spitze des Degrowth-Aktivismus, der durch die COVID-19-Pandemie neuen Auftrieb erhalten hat. Neben einem Care-Einkommen würden politische Maßnahmen, die die Rechte und Ansprüche von essenziellen Arbeitskräften ausweiten, sowie öffentliche Investitionen in die soziale und ökologische Reproduktion dazu beitragen, die Anerkennung und Wertschätzung von Arbeit zu verändern.
Feministische Auseinandersetzungen mit Degrowth haben jedoch nicht nur dazu beigetragen, dass die Arbeit der sozialen und ökologischen Reproduktion anerkannt und belohnt wird. Sie haben auch problematisiert, wie diese Reproduktionsarbeit organisiert ist, d.h. die geschlechtsspezifische und rassifizierte Natur dessen, wer wie viel davon unter welchen Bedingungen leistet. In diesem Sinne bietet der breitere Arbeitsbegriff von Degrowth auch eine neue Sichtweise für das Nachdenken über Übergangsgerechtigkeit, da er nicht nur den Begriff des gerechten Übergangs, sondern auch den der Übergangsgerechtigkeit mit dem vielfältigen und immensen Arbeits- und Produktionsfeld verbindet, das der Warenproduktion und Kapitalakkumulation zugrunde liegt. Das heißt, dass Übergangsgerechtigkeit Gerechtigkeit für (menschliche und nicht-menschliche) Arbeiter*innen der sozialen und ökologischen Reproduktion erfordert.
Autonomie und (wirtschaftliche) Demokratie
Die zweite grundlegende Achse ist Autonomie und Demokratie. Dies bezieht sich auf die Forderung von Degrowth, eine vom Ökonomismus – wirtschaftlichen Darstellungen und Imperativen – dominierte gesellschaftliche Vorstellung zu verlassen und sich vom Wachstumsimperativ zu befreien, um die demokratische Entscheidungsfindung bei der Gestaltung wirtschaftlicher Prozesse in den Vordergrund zu stellen. Es baut aber auch auf den Arbeiten von Denkern wie Ivan Illich, Andre Gorz und Cornelius Castoriadis auf, die einen gemeinsamen Nenner haben: dass das zunehmende Ausmaß der Wirtschaftstätigkeit unsere Fähigkeit zur Selbstverwaltung untergräbt.
Die Demokratisierung der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung in Richtung einer Ausweitung der Selbstverwaltung, d.h. die Befähigung aller, an den Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, teilzuhaben, ist daher ein wesentlicher Bestandteil von Degrowth. Wirtschaftsdemokratie ist nicht nur an sich erstrebenswert, sondern würde auch als Kraft gegen die sozial und ökologisch zerstörerischen Aktivitäten unserer Volkswirtschaften wirken. Die Einschränkung der Macht von Unternehmen, die Einführung einer demokratischen Kontrolle über Geld und Finanzen, die partizipative Aufstellung öffentlicher Haushalte und die demokratische Steuerung der Produktionskapazitäten sind allesamt Facetten einer Degrowth-Zukunft.
Die Frage der Gerechtigkeit
Die dritte und letzte Achse ist die Gerechtigkeit. Degrowth ist ein Projekt der Gerechtigkeit: Gerechtigkeit erfordert das Setzen von Grenzen, da die sozialen und ökologischen Kosten des Wachstums niemals gleichmäßig verteilt werden, weder innerhalb von Gesellschaften noch zwischen dem globalen Norden und Süden, wie die lange Geschichte der Kämpfe um Umweltgerechtigkeit zeigt. Aber Wachstum schafft nicht nur Ungerechtigkeit, es wird auch durch sie angetrieben.
Das ungleiche Verhältnis zwischen dem globalen Norden und dem Süden, das historisch begründet ist und gegenwärtig fortbesteht, ist die Grundlage des globalen kapitalistischen Systems, das auf endlosem Wirtschaftswachstum beruht. Es positioniert die Länder des Nordens und des Südens unterschiedlich innerhalb eines Weltsystems, in dem der Wohlstand und das Wachstum des Nordens von der Aneignung der Ressourcen des Südens abhängen. Die Beseitigung historischer und aktueller Ungerechtigkeiten ist daher von grundlegender Bedeutung für Degrowth – und hier verbinden sich Degrowther mit Debatten über ökologische Schulden, d.h. Diebstahl, Plünderung und unverhältnismäßige Nutzung von Ressourcen (und Senken), und ökologisch ungleichen Austausch, d.h. ungleiche Ströme von “verkörperter Natur” durch den globalen Handel.
Degrowth als konkrete Utopie bezeichnet sowohl ein (offenes) Imaginäres einer Zukunft als auch einen Weg der Transformation, der die Machtverhältnisse in einer Weise verschieben würde, die uns “in die beste Position versetzt, später mehr zu tun”: nicht-reformistische Reformen in der berühmten Formulierung von Andre Gorz. Der Raum der politischen Vorstellungskraft und des politischen Handelns, der sich in dieser Zeit der Krisen aufgetan hat, muss für einen umfassenderen institutionellen und politischen Wandel genutzt werden. Und zu diesem Zweck ist eine Degrowth-Politik, die in der Lage ist, eine breite Unterstützung zu mobilisieren, heute notwendiger denn je.
Anm.d.Red.: Dieser Text ist ein Beitrag zur “After Extractivism”-Textreihe der Berliner Gazette; die englischsprachige Version ist auf Mediapart verfügbar. Weitere Inhalte finden Sie auf der englischsprachigen “After Extractivism”-Website. Werfen Sie einen Blick darauf: https://after-extractivism.berlinergazette.de

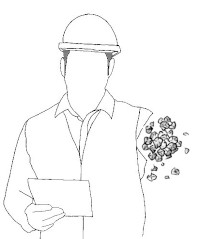

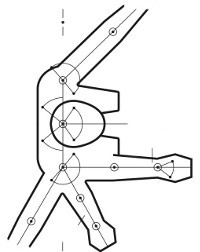


Noch keine Kommentare zu
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.