[Casa di Schulze, Amelia, vorderer Küchentisch.]
Es gibt hier im Ort, der kein Kino mehr hat, einen kleinen Filmclub, getragen von vierfünf Personen (früher hätte man „Honoratioren“ gesagt, allerdings besonders von einem noch jungen Mann vorangetrieben), und dieser Club, zu dem auch mein Übersetzerfreund gehört, zeigt einmal pro Woche entweder in der Pizzeria einen Film, die ohnedies eine Kernstelle intellektueller Kommunikation ist, oder aber im offenen Kreuzgang des kleinen Klosters, das heute ein städtisches Miniaturmuseum beherbergt. Dort auch, sonnabends, findet vormittags ein ökologischer Kleinmarkt statt, gestern mittags
Das ist mit einer tiefen Menschlichkeit inszeniert, nahezu alle handelnden Figuren sind bei Guédiguian nicht solche, sondern Personen, was sicherlich auch daran liegt, daß dieser Regisseur immer wieder, wie Faßbinder, Cassavetes und viele andere taten, mit denselben Schauspieler:innen arbeitet. Dabei erfüllt ihn eine utopische Sentimentalität, von der man meinen könnte, sie grenze an den Kitsch – etwas, demgegebenüber ich an sich scheue; und dem Freund ging es auch so: „Wenn solch ein Sozialdrama so mit Happy-end ausgeht“, sagte er, als wir die alten, von dem gelben Licht der an den Hauswänden angebrachten Laternen viertelserfüllten Gassen hinanstiegen, „dann sperre ich mich, weil das doch irgendwie verlogen ist.“ Da ging mir unversehens ein Satz über die Lippen, den ich so noch niemals ausgesprochen habe und auch nie hätte aussprechen wollen, jetzt aber sprach e r sich: „Aber es tut den Menschen gut.“
Darüber dachte ich nach, als ich vorhin früh mit meinem ersten Latte macchiato wieder in der braunrot-hölzernen Eingangstür auf den drei Stufen zum Cortile saß, meine Mrogenpfeife rauchend, daß es an diesem Sentimentalen etwas gibt, das wir Menschen brauchen, ganz egal, ob es der Realität entspricht. Ja, eine andere Realität könne nur werden, dachte ich, wenn wir diese Art Hoffnung nicht verlören. Sei es denn nicht genau das, was die Kirchen, noch immer und gegen jeden Geist, so mächtig mache? Ist es denn nicht so, daß uns der graue Realismus, seine geradezu fetischisierte Negativität der Verhältnisse imgrunde – schwächt, weil sie der realen Aussichslosigkeit noch die permanente Wiederholung einer imaginären hinzufügt? So daß, aber das sah bereits Ernst Bloch, sogar in manchem Kitsch mehr utopische Kraft steckt als in irgend einem Schauspiel Samuel Becketts. Was also ist vorzuziehen?
Ich denke noch immer darüber nach. Denn es hat Implikationen auch und gerade für die Ästhetik, also die Künste, für also auch meine eigene Arbeit. Um die ich mich langsam wieder kümmern muß.
Mehr, vielleicht, nachher noch. Weil ich im Moment zudem von meinem Schwanz getrieben bin; so gehen Nachrichten hin und her, die an stiller Raserei ihresgleichen suchten, wenn sie sich zugeben würden und nicht nur in die Tasten tippten, noch freilich, wie zu konzedieren. Doch weiß ich entschieden, wer ich sexuell b i n:
Jedenfalls, meiner cybertechnisch so losgelassenen inneren erotischen Rage halber, grummelte gestern nacht der Freund, als wir noch die kleine Feier hinter der Piazza besuchten und ich heimwollte, weil sie mir zu intim war – es beging eine ihm bekannte Frau ihren Geburtstag -, grummelte also, indem er dortblieb: „Du sitzt ja dann doch nur hinter dem Computer und tippst“. Momentlang Aufschuß eines schlechten Gewissens. Aber bin halt getrieben und aber begeistert von dieser Raserei— daß sie mich immer noch erreicht und beseelt. Ich nenne diesen Zustand deshalb
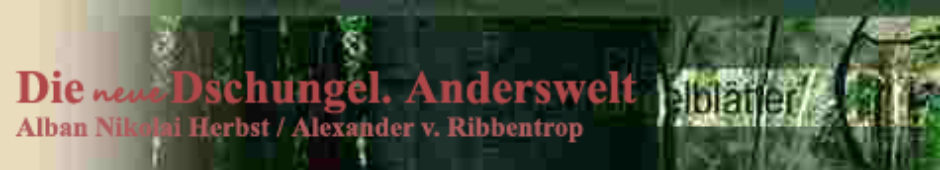






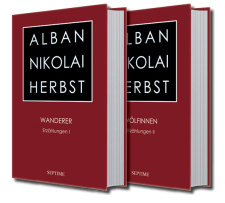

Das Prinzip Hoffnung oder „Aber es tut, … … den Menschen gut.“ ist wirklich ein Problem, lieber ANH. Ich hatte im Gegensatz dazu immer das „Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar.“ wie ein Schild vor mir her getragen. Dann war ich mal in Rocca die Papa, um die Luise Rinser zu interviewen. Und Luise Rinser hatte sich auf dieses Interview oder besser auf mich vorbereitet, indem sie meinen Roman „Kinder der Bosheit“ gelesen hatte. Sie erzählte mir das, nachdem wir mit dem Interview fertig waren. Und dann sagte sie: „Ich verstehe Sie und weiß genau, was Sie meinen. Aber meine Bitte wäre: Geben Sie doch den Menschen eine Chance.“ Dieser Satz hat mich damals sehr erschüttert. Denn sie hatte völlig recht.
Schön, dass Sie immer noch lottern dürfen. Es grüßt aus seinem Brasilienbuch PHG