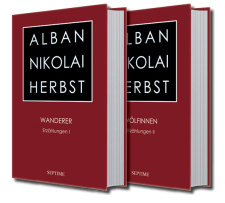7.25 Uhr. Krähenrufe.
Sich aufgrauender, imgrunde nachtgebliebener Himmel.
Innigste,
magst Du es glauben? Da hielt Dich gestern jemand >>>> nicht für real. Wie recht er hatte! Ich gab ihm klare Antwort. Überhaupt folgt in diesem Kommentarbaum ein Fuß, der wütend aufstößt, auf den anderen, womit sich die wieder einmal moralischen Angriffe auf mich inszenieren. Da dürftest Du gar nicht real sein, weil Du sonst mit diskriminiert würdest, obwohl Du mit meinem Mir gar nichts mehr zu tun hast. Und diese Kleinheit immer, wenn es um Sexualität geht, dieses klebrig Geheimlichhaltenwollen..! Schwanz, wirklich „Schwanz“ – als etwas Ordinäres! Es kreuzten sich Sprachebenen, ja du mei! (Vielleicht ist dieses grad das Geheimnis des Gedichts, daß sie es tun. Liegen wir beieinander, dann kreuzen wir uns und unsere, was sag ich?, Sphären wäre nun wirklich kitschig… also nein: „Flüsse“ vielleicht, reale und imaginäre und die der Gefühle.) – Dann legte der Zweifelnde nach und >>>> forderte „Erkennbarkeit“ ein, verlangte „Dokumente“. Und wie schon einmal, bei >>>> Verbeen, wurde ich der „Fälschung“ bezichtigt, und nachher immer mal wieder. Wissen die Menschen wirklich nicht, was das ist, Literatur?
Aber auch Du hast mir ja oft widersprochen, zärtlich aber, gewiß, also wissend. Das wird nun, ich dachte es gestern bereits, ein großes Problem dieser Briefe werden, daß sie nicht wirkliche Antwort bekommen, auf die ich meinerseits reagieren könnte. Deshalb sind schon sie tatsächlich Roman. Ich könnte solche Antworten selbstverständlich erfinden, wobei es sich verböte, auf Deine Briefe zurückzugreifen. Das ist das nächste Problem. Doch das Buch, das ich schreiben möchte, soll ja Briefroman gar nicht werden; diese Briefe nach Triest dienen deshalb nicht nur dazu, mich in eine andere hineinzuschreiben, als Du warst, sondern in einen anderen auch; es wird schließlich nicht m e i n Gefühl mehr sein, das sich im Buch entfaltet.
Ein schwieriger Prozeß, weil er eine Absage an die Realität ist. Eine Freundin schrieb mir gestern einen langen guten Brief. Darin hielt sie mir meine eigene Überzeugung entgegen, quasi, daß ich sie verriete: nämlich n i c h t mich zu beteiligen, an den, sagen wir, bürgerlichen Sublimationsprozessen. Ich verriete mich selbst: so interpretierte ich den Tenor. Der Brief war gegen Ende nicht mehr klar, so genau er zuvor analysierte. „Ach, ich drücke mich nicht aus, wie ich wollte“, schrieb sie auch selbst, diese Freundin.
Ich erwache und hebe mein Gesicht aus dem Hemdchen, Deinem, heb‘s aus Deinem Duft. Und mag gar nicht aufstehen, weil sie, die Nähe, bleibt im Träumen. Wer aufsteht, verläßt sie. Oft habe ich gedacht, wie glücklich Strafgefangene sein müssen, die endlich schlafen dürfen; daß es für sie in jeder Nacht Entkommen gibt. So leben sie hin durch jeden Tag, jahrzehntelang mitunter, auf jedes Tages Nacht. Gefängnisse sind, so betrachtet, ein realisierter Novalis.
Nun, ich bin ein Tagmensch, war es, härter, weicher: bin‘s vielleicht gewesen. Ich hebe mein Gesicht aus dem Duft und mag den Tag nicht mehr. Aber entsinne mich eines Films, Fersehfilms, glaub ich (ich seh gleich mal nach), mit Heinz Bennent – ah, da ist er: >>>> Nasrin oder Die Kunst zu träumen. Mit Evelyn Opela. Als ich ihn sah, war ich noch ein ganz junger Mensch, siebzehn Jahre alt. Das Stück hat mich ungemein beeinflußt. Einem Mann, so viel weiß ich noch, kommt die Frau abhanden; wie, weiß ich nicht mehr, Trennung oder Tod. Und nun fantasiert er sie sich so konkret, daß er nichts mehr tut, als mit ihr zusammenzusein. Er wird für die Realität dabei handlungsunfähig, irre, könnte man sagen und sagen auch die, die um ihn herum sind. In sich selbst aber ist alles da, die Frau, der Ort, die Luft. Was den Film, daran erinnere ich mich, so bemerkenswert machte, war, daß er aus der Sicht dieses Mannes gedreht worden ist. Die Filmrealität ist die seine und die faktische der Außenwelt eine Schimäre. Damals entschied ich, glaube ich, mich (und kann von „entscheiden“ nicht eigentlich schreiben) für die Phantastische Literatur.
Evelyn Opela allerdings, in meiner Erinnerung, kommt mir für eine Sìdhe zu grob vor, ihr Gesicht ist zu gemein, um für die Feinheit einzustehen, die Deine Züge haben. Nie sah ich solch eine Lippenkrone. Du weißt es, wie ich Dich wie ein Wunder ansah, das mir begegnet war, doch als unentwegtes Wunder, mir in die Augen gelegt, die wie Hände offenblieben. So sahst Du aber auch mich an. Nun, es hat nicht genügt. Aber im Roman soll‘s genügen. Ich stelle mir vor, wie viel Freiheit er verströmen wird. Ein Roman kann das tun, er ist nicht an Gründe gebunden.
Ich erhebe mich aus Deinem Duft, sehe zur Uhr, stelle fest, schon wieder zu spät für einen Arbeiter wie mich. Arbeiter: Daher habe ich meine Hände. Das sind keine Hände, sagtest Du, eines Intellektuellen. Nein, sagte ich, es sind Bauernhände. Wie gut, sagtest Du. (Hast Du‘s gesagt? Ist auch dieses bereits eine Erfindung? – Was war, was ist, was wird, schon geht es durcheinander.)
Ich erhebe mich aus Deinem Duft. Der Satz ist ganz konkret zu nehmen, darf im Buch nicht fehlen.
Gestern nacht, Du Nahste, versagte plötzlich mein DSL. „Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Telefonbuchse und EasyBox.“ Ich tat es mehrere Male. Eigentlich, früher, wäre ich da nervös geworden, hätte übers Ifönchen bei Vodafone angerufen, nachgefragt, mich nach links und rechts geärgert. Nun war das unversehens egal, ich ließ es laufen, gehen, vor sich hin versagen; mir war „Nasrin“ eingefallen. Als es noch darum ging, daß ich von der Mutter meines Sohnes vielleicht noch ein, so wünschte ich, Töchterchen bekäme (aber ein zweiter Junge wäre auch recht gewesen), habe ich den Namen als einen möglichen vorgeschlagen; sie mochte ihn nicht. So dominant bin ich, daß ich sofort nachgab. Es kam zu dem Kind doch auch nicht, zu keinem mehr. „Was willst du?! Du hast doch eins und w a s für eines!“ Und dennoch, dennoch. Dieses Sehnen. Ich wollte nur noch in den Duft. Was interessierte mich DSL? – Heute morgen funktionierte alles wieder. Ich hatte, als ich mich erhob aus dem Duft, ergeben, tatsächlich ergeben, gedacht, nun ja, ich hab ja noch den Stick. Und fing schon im Kopf diesen Brief an.
Ich rauche zu viel, viel zu viel. Und betrinke mich ständig, jeden Abend. Doch das muß Dich nicht sorgen: dagegen halte ich streng den Sport. Zwei Tage hintereinander hartes Kraft- und Konditionstraining, den dritten Tag anderthalb Stunden schwimmen: so der Rhythmus. Für alles, auf das es ankommt im Leben, ist unser Körper der Schlüssel. Auch Du, wenn Du unglücklich bist, läufst Kilometer um Kilometer. So die Löwin, die ebenfalls furchtbar unglücklich ist. Gestern nacht versuchte ich, sie zu fangen. Und bin, für mich das fast Erstaunlichste, komplett asexuell; hab gestern durch Pornos, einigermaßen harte, gesurft. Es wollte sich nichts tun. Wenn ich wollte, höchstens zwei Anrufe genügten, hätte ich Frauen hier. Auch diesbezüglich bin ich ja privilegiert. Aber mein Schwanz mag nicht, ennuyé, was einen Überdruß meint, an dessen Grund Vergeblichkeit liegt. In Nasrin dringt nur ein, wer selbst die Hand an sich legt. Ich meine den Schwanz. Manchmal denke ich, er erigiert nicht mehr, weil es kein Kind mehr geben wird. Diese Tür, zu ihm hinein, hat sich geschlossen. Da brauche ich Sexualität nicht mehr, fast ein bißchen höhnisch hat sich Frau Venus abgewendet, durchaus mit Verachtung. Also das Luftgespinst der Nasrin.
Tatsächlich, auch darüber denke ich ständig nach, ist letztlich selbst der Eros, nicht nur die pure Sexualität, für mich mit Fortpflanzung assoziiert, tatsächlich scheine ich da nicht trennen zu können. „Dass keine Frau deine werden kann, die nicht Mutter deines Kindes ist. Nicht s o. Dahin hast Du das Mythische gewandelt und ihm so ein Leben gegeben.“ Das schrieb mir die Freundin gestern auch. Ich fürchte, daß sie recht hat.
Wozu dann noch, aber, meine Achtung vor dem Körper, mein um ihn Besorgtsein?
Ich weiß es nicht. Autoerotik ist nicht die Antwort, selbst dann nicht, wenn zurecht die Löwin sagte: „Männer irren sich, wenn sie meinen, es spiele irgend eine Rolle, wie sie aussehen. Wir Frauen lieben, wenn wir es tun, ganz unabhängig davon.“ Was die exemplarische Häßlichkeit der großen Liebhaber erklärt, D‘Annunzios etwa, auch Casanovas: sie spielt keine Rolle. Ich müßte mich also nicht mühen. Wozu mühe ich mich? Eitelkeit, ja, galoppierende, meinetwegen; doch für wen?
Vielleicht, weil ein Etwas in mir nach wie vor nicht aufgeben will. Weil ich keiner bin – das Etwas in mir keines ist – , das sich jemals ergeben wird. Es müßte denn eine Krankheit kommen. Dann würde ich über den Tod nachdenken.
Ich denke aber auch jetzt über ihn nach, wieder, obwohl der Sterberoman schon geschrieben. Was wäre sein organischer Zeitpunkt? Wenn ich nicht mehr zeugen könnte. Keine Sorge, bitte. Ich habe einen Sohn, da verbietet sich ein Freitod ganz von alleine. Und es sind noch Bücher zu schreiben, auch das steht geradezu autoritär dagegen – ich meine, mit großer, vollkommen unsentimentalerm geradezu gegebener Autorität.Zarte, warum, wem, Du in mich hinein Verwunschene, schreibe ich das? So öffentlich zumal? – Ich schreibe an die Möglichkeiten. Bin ich‘s denn, der schreibt? Sicher ist nur, daß Lenz kein junger Mann mehr sein kann. Er sollte sogar ein bißchen zynisch sein, sagen wir, abgeklärt, distanziert. Wenn ihn die Erleuchtung mit aller Gewalt überfällt, ihn restlos aus seiner gesicherten Bahn wirft. Was ihn auszeichnen wird, ist, daß er das zuläßt, sich – vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben – n i c h t sichert, indem er eben nicht dem status quo den Vorrang für seine Entscheidungen gibt. Damit der Roman nicht kitschig wird, muß er, Lenz, daran scheitern. Aber die Art seines Scheiterns, der Weg dahin, muß von einer solchen Lust prall sein, einem Begehren und Erhalten und einer Bereitschaft, sich zu opfern, sich und alles um ihn herum, daß es das Scheitern weit übertrifft. Einfach weiterzuleben wie bisher, muß ihm noch im Moment des Scheiterns, wenn das Beil fällt und uns sein Kopf, dessen Mund aber noch spricht, vor die Füße rollt, zu karg vorkommen, zu öde, zu dörr, als nicht sogar dieses, das Scheitern, vollständig zu bejahen: Ich habe gelebt!Ein Hohelied gegen das Reale, Vernünftige, Pragmatische. Und die Lydierin scheibt ihm: „Du minnst um mich“ – was nach herkömmlicher Meinung, nicht nach tatsächlichem Geschehen den Verzicht schon einschließt. Auch davon haben wir gesprochen. Du kennst das Bild, Türmerin und Sänger, und sie zieht ihn rapunzelrapunzel hoch. Tatest Du nicht. Doch sie wird es tun: im Roman.
Ich könnte ihn, Lenz, einen Banker sein, das hätte Witz, gewesen sein lassen, schließlich, und die Frau überstrahlt jede Zahl. Alles gibt er auf, die gesamte Karriere, für sie. Fällt. Fällt immer tiefer. Aber sie, sie i s t ihm. Es kommt auf andres nicht an. Und das wichtigste fast: Sie bekommen ein Kind. Ich kenne mich aus im Bankerwesen, Wesen des Brokers, war schließlich selber mal einer. Das, lacht auf, „Brokerwesen“. Oswald Kolle fällt mir ein. – Der Lydierin reicht ein einziger Blick, um es ganz vom Tisch zu wischen. Es zerstäubt, zerrieselt unter ihrem Blick. Dies wär die Utopie. Jedenfalls darf er kein Künstler sein, überhaupt kein, was für ein Wort!, Schöngeist. Sondern Pragmatiker, als solcher, notwendigerweise, Ironiker, wenn es um Seele geht. Nur die Fakten zählen. Und zählen nach dem ersten Blick n i c h t mehr. Werden n i e mehr zählen. Die beiden leben >>>> in Lydien fortan, nicht mit „b“, nein, das „d“ steht da schon richtig. Vielleicht beginnt auch alles mit einer Reise dorthin; er muß einen Kunden besuchen, dessen, sagen wir, Sekretärin den Raum betritt, stehenbleibt, ihn ansieht, und er sieht sie an. Und begreift. Alles, was war, fällt von ihm ab.
Es könnte komplizierter sein: Lenz ist verheiratet, seit Jahren. Da fällt auch seine Ehe von ihm ab. In der Realität wird es dann unschön; meine Bücher haben noch nie zu einfachen Lösungen tendiert. Er will auch erst, der Broker in ihm, nur eine Affaire, nebenher, wie er schon zahllose hatte. Immer, wenn er Fremdheit brauchte, also sein Schwanz. Das läßt die Lydierin aber nicht zu. Und imgrunde weiß er es selbst, vom ersten Anblick an. Die Frau muß gar nichts sagen. Ihre pure Existenz – daß sie ist –, läßt es nicht zu. Also ist er verloren. Keine seiner Lebens-, sagen wir,-techniken funktioniert mehr. Alles ausgehebelt, niedergeschmirgelt. Er wird in seiner Alltagspraxiswelt zum Störfall.
Leidenschaft, nicht aber sexuelle Obsession. Das wird diesen Roman von >>>> Meere unterscheiden. Der Mann wird geradezu, was Fichte nie war, wieder jugendlich: liebt als Jugendlicher wieder. So, Hohe Frau, stell ich‘s mir vor. Und daß ihn, mich, heute eine SMS erreicht: „Lust, auf dem Karst spazierenzugehen? Ich hätte morgen Zeit, so gegen 15 Uhr.“ Oder ein kleines Café in der Via San Michele. Gibt es da eines? Weiß ich nicht mehr, doch kann nachschaun. Du weißt es besser, lebst schließlich dort. Wo sie abermals nichts anderes tun werden als sich anzusehn. Gut, sie trinken, aber nur aus Rücksicht auf den Padrone, Tee und Kaffee. Gehn dann wieder auseinander. Er fliegt sogar eigens hin, aus Berlin oder von wo immer er lebt. Und beide wissen.
So erhob ich mich aus dem Duft meiner >>>> Almapuppe. Wußtest Du, daß er, Kokoschka, sie sogar in Fiaker gesetzt hat und ganz durch Wien kutschieren ließ, sogar mehrmals? Man kann ihn deshalb einen kleinen Mann kaum nennen. Ich lege Dir von dieser Puppe ein Bild Kokoschkas bei. Die m e i n e wird der Roman sein. Das erspart mir den kläglichen, entsetzlich trockenen Versuch, mit ihr zu schlafen. Für Ersatzobjekte taugen Romane nicht wirklich, zumal ich darin nicht meine und also nicht unsre Geschichte erzähle. Die ist das Treibmittel nur. Das schönste Lied auf >>>> Mathilde Wesendonck ist so betitelt, „Im Treibhaus“. Tristans Kernzelle, Isoldes Urbild (König Marke ist Frau Wesendoncks Mann, pikanter- und schlimmerweise Wagners Mäzen). Es hat also hier seinen Grund, ausgerechnet auf sie, die Wesendonck, zu kommen. Du kennst ihn.
Alban
P.S.: Es ist geschickt, kommt mir jedenfalls (noch?) so vor, daß er, nicht sie verheiratet ist. Aber natürlich hat sie schon einen Partner, als sie ihn trifft. Eine Frau wie die Lydierin ist selbstverständlich nicht allein. Das ergibt sich notwendigerweise, denn b e i d e sind nicht mehr zwanzig. Dennoch muß er sehr viel älter als sie sein. Sonst wäre, wie sein Leben zerbricht, zu marginal.
(17.46 Uhr.
Espresso.)
Für mich steht dahinter eine, allerdings sehr menschliche, Ergebung; wozu paßt, daß diese Freundin gläubig ist. Ich bin das nicht oder in völlig anderem, eben heidnischem Sinn..„Ich sehe Sie als Mutter“, hat mir Amélie gesagt, meine kluge Prostituiertenfreundin, mit der ich nachher, um neun, wieder essen gehen werde, um Neues aus dem Bordell zu erfahren. So asexuell, Sìdhe, wie ich derzeit bin, werde ich mich als Ratgeber besonders gut eignen in meiner kompletten Vorurteilslosigkeit. Zum „Augleich“ gibt es Fisch, beim von mir so genannten Maghrebiner. (Lach nicht, Sìdhe! Er ist zwar Türke in Wahrheit, aber ich schrieb schon in einem vorherigen PP, bei noch keinem Mann derart sinnliche Hände gesehen zu haben; das krieg ich halt besser mit Nordafrika zusammen. Die meinen sind Schaufeln für Kohle dagegen, allenfalls für Torf; aber den sticht man und braucht darum Spaten.) Noch sei mir, so seinerzeit die Freundin über die >>>> Sizilische Reise, der Umgang mit den Müttern verwehrt geblieben. Das mag sich jetzt geändert haben. Morgen werde ich darauf eingehen, denn was ich d o ch geschafft habe heute, war, bereits den Anfang der dritten Briefes zu skizzieren.
Und jetzt an die Schändung der Lukretia; da warst Du bei mir, und beide haben wir nachher den Kopf geschüttelt, fast ein bißchen verärgert. Vielleicht habe ich deshalb solche Schwierigkeiten mit der Kritik, also sie zu schreiben, weil das, dem sie gilt, geschah, als es noch Uns gab. Ich müßte mich erinnern, nun an Verlorenheit – was ich des Romanes wegen nicht will. Denn in der Tat, liebe Freundin, davon, vom Werk, laß ich nicht ab. Es gilt, eine Welt zu erschaffen, nicht, sich in sie einzufügen, wie sie ist.