Das ist auch nötig, sonst wäre das Stück, gerade als ein modernes, unerträglich. Imgrunde ist ausschließlich sie, die Musik, der Grund für den unterdessen Welterfolg dieser Oper; die Handlung selbst ist aus heutiger, jedenfalls meiner Sicht Schmonzette, ja schon Eifersucht selbst, wenn in Mord und Totschlag ausartend, nichts als lächerlich – doch, so gesehen, in einem psychiatrischen Sinn, tatsächlich tragisch. Insofern wäre um so weniger klar, wieso hier „Allgemeinmenschliches“ verhandelt werde, bräche nicht >>>> Flimms Inszenierung das Phänomen auf grundsätzliches Begehren und sein Scheitern herunter, in diesem Fall auf die frühkindliche Sehnsucht nach heiler Identität und Verschmelzung mit einem/r anderen, also auf in uns allen latent weiterwirkende Sehnsüchte der unmittelbaren Zeit nach der Geburt.
Genau dieser Sehnsüchte nämlich versichert sich das Paar in den ersten beiden Szenen, und zwar als bleibend erfüllte. Doch in der Gestalt des Dieners, der zu seiner Herrin in heimlicher Liebe entbrannt ist, bekommt die Illusion schon Risse – erst recht aber, als ein Gast das Haus betritt, der die Malaspina nur anzusehen braucht, und sie sieht ihn an, um in das feste Ehegefüge ein Außen erst einsickern, dann -strömen zu lassen. Die Frau mag sich anfangs noch wehren („zieren“ hätte man heute gesagt; siehe dazu mal >>>> die aktuelle Neufassung des § StGB); schließlich wird sie von ihrem unmittelbaren Begehren d o c h überwältigt. Wobei der Gast sie durchaus, mit Worten und Gesten freilich, verführt:
Er muß also nur eintreten, der Gast, und die hintere Wand des Salons bekommt einen riesig klaffenden Riß – und zwar dort, wo die Tür ins Schlafzimmer führt – ein im zweiten Akt gerade auch in der Ausführung bühnenbildnerisch mitreißender Einfall Annette Murschetz‘, den ich hier nicht verraten möchte. Es ist ein Effekt ganz großer Theaterzauberkunst. Sie müssen ihn einfach selber sehen.
Jedenfalls ist der Diener nun derart eifersüchtig, daß er die Liebenden beim Herrn verpetzt. Der mit quasi derselben Unerbittlichkeit sofort die Konsequenzen zieht, die schon die Vorstellung einer unantastbaren Einheit zu zweit bestimmt. Imgrunde handelt es sich um die Imagination des Säuglings, eines mit der Mutter zu sein – als hätte die Geburt und also eine Trennung von ihr gar nicht stattgefunden; sprich: es ist niemals zur Reifung, geschweige denn der schließlich erwachsenen Individuation gekommen. Dem entspricht bei Sciarinno der Ohnmachtsanfall Il Malespinas, mit dem er auf seine sich am Dorn gestochene Frau reagiert, auf kaum ein Blutströpfchen also. So ist seine krankhafte Eifersucht nicht etwa Ausdruck der Überführung von Beziehungsstrukuren in Eigentumsverhältnisse („meine“ Frau, „mein“ Mann), sondern eben der einer schwer gestörten Persönlichkeitsentwicklung.
Genau so agiert Sciarrinos Musik: Sie bleibt in der ständig ungefähren Wahrnehmung, liegt wie ein unbewußter Teppich unter den Geschehen – was ihr etwas ungemein sowohl Bedrohliches als eben auch Heimatliches, Gebärmutterartiges gibt. Dem läßt es sich bei aller Hysterie der Szene nicht entziehen – zumal dann nicht, wenn Sciarrino überdies zum Zitat greift, das etwas Verlorenes anruft – bzw. ruft das Verlorene, Vergangene zu uns – : die harmonische Tonalität einer madrigalhaften Elegie >>>> Claude Le Jeunes Sie leitet die Oper sogar ein, wird zwar danach zunehmend verfremdet, doch bleibt im Ohr permanent zugegen. Dabei verblaßt der Elegientext gleichsam, der anfangs „heil“ die Bühne überschrieb, und zwar in doppelter Projektion. Er zersetzt sich in Versfragmente, und eine Figurierung La Malespinas zu Anfang der siebten Szene zeigt die Frau in geradezu derselben Haltung, wie wir sie ganz am Beginn sahen:
Daß nach den Morden Il Malaspina freilich nicht erlöst ist, sondern erst recht verdammt, erklärt sich aus dem symbolischen Muttermord; die Trennung ist zementiert, das Kind bleibt einsam zurück. „Lebt wohl, lebt wohl“, ruft er ganz am Ende, „ich werde auf ewig in Qualen leben!“ Die Reifung wird über den Tod hinaus verweigert.
Dabei ist hochinteressant, daß die Figur Il Malaspinas erst mit dem Mordentschluß überhaupt Kontur gewinnt; ein erstes Anzeichen von Reifung, das die Tat selbst wieder durchstreicht. Zuvor war der Mann ein so winselndes Etwas, daß mir leicht widerlich zumute war; doch ließ sich eben genau deshalb begreifen, daß seine Frau schon beim Erscheinen des Gastes, ihres nachherigen Liebhabers, völlig von ihm berückt wird: kein Kind nämlich, sondern ein Mann mit eigenem Willen trat ihr gegenüber. Da konnte sie gar nicht anders, als sich ihm hinzugeben. Sich auf diese Liebschaft einzulassen, ist der Beginn ihrer eigenen Reifung; mit anderen Worten: Die Mutter anerkennt die Trennung vom Kind.
Witzig ist daran, daß Sciarrino die Rolle des Liebhabers mit einem Counter besetzt hat, was für die „eigentliche“ Zeit der Handlung, dem späten 17. Jahrhundert, – vor allem in der weltlichen Oper >>>> gefeierter Usus war. Von heute aus betrachtet, wäre ein Kastrat aber eben einer, der sich als Liebhaber gar nicht eignet; insofern wäre auch hier Vergeblichkeit im Blick. Allerdings haben Regisseur Jürgen Flimm und Dirigent David Robert Coleman den Gast als Hosenrolle besetzt, hinreißend von Lena Haselmann gestaltet, einem Bilderbuch->>>>Octavian. Mag jedenfalls sein, daß nicht nur besetzungspraktische Gründe zu dieser Inszenierungsentscheidung geführt haben.
Man kann darüber streiten, ob es szenisch nicht überinterpretiert ist oder Eulen nach Athen getragen, wenn Il Malespina im zweiten Akt als Racheengel erscheint, tatsächlich mit dunklen Schwingen:

LUCI MIE TRADITRICI
Oper in zwei Akten
Libretto von Salvatore Sciarrino
nach dem Drama Il tradimento per l‘onore von Giacinto Andrea Cicognini
Inszenierung Jürgen Flimm Bühnenbild Annette Murschetz Kostüme Birgit Wentsch
Licht Irene Selka Dramaturgie Detlef Giese
Katharina Kammerloher, Otto Katzameier, Lena Haselmann, Christian Oldenburg
Staatskapelle Berlin
David Robert Coleman
__________________
Die nächsten Aufführungen:
13., 15. und 16. Juli 2016, jeweils um 19.30 Uhr
>>>> Karten









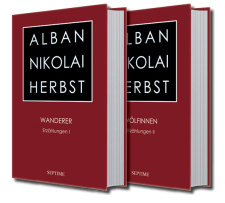

Sehr schön und detailgenau angesehen!
Ich fand allerdings, die doch arg ehehöllen-psychologisierende, m.E. vordergründige Regie von Flimm entzaubert etwas Sciarrinos Musik, die immer wie hinter einem Vorhang ist. Die Stimmen bzw das, was aus ihnen wird, sind ja das Zentrum von Sciarrinos Musik. Aber auf der Bühne wirkt es, als wären es klassische Dialoge und nicht mikroskopische Sprachgesten und bizarre Arabesken, die den Körpern der Figuren entfleuchen. Die schwarzen Flügel fand ich ehrlich gesagt indiskutabel.
Haben Sie vor 1 oder 2 Jahren Sciarrinos Lohengrin in der Werkstatt der SO gesehen? (Und übrigens musste ich auch an Klaus Florian Vogt mit weißen Flügeln im Wagner-Lohengrin an der Deutschen Oper denken; kuriose Querbezüge, die irgendwie in die Sackgasse führen.)
Wunderbar diese Zwischenspiele, dieser sich auflösende Ohrwurm von Le Jeune.
@Albrecht Selge. Ich stimme prinzipiell zu; dennoch meine ich, daß Flimm etwas Theatralisches herausholt, das der Bühne Bühne gibt – besonders wenn man es mit >>>> Rebecca Horns „Regie“ von vor rund sechs Jahren an der Volksbühne vergleicht.
[Hier auch noch der Link auf >>>>eine sehr detaillierte Dschungelkritik von Bernd Leukert aus dem Jahr 2011 (Schwetzingen und Oper Frankfurt).]