Dreimal der Greisin begegnet, die oft durch die Gassen schlurft, über den Platz, sich auch mal hinsetzt in die Sonne. “Die Sonne scheint.” sagte sie, als ich zum Auto ging. Setzte sich in die Sonne und schaute mir beim Manövrieren zu. Daß die Sonne scheine, sagte ich auch zur Tabaccaia, als sie sich die Hand vor den Kopf schlug, weil sie vergessen, außer den panisch gesuchten Geldscheinen zum Wechseln, die sie sich aus ihrem eigenen Portemonnaie fischen mußte, wobei sie ständig im Kopf rechnete, auch noch die Wechselmünzen hinzulegen. “La testa!”
Gestern hatte ich mehr Gedanken als heute. So eine Art Abendsterne vor einem noch kobaltblauen Himmel kurz vor der Düsternis. Sah auch einen, als ich neulich am Fenster stand mit dem Telefonhörer in der Hand. Man muß immer irgendwo hinschauen oder hin und her gehen, wenn man einen Telefonhörer in der Hand hat, um auch beschreiben zu können, was man sieht, weil das Hören der anderen Stimme, die plötzlich lebendig geworden, immer auch ein “Wegholen” ist. Darum schaute ich gebannt auf den einen Abendstern. Auch wenn der unbestimmte Artikel unangebracht ist. Es ist ja immer derselbe. Auch liegen genug weiße Zettel herum, um etwas darauf zu notieren.
Auf dieselbe Weise begegnete ich dem Mond: heute ein Mond, gestern ein Mond. Und je mehr ich zurückgehe in der Zeit, desto voller wird er. Wie ja auch die vergangenen Tage voll gewesen sind. Gestern ging die Konzentration bis an den Rand ihrer Möglichkeiten. Vorgestern erreichte die Kommunikation den Rand ihrer Möglichkeiten. Nämlich den Rand der Welt, in der einer aufgehoben. So am Ende die Empfindung. Nachdem ich am Morgen noch die Schultern gezuckt wegen der neuen Quersumme der Jahre, die lautlich einem “Nein” sehr nahe stand. Auch das steht auf keinem Zettel.
Tullias Besuch von vorvorgestern (ihr Sohn wahr dabei) kommt mir in den Sinn. Ob ich eine Putzfrau brauche. “Theoretisch ja.” Antwortete ich. Und sie fing an, ihre Tochter wegen ihres Ordnungssinns zu loben, und daß sie ja doch mal anfangen könne, sich etwas dazu zu verdienen. Was ich sehr merkwürdig fand. Nie könnte ich mir die noch nicht mal erwachsene Tochter als Putzfrau vorstellen. Die solle lieber schreiben, meinte ich. Denn neulich las ich einen feurigen Text von ihr, der ein Plädoyer für die Jugend gewesen.
Und so kommt die Greisin zum Mädchen, ganz ungewollt:
Wie es mir mit der Unsterblichkeit ergeht, so ergeht es mir mit der Ehe: Ich brauche sie augenblicklich nicht, aber der Tag wird kommen – falls ich alt werde -, da ich sie brauchen werde, und ich will mich nicht der Gefahr aussetzen, dass ich in dem Alter, da ich unsterblich sein will, ohne die Liebe einer Frau dastehe, so dass ich mich in ein Mädchen – oder eine Greisin – verlieben müsste, die die Ruhe gefährden würde, die mir in meinen letzten Tagen wohl bliebe. >>>> Pujols, Der Herbst in Barcelona
Es stimmt, daß ich sie augenblicklich nicht brauche, aber nicht, daß ich sie brauchen werde. (Und dauernd ist auch vom Tibidabo in Barcelona die Rede, ich aber wohne auf dem Tibidedi). Außer dem Mädchen und der Greisin stimmt nichts an dem Satz. Denn beide sind Chimären des Neunerquersummenklubs. Ich könnte dem Erzähler höchstens darin zustimmen, daß es ganz hübsch ist, über Selbstmord nachzudenken. Aber weil es so hübsch ist, daran zu denken, sollte man es nicht tun. Es sei denn, man tut es, um es hinterher (!) zu beschreiben, wie in diesem bzw. jenem Text. Man lese ansonsten Montaigne zu diesen Thematiken.
Meta
VERLAGE
NEU ERSCHIENEN
LESUNGEN & AUFTRITTE
Sämtliche Auftritte coronahalber abgesagt. Aus demselben Grund können auch zeitlich ferne momentan nicht geplant, geschweige vereinbart werden.
NETZ & RUNDFUNK
Unter dem Schleier
Gutenbergs Welt, 2. Januar 2021
>>>> Podcast***
DER GANZE HYPERION

Gelesen zu Hölderlins 250. Geburtstag am 20. März 2020 für >>>> dort.
>>>> Tonfile (Rezitation ANH)***
WDR3, Büchermarkt, >>>> Podcast
ANH über Dorothea Dieckmann, KirschenzeitNeueste Kommentare
- Alban Nikolai Herbst bei
In den Zeiten Covid-19s
Alban Nikolai Herbst spricht
Ein Gedicht für jeden Tag
Erste Serie, dritter Tag:
Dem nahsten Orient
|| „Deinem Nacken“ || - Bruno Lampe bei
In den Zeiten Covid-19s
Alban Nikolai Herbst spricht
Ein Gedicht für jeden Tag
Erste Serie, dritter Tag:
Dem nahsten Orient
|| „Deinem Nacken“ || - Alban Nikolai Herbst bei
In den Zeiten Covid-19s
Alban Nikolai Herbst spricht
Ein Gedicht für jeden Tag
Erste Serie, zweiter Tag:
Dem nahsten Orient
|| „da hobst Du den Arm“ || - Bruno Lampe bei
In den Zeiten Covid-19s
Alban Nikolai Herbst spricht
Ein Gedicht für jeden Tag
Erste Serie, zweiter Tag:
Dem nahsten Orient
|| „da hobst Du den Arm“ || - Phyllis bei Wiederaufnahme des Krafttrainings (Sling)
- Alban Nikolai Herbst bei
In den Zeiten Covid-19s
Alban Nikolai Herbst spricht
Ein Gedicht für jeden Tag
Erste Serie, erster Tag:
Dem nahsten Orient
|| „hab dein“ || - Bruno Lampe bei
In den Zeiten Covid-19s
Alban Nikolai Herbst spricht
Ein Gedicht für jeden Tag
Erste Serie, erster Tag:
Dem nahsten Orient
|| „hab dein“ || - schwarz armatur bei Welch eine schöne alte Sprache in neuem Gewand! (Lederstrumpf II).
- Alban Nikolai Herbst bei Dem Sohn. (Entwurf).
- Werner K. Bliß bei Dem Sohn. (Entwurf).
- Reni Ina von Stieglitz bei … und welch ein Glück! (Fünfunddreißigstes Coronajournal)
- Alban Nikolai Herbst bei
-
Neueste Beiträge
-
In den Zeiten Covid-19s
Alban Nikolai Herbst spricht
Ein Gedicht für jeden Tag
Erste Serie, dritter Tag:
Dem nahsten Orient
|| „Deinem Nacken“ || -
In den Zeiten Covid-19s
Alban Nikolai Herbst spricht
Ein Gedicht für jeden Tag
Erste Serie, zweiter Tag:
Dem nahsten Orient
|| „da hobst Du den Arm“ || -
In den Zeiten Covid-19s
Alban Nikolai Herbst spricht
Ein Gedicht für jeden Tag
Erste Serie, erster Tag:
Dem nahsten Orient
|| „hab dein“ || - Wiederaufnahme des Krafttrainings (Sling)
- ANHs Traumschiff.
- Rückwerdenssmiley (Entwurf)
- Seirēn | Exposé eines Kammeropernlibrettos
- Dem Sohn. (Entwurf).
- … und welch ein Glück! (Fünfunddreißigstes Coronajournal)
- Welch eine schöne alte Sprache in neuem Gewand! (Lederstrumpf II).
- Paella
-
ANH
„Windows on the World“
Eine Nostalgie
In New York, Manhattan Roman
Aus der Neubearbeitung (Dezember/Januar 2020/21) -
ANH
„Unter dem Schleier“
Eine Ergreifung
-
KAPITEL
- AlltagsMythen
- Altblog
- AltesEuropa
- ANDERSWELT
- ANTI-HERBST
- Arbeitsjournal
- AUFUNDNIEDERGÄNGE
- BambergerElegien
- BEAT
- Brüste-der-Béart
- BUCHMESSEN
- Buchverbot
- CAMP
- ChamberMusic
- Chats
- Collagen
- DATHSÄTZE
- DieKorrumpel
- DieReise
- Dirnfellner
- DISTICHEN
- DSCHUNGELBLÄTTER
- DSCHUNGELBUCH
- DTs
- Elymus repens
- Entwuerfe
- Essays
- evolution
- Filme
- FORTSETZUNGSROMAN
- FrauenundMaenner
- Friedrich
- G U R R E
- Gedichte
- Geschichten
- GIACOMO.JOYCE
- GLAEUBIGER
- Hauptseite
- HOERSTUECKE
- InNewYorkManhattanRoman
- JedenTagGedicht
- Konzerte
- Korrespondenzen
- KREBSTAGEBUCH
- Krieg
- Kulturtheorie
- KULTURTHEORIEderGESCHLECHTER
- KYBERREALISM
- LexikonDerPoetik
- Links
- Litblog-THEORIE
- LOYOLA
- lyrics
- MEERE, Letzte Fassung.
- melville
- MusikDesTagesFuerEB
- MW, Roman
- Nabokov lesen
- Netzfunde
- NOTATE
- Oper
- Paralipomena
- Pasolinimitschrift
- Peter Hacks Nachlaß
- POETIK-DOZENTUR-2007
- POETIKzurMUSIK
- Polemiken
- PRÄGUNGEN
- PROJEKTE
- PruniersRomanDeManhattan
- Reden-Laudationes
- Reisen
- Rezensionen
- Rezitation|Lesung
- Rueckbauten
- SchlechtesteGedichte
- Schule
- SieSindReaktionär
- Sprache
- Tagebuch
- Texte
- Trainingsprotokolle
- Traumprotokolle
- TRAUMSCHIFF
- Travestien
- UEBERSETZUNGEN
- Unkategorisiert
- Unveröffentlicht
- VERANSTALTUNGEN
- Veröffentlichungen
- Videos
- W E R K S T A T T
- Zitate
Stats





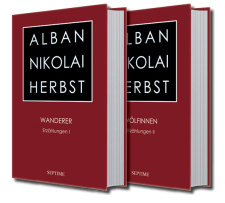

1 Eher doch das Gegenteil der Null – also weit, weiter entfernt als von der 1 sogar die Unendlichkeit.
dennoch besteht diese welt hier aus lauter ja- und nein-sequenzen, sofern man sie als einen binärcode betrachten wollte, der vielleicht unendlichkeit mit unvorstellbarkeit verwechselt.
Die Welt @Lampe als Module steht aber durchaus infrage.
Das Problem ist, daß Unendlichkeit nur als Abstraktum unvorstellbar ist, nicht in der Konkretion. Jede Zahl nach der vorherigen ist durchaus vorstellbar, und zwar als klar definierte (kohärente) Menge von Teilen. Ähnliches gilt von der Teilbarkeit. Unvorstellbar ist viel eher, daß über etwas nichts mehr hinausgehe und/oder daß es etwas gebe, daß das Kleinste sei. Teilbarkeit ist ein Konkretum, Unteilbarkeit abstrakt.
dennoch suggerierte die 1 und die erwähnung der null solche module. ihr geschaltetsein. die einzig vorstellbare unendlichkeit ist für mich die jeweilige gegenwart, die sich aber nicht als abstraktum begreift, sondern als kontinuum. und meinetwegen als perpetuum mobile. außer der teilbarkeit, deren begrifflicheit ich in diesem zusammenhang nicht verstehe, da zwischen null und eins keine teilbarkeit besteht, wäre noch mit-teilbarkeit immer ein erwünschtes konkretum. das kleinste aber hat immer noch ein kleineres. und so entwischt der komparativ dem superlativ.
„so“ @Lampe „entwischt“. Das meinte ich. Aber, wie uns die Wörter narren, „zwischen Null und Eins“ besteht sehr wohl eine Teilbarkeit. 1/2 liegt dazwischen und ist teilbar, ebenso 1/4 …. 1/1.000.000 usf. Freilich die Null-selbst ist nicht teilbar – teilen wir sie, bleibt es bei der Null. Hingegen ist durch Null nicht teilar. Aber dies ist eine Definition, die aus dem Umstand herrührt, daß Null-selbst eine Definition ist. Mithin sie ist reinabstrakt. (Weshalb Divisionen durch Null nicht möglich sind, denn sie ererzeugen sich logisch widersprechende Ergebnisse, ist sehr schön >>>> dort erklärt.)
Nota: Die Empfindung eines Kontinuums ist kein Kontinuum, sondern eben die Empfindung eines solchen. Das Wort Kontinuum wird metaphorisch.