Vergangenheiten, Liebste, die sich gleich
sonnabendspätnachmittags: 17.18 Uhr,
Allan Pettersson, Siebte Sinfonie,
Ich hatte Dir, als Du bei mir warst, diese Musik vorspielen wollen. Aber wir kamen nicht dazu. Jetzt werde ich sie Dir von meinem Plattenspieler in eine Tondatei einspielen und in die Dropbox tun. Ich könnte es mir leichter machen und eine der flac- und/oder mp3-Dateien von meiner Musikfestplatte nehmen, aber die haben bei weitem nicht den Frequenzgang; es ist mir wichtig, daß Du die Details hörst und sich in Deiner Elbenburg die gesamte Dynamik entfaltet. Petterssons Siebte gehört zu meinen absoluten Lieblingssinfonien, in ihren Härten wie ihrer Schönheit, und in ihrem Beharren, das, so fühlte ich schon, als ich das Stück zum ersten Mal hörte, ein Bruder meines eigenen ist. Jedesmal wieder, wende ich mich dieser Musik zu, beginnt mein Herz zu rasen. Seit nun über zwanzig Jahren hat sie für mich nicht an Wirkung verloren, eher noch gewonnen. Die Tragik, von der sie singt, und die Hoffnung dennoch, s t e i g e n mit dem Alter und seinen Vergangenheitsnebeln, zu denen auch mein Leben zunehmend wird, steigen in es auf.
Keiner, wirklich keiner der berühmten Dirigenten unserer Tage hat sich Petterssons jemals angenommen, weder Rattle noch Barenboim, nicht Gielen, nicht, als er noch lebte, Solti, weder Abbado noch Maazel, nicht Mehta, um nur ein paar mögliche zu nennen; diese große Musik ist eine Angelegenheit der zweiten und dritten Reihe geblieben. Dabei gibt es durchaus begründete Stimmen, die Pettersson den wichtigsten Sinfoniker nach Gustav Mahler nennen. Aber der Mann war zu schwierig, zu querköpfig und stand vor allem den Musikdoktrinen seiner Lebeszeit im Weg: Abgesehen von einer frühen, von ihm bis zu seinem Tod zurückgehaltenen Arbeit hat er zeitlebens tonal komponiert – ein Umstand, der ihm eigentlich die Zuhörer hätte zuströmen lassen müssen. Aber der Markt verstand es, ihn zunehmend zu verdrängen, was wiederum bei dem längst schon schwer erkrankten Mann zu einer Bitterkeit führte, die ihn seinerseits, dem späten Lenz ähnlich, schroff und in seinen Aussagen scheinbar grob und ungebärdig werden ließ. D a s war dann im Blick, weniger die Musik selbst, ja sie so gut wie gar nicht. Einige Zeit lang, als sich auf den Wegen der Postmoderne das Tonalitätstabu lockerte, entdeckten einige junge Komponisten den Schweden, aber auch sie ließen ihn so gut wie alle wieder fallen. Seine Unerbittlichkeit, die kein Tändeln zuließ, schon gar nicht mit dem Markt, mag sie schließlich abgeschreckt haben, ganz ebenso sein Pathos, dem im Nu das Stigma des Selbstmitleids angepappt wurde, ein Urteil, das nur ausgesprochen werden muß, und der Betroffene ist zeitlebens diskriminiert. Argumentieren läßt sich nicht dagegen.
Bitte hör die Musik Dir an. Wenn sie Dich erfaßt, schicke ich weitere ihr nach. Hör Dir an, welch künstlerisches Wunder uns dieser Schwede hinterließ. Ich habe mehrfach über ihn geschrieben, Du hast einen langen Artikel gesehen, weil er hier an eines meiner Bücherregale gepinnt ist. Dennoch würdest Du nun, nach Deiner Trennung, ohne ihn bleiben, wenn ich nicht beharrte, würdest ihn niemals gehört haben bis zu dann Deinem Tod – eine Vorstellung, die mir, Du Nahste, unerträglich auch dann ist, wenn Du mir zur Fernsten wurdest. Aber vielleicht wirst Du auch scheuen und bewußt nicht zuhören wollen, weil Du ahnst, daß ich Dir andernfalls wieder näher kommen würde, nicht als Körper, sondern als ein Nebel in dem, Du wirst ihn in Dir spüren, Abschiedsklang. Allan Petterssons Musik – nicht seine Person, die mir wesenhaft fremd blieb – ist mir über die Jahre zu einer geradezu Identifikationsfigur geworden, im Sinn einer Figuration. Denn wie meine Dichtung stand sie und steht sie fremd in der Welt, vom Allgemeinen abgewiesen. Aber Einzelne gibt es, die hören, und w i r d es immer geben.
Ich bin Dir, Sìdhe, an der letzten Schwelle begegnet, vor der man beidrehen, die Richtung ändern kann, sofern sich die Dinge u n s noch einmal zuwenden. Tun sie es nicht und treten wir deshalb darüber, fängt das Alter für uns an. Meine Panik, nachdem Du mich verließt, rührt auch aus dem Wissen davon. Ich hab mir selten etwas vorgemacht, dem Kommenden fast immer ins Auge geblickt, bin ihm allenfalls gelegentlich ausgewichen. Es niederrennen oder mich verweigern, nie wirklich furchtlos, doch auf keinen Fall bereit, mich einschüchtern zu lassen, das ja. Sich aber beugen lassen? Nein. Das hast erst D u vermocht, auch wenn ich weiß, daß Du nicht anders konntest. So tat ich den Schritt, e s tat ihn m i r, schob mich unversehens hinüber, und nun steh ich, gleichsam plötzlich, drüben und seh von dort in die Nebel zurück.
Obwohl es, wie ich eingangs dieses Briefes schrieb, längst schon draußen dunkel ist, formen sich immer mal wieder Gestalten meiner selbst heraus, des jungen Mannes, der ich war, sogar des Kindes, dann wieder des Heißsporns von sechsundzwanzig, dreißig Jahren und vorher eines Jünglings, der allen Ernstes vermeint hat, aus ganz eigener Kraft und eignem Vermögen eine neue Form von Literatur in die Welt zu setzen und dafür weder auf, sagen wir, Mentoren noch Gruppen angewiesen zu sein und in ihre Regularien eingebunden. Einfach die Qualität genüge. Wie sehr ich mich darin geirrt habe, weiß ich heute, weiß es seit ein paar Jahren und mag es doch immer noch nicht für wahr halten.
Sonntagsmorgenshelligkeit,
ein Licht wie im März.
Selbstverständlich hast nicht Du, Geliebte, das zu verteten und nicht einmal zu bedenken; es geht Dich imgrunde nichts an, kann Dir mit vollem Recht einerlei sein, ja das muß es sogar. Wir waren zwei aufeinandergetroffene Strahlen, die es für ein paar Wochen ineinanderhielt, die sich drin umeinanderwanden, enge, enger, aber deren einen stieß es dann wieder ab, und er suchte das Freie, schoß fort und fort, der andre sieht ihn schon nicht mehr. Das ist das Schweigen. So ruft ihm der andre nach und nach. Nur ist der Schall so viel langsamer als das Licht, er wird es niemals einholen können, ja ihn, Deinem Licht, ist es, selbst wenn es sich umdrehen könnte, naturgemäß unmöglich, mein Rufen überhaupt zu hören. Weshalb ich es wieder, in dem zweiten Sinn dieses Wortes, „eingeholt“ habe, nämlich einem Wurfnetz gleich, doch einem leeren, es eingezogen rück zu mir, und jetzt Text aus seinen verknoteten Schnüren mache, sie weiterverknote, presse und modelliere und schließlich mit einer Bronze überziehe, aus der die Statue wird, die man in Lenzens Grenzhäuschen findet. So daß ich in dieser Variante meiner Erzählung unrecht hatte: denn sie, die Statue, ist nicht aus Marmor. Was für ein Staunen schon deshalb, als man ihren, sagen wir, Kern begriff! daß der aus verknoteten Schnüren bestand, und aus Korkstücken, Bleien, hohlem, späterem Auftrieb dienenden Glas – komplett unklar, wie ihr so etwas als Skelett dienen konnte und daß es offensichtlich nie eine Gußform gegeben hatte. Noch surrealer war, daß der doch im weiten Sinn textile Netzkern hätte eigentlich sofort verbrennen müssen, als die Bronze, immerhin an die eintausend Grad heiß, über ihn floß. Die Triester Venus hätte dann hohl sein müssen. Statt dessen umschloß ihr Körper dieses Netz wie ein Bernstein den Einschluß. So war sie, und blieb es, allein schon technisch Mysterium.
Metaphorisch gesprochen, allerdings, verhütet sie, diese Venus, daß ich das Treibnetz abermals auswerf, indem sie aber meinen Fang, Dich, zugleich symbolisiert, meinen für immer nun Nichtfang. Was wir nämlich tatsächlich wissen und was sich schlichtweg beweisen läßt, ist, daß ihre Gesichtszüge den Deinen vollkommen gleichen, und nicht nur sie, sondern ihre gesamte Gestalt scheint Dir nachgeformt zu sein. Ich könnte außerdem beweisen, daß sich ihre linke Achselhöhle in der Cava gigante, Du weißt schon: Sgonico, wiederfinden läßt, in der Form einer natürlichen Seitenkapelle fast am Grund dieser riesigen Höhle. Man kann da sogar, muß nur sehr genau, den Kopf weit zurück, hinschauen, den kleinen Schnitt erkennen, den Du Dir beim Rasieren, hier in Berlin, zugefügt hast, nur daß er nicht blutet, sondern tropft. Lenz war davon wie vor den Kopf geschlagen, als sie, die Lydierin und er, diese Kapelle damals besuchten, bevor sie sich dann in ihr liebten. Gleichsam hast Du Deine Achselhöhle über das Paar da gewölbt, um es zu schützen, und aus dem Spalt, der der Schnitt war, fielen Lenz immer und immer wieder, während des Aktes, Tropfen auf den Nacken. Nur deshalb, weil sie ihn kühlten, konnte er so lange in der Lydierin bleiben. Übrigens verstand er erst nun, weshalb seine Geliebte drei große zusammengerollte Decken mitgebracht hatte, eine sich selbst unter den Arm geklemmt, die beiden anderen sollte e r tragen. Als sie noch in dem Grüppchen Wartender standen, weil erst genügend Leute zusammenkommen mußten, um eine Führung auch ökonomisch zu rechtfertigen, hatte er sie ziemlich verwirrt gefragt, was sie denn damit wolle. „Es ist kalt da unten“, hatte sie in ihrem leicht schnippischen, jedenfalls spöttischen Ton geantwortet, „was denkst denn D u?“ Und aufgelacht. Wobei ich, der ich ja ebenfalls dort unten gewesen bin, aber seinerzeit mit Dir, bei meinem ersten Besuch in Triest, überhaupt jetzt erst verstehe, weshalb Du so unbedingt wolltest, daß ich diese Deckenspalte erkennte. Du hast richtiggehend beharrt, weil ich sie lange Zeit nicht sah. „Dort! So guck doch, Liebster, h i n!“ Aber auch dann, als ich sie sah, blieb mir der Zusammenhang mit dem Rasierschnitt verborgen. Bis eben blieb es mir völlig rätselhaft, weshalb Du diesem Spalt solch eine Bedeutung beigemessen hast. Doch jetzt, Herz, plötzlich… – verzeih mir, zu spät.
Kannst Du Dir vorstellen, wie oft Lenz, in seinem Grenzhäuschen, darüber nachdenkt, ja wie so sehr wahnsinnig ihn das macht, daß er gar nicht anders kann, als eben deshalb so wortkarg und immer schroffer zu werden? Er muß das niederhalten. Wenn einer die Zusammenhänge völlig begriffe, er müßte seinen Verstand wirklich verlieren. So kann man sich nur noch dagegenstemmen, versuchen, jedes Erklären sein zu lassen; statt dessen muß man sein und gewesen sein lassen und sich, letzlich, ergeben.
Alban
Pettersson, Achte Sinfonie.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob auch Lenz, in seiner Zeit mit der Lydierin, solch ein Verlangen hatte. Wenn ich zurücksehe, kommt es mir eher so vor, als hätte er gewünscht, seinerseits umsorgt zu werden. Jetzt freilich, in dem Grenzhäuschen, ist das anders, da baute er, sowie sie es nur brauchte, Kartoffeln für sie an. Aber seine Vorgeschichte, obwohl auch ich einst im Geldgeschäft war, unterscheidet sich von meiner, zumal ich nie eine Ehefrau hatte, die mich bestimmt hätte wie seine, und gegen mein Elternhaus lief ich schon frühe an; Lenz hat das nie getan. Seine Emanzipation begann imgrunde erst mit der Lydierin, paradoxerweise gerade, indem er ihr verfiel; das gehört zu ihrer, dieser Emanzipation als Mann, Vorgeschichte: Sie brauchte den Verlust.
Deshalb wird er, wenn seine Sìdhe erneut bei ihm in der Tür steht, schwanger und für diese stolze Frau seltsam verloren, die Zumutung annehmen können, die das doch zweifelsfrei bedeutet. Denn tatsächlich ist Jessir n i c h t tot, nein, er wurde n i c h t exekutiert, sondern sie, als er für den neuen, sagen wir, Einsatz, losgezogen war, rechts an der Schulter die schwere Fototasche, links in der Hand sein Köfferchen, an persönlichen Dingen und Kleidung brauchte er auf seinen Reisen nie viel – sondern sie hatte da, kaum war in dem repräsentativen Palazzo der viale XX Settembre die Wohnungstür ins Schloß gefallen, nur ein paar Schritte vom Jugendstil-Ambasciatori entfernt, fast fluchtartig ihrerseits einen Koffer gepackt, sich schließlich ins Auto gesetzt und war über die Battisto und die Piazza Rossetti quasi zwischen dem Parco di Villa Gulia und dem Giardino pubblico hindurch, ihren wechsel- und stimmungsseitig täglichen Jogginggründen, in schließlich weitem Bogen zur Strada statale und diese hoch Richtung Opicina gefahren, direkt Lenzens Grenzhäuschen zu.
Sie wußte gar nicht genau, was in sie gefahren war, schon gar nicht in dieser Situation. Plötzlich, Jessir und sie hatten beim Abendessen gesessen, feierlich beinahe, so hielten sie es vor jeder seiner großen Reisen – plötzlich hatte sie an Lenz denken müssen, ja sie hörte ihn, roch ihn.
„Was hast du?“ fragte Jessir.
„Nichts“, sagte sie.
„Aber ich merk doch, daß du was hast!“
Man kann nicht sagen, daß er sich auf das Baby nicht freute, im Gegenteil, manchmal war er ganz aus dem Häuschen und, soweit er vermochte, überaus zärtlich, aber seinen Beruf aufzugeben, das kam nicht infrage. Sie hatten darüber nun schon mehrfach diskutiert. „Und was soll ich dann machen? Im Büro hocken? Du weißt genau, daß ich das nicht kann!“ – Seine, so nannten wir es schon, Sucht. Er brauchte einfach, Kind her, Kind hin, den Kick.
„Ich kann so nicht leben, nicht weiterleben“, sagte sie. „Nicht, wenn ich Mutter bin.“
Kam das Gespräch an diesen Punkt, wich Jessir aus, umarmte sie, küßte sie. „Ich liebe dich.“ Und stieg schon in den Flieger. Tatsächlich war ihm ein, sagen wir, bürgerliches Leben unvorstellbar, Kleinfamilie, jeden Tag derselbe Trott. Wie sollte er das durchstehen? Die Wahrheit ist, daß er sich, seit es darauf zulief, sogar verstärkt um Auslandseinsätze bemühte; ohne es sich selbst zuzugeben, war Jessir auf der Flucht eher als seine Gefährtin. Was sie wahrscheinlich gespürt hat. – Nein, finanziell wäre es kein Problem gewesen, Jessir wurde gut bezahlt; seit seine ersten Fotos im Live erschienen, sogar vorzüglich. Also darum ging es nicht.
„Du bist über vierzig! Wie lange k a n n s t du das noch machen, überhaupt? Rein körperlich, meine ich.“ – Er hätte lachen sollen, so in Form, wie er war. Aber war wieder einmal resolut: „Bis ich umfallen werde“, gab er ihr zur Antwort.
So daß sie ihn knien sah, Hände auf den Rücken gebunden; Exekutionen wie diese werden von hinten durchgeführt, den Lauf nahe am Kopf. Dieses so spontane wie furchtbare Bild vor den Augen, ein derart grelles scharfes Aufblitzen, daß sie die Lider schloß, stand am Anfang ihrer Entscheidung, einer aber, von der sie noch nichts wußte. Zwei Wochen später, an dem Abendessen vor Jessirs Abreise, stieg dann Lenz vor ihr auf: unfaßbar wärmend, wenn auch noch unzugegeben, nicht nur gegenüber Jessir, sondern auch für sich selbst.
„Was hast du?“
„Nichts.“
Wenn Frauen sich entscheiden.
Dennoch schliefen sie in dieser Nacht noch einmal miteinander. Sie ließ ihn gar nicht mehr los. Deshalb schlief er in ihr ein; sie, unter ihm liegend, sah noch lange, an seiner Herzschulter vorbei, zur Decke. Möglich, daß sie geweint hat, stumm und ohne Erschütterung; ihr liefen einfach die Tränen. Wenn dem so war, hat er es nicht bemerkt. Und ihr Bedrücktsein morgens, wie vor jeder seiner Reisen, kannte er schon. „Mach dir keine Sorgen“, sagte er, gab ihr einen schnellen Kuß und legte die Hand über die deutlich erkennbare Bauchwölbung. Der Satz war die übliche Stanze, bevor er seine Fototasche über die Schulter wuchtete, auch das Köfferchen nahm und sich zur Tür wandte. „Unkraut vergeht nicht.“ Abschiede lagen ihm nicht; Sentimentalität, ich erzählte es in einem meiner ersten Briefe, war ihm wesenhaft fremd.
Ihr freilich auch, aber nicht eigentlich; vielmehr hatte sie nach und nach über ihr, wie er es nannte, „Romantisches“ eine Folie der Ironie gezogen, mit der er besser umgehen konnte; auch ihr jugendlich Unbedingtes tat er gern mit einem Spottwort ab. Schließlich war man erwachsen.
Auch so etwas, Liebste, verwundet. Wir mögen es Kleinigkeiten nennen, doch auch die, über die Jahre, fressen sich ein. Zwar meinen wir, uns dran gewöhnt zu haben und nehmen es schließlich nicht mehr recht ernst, ja lachen selber mit. Dennoch, eines Tages… ein einziges falsches Wort, eine noch einmal falsche Entscheidung, irgend ein Abtun… –
Während der nicht sehr langen Autofahrt zu Lenz war die Lydierin noch zittrig, ihre Entscheidung um sich gerafft wie im Winter einen Mantel, wenn die Bora aus dem Karst stürzt. Aber als er die Tür öffnete, brauchte es nur seinen Blick und ihren, ihrer beider Blicken, und sie wurde wieder Sìdhe.
Hinter ihr die Spätsommerwiese, noch dahinter der Wald, vor ihr der hartgewordene Mann.
„Läßt mich herein?“
Er tritt zur Seite.
Sie nimmt die zweidrei Stufen. Drinnen streift ihr Blick die Wände.
„Das kommt dann weg.“
A.
>>>> Zweiunddreißigster Brief nach Triest
Dreißigster Brief nach Triest <<<<
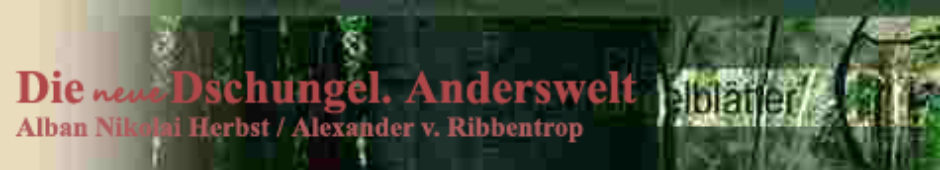




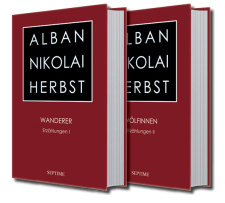

Untriest 9, 18. Januar 2015.
Amélie hat sehr schön erzählt gestern abend; frühnachts nahmen wir noch einen jeder einen Cocktail, gegen halb Mitternacht war ich zurück und fand einen wirklich wunderbaren Brief >>>> Edgar Leidels vor, der mir eine Art Asyl anbieten möchte und aus dem ich ein paar Sätze zitieren will, weil sie mir wirklich die Stimmung erhellten:
Ich will ihm auf jeden Fall heute noch antworten, aber auch, nach nun endlich wieder Rasur und Dusche, den Triestbrief noch fortsetzen. Die gestrige tatsächlich schwere Bedrückung ist nicht mehr so zusammengeballt; zwar bin ich noch nicht wirklich neuen Muts, aber doch wieder einigermaßen konzentriert. Leidels Brief hat das schon gestern nacht bewirkt. Es sind solche Ereignisse, die einem helfen – mehr als alle „Argumente“, die letztlich ja doch nicht verfangen..
(13.22 Uhr.)
(17.06 Uhr).
Jetzt hat mich der Kommentarbaum >>>> dort von der Fortsetzung des einunddeißigsten Briefes abgehalten; aber manchmal ist es nötig, eingehend zu argumentieren, etwa besonders auf >>>> Peter H. Gogolins erneute Einwände gegen Die Dschungel, was nun immerhin zu einem neuen Segment der >>>> Kleinen Litblog-Theorie geführt hat. Dabei hätte ich auch gerne noch etwas unter >>>> Phyllis Kiehls schönen heutigen Tageseintrag geschrieben. Aber hier warten, für die horen, überdies fünf Seiten enggedruckte Fahnen, die zu korrigieren sind. Das muß bis abends geschafft sein. Dennoch schaffe ich‘s vielleicht, am Brief nachher noch weiterzuschreiben. Insgesamt ist die Diskussion allerdings zu wichtig, um sie linksliegen zu lassen.
Ein neues, diesmal wieder dunkles Brot geknetet habe ich außerdem; soeben heizt der Backofen vor, so daß ich später schon werde von ihm kosten können.
Der Mittagsschlaf fiel aus, weil ich zu spät hochkam.