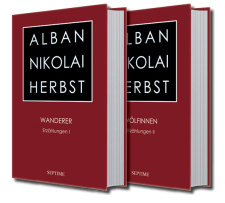[Meru Mbega, Terrasse.
Wie seltsam das aus den „Bord“lautsprechern meines Laptops in die warme Luft des Morgens perlt und sich mit den Geräuschen, die zu Tage schlafen gingen, vereinigt: als senkte sich ein Staub aus Tönen auf die trockne Erde nieder. Denn noch war an Regen gar nicht zu denken; mittags geht‘s gegen dreißig Grad, nachts kaum unter zwanzig. Da kommen einem >>>> solche Gedichte doch arg jenseits vor, „East of Africa“ eben, wie Tote spröde, an die längst niemand mehr denkt, doch schon zur Lebzeit hat sie keiner bemerkt. Wer nicht an Deutschland denkt, schreibt drüber kein Gedicht. Wie kann man an einem Land leiden, bzw. so nicht leiden, daß man dennoch an ihm… nun ja, „leidet“? Was ich mir vorstellen kann, ist, daß man an/unter einer Kultur, weil sie eben fehle, leidet. So etwas, daß sie fehle, läßt sich aber weder von Deutschlands noch von der irgend einer anderen Nation sagen.
Einen „richtigen“ Latte macchiato, allerdings, bekommen die Leute hier nicht hin, auch keinen Café au lait; was als Kaffee ausgeschenkt wird, ist eine Plürre. Also geh ich morgens selbst in die Küche; die Bohnen sind nämlich gut. Ich habe wirklich auch eine elektrische Mühle entdeckt und nutz sie; Milch gibt‘s ebenfalls, wenn auch nur in der „H“-Form.
Dann auf die Terrasse, besser: Loggia; auch „Pergola“ könnte man, ungefähr, sagen: das alte Wort dafür wär „Laube“; wir sind ja blätterzweigig überdacht; Laube in allerdings afrikanischem Ausmaß. Ich muß nicht mal weggehn, wenn ich essen will; die Mahlzeiten werden hier hinausgetragen. So bleibt der Laptop laufen, ich setze mich nur um. Nur jetzt, hier, morgens, um weit ins Land zu blicken, habe ich einen anderen Platz, siehe Bild, gewählt.
Ich saß den ganzen Tag, zähe Vers für Vers: über vierzig Verse gestern. Das läuft befreit – wie ich‘s mir dachte. Ich brauche wirklich nur Wärme.
So will ich heute weitermachen; die Steaks warn derart riesig, daß wir sie nicht schafften; ich „schaffe“ Steaks sowieso nie ganz und flüchte oft bald ins Gemüse. Doch mit ein wenig Glück werden am Abend die Erissohn-Verse sämtlichst fertig sein, so daß ich die nicht wirklich nennenswerten Dimensionen des noch „offenen“ Argo-Epiloges bis auf die letzte Silbe wissen werde; von jetzt aus über den Daumen gepeilt, werden es – also im Buch – mehr als zehn Seiten kaum werden.
Nein, es riecht nicht mal nach Regen.
Irre, komplett irre, daß ich morgen abend bereits wieder >>>> in der Oper sitzen werde.
Es belebt sich grade hier; ich wutsch mal schnell in die Küche für den zweiten Latte-Oh!-macchiatoLä.
Unschärfe ist manchmal ein klügrer „Beweis“ als Genauigkeit: Täuschung als Funktion des Ungefähren und das Ungefähre als ein Moment der Täuschung.
(Hab mich umgesetzt; man räumt auch schon ab.)
Enkelin, Tochter des Sohnes Achilleus – geboren kaum, sprach sie:
Über wen, sag mir, lächeln die Rinder des Tethra? – / –
(Argo 763, Verse 241-243,
im zu bearbeitenden Entwurf.)
Durchgearbeitet in einem Rutsch und soeben mit den Versen der Eriserzählung fertiggeworden. Jetzt muß ich sie noch aus der Achilleis-Datei in das Argotyposkript hinüberkopieren; hab auch schon angefangen. Aber es ist Zeit für die Siesta. Nur ein loses Laken werde ich über mich und die Löwin decken, die schon seit einer Stunde schläft. Es steht eine Stille über dem Busch, die von Pan rühren könnte.
Heftig umwinden die Wogen ihn, Strudel spülen ihn weiter,
267 /-/–/-/–/–/-
bis das Ufer der metymnäischen Lesbos erreicht ist.