Inhaltsverzeichnis
- 1 Sprachwandel oder Sprachzerfall?
- 1.1 Jugendliche schreiben heute mehr als früher
- 1.2 Aneinanderreihung von Hauptsätzen
- 1.3 Merkmale des Sprechens in die Schriftsprache transferiert
- 1.4 Unlogische Konjunktionen zwischen zwei Aussagen
- 1.5 Inhalt wichtiger als die Form
- 1.6 Sorglosigkeit der Sprache gegenüber
- 1.7 Persönliche Erfahrung als Massstab des Schreibens
- 1.8 Verwischung der Sprachebenen
- 1.9 Unterschied zwischen Hochsprache und Dialekt verwischt
- 1.10 Jugendliche passen die Sprache der Situation an
Sprachwandel oder Sprachzerfall?
Wie Jugendliche heute schreiben
von Mario Andreotti
„Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben; sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher, und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur und Sprache zu erhalten.“ Worte eines frustrierten Lehrers, werden Sie jetzt vielleicht denken. Weit gefehlt. Das ist nicht die Klage eines Zeitgenossen; die Klage findet sich vielmehr auf einer rund 3000 Jahre alten babylonischen Tontafel.
Warum führe ich das an? Aus dem ganz einfachen Grunde, weil die ältere Generation zu allen Zeiten über den Zustand der jüngeren geklagt hat. Uralt schon ist dieses Reden vom Sprachzerfall, und hätte es zu jeder Zeit zugetroffen, so würden uns heute fast gänzlich die Worte fehlen und unsere Kommunikation wäre wohl nur noch auf ein Stammeln, ein Grunzen oder Pfeifen reduziert.
Stimmt es aber, dass die sprachlichen Fähigkeiten unserer Jugendlichen derart zurückgegangen sind, wie man immer wieder hören kann? Um es gleich vorwegzunehmen: Die Antwort auf diese Frage wird nicht ein Ja oder Nein, sondern ein differenziertes Urteil sein.
Jugendliche schreiben heute mehr als früher

Beginnen wir mit einem vielgehörten Vorurteil, das da lautet, Jugendliche würden ausserhalb der Schule kaum noch schreiben; sie sässen in ihrer Freizeit vielmehr vor dem PC, den sie vor allem für Spiele und für das Surfen auf Unterhaltungsseiten im Internet nutzten. Ein Vorurteil, das so nicht stimmt, denn die Fakten sprechen eine andere Sprache: Jugendliche schreiben heute mehr als je zuvor. Ob sie mit Klassenkameraden chatten, E-Mails verfassen, Mitteilungen über SMS machen, sich an Online-Spielen beteiligen, ihr Profil auf Facebook aktualisieren oder einen Kommentar in einem Blog veröffentlichen: Sie schreiben. Selbst das Handy dient Jugendlichen, anders als das Telefon früher, vorzugsweise zum Schreiben, nicht zum Sprechen. Ja, es wird im privaten Raum heute derart viel geschrieben, dass wir Germanisten geradezu von einer „neuen Schriftlichkeit“ sprechen. Nur ist es ein etwas anderes Schreiben, als es sich besorgte Eltern, Lehrer und Arbeitgeber wünschen – ein Schreiben, das von ihnen häufig als defizitär bezeichnet wird. Doch wie sieht dieses Schreiben unserer heutigen Jugendlichen konkret aus?
Aneinanderreihung von Hauptsätzen
Bevor ich diese Frage beantworten kann, gilt es, darauf hinweisen, dass frühere Generationen ihr Schwergewicht zum einen auf die geschriebene Sprache legten und zum andern diese geschriebene Sprache häufig mit der hohen Sprache der Dichtung gleichgesetzt haben. Im Schüleraufsatz eines 16-jährigen Jugendlichen aus den 1950er Jahren tönte das dann, recht abgehoben, etwa so:
Dann betraten sie das kühle, dämmerige, kerzenerleuchtete Kirchenschiff. Wärme zog ein in ihre erkalteten Herzen und verbreitete den heissen ersehnten inneren Frieden.
Ganz anders ein paar Sätze aus einem 2015 entstandenen Aufsatz zum Thema „Eifersucht“ einer ebenfalls sechzehnjährigen Schülerin:
Wir sind umgezogen und ich kam in eine neue Schule, es war mir peinlich als Frau Schmidt (die Direktorin) mich der Klasse vorstellte, sie sagte: „So, das ist die neue Schülerin Vanessa“! Ich kam mir echt blöd vor, dann sagte Frau Schmidt zu mir, das ich mich zu Kevin setzen soll, das ist ein Junge mit blauen Augen und blonde Igelhaare, er hätte auch super coole Klamotten an, er sah echt süss aus. In der ersten Woche waren alle auch sehr nett zu mir, vor allem Kevin. In der Pause hängte ich immer mit Kevin rum.[…]
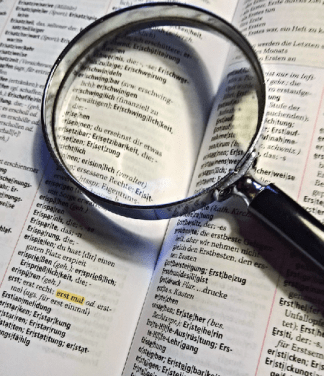
Das ist, wie man sofort bemerkt, nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich ein ganz anderer Text. Was an diesem Text, neben den Orthografie- und Grammatikfehlern, sofort auffällt, die fast ausnahmslose Aneinanderreihung von Hauptsätzen, die jeweils weder durch ein Satzschlusszeichen abgeschlossen noch ausreichend kausallogisch miteinander verknüpft werden. Man beachte beispielsweise nur schon den ersten Satz „Wir sind umgezogen und ich kam in eine neue Schule“, der kausallogisch korrekt folgendermassen heissen müsste: „Weil wir umgezogen waren, kam ich in eine neue Schule.“ Auch die beiden Sätze „Ich kam mir echt blöd vor“ und „dann sagte Frau Schmidt zu mir […]“ sind unsauber miteinander verknüpft: „dann“ ist eine temporale Partikel; zwischen den beiden Sätzen besteht aber kein temporaler Bezug.
Merkmale des Sprechens in die Schriftsprache transferiert
Und noch etwas muss uns aufgefallen sein, die Tatsache nämlich, dass der Text der Schülerin typische Merkmale der gesprochenen Sprache aufweist. Beachten wir nur, wie die einzelnen Aussagen und Sätze weniger einer grammatischen Logik als vielmehr einem vagen Assoziieren folgen, so wie sich die Gedanken der Schreiberin im Augenblick gerade ergeben. Besonders schön zeigt sich dies in den beiden bereits vorhin genannten Sätzen „Wir sind umgezogen und ich kam in eine neue Schule“ und „Ich kam mir echt blöd vor, dann sagte Frau Schmidt zu mir usw.“, die nicht durch logische Konjunktionen, sondern rein assoziativ miteinander verbunden sind. Überhaupt fehlen im Text die Konjunktionen, die ja eine Art Scharnier zwischen den einzelnen Aussagen bilden, fast ganz. Sehen wir uns dazu beispielsweise die folgenden drei Sätze an, die durch keinerlei Scharniere miteinander verknüpft, nebeneinander stehen: „das ist ein Junge mit blauen Augen und blonde Igelhaare, er hätte auch super coole Klamotten an, er sah echt süss aus.“ Kausallogisch sauber verbunden, könnten die drei Sätze etwa folgendermassen lauten: „Das ist ein Junge mit blauen Augen und blonden Igelhaaren, der super coole Klamotten trug, so dass er echt süss aussah.“
Zur mehr assoziativen als logischen Schreibweise unserer Schülerin tritt aber noch etwas Weiteres: Warum wohl sagt die Schreiberin „er hätte auch super coole Klamotten an“ und nicht „er trug super coole Klamotten“? Ganz einfach deshalb, weil es in unserer Mundart auch heisst „Er hett super cooli Klamotte a“. Die Schülerin gleicht also den hochdeutschen Satz an die Mundart, unser mündliches Sprechen an. Ganz ähnlich verfährt sie mit dem Satz „In der Pause hängte ich immer mit Kevin rum.“ Das ist eine dem Dialekt angenäherte Umgangssprache, welche die Schülerin anstelle des hochsprachlich formulierten Satzes „In der Pause halte ich mich zum blossen Zeitvertreib mit Kevin auf“ wählt.
Unlogische Konjunktionen zwischen zwei Aussagen
Was wir im Text unserer Schülerin vorfinden, ist eine Schreibweise, wie wir sie in vielen Texten Jugendlicher antreffen. Sie zeigt sich vor allem in fehlenden oder unlogischen Konjunktionen zwischen zwei Aussagen, in einem häufig unlogischen Gedankengang, in langen Sätzen mit wenig gliedernder Interpunktion, in einem vagen Assoziieren, in einer oftmals ungenügenden äusseren Gliederung und nicht zuletzt in einer gewissen Geschwätzigkeit. Fassen wir diese Ergebnisse zusammen, so lässt sich sagen, dass sich bei unsern Jugendlichen eine zunehmende Angleichung der geschriebenen Sprache an die gesprochene Sprache vollzieht, in der wir ja in der Regel auch nicht stringent logisch, sondern vielmehr assoziativ argumentieren, indem wir immer wieder von einem Gedanken zum andern springen. Die Germanistik bezeichnet diese Tendenz zur Vermündlichung der Sprache, die übrigens nicht nur bei jugendlichen Schreibern, bei diesen aber besonders ausgeprägt, feststellbar ist, mit dem Begriff „Parlando“ – einem Begriff, der aus der Musiktheorie stammt und dort eine musikalische Vortragsweise meint, die das natürliche Sprechen nachzuahmen versucht.
Unter Jugendlichen gibt es mit Blick auf ihre Parlando-Texte so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz, das aus folgenden vier Schreibanweisungen besteht:
- Nimm das einzelne Wort, den einzelnen Satz nicht allzu wichtig. Schreib weiter.
- Gehe davon aus, dass der Leser das, was Du schreibst, auch so versteht wie Du.
- Rechne mit dem gesunden Menschenverstand des Lesers; vermeide unnötige Differenzierungen.
- Nimm den Inhalt wichtiger als die Form.
Inhalt wichtiger als die Form
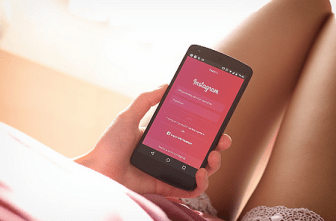
Diese letzte Anweisung „Nimm den Inhalt wichtiger als die Form“ ist dabei die wichtigste dieser vier Schreibanweisungen. Sie ist ganz wesentlich verantwortlich für den häufig sorglosen Umgang mit den Normen und Ansprüchen der geschriebenen Sprache, wie das Erwachsene, vor allem Eltern, Lehrer und Arbeitgeber, bei den heutigen Jugendlichen mit einem gewissen Entsetzen feststellen. So machen Schüler heute, wie der Vergleich von Schulaufsätzen aus drei Jahrzehnten gezeigt hat, doppelt so viele Rechtschreib- und vor allem Interpunktionsfehler als noch vor vierzig Jahren, wobei die Mädchen statistisch immer noch besser abschneiden als die Jungen. Und so hapert es denn auch bei der Grammatik, der Stilistik und der Sprachlogik zum Teil gewaltig, so dass wir in Schulaufsätzen beispielsweise Sätze wie die folgenden zu lesen bekommen:
Der Blitz hat uns erschrocken.
Er hing die Bilder an die Wand, aber sie hängten schief.
Graubünden ist ein gebirgiges Volk, das sich vorwiegend von Touristen ernährt.
Unsere Welt nimmt in erschreckendem Masse zu.
Fünf Prüfungstage mit weichen Knien sind abgeschlossen.
Sorglosigkeit der Sprache gegenüber
Bemerkenswert ist dabei, dass all diese Fehler weniger mit mangelnder Sprachbeherrschung zusammenhängen als vielmehr mit einer gewissen Sorglosigkeit der Sprache gegenüber. Besonders schön zeigt sich das an den auffallend vielen Rechtschreibfehlern in Wörtern, die eher einfach zu schreiben sind: Ich fant die Läute gemein.
Wie erklärt sich diese Vernachlässigung der sprachlichen Form, wie wir sie in Parlando-Texten unserer Jugendlichen, geradezu gehäuft vorfinden? Dafür gibt es selbstverständlich verschiedene Gründe; die drei wichtigsten möchte ich kurz nennen:
Der erste Grund – wie könnte es anders sein – ergibt sich aus dem Aufkommen neuer, elektronischer Medien wie E-Mail, SMS, Chat, Facebook, Whatsapp usw., wo das ungeschriebene Gesetz der Sprachökonomie gilt, d.h., wo alles möglichst schnell, kurz und der mündlichen Redesituation angepasst sein muss. So tippen Jugendliche in ihren Mails beispielsweise nur das Kürzel gn8, wenn sie dem Freund „Gute Nacht“ wünschen, oder OMG (oh my god), wenn für sie etwas furchtbar ist oder hdgdl, wenn sie jemandem sagen wollen: „hab dich ganz doll lieb“. Und gegrüsst wird nur noch mit Kürzungen wie LG (liebe Grüsse) oder „hegrü“, falls man sich überhaupt noch Zeit für einen Gruss lässt. Kommas lässt man selbstverständlich möglichst weg; sie kosten ja auch nur Zeit. Schliesslich schreiben Jugendliche etwa beim Chatten konsequent klein; das geht schneller, als wenn sie zwischen gross- und Kleinbuchstaben abwechseln müssen.
Persönliche Erfahrung als Massstab des Schreibens
Dass dieses informelle, verkürzte Schreiben in den neuen Medien das Schreiben in den übrigen Texten, etwa in Schulaufsätzen, beeinflusst, steht ausser Frage, auch wenn dieser Einfluss, wie neuere linguistische Studien gezeigt haben, nicht überschätzt werden darf. Es gibt da nämlich noch ein weiteres wichtiges Moment, das sich auf die Schreibweise unserer heutigen Jugendlichen auswirkt. Wurde früher, etwa in Schulaufsätzen an der Oberstufe die Darstellung schulischer Inhalte gefordert, lautete ein Thema etwa „Der Freiheitsbegriff in der Schweizerischen Bundesverfassung“, so wird heute eine stärker eigenständige Auseinandersetzung mit Themen verlangt. So z.B. „Welchen Wert hat der Sport für mich?“. Persönliche Erfahrungen werden für die Jugendlichen so vermehrt zum Massstab ihres Schreibens. Sie äussern sich in der Formulierung einer Ich-Perspektive, zeigen sich im Anspruch der Jugendlichen, authentisch zu sein, was dazu führt, dass sich ihr Schreiben der gesprochenen Sprache stark annähert. Das hat einerseits zur Folge, dass die Texte spontaner, ja lebendiger wirken, dass andererseits aber ihre formale Korrektheit abnimmt, was Grammatik, Rechtschreibung und vor allem die Interpunktion betrifft.
Verwischung der Sprachebenen

Schliesslich gibt es da noch einen dritten Grund für den häufig sehr sorglosen Umgang unserer Jugendlichen mit der Sprache. Er besteht in einer gewissen Demokratisierung der Sprache. Was ist damit gemeint? Ich sage es: In der deutschen Sprache haben Normen in der Grammatik, vor allem aber in der Rechtschreibung, anders als etwa im Englischen, einen sehr hohen Stellenwert, weil wir ihre Beherrschung als Zeichen für Intelligenz und schulischer Bildung nehmen. Machen wir die Probe aufs Exempel: Ich frage meine Leserinnen und Leser: Würden Sie als Arbeitgeber jemanden für einen verantwortungsvollen Posten einstellen, der in seinem Bewerbungsschreiben Grammatik- oder gar Orthografiefehler macht? Höchstwahrscheinlich nicht. Zu wichtig sind Ihnen nämlich sprachliche Normen. Und genau gegen diese Normen, die sie als elitär empfinden, rebellieren viele unserer Jugendlichen. Sie neigen zu einer Sprache, die nicht mehr grammatisch korrekt, stilistisch rein sein will, sondern in der sich verschiedene Sprachebenen gewissermassen verwischen, die – mit einem Wort – demokratisch ist. Das zeigt sich zum einen in ihrem häufig spielerischen und sorglosen Umgang mit der geschriebenen Sprache, und dies alles mit einer starken Orientierung an der Mündlichkeit, und zum andern in einem zunehmenden Einbezug der Mundart. Ohne die geringsten sprachlichen Skrupel können sie dann beispielsweise „I bi xi“ anstatt hochdeutsch „Ich bin gewesen“ schreiben. Das schafft für sie offenbar Nähe.
Unterschied zwischen Hochsprache und Dialekt verwischt
Bei Jugendlichen läuft der private schriftliche Austausch – per SMS, Chat, Mail, Whatsapp usw., aber auch in vielen nichtelektronischen Texten – heute fast ausschliesslich in der Mundart ab; für sie existiert der Unterschied zwischen Hochsprache und Dialekt nicht mehr, so dass die Linguisten längst von einem „Schriftdialekt“ sprechen. Interessant ist dabei, dass diese Tendenz zur Dialektisierung der Hochsprache zunehmend auch junge Erwachsene erfasst. Als unsere Tochter Flavia, die Lehrerin ist, für ihre beruflichen Leistungen vom Schulrat mit einer Prämie belohnt wurde, gratulierte ihr unser 28jähriger Sohn Fabio, der Jurist ist, mit folgender Mail:
Sehr geilö Flav
gratuliere vu herze
lg Fab (Herzchen)
Was an dieser Mail auffällt, sind nicht nur die Mundart und die Kürzung lg für „Liebe Grüsse“, sondern auch der typisch jugendliche Ausdruck „geilö“, der hier nichts weiter meint, als dass man etwas gut findet, und das Herzchen am Schluss, das nicht fehlen darf. Denn Jugendliche empfinden eine Nachricht als unvollständig, wenn nicht mindestens ein Smiley oder ein Herzchen gesetzt wird. Die Linguisten sprechen inzwischen gar von einer „Gefühlsstenografie“. Zu ihr gehört auch, ganz nach amerikanischem Vorbild, die informelle, stark emotional gefärbte Anrede, die inzwischen mehr und mehr auch von Erwachsenen, ja selbst von Unternehmen praktiziert wird, wie das folgende Beispiel zeigt, das übrigens meine Frau in St. Gallen entdeckt hat:

Man beachte in dieser etwas kumpelhaften Anwerbung nicht nur die typische Jugendsprache, sondern auch die mit ihr zusammenhängenden Anglizismen „hey“ und „cool“. Dass englische Wörter unsere deutsche Sprache zunehmend vereinnahmen, ist längst eine Tatsache. Dass sie bei Jugendlichen besonders beliebt sind, hängt unter anderem damit zusammen, sich als Gruppe von den Erwachsenen abgrenzen zu können. Dazu kommt das hohe Prestige des Englischen, wirkt es doch so modern, so snappy, so sexy, wie es Deutsch offenbar nicht kann. „Tschau Simon, see you later“ verabschieden sich Jugendliche untereinander heute. Und wenn sie etwas essen, dann „fooden“ sie, und wenn sie beim Essen ein Bier bestellen, dann rufen sie nicht einfach nach einem Bier, sondern dann heisst es „Hey Kellner, schwing mal a cold one rüber.“ Und wenn sie schliesslich etwas nicht hinbekommen, dann sagen sie nicht „Scheisse“, sondern „Shit“.
Jugendliche passen die Sprache der Situation an

Jugendliche schreiben heute informeller als noch vor 30 Jahren, machen z.T. auch deutlich mehr grammatische und orthografische Fehler. Das ist wahr. Dafür schreiben sie aber auch viel kreativer, wie neuere Studien gezeigt haben. Zudem können sie sehr wohl unterscheiden, ob sie eine SMS oder einen Deutschaufsatz schreiben. Sie passen ihre Sprache der Situation an. Und vergessen wir zum Schluss nicht: Die sprachlichen Anforderungen sind heute in einem Masse gestiegen, dessen wir uns erst allmählich bewusst werden. Was früher nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung sprachlich zu leisten war, wird heute von vielen gefordert. Daher kommt dem Auf- und Ausbau der Sprachfähigkeit unserer Jugendlichen in der Schule, aber auch später eine fundamentale Rolle zu. ♦
Geb. 1947, Studium der Germanistik und Geschichte in Zürich, 1975 Promotion über Jeremias Gotthelf, 1977 Diplom des höheren Lehramtes, danach Lehrtätigkeit am Gymnasium und als Lehrbeauftragter für Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität St. Gallen und an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, langjähriger Referent in der Fortbildung für die Mittelschul-Lehrkräfte und Leiter von Schriftstellerseminarien, seit 1996 Dozent für Literatur und Literaturtheorie an der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Linguistik; Verfasser mehrerer Publikationen und zahlreicher Beiträge zur modernen Dichtung, darunter das Standardwerk: Die Struktur der modernen Literatur; Mario Andreotti lebt in Eggersriet/CH
Lesen Sie im Glarean Magazin auch von Mario Andreotti:
♦ Aspekte und Tendenzen der neueren und neuesten Schweizer Literatur
Ausserdem zum Thema Kulturgeschichte über die Albert-Schweitzer-Monographie von Claus Eurich: Radikale Liebe

