Inhaltsverzeichnis
Urzeit-Zauber und Orkney-Klänge
von Wolfgang-Armin Rittmeier
Das schottische Label Delphian steht seit mittlerweile 17 Jahren für aussergewöhnliche Musikproduktionen jenseits des sogenannten „Mainstreams“. Es sind besonders Konzeptalben – wie die kürzliche erschienene Steinzeit-CD „The Edge of Time“ und Plädoyers für bislang Unerhörtes wie „The Last Island“, das Miniaturen und kammermusikalische Werke des im vergangenen Jahr verstorbenen Komponisten Sir Peter Maxwell Davies präsentiert -, die Delphian sein charakteristisches Gepräge verleihen. Und so zeigen diese beiden Alben Möglichkeiten musikalischer Rede auf einer Zeitachse auf, die etwa 43’000 Jahre umfasst. Dergleichen bieten nicht eben viele Labels.
Musik aus dem Paläolithikum: „The Edge of Time“
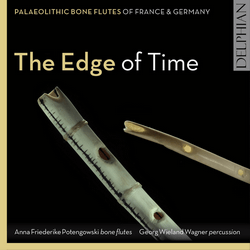 „The Edge of Time“, das Volume 4 der insgesamt herausragenden Reihe „European Archeology Project“, wirft also den Blick zurück in eine Zeit, die wir uns – wenn wir ehrlich sind – nicht wirklich vorstellen können. Wir schreiben das Ende des Mittelpaläolithikums, befinden uns in einer Welt am Rand der letzten Eiszeit und auf einem europäischen Kontinent, auf dem erstmals der anatomisch moderne Mensch auftaucht. In den Höhlen „Geissenklösterle“ und „Hohle Fels“ auf der Schwäbischen Alb sowie in der in Südfrankreich gelegenen Höhle von Isturitz entdeckte man in den letzten Dezennien – neben anderen Funden – auch Flöten aus Tierknochen (Mammut, Schwan, Geier).
„The Edge of Time“, das Volume 4 der insgesamt herausragenden Reihe „European Archeology Project“, wirft also den Blick zurück in eine Zeit, die wir uns – wenn wir ehrlich sind – nicht wirklich vorstellen können. Wir schreiben das Ende des Mittelpaläolithikums, befinden uns in einer Welt am Rand der letzten Eiszeit und auf einem europäischen Kontinent, auf dem erstmals der anatomisch moderne Mensch auftaucht. In den Höhlen „Geissenklösterle“ und „Hohle Fels“ auf der Schwäbischen Alb sowie in der in Südfrankreich gelegenen Höhle von Isturitz entdeckte man in den letzten Dezennien – neben anderen Funden – auch Flöten aus Tierknochen (Mammut, Schwan, Geier).
Uraltes Vokabular im Dialog mit der Moderne
Diese Flöten nun – genauer gesagt: die Rekonstruktionen dieser Instrumente – stehen im Zentrum der Einspielung. Die Flötistin Anna Friederike Potengowski hat sich mit diesen Instrumenten vom Rande der Zeit zwar wissenschaftlich auseinandergesetzt, das eigentlich Interessante aber ist, dass sie auch angegangen ist, ihnen Leben einzuhauchen und sie auf diese Weise der toten Welt des frühzeitlichen Raritätenkabinetts zu entreissen: „Die Idee des Projektes war es, die Gegenwartskultur mit ihren vergessenen Wurzeln in Kontakt zu bringen, etwas von dem uralten musikalischen Vokabular zurückzuholen und es in einen Dialog mit modernen musikalischen Ausdrucksformen zu setzen.“
Gemeinsam mit dem Perkussionisten Georg Wieland Wagner hat sich Potengowski also auf den nicht eben unproblematischen Weg der Nachempfindung begeben. Und diese Nachempfindung klingt in der Tat höchst faszinierend. Die Kombination der ein wenig scharfen, kratzigen, an die Panflöte erinnernden Knochenflötenklänge mit einer Gesangsstimme und den Naturmaterialien, die Wagner im Rahmen der Perkussion einsetzt (Holz, Stein, Heu, Wasser, Tierhaut), wirkt durchweg überzeugend. Aber auch, wenn plötzlich Marimba und Vibraphon zu Einsatz kommen, bleibt das, was die beiden Künstler an Musik erzeugen, atmosphärisch ausgesprochen dicht. Es wird eine Vielfalt an Stimmungen erzeugt, die der Hörer unmittelbar nachvollziehen kann: Heiterkeit, Klage, Meditation, Geheimnis, Magie – von all dem können diese uralten Knochen ebenso überzeugend singen wie die modernen Flöten, Oboen oder Englischhörner.
Begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten der Instrumente
Doch leider bleibt auch in Anna Friederike Potengowskis ansonsten durchweg informativen Einführungstext eine Frage unbeantwortet, die doch als Fixpunkt der Nachempfindung nicht unwichtig erscheint: In welchen Zusammenhängen spielten die frühen Menschen diese Instrumente? War es zum Zeitvertreib? War es um, nachts die grosse Stille der Welt zu vertreiben? Wurden sie im Rahmen von kultischen Handlungen eingesetzt? Hier wäre ein Hinweis auf Forschungsergebnisse informativ gewesen. Davon abgesehen ist das einzige Manko dieser an sich wirklich rundum gelungenen Produktion vielleicht die Spielzeit von gut 65 Minuten. Denn man kann nicht daran vorbeireden, dass sich nach nicht allzu langer Zeit des Hörens das Gefühl einstellt, dass die Möglichkeiten der Gestaltung von Musik mit diesen Instrumenten – so überzeugend diese an sich auch ist – auch ihre Grenzen hat. Und so schleicht sich nach einiger Zeit der ungute Eindruck der Redundanz und kreativen Ermüdung ein, aufgrund dessen man neben das „Sehr gut“, das diese Produktion im Ganzen verdient hat, wohl ein kleines „Minus“ setzen muss. 40 Minuten hätten gereicht. ♦
The Edge of Time, Palaeolithic Flutes of France & Germany, Anne Friederike Potengowski & Georg Wieland Wagner, Audio-CD, 64 Minuten, Delphian CD-Label
Lesen Sie im Glarean Magazin zum Thema „Alte Instrumente“ auch über Ariel Ramirez: Misa Criolla
Eine Postkarte von den Orkneys: „The Last Island“
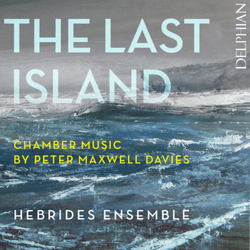 Am anderen Ende des Zeitstrahles nun findet sich jene Musik, die die CD „The Last Island“ vorstellt. Sie präsentiert kammermusikalische Kompositionen der Gegenwart aus der Feder des 2016 verstorbenen Komponisten Sir Peter Maxwell Davies. Viele der Werke, die auf dieser CD enthalten sind, sind über die Jahre für das schottische Hebrides Ensemble komponiert worden, das hier für die Gestaltung der zehn mehr oder minder knappen Stücke verantwortlich zeichnet. Der künstlerische Leiter des Ensembles, William Conway, war über 30 Jahre hinweg freundschaftlich mit dem Komponisten verbunden. In seinem einleitenden Text zur Aufnahme versucht er zu erklären, was das ganz besondere an den hier eingespielten Werken ist, die allesamt zwischen 1991 und 2016 entstanden sind: „Man kann es so sehen, dass die Kammermusik, von der eine Menge unter dem Schatten von Krankheit entstanden ist, […], Max‘ eigene letzte Insel war, seine Version der verzichtenden, freigebenden Gesten des Prospero […].“
Am anderen Ende des Zeitstrahles nun findet sich jene Musik, die die CD „The Last Island“ vorstellt. Sie präsentiert kammermusikalische Kompositionen der Gegenwart aus der Feder des 2016 verstorbenen Komponisten Sir Peter Maxwell Davies. Viele der Werke, die auf dieser CD enthalten sind, sind über die Jahre für das schottische Hebrides Ensemble komponiert worden, das hier für die Gestaltung der zehn mehr oder minder knappen Stücke verantwortlich zeichnet. Der künstlerische Leiter des Ensembles, William Conway, war über 30 Jahre hinweg freundschaftlich mit dem Komponisten verbunden. In seinem einleitenden Text zur Aufnahme versucht er zu erklären, was das ganz besondere an den hier eingespielten Werken ist, die allesamt zwischen 1991 und 2016 entstanden sind: „Man kann es so sehen, dass die Kammermusik, von der eine Menge unter dem Schatten von Krankheit entstanden ist, […], Max‘ eigene letzte Insel war, seine Version der verzichtenden, freigebenden Gesten des Prospero […].“
Bezug zur Lebensumwelt des Komponisten
Greift man diesen Gedanken auf, so findet sich leichter ein Zugang zu diesen nicht selten bedrohlich-düsteren, unheimlich-magischen, sperrigen, aber auch nicht selten tiefe Melancholie offenbarenden Werken. Oft beziehen sich die Kompositionen, will man den Worten Davies‘ Glauben schenken, auf Erscheinungen der Lebensumwelt des Komponisten, der sich zu Beginn der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts auf den Orkney Islands niedergelassen hatte. So ist das Streichsextett „The Last Island“ von zwei unbewohnten Inseln inspiriert, die in der Nähe seiner Wahlheimat Sanday sind.
Das ständige Changieren zwischen dunkel gehaltenen, weitgehend ruhigen Passagen, die sich nicht selten durch einen nostalgischen Ton auszeichnen, und erregten Abschnitten, die rauschen, tänzeln und schwirren, versinnbildlicht trefflich die beiden Felsen im tosenden Ozean. Eine echte Meeresmusik, die in ihrer gesamten Haltung von fern an Bax‘ Tondichtung „Tintagel“ gemahnt. Von der Orkney-Insel Sanday aus schreibt er auch musikalische Postkarten („Postcard from Sanday“) oder eine „Birthday Card for Jennifer“ – reizende Miniaturen, von Philip Moore am Klavier überzeugend in Szene gesetzt.
Spannungsfeld von Lyrik und Dramatik

Der Rest der hier zu hörenden Werke aber zeichnet sich durch eine Herbheit, Nervosität und Trancehaftigkeit aus, die insbesondere auf der Folie der von Conway angedeuteten Entstehungsbedingungen eine besondere Prägnanz und Dringlichkeit erhält. Ähnlich wie im Fall von Bruckners neunter Symphonie scheint hier ein Komponist am Abgrund fieberhaft zu Werke zu gehen. Für diesen Peter Maxwell Davies legen sich die Musikerinnen und Musiker des Hebrides Ensembles nicht nur ins Zeug: sie atmen ihn förmlich und legen eine rundheraus grandiose Interpretation dieser Werke vor. Man mag hinsehen (oder hinhören), wohin man möchte, und kann doch immer wieder nur zu dem einen Ergebnis kommen. Sei es Gestaltung der gespenstisch-gewichtigen „Nocturnes“ für Klavierquartett, des sich in einem enormen Spannungsfeld von Lyrik und Dramatik bewegenden „Oboenquartett“, der zwischen Unerbittlichkeit und romantischster Tonsprache schwankenden „Sonate für Violine und Klavier“ oder dem Streichquartettsatz aus dem Jahre 2016, dem letzten Werk, an dem Peter Maxwell Davies arbeitete: das Hebrides Ensemble und die Musik von Peter Maxwell Davies sind in jeder Hinsicht füreinander gemacht. Ob man dereinst eine weitere Aufnahme dieser Werke braucht? Ich bezweifle es. ♦
The Last Island, Chamber Music by Peter Maxwell Davies, Hebrides Ensemble, Audio-CD, 76 Minuten, Delphian CD-Label
Lesen Sie im Glarean Magazin zum Thema Kammermusikalische Moderne auch über Audio-CD
Franz Schubert & Jörg Widmann: Oktette
