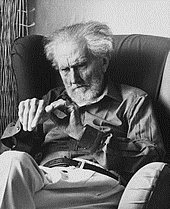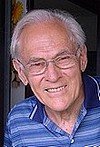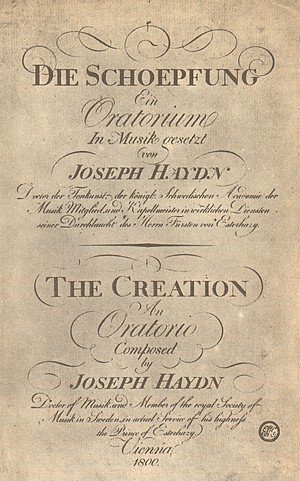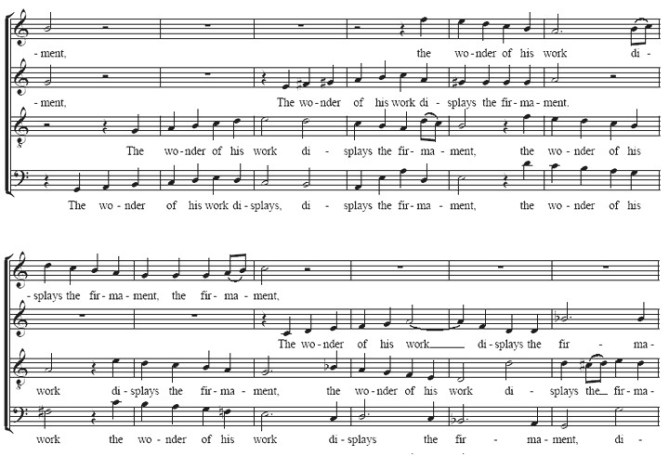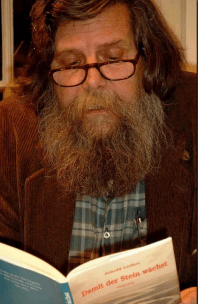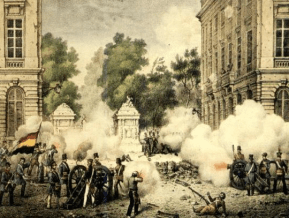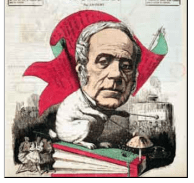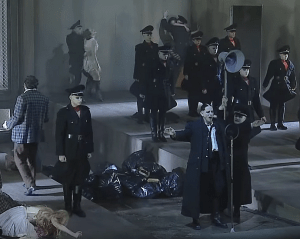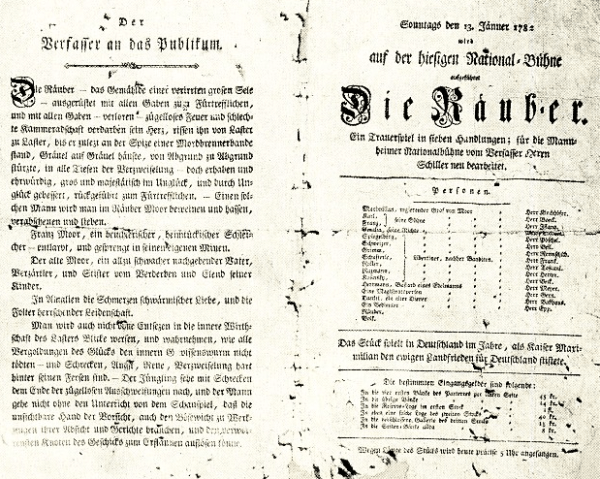Nachdenken über Luxus
Einige Anmerkungen zum Schreiben von Gedichten
von Bernd Giehl
Das kleine Gesicht im Wintermantel:
Trauermund, Warteaugen, Schrittklein
in den Hof, den Stall, die Viehspuren
im Strassenschmutz schon lang verwischt.
Waldmeisteressenz und Brunnenwasser
gegen den grossen Durst.
Neben der Wasserbank eine Schöpfkelle.Sigfrid Gauch: „Morgentod“
1.
32 Worte. So viel wie wir Normalsterblichen sonst für drei Sätze benötigen. 32 Worte nur, aber ein Text, an dem das Auge hängenbleibt, den man wieder und wieder liest, fast wie eine Offenbarung, den man wahrscheinlich nie mehr vergisst.
32 Worte. Gefunden in einer Spalte namens „ZEITmosaik“ in der „ZEIT“ vom 28. Juni 97. Eine Spalte, über die ich sonst schnell hinweglese; den Namen des Verfassers, Sigfrid Gauch, habe ich vorher noch nie gehört. Aber dieses Gedicht rührt mich an, wie nur weniges sonst. Fast möchte ich behaupten: es ist „vollkommen“. Vollkommen wie eine Arie aus der „Matthäuspassion“ von Bach. Oder wie ein Bild von Manet.
Über Schönheit nachdenken, wenn Hässlichkeit angesagt ist?
Und jetzt höre ich auch schon wieder das Wetzen der Messer. Darf man das, über „Schönheit“ nachdenken, wenn doch allgemein eher „Hässlichkeit“ angesagt ist? Seit Baudelaire seine „Fleurs du mal“ schrieb, seit Rimbaud eine „Zeit in der Hölle“ verbrachte, seit dem Beginn der „Moderne“ also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, lebt die Kunst – Malerei, Literatur, Musik – doch eher von der Dissonanz, der Beschreibung des Hässlichen und Abstossenden. Die Kunst reagierte damals auf die zunehmende Hässlichkeit, hervorgerufen vor allem durch die Industrialisierung. Dass es seither aufwärts gegangen wäre mit der Welt, kann man eigentlich nicht behaupten.
Wäre also nicht statt des Nachdenkens über Gedichte ein flammender Protest gegen den Afghanistan-Krieg oder die ewigen Streitereien der schwarzgelben Regierung angesagt? Das alles sind sicher wichtige Themen. Und doch will ich hier nur eins tun: über Gedichte nachdenken. Über das, was mich und sicher auch andere an ihnen fasziniert.
Vermutlich sind Gedichte unnötig. Wahrscheinlich brauchen wir viel eher Arbeitsplätze als Gedichte. Aber wer Brot hat, möchte womöglich irgendwann auch Butter dazu. Das ist unverschämt; ich weiss. Gut möglich, dass eines Tages der Genuss verboten wird, weil er unmoralisch ist; in Amerika sind sie ja schon so weit. Solange der Genuss jedoch noch nicht verboten ist, (solang man sogar noch in der Öffentlichkeit rauchen darf), solange kann man einstweilen noch über Gedichte nachdenken. Und was es eigentlich ist, das sie (oder jedenfalls manche von ihnen) über die Banalität all dessen erhebt, was täglich geredet und geschrieben wird.
2.
Die Schönheit von Gedichten also. Und zwar nicht von Goethe- oder Eichendorff-Gedichten, sondern von moderner Lyrik. Auch ein Gedicht wie Goethes „Über allen Wipfeln ist Ruh“ ist „schön“, aber wer heute noch so schreiben würde, wäre ein hoffnungsloser Fall. Bilder von erhabenen Gipfeln, von rauschenden Bächen, das geht nicht mehr; an ihre Stelle muss anderes treten. Auch die Formen sind andere geworden; Hexameter und Jambus, das war einmal, obwohl es mittlerweile auch wieder Gedichte mit Endreim gibt. Überhaupt ist es schwieriger geworden, von „Form“ zu sprechen, wo so viele Formen sich aufgelöst haben und neue Formen zwar entstanden, jedoch nur schwer abzugrenzen sind. Zwischen einem Rilke-Gedicht und einem Gedicht von Erich Fried stehen Welten, und wer das nicht glaubt, lege einmal Frieds „Massnahmen“ neben die „Duineser Elegien“.
Spannung in wenigen Zeilen
Und dennoch gibt es etwas, was Lyrik abgrenzt von Prosa, was sie erkennbar macht. Wo eine Geschichte oder ein Roman Zeit braucht, um sich zu entwickeln, Spannung zu erzeugen oder was immer auch den Leser daran hindert, zur Fernbedienung zu greifen, da muss das Gedicht in wenigen Zeilen das Gleiche leisten. Und das kann es nur durch seine besondere Sprache, die so schwer zu benennen ist: „leuchtend“ vielleicht, oder „verdichtet“. Dabei spielt der Rhythmus immer noch eine grosse Rolle, und auch die Bilder, die ein Gedicht verwendet, sind wichtig. Oft sind es ungewohnte, vielfach nur angedeutete Bilder, wie man an Gauchs Gedicht sehen kann. Dieses Gedicht besticht mit seiner Sprache. Ungeheuer konzentriert ist sie, fast möchte ich sagen: „sinnlich“. Verkürzt gesagt: ein Roman kann notfalls auch mit einer schwächeren Form auskommen; für ein Gedicht ist das tödlich.
Was ist die Besonderheit der lyrischen Sprache?
Fragen wir also ruhig einmal nach der Besonderheit der lyrischen Sprache. Und nehmen wir – pars pro toto – Gauchs Gedicht „Morgentod“ dazu. Was wahrscheinlich als erstes bei diesem Gedicht ins Auge springt, sind die ungewöhnlichen Substantive in der zweiten Zeile: „Trauermund“ – doch ja, das könnte man schon einmal gelesen haben; „Warteaugen“ – schon schwieriger; aber „Schrittklein“ – das sieht nun doch schon sehr nach Neuschöpfung der Sprache aus;. Was ja in der Lyrik nichts Ungewöhnliches ist, auch wenn das Überraschungsmoment sonst eher in der Zusammenstellung der Bilder liegt (unübertrefflich, auch hier, Paul Celan, z.B. in „Spät und Tief“: „Boshaft wie goldene Rede beginnt diese Nacht/ wir essen die Äpfel der Stummen …“)
Nun bringt der Vergleich mit Celan nicht allzu viel ein, denn dieses Gedicht ist eigentlich nicht „dunkel“, auch wenn es sich gewiss nicht dem ersten flüchtigen Lesen erschliesst. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass hier die Verben fehlen. Ein paar Adjektive und Präpositionen; ansonsten nur Substantive. Die Person, die hier „handelt“ ist absichtlich im Unklaren gelassen. Beschrieben wird eigentlich nur ihr Gesicht: „Das kleine Gesicht im Wintermantel:/ Trauermund, Warteaugen, Schrittklein“; möglich dass es sich um ein Kind handelt, aber vielleicht ist es auch ein Erwachsener, der an einen Ort seiner Kindheit zurückkehrt. Dieser Ort ist ein Bauernhof. Der Brunnen, der hier (wiederum indirekt) erwähnt wird, lässt Vergangenes erahnen; möglich, dass dieser Hof schon lange nicht mehr bewirtschaftet wird. Allenfalls als Wohnung dient er noch, und doch ist er ein wichtiger Ort für den Sprecher, das „lyrische Ich“. Durch das Gedicht bekommt dieser Ort eine Bedeutung, die der reale Hof nie gehabt hat. Die gewollte Unschärfe der Beschreibung – alles wird nur angedeutet – setzt die Phantasie des Lesers in Gang. Er ist es, der den Zwischenraum zwischen den Worten füllen muss mit eigenen Assoziationen. Seine Erinnerung wird gebraucht. Und das ist es wahrscheinlich, was den Leser schliesslich in seinen Bann zieht.
3.
Die Sprache ist es also, die ein Gedicht ausmacht. Eine Sprache, die eher andeutet als benennt, die Zwischenräume schafft, die es nötig macht, dass man zwischen den Zeilen liest. Sie kann feierlich sein, ungewohnt, sie kann mit ungewöhnlich zusammengesetzten Bildern arbeiten, aber sie muss es nicht. Es gibt auch (scheinbar) lakonische Gedichte; dafür ein Beispiel aus dem „Jahrbuch der Lyrik 97/98“, (in dem ich später auch Gauchs Gedicht gefunden habe):
Seit ich hier bin
Seit ich hier bin trage ich Taschen
voller Papiere, fahre ich Fahrstuhl
telefoniere, trinke Kaffee wie ein Mann
mit Terminen , liege ich schlaflos,
interpretiere, huste und reime, traurige
Tiere, spende dem Geiger in der Passage
einen Gedanken, was ist das Leben,
wenn nicht ein Geigen in den Passagen,
was kann er tun und was soll ich sagen:
Pflege Kontakte und streue Asche auf
deine Akte. So ist das hier.Hans Ulrich Treischel
Auch hier werden, wie in „Morgentod“, Orte benannt. Aber im Gegensatz zu dem eingangs besprochenen Gedicht sind es Orte, die nicht viel bedeuten: ein Büro, der Fahrstuhl, eine Passage. Der Tonfall ist locker, ironisch. So ganz ernst scheint das „Ich“ in diesem Gedicht sich nicht zu nehmen. Der, der hier spricht, ein Angestellter offensichtlich, schaut sich selbst über die Schulter. Natürlich muss er so tun, als ob er arbeite, aber er nimmt das alles nicht so eng; womöglich schreibt er sogar Gedichte in seiner Arbeitszeit.
Das Leben: Ein Geigen in den Passagen?
Doch wenn man genauer hinschaut, ist die Lakonie, die einem förmlich entgegenspringt, nichts als eine Maske. Eine schwer greifbare Trauer spricht aus diesem Gedicht, eine Trauer über das mit Akten und Terminen vertane Leben. Das Leben ist ein „Geigen in den Passagen“; offensichtlich wird der Strassenmusikant zu einem Bild für das geschäftige Leben, das den armen Strassenmusikanten dort stehenlässt, wo er steht. Es gibt wohl kaum einen ungeeigneteren Ort für einen Musiker als die Strasse. Leute bleiben kurz stehen und hören zu, aber sie haben keine Zeit, das ganze Stück anzuhören, also werfen sie eine Mark in den Geigenkasten und gehen weiter. Lieber als hier zu stehen würde man an der Met spielen oder bei den Wiener Philharmonikern, aber was will man machen, es gibt einfach zu viele Musiker, Künstler, Dichter, Menschen…
Es ist die Kunst dieses Gedichts, diese – doch eher schweren – Gedanken hinter der (scheinbaren) Leichtigkeit des Tons zu verbergen. Kunstvoll ist auch der Reim, der sich durchzieht, aber nicht als Endreim, sondern an den Zeilenanfängen, wo man ihn nicht beim ersten Lesen bemerkt. Überhaupt muss man auch dieses Gedicht mehrmals lesen, bis es sich einem erschliesst. Aber davon sprachen wir schon.
4.
Und da kommt mir nun ein Begriff in den Sinn, der für mein Verständnis von Literatur eine grosse Rolle spielt, den man aber auch auf Lyrik im Besonderen anwenden kann. Es ist der Begriff des Spiels. Gedichte – so denke ich – „spielen“ mit ihrem Gegenstand. Woraus auch immer sie entstehen – und das ursprüngliche Material kann so banal sein wie es will -, sie verwandeln dieses Material.
Gedichte spielen mit Bildern, Rhythmen, Reimen, mit Assoziationen, Klängen, Bedeutungen, mit allem, was ihnen zwischen die Buchstaben gerät. Es ist ein Spiel, dessen Regeln sich nicht von vornherein festlegen lassen; aber natürlich gibt es Regeln, weil sonst das Spiel aufhörte, Spiel zu sein. Gedichte schreiben ist ein hoch artifizielles Spiel; man kann es erlernen, wie man das Jonglieren erlernen kann; man braucht dazu Begabung und einiges an Übung.
Vor vielen Jahren hat der Literaturwissenschaftler Mario Andreotti in der Schweizer Literaturzeitschrift „Scriptum“ die assoziative Verknüpfung ansonsten disparater Wortgruppen, das Weglassen von Verben und die Verknappung als Zeichen eines guten Gedichts genannt. („Was ist heute ein gutes Gedicht? Über einige Kriterien zeitgenössischer Lyrik“, in: „Scriptum“ 21/95) Dies können Kriterien für ein gutes Gedicht sein; sie haben aber keinen Ausschliesslichkeitscharakter, wie man an dem Gedicht von Treischel, aber auch an vielen Gedichten von Brecht z.B. deutlich erkennen kann.
Sind Gedichte Luxus?
Sind Gedichte also Luxus? Für die Verleger ganz bestimmt; an einem Gedichtband verdienen sie nur in den wenigsten Fällen. Für die Leser wahrscheinlich auch: sie informieren weder über den Börsenkurs noch geben sie Hinweise, wie die politische Situation zu verändern sei. Womöglich sind sie nicht einmal unterhaltsam oder belehrend, wie ein Roman das sein kann.
Mag sein, dass sie einfach nur spielen: mit dem Klang, den Worten, den Bedeutungen, mit der Sprache. Dem „l’art pour l’art“ stehen sie meist näher als ein Roman oder eine Geschichte. Romane müssen, Gedichte können Inhalte transportieren. Womöglich ist so manches Gedicht mehr dem schönen Klang geschuldet, als dass es wichtige Gedanken zu transportieren gehabt hätte, auch wenn ich natürlich nicht verrate, an welche Gedichte oder welchen Dichter ich denke. Auf die Klanggedichte z.B. eines Franz Mon, die allen Wert auf „Form“ legen, denen die Worte nur Material sind und keine Botschaften transportieren, sei hier nur am Rande hingewiesen.
Soll ein Gedicht einfach nur „Schönheit“ vermitteln?
Aber warum soll ein Gedicht nicht einfach nur „Schönheit“ vermitteln? Oder das Spiel mit der Sprache ins Extreme treiben, wie es die schon erwähnten Poeten tun? Sprache ist eben Bedeutung und Klang, und genau das ist es, was Gedichte sich zunutze machen. Oder andersherum: ohne diese Tatsache würden Gedichte gar nicht geschrieben werden können.
Doch ja, Gedichte sind Luxus. Und der Forderung nach Hässlichkeit kommen sie auch eher in seltenen Fällen nach. Man muss Luxus nicht mögen. Man kann durchaus auch auf ihn verzichten. Manchmal sprechen Gedichte – wie das eingangs zitierte von Gauch – von Dingen und Orten, die es (so) nicht mehr gibt.
Wer will, kann das für „reaktionär“ halten. Ich für meinen Fall würde auf manches andere lieber verzichten wollen als auf Gedichte. ♦
 Bernd Giehl
Bernd Giehl
Geb. 1951 in Marienberg/D, Studium der Theologie in Marburg, verschiedene literarische und theologische Publikationen, lebt als evang. Pfarrer in Nauheim