Das Zitat der Woche
.
Über das Lächeln
Helmuth Plessner
.
Lächeln ist Mimik des Geistes. Wir können auch sagen: Mimik der menschlichen Position. Wie aber steht es dann mit Lachen und Weinen? Steht das Urteil nicht in Widerspruch zu unserer eigenen These, daß Lachen und Weinen Monopole des Menschen sind, Ausdrucksweisen seiner exzentrischen Position? Zunächst sind beide überhaupt keine mimischen Gebärden, sondern Katastrophenreaktionen an Grenzen menschlichen Verhaltens. Als Ausbrüche ziehen sie auch die Mimik in Mitleidenschaft, jedoch durch Verlust unserer Selbstbeherrschung und damit auch unserer Herrschaft über den eigenen Körper. Dieser Verlust trifft den Menschen in Situationen, auf die er keine Antwort weiß, da sie durch ihre Mehrdeutigkeit oder Unvermitteltheit zugleich an sein Verständnis appellieren und ihn der Mittel berauben, ihrer Herr zu werden. Ein Wesen ohne Verständnis, ein ungeistiges Wesen könnte demnach seiner Inkongruenz mit der Situation nicht gewahr werden. Nur ein geistiges Wesen vermag auf solches Mißverhältnis entsprechend, d.h. in diesem Falle mit einem Bruch zwischen sich und seinem Leib zu reagieren.
Lachen und Weinen sind unbeherrschte und gebrochene Antworten auf Situationen, welche beherrschte, auf geordnetem Verhältnis der Person zu ihrem Leib beruhende und solches Verhältnis wahrende Antworten unmöglich machen, doch die Person zugleich zur Antwort zwingen. Wenn die Formel erlaubt ist: sinnvolle Fehlreaktionen mit Hilfe eines Bruchs zwischen Mensch und Körper. Die Distanziertheit der menschlichen Person wird als Bruch im Verlust ihrer Selbstbeherrschung sichtbar. Ein physischer Automatismus tritt an die Stelle artikulierter, von der Person selbst ausgehender Antworten. Ein Wesen ohne Distanz, ohne Exzentrum kann nicht objektivieren, nicht begreifen, kennt weder Sinn noch Unsinn und vermag darum weder zu lachen noch zu weinen. Es vermag, da es nicht »über sich« steht, auch nicht, »unter sich« zu fallen. Nur wer Selbstbeherrschung besitzt, kann sie verlieren.In ihrem Verlust wird die Distanziertheit, die Geistigkeit manifest. Ihr explosiver und desaströser Ausdruck reißt auch die Mimik mit sich, läßt aber der Person gerade keine Freiheit zu ausdrückender Gebärde mehr. Sie ist das katastrophale Ende aller Mimik, wiewohl darin ein Zeugnis menschlicher Distanz und ein Monopol des Menschen. Im Lächeln dagegen bewahrt er seine Distanz zu sich und zur Welt und vermag sie, mit ihr spielend, zu zeigen. Lachend und weinend ist der Mensch das Opfer seines Geistes, lächelnd gibt er ihm Ausdruck.
In seiner lehrreichen Auseinandersetzung mit den Auffassungen Duchennes, Spencers und Dumas’ vom Mechanismus des Lächelns kommt Buytendijk, wiewohl am üblichen Gedanken festhaltend, Lächeln sei Einleitung des Lachens, Ausdruck der Freude, zu dem trefflichen Satz, seine Paradoxie bestünde in der Spannung einer Muskelgruppe, welche Spannung als Entspannung einer aktiven Ruhehaltung erlebt werde. Diese bilde zugleich die Vorbedingung für die Entwicklung einer ausdrucksfähigen Innerlichkeit, somit für die Erscheinung des Lächelns als echter Ausdrucksbewegung. Hiermit ist phvsiologisch fixiert, was wir Abstand im Ausdruck zum Ausdruck nannten. Sicher trifft auch seine Zeichnung der Genese etwas Richtiges, die er als Entwicklung aus einer puren Reaktion auf ein passiv erlebtes ambivalentes Lustgefühl, den Kitzel, zu einem aktiven Lächeln, einem Suchen nach expansivem Gefühl – wir sprechen von Lockerung – sieht. Das Lächeln wird dann Ausdruck einer Vorwegnahme und zugleich Reaktion auf eine sinnlich bestimmte Empfindung, die sensorische Verlegenheit. Freilich scheint mir die Entfaltung des ausdrücklicken Lächelns hier zu stark an ein sinnliches Anfangsstadium gebunden und seiner Emanzipationsfähigkeit zu wenig Rechnung getragen. Selbst wenn das erste Lächeln des Kleinkindes Reaktion auf kitzelnde Reize wäre, brauchte seine weitere Ausbildung zum Ausdruck der Lockerung nicht an Verlegenheit und strukturell verwandte »Freuden« gebunden oder darauf bezogen zu sein. Hier macht sich auch für die Entwicklungspsychologie des Phänomens die einseitige Auffassung als Einleitung des Lachens und als Ausdruck der Freude störend bemerkbar. Wie für die Genese des Lachens und Weinens hat auch für dir Genese des Lächelns der methodische Grundsatz zu gelten, daß man erst den vollentwickelten Ausdruck in seinem vollen Sinn verstanden haben muß, will man seine Keimformen richtig taxieren.
Nur dann wird die Gefahr der Überbestimmung ebenso wie der Unterbestimmung eines Ausdrucksphänomens vermieden. Das Diffuse in den kindlichen Reaktionen kann erst zum Ansatz eines Studiums gemacht werden, wenn ihre entwickelten Endstadien bekannt sind, so aufschlußreich auch der erinnernde Rückblick auf ihre Keimformen bleibt. Die Formel: Lächeln ist Ausdruck des Geistes, scheint das Phänomen viel zu hoch und einseitig im Hinblick auf gewisse Formen des Lächelns beim Erwachsenen zu nehmen, für die einfachen Freuden des sinnlichen Wohlseins und Behagens und für die entsprechenden Gebärden des Kleinkindes dagegen verfehlt. Nimmt man sie freilich in verengter Bedeutung, als Gebärdensprache und Sinnbezüge andeutendes Gebaren, dann fällt das sinnlich-reaktive und vitale Lächeln aus dem Bereich der Formel. Jedoch auch das »nicht mehr« andeutende und zu verstehen gebende Lächeln des Friedens, des Erlöstseins und der Entrückung, das sich bisweilen auf dem Antlitz der Toten malt, gehört dann nicht mehr dazu.
Wird Lächeln Ausdruck, dann drückt es in jeder Form die Menschlichkeit des Menschen aus. Nicht nur so wie jede Expression bei ihm, auch die ungehemmteste der starken Affekte, noch etwas Menschliches durchscheinen läßt, nicht wie Lachen und Weinen, die als Monopole m spezifischen Formen eines Verlusts seiner Selbstbeherrschung zum Vorschein kommen, sondern in aktiver Ruhehaltung und beherrschtem Abstand. Noch in den Modifikationen der Verlegenheit, Scham, Trauer, Bitterkeit, Verzweiflung kündet Lächeln ein Darüberstehen. Das Menschliche des Menschen zeigt sich nicht zufällig in leisen und gehaltenen Gebärden, sein Adel in Lockerung und Spiel; wie eine Ahnung im Anfang, wie ein Siegel im Ende. Überall, wo es aufscheint, verschönt sein zartes Leuchten, als trage es einer Göttin Kuß auf seiner Stirn.Aus Helmuth Plessner, Das Lächeln, in: Philosophische Anthropologie, S.Fischer Verlag 1970
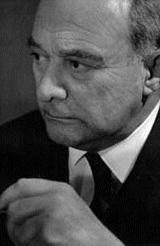





leave a comment