Das Zitat der Woche
.
Über die Realität im Schauspiel
Georg Simmel
.
Wie zurückhaltend und kritisch man auch über die »allgemeine Meinung«, über die Vox populi denken möge – die dunklen Ahnungen, Instinkte, Wertungen der groβen Masse haben in der Regel einen Kern von Zutreffendem und Zuverläβigem, den freilich eine dicke Schale von Oberflächlichem und Verblendetem umgibt; aber er wird im Religiösen und im Politischen, im Intellektuellen und Ethischen doch immer wieder als eine fundamentale Richtigkeit fühlbar werden.
Nur auf einem Gebiet, das sogar zugänglicher als jene anderen erscheint, zeigt sich das Urteil der Allgemeinheit als sozusagen von allen Göttern verlassen, gerade im Fundamentalen schlechthin unzulänglich: auf dem Gebiete der Kunst. Hier trennt ein brückenloser Abgrund die Meinung der Majorität von aller Einsicht in das Wesentliche, und in ihm wohnt die tiefe soziale Tragik der Kunst.
Der Schauspielkunst gegenüber, die mehr als jede andere an das unmittelbare Publikum appelliert, scheint deshalb allenthalben in dem Maβe von dessen massenmässiger Demokratisierung der Wertmaβstab sich von dem eigentlich Künstlerischen weg zu der Unmittelbarkeit des Natureindrucks zu wenden. Und, eigentümlich hiermit zusammenhängend, scheint das Wesen dieser Kunst selbst ihren Naturalismus tiefer als jede andere Kunst zu begründen. Denn so ungefähr wird dieses Wesen populär verstanden: durch den Schauspieler wurde das Dichtwerk »real gemacht«.
Das Drama besteht als abgeschlossenes Kunstwerk. Hebt der Schauspieler dies nun in eine Kunst zweiter Potenz? Oder wenn dies sinnlos ist, führt er, als leibhaftig lebende Erscheinung, es nicht doch in die überzeugende Wirklichkeit zurück? Warum aber, wenn dies der Fall ist, fordern wir von seiner Leistung den Eindruck von Kunst und nicht den von bloβer realer Natur? In diesen Fragen treffen sich alle kunstphilosophischen Probleme der Schauspielkunst.Die Bühnenfigur, wie sie im Buche steht, ist sozusagen kein ganzer Mensch, sie ist nicht ein Mensch im sinnlichen Sinne – sondern der Komplex des literarisch Erfassbaren an einem Menschen. Weder die Mienen noch den Tonfall, weder das Ritardando noch das Accelerando des Sprechens, weder die Gesten noch das Maβ anschaulicher Lebendigkeit der Gestalt kann der Dichter zeichnen oder auch wirklich unzweideutige Prämissen dafür geben. Er hat vielmehr Schicksal, Erscheinung, Seele dieser Gestalt in den nur eindimensionalen Verlauf des bloβ Geistigen projiziert. Diesen nun überträgt der Schauspieler gleichsam in die Dreidimensionalität der Vollsinnlichkeit. Und hier liegt das erste Motiv jener naturalistischen Verbannung der Schauspielkunst in die Wirklichkeit. Es ist die Verwechslung der Versinnlichung eines geistigen Gehaltes mit seiner Verwirklichung.
Wirklichkeit ist eine metaphysische Kategorie, in Sinnesimpressionen gar nicht auflösbar: der Inhalt, den der Dichter zum dramatischen gestaltet hat, zeigt ganz verschiedene Bedeutung, wenn er von da aus in die Kategorie sinnlicher Gestaltung wie wenn er in die der Wirklichkeit überginge. Der Schauspieler versinnlicht das Drama, aber er verwirklicht es nicht, und deshalb kann sein Tun Kunst sein, was Wirklichkeit ihrem Begriffe nach eben nicht sein könnte. So erscheint Schauspielerei zunächst als die Kunst der Vollsinnlichkeit, wie Malerei die Kunst der Augensinnlichkeit, Musik die der Gehörssinnlichkeit ist.
Innerhalb des realen Daseins ist jedes einzelne Stück und Ereignis in endlos weiterwebende Reihen räumlicher, begreiflicher, dynamischer Art eingestellt. Darum ist jede einzelne bezeichenbare Wirklichkeit ein Fragment, keine ist eine in sich geschlossene Einheit. Zu einer solchen aber die Inhalte des Daseins zu gestalten, ist das Wesen der Kunst. Der Schauspieler hebt alle Sichtbarkeiten und Hörbarkeiten der Wirklichkeitserscheinung in eine gleichsam eingerahmte Einheit: durch die Gleichmäβigkeit des Stiles, durch die Logik in Rhythmus und Ablauf der Stimmungen, durch die fühlbar gemachte Beziehung jeder Äuβerung auf den beharrenden Charakter, durch das Abzielen aller Einzelheiten auf die Pointe des Ganzen. Er ist der Stilisierer aller sinnlichen Beeindruckbarkeiten als einer Einheit.
Von neuem aber scheint an diesem Punkt die Realität in den Kunstbezirk einzubrechen, um eine innere Lücke in ihm zufüllen. Woher weiβ der Schauspieler sein durch die Rolle notwendig gemachtes Verhalten, da, wie ich andeutete, es in der Rolle nicht steht und nicht stehen kann? Mir scheint: wie sich Hamlet zu benehmen hat, kann der Schauspieler unmöglich anderswoher wissen, als aus der Erfahrung, der äuβeren und vor allem der inneren, wie ein Mensch, der wie Hamlet spricht und Hamlets Schicksal erlebt, sich in Wirklichkeit zu verhalten pflegt. Der Schauspieler taucht also, von dem Dichtwerk nur geführt, in den Realitätsgrund hinab, aus dem auch Shakespeare es erhoben hat, und erschafft von ihm aus das schauspielerische Kunstwerk Hamlet.
Die Dichtung führt den Schauspieler auf reale Koordinationen von Innerem und Äuβerem hin, von Schicksal und Reaktion, von Ereignissen und dem Luftton um sie herum – Koordinationen, zu denen auch jene Führung ihn nie bringen könnte, wenn er sie oder ihre schlusskräftigen Analogien nicht empirisch, in der Kategorie der Realität, kennen gelernt hätte.
Und nun schlieβt der Naturalismus: da der Schauspieler ausser dem Hamlet Shakespeares nur die empirische Wirklichkeit hat, an der er sich für alles von Shakespeare nicht Gesagte orientieren kann, so muss er sich so benehmen wie ein realer Hamlet, der auf die von Shakespeare vorgezeichneten Worte und Ereignisse festgelegt ist, sich benehmen würde. Dies ist dennoch ganz irrig; über jene Wirklichkeit, zu der der Schauspieler gleichsam an der Hand des Dramas hinabsteigt, über das sozusagen passiv gewonnene Wissen, das den Stoff für die Gestalt Hamlets bietet, kommt nun die Aktivität der künstlerischen Formung, der Aufbau des künstlerischen Eindrucks. Er hält an der empirischen Wirklichkeit nicht still. Jene realen Koordinationen werden umgelagert, die Akzente abgetönt, die Zeitmaβe rhythmisiert, aus allen Möglichkeiten, die diese Wirklichkeit gibt, das einheitlich zu Stilisierende ausgewählt. Kurz, der Schauspieler macht auch um dieser Unentbehrlichkeit der Realität willen nicht das dramatische Kunstwerk zur Realität, sondern umgekehrt, die Wirklichkeit, die jenes ihm zugewiesen hat, zum schauspielerischen Kunstwerk.
Wenn heute viele sensible Menschen ihre Aversion gegen das Theater damit begründen, dass ihnen dort zuviel vorgelogen wird, so liegt das Recht dazu nicht in seinem Zuwenig, sondern in seinem Zuviel an Wirklichkeit. Denn der Schauspieler überzeugt uns nur, indem er innerhalb der künstlerischen Logik verbleibt, nicht aber durch Hineinnehmen von Wirklichkeitsmomenten, die einer ganz anderen Logik folgen.Aus Georg Simmel, Der Schauspieler und die Wirklichkeit, Berliner Tageblatt, 1912
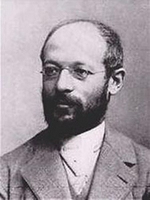





leave a comment