Interview mit dem (Schach-)Schriftsteller Martin Weteschnik
.
«Systematisch lernen und regelmäßig üben!»
Thomas Binder
.
Vor zwei Wochen stellten wir hier den neuen Taktik-Band des Frankfurter Schach-Autoren Martin Weteschnik vor. Mit seinem «Schachtaktik–Jahrbuch 2011» setzt der FIDE-Meister eine Reihe erfolgreicher Schach-Publikationen aus seiner Feder fort. Nun denkt aber der bekannte Taktik-Theoretiker an die Beendigung seiner schachlichen Publikationsarbeit, um sich stattdessen «mit voller Kraft» aufs Romane-Schreiben konzentrieren zu können. «Glarean»-Mitarbeiter Thomas Binder stellte dem rührigen Schach-Pädagogen und Roman-Autoren einige Fragen zu seiner zurückliegenden Karriere und zu seinen Zukunftsvorstellungen.
Glarean Magazin: Als Turnierspieler ist es inzwischen recht ruhig um Sie geworden, dafür widmen Sie sich je länger desto mehr dem belletristischen Schreiben. Was waren denn so die wichtigsten Lebensstationen Ihrer (Schach-)Karriere?
Martin Weteschnik: Ich bin 1958 in Frankfurt am Main geboren und dort aufgewachsen. Nach dem Abitur begann ich Germanistik zu studieren und wollte Schriftsteller werden. Das Schreiben, so meinte ich damals, sei der einfachere Part, das «Worüber» weitaus schwieriger. Tatsächlich hatte ich bis dahin nicht eben viel erlebt, was einem künftigen Schriftsteller nicht gerade zu einem sensationell anspruchsvollen Blickfeld verhilft. Folglich sollte und wollte ich erst einmal die Welt kennenlernen! In Japan blieb ich etwas länger. Das Land und seine Kultur haben mich tatsächlich bis heute geprägt. Seither bemühe ich mich um eine Synthese zwischen östlichem und westlichem Denken.
In Amerika schließlich, wo ich fast fünf Jahre in San Francisco wohnte (eine verdammt schöne Stadt!), begann ich mich – nunmehr Mitte zwanzig – mit einem äußerst faszinierenden Spiel zu beschäftigen: mit Schach. Mehr als zwei Jahre verbrachte ich in Ungarn und lernte bei einem Profitrainer. Später unterrichtete ich selbst und schrieb mein erstes Schachbuch. Das «Lehrbuch der Schachtaktik» wurde mittlerweile in mehrere Sprachen übersetzt und erschien zudem bei ChessBase auf CD und DVD. Am erfolgreichsten ist es auf dem englischsprachigen Markt und gilt mittlerweile als Standardwerk im Bereich Taktik. Auf diese Weise gelangte ich also wieder zum Schreiben…
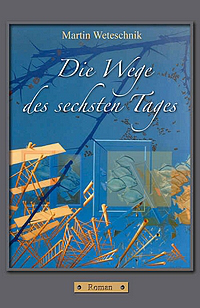
Weteschnik-Roman: «Einen Verlag zu finden ist ungleich schwieriger, als ein gutes Buch zu schreiben.»
Mit etwa 25 Jahren erlernte ich das Schachspiel in San Francisco im sogenannten Mechanics’ Institute. Nach einem Jahr schlug ich meinen ersten IM und den einen oder anderen ELO-Träger (damals ab 2200). Die Leute befragten mich anschließend, weshalb ich über die ersten Züge einer Hauptvariante eine Stunde lang nachgedacht hätte (ich kannte noch keine Eröffnungstheorie), oder warum ich den gleichen Fehler beginge wie Anderssen in einer seiner Matchpartien gegen Morphy. Oh natürlich! – Ich spielte also schon damals wie Anderssen… (leider hat es, wenn überhaupt, nur bezüglich der Fehler zu Anderssens Niveau gereicht).
Nach etwas über einem Jahr wurde mir praktisches Schach langweilig. Tatsache! Die anderen schienen immer nur dasselbe zu spielen, so jedenfalls kam es mir vor (mit dieser Vermutung hatte ich auch nicht ganz unrecht, zumindest was das blinde Nachspielen von Eröffnungstheorie anbelangt) – und selbst fiel mir auch nichts Weltbewegendes ein.
GM: Wie wurde denn aus dem «gelangweilten» Schach-Adepten ein FIDE-Meister?
MW: Aus irgendeinem Grund empfahl mir jemand, Capablancas Partien nachzuspielen (für manche nicht gerade der aufregendste Spielstil). Vielleicht lag es ja an Capablancas Bestreben, alle Figuren harmonisch einzusetzen und zusammenspielen zu lassen, jedenfalls half Capablancas Schachstil mir zu verstehen, wie Einfachheit und konsequentes Verfolgen einer Idee bei gleichzeitigem Bemühen um Harmonie (alle Kräfte wirken irgendwann zusammen) folgerichtig zu einem neuen und einzigartigen Ergebnis führen. So ein «magischer» Moment entsteht im Strategischen ähnlich wie Steinitz es einst bei der Taktik postulierte: dass Kombinationen keine Geniestreiche aus heiterem Himmel sondern das Ergebnis konkreter Positionen sind. Nun, das klingt ziemlich theoretisch. Mag mir im Schach das höhere Handwerkszeug – und möglicherweise auch die nötige Gedächtnisleistung – gefehlt haben, so behaupte ich aus meinen Erfahrungen heraus dennoch, dass selbst große Kreativität für jeden erfahrbar ist. Möglicherweise verdanke ich dem «Langeweiler» Capa den Zugang zu meinem Einfallsreichtum. Auch in anderen Bereichen (zum Beispiel beim Schreiben) werden mir die Ideen wohl nicht mehr ausgehen.
GM: Und wie ging’s dann in Europa weiter, in den angestammten Schachgefilden sozusagen?
MW: Meine «Schachkarriere» ist schnell erzählt. Aus Amerika kehrte ich nach Europa zurück, um dort Schach besser lernen und spielen zu können. Es blieb zumeist beim Lernen. Zwei Jahre trainierte ich mit Tibor Karolyi (dessen Schüler Peter Leko seinerzeit der jüngste Großmeister wurde). Fast ohne Vorkenntnisse war ich mit dem 70’000 Züge umfassenden, auswendig zu lernenden Eröffnungsrepertoire zumeist überfordert. Als «alter Mann» in der Dreißigern lernt sich eben nicht mehr so leicht, was heutzutage bereits Elfjährige mit ELO 2500 (allerdings auch erst nach Jahren intensivsten Trainings) beherrschen… Mir fehlten die praktischen Erfahrungen, um den gigantischen Stoff mit etwas Konkretem verknüpfen und ihn so im Gedächtnis speichern zu können.
Meist spielte ich damals geschlossene (IM-)Turniere. In meinem zu der Zeit einzig gespielten Open in Deutschland (Bad Vilbel 1995; verflucht aber auch, was könnte ich mir heute alles leisten, wenn es damals ausgewertet worden wäre…) erreichte ich den zweiten Platz. Später nahm ich an ein paar GM-Turnieren teil, und auf meinem «schachlichen» Höhepunkt (und letztem Turnier in Ungarn) fehlte mir nominell nur ein Titelträger, um die erste IM-Norm zu erspielen.
Ich muss dennoch zugeben, dass ich nie ein guter praktischer Spieler war. Viele recht peinliche Performances wären mir erspart geblieben, hätte ich aus gesundheitlichen o.ä. Gründen rechtzeitig aufgehört. Aber wir alle wissen ja: Der rechte Zeitpunkt, sich von jenen Dingen zu trennen, an denen wir hängen, ist nicht immer leicht abzupassen. Mein Freund und Trainer Tibor Karolyi sagte einmal zu mir, er kenne keinen (und er kennt eine Menge Leute), der das Schachspiel so sehr liebe wie ich. Sei’s drum, heute kann ich mir nichts Gewinnbringenderes, systematisch Erlernbareres und Tiefgreifenderes vorstellen als Tai Chi (Meditation in Bewegung), das ich wenig, dafür aber tagtäglich praktiziere. Schach war leider irgendwann nicht mehr mein Weg.
GM: Ihre Bücher haben nach meinem Eindruck einen großen Praxisbezug. Da liegt die Vermutung nahe, dass Sie auch als Trainer aktiv waren bzw. sind?
MW: Ja, ich habe Schach unterrichtet, Vorträge gehalten und auch einen Verein betreut. Allen Amateuren (und da meine ich durchaus Spieler bis 2400 ELO) kann ich empfehlen, wenigstens ein Mal in ihrem Schachleben mit einem gutem Trainer oder einem Profi zu trainieren (möglichst nicht in einer größeren Gruppe!). Durchschnittlich werden Spieler (bis etwa 1900) meiner Erfahrung nach innerhalb eines Jahres um 200 Ratingpunkte zulegen. Spieler (etwa wie die «ewigen FMs») werden möglicherweise feststellen, dass sie zu einseitig spielen. Gute Spieler lernen vielleicht weniger an technischen Dingen dazu, doch werden sie davon profitieren, dass ihnen ein erfahrener Trainer eine andere Perspektive aufzeigt. Natürlich nicht immer, aber immer öfters: Ich habe Leute mit einer Spielstärke von 2200 erlebt, die nach nur ein paar grundlegenden Stunden mit einem guten Trainer Titelträger einfach übers Brett schoben (push him over the board, meint Tibor Karolyi treffend, wenn er von der Waffe des Raumvorteils spricht).
Auch wenn meine schriftstellerische Arbeit das Trainieren anderer heute nicht mehr zulässt, möchte ich an dieser Stelle einen Tipp loswerden (auch wenn er allzu einfach klingen mag): Systematisch lernen und regelmäßig üben!
GM: Wie würden Sie die Zielgruppe Ihrer Schachbücher beschreiben?
MW: Das sind Spieler mit einer DWZ von 1200 – 2000.
GM: Wie findet man eigentlich bei der heutigen Fülle von Turnierpartien die «Rosinen im Kuchen», also die wirklich sehenswerten Kombinationen?
MW: Auf diese «Rosinen» im Kuchen wird man natürlich auch durch Quellen wie Internet und Zeitschriften aufmerksam. Man soll das Rad nicht immer neu erfinden; Eine brillante Kombination wird nicht schlechter, nur weil sie irgendwo mehrfach erscheint. Und ein Copyright gibt es weder auf das Finden noch (leider) auf das Kreieren von Taktik. Grundsätzlich bemühe ich mich natürlich, durch Eigenarbeit Neuem auf die Spur zu kommen. Dabei macht es die Fülle an Material eher einfacher, interessante Kombinationen aufzuspüren. In der Tat sollte man die guten Kombinationen bei den besseren Spielern suchen. Andererseits erstaunt es immer wieder, wie taktisch beschlagen auch schwächere Spieler sind. Das mag daran liegen, dass den meisten Turnierspielern im Amateurbereich viele Ideen bereits bekannt sind. Wenn einer die taktischen Motive kennt und ihren Aufbau versteht, kann jeder auch mal ganz große Taktik spielen… Also auf geht’s!
GM: Sind bei Ihren Taktik-Publikationen nachträglich viele interessante Partien «durch den Rost gefallen», weil sie sich bei nachträglicher Analyse als unkorrekt erwiesen?
MW: Natürlich lässt jeder ein Analyseprogramm im Hintergrund laufen. Unfehlbar ist keiner von uns. Man sollte sich dennoch auch auf sein Gefühl verlassen. Meist werden Kombinationen eher verworfen, weil mehrere Lösungswege dem Leser das Üben erschweren.
GM: Ich habe gelesen, dass Sie sich aus dem Schachbuchgeschäft zurückziehen wollen. Es wird also keine weiteren «Schachtaktik-Jahrbücher» mehr geben?
MW: Vermutlich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass mein Freund Heinz Brunthaler diese hübsche Reihe auch unter seinem Namen weiterführen kann.
GM: Zu Ihren Roman-Projekten: Auf welches Genre und welche inhaltlichen Schwerpunkte konzentrieren Sie sich dabei?
MW: Gerade habe ich einen Thriller mit historischer Schiene fertiggestellt und mich auf Verlagssuche begeben. Einen Verlag zu finden ist ungleich schwieriger, als ein gutes Buch zu schreiben… Da ich ein möglichst großes Publikum erreichen möchte, stehen Handlung und Spannung im Vordergrund. Allerdings konnte ich es mir nicht verkneifen (neben gründlicher Recherche), das Ganze auch mit etwas Gehalt zu unterlegen… Spannung mit Tiefgang soll auch meine künftigen Werke auszeichnen. Das nächste ist bereits in Planung und wird sich noch deutlicher auf das Thriller-Element konzentrieren. Während der jetzige Roman an den Schauplätzen Dresden, Genf, New Orleans und New York angesiedelt ist, spielt der nächste in Frankfurt, gleichwohl mit ein wenig internationalem Flair garniert. Irgendwann schreibe ich auch wieder ein Sachbuch (Mensch, Wissenschaft, Umwelt – sorry: keins über Schach). Mein unbescheidenes Ziel aber ist es, mit Romanen auch in Englisch verlegt zu werden und eines Tages ein Buch zu schreiben, das nicht nur inhaltlich, sondern zudem stilistisch über gute Unterhaltungsliteratur hinausgeht.
GM: Wird Ihr umfangreiches Wissen aus der Schachszene irgendwie in die Handlung einfließen?
MW: In wie weit das Thema Schach in meinen ersten Roman («Die Wege des sechsten Tages» / 2008) eingeflossen ist, kann man z.B. dem entspr. Medienecho entnehmen. Genauso wenig wie ich allerdings in reinem Lokalkolorit zu versinken gedenke, meide ich einseitig themenbezogenes Schreiben. Für den aktuellen Roman war zunächst kein Schachbezug vorgesehen. Allerdings drohte der historische Plot (des hauptsächlich in der Jetztzeit spielenden Thrillers) plötzlich in Paris zu versanden. In dem Roman geht es nebenbei um das Mausoleum Karl II. Zudem sollte die historische Schiene nach Amerika führen. Der Herzog von Braunschweig, Paris Mitte des 19. Jahrhunderts, Amerika… mmh… da war doch was? Richtig, die legendäre Schachpartie zwischen dem Amerikaner Paul Morphy und eben jenem Herzog (und dem Grafen dʼIsoard). Schach hilf! – Wie fantastisch sich das Ganze letztlich fügt, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten – auch nicht, was meine Recherchen zu dieser Partie und über den Grafen dʼIsoard ergeben haben… ■
.
.
.
.
.
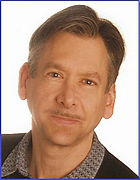







leave a comment