Tomas Liska: «Bercheros Odyssee» / Jaromir Honzak: «Uncertainty» (CD’s)
.
Auf Linie gebracht –
2 neue Alben von Bassisten als Bandleader
Michael Magercord
.
 Ein Komponist für Filmmusik, der seine Wurzeln im Jazz verortet, gestand mir einmal, dass er, wenn er partout keinen Einfall für eine Melodie-Linie bekomme, zunächst entsprechend der filmischen Vorgaben eine Bass-Linie einspielt, auf der sich dann alles weitere finden lässt.
Ein Komponist für Filmmusik, der seine Wurzeln im Jazz verortet, gestand mir einmal, dass er, wenn er partout keinen Einfall für eine Melodie-Linie bekomme, zunächst entsprechend der filmischen Vorgaben eine Bass-Linie einspielt, auf der sich dann alles weitere finden lässt.
Musik, die bewegten Bildern unterlegt wird, folgt einer zuvor festgelegten Dramaturgie. Und ein wenig wirken die beiden vorliegenden Alben, in denen die Bassisten jeweils den Ton angeben, auch wie Filmmusik. Obwohl es keine Platten mit Filmmusik sind, sondern eher das, was man einmal «Konzeptalben» nannte: eine dreiviertel Stunde zusammenhängende Klanggebilde – das kann entweder großartig werden oder ganz besonders repetitiv enden.
Mit Tomas Liska und Jaromir Honzak, haben sich zwei versierte Jazz-Bassisten und ihre jeweiligen Formationen in ihren neuen Einspielungen – beide bei Supraphon – auf genau diese Gratwanderung begeben. «Bercheros Odyssee» nennt Tomas Liska, der jüngere von beiden, seine Komposition, die der Absolvent des Berliner Jazz-Instituts zusammen mit seinen Kommilitonen Fabiana Striffler (Geige), Simon Marek (Cello), Markus Ehrlich (Klarinette) und Natalie Hausmann (Tenorsaxophon) unter dem Bandnamen Pente eingespielt hat. Das Album folgt ganz und gar der Konzeptidee. Die sechs einzelnen Passagen heißen auch konsequenterweise «Parts», die ein zusammenhängendes Ganzes bilden sollen.
Liska war zuvor eher in der Weltmusik und im Bluegrass unterwegs. Mit dem Studium begann wohl die Reise durch philosophische und ästhetische Tiefen seines Faches. Seine CD gewordene Odyssey mit einem Titel, der aus den Namen seines Studienortes und dem des Indianerstammes der Cherokee zusammengesetzt wurde, kommt zunächst etwas intellektuell und ernst daher, verliert sich ab und zu im Free Jazz, um dann doch immer wieder kürzere Aufenthalte an bekannten Orten einzulegen: wenn nämlich die Geige oder das Cello folkloristisch ertönen, die Klarinette einen Gospel andeutet oder uns das Saxophon auf dem Balkan Station machen lässt – und trotzdem findet es zu einer lyrischen, unprätentiösen Einheit.
 Etwas traditioneller erscheint aufs erste Hören das Album des versierten Altjazzers Jaromir Honzak zu sein. Auch er hatte einst studiert, nur liegt das schon bald 30 Jahre zurück. Zehn Jahre zuvor hatte er seinen Militärdienst in einer Armeeband in Prag absolviert, und danach begann seine Laufbahn in der Jazzszene der Stadt. Sein Studienort war dann Boston. Nach dem USA-Aufenthalt begann seine internationale Karriere als Bassist, Bandleader – und Komponist.
Etwas traditioneller erscheint aufs erste Hören das Album des versierten Altjazzers Jaromir Honzak zu sein. Auch er hatte einst studiert, nur liegt das schon bald 30 Jahre zurück. Zehn Jahre zuvor hatte er seinen Militärdienst in einer Armeeband in Prag absolviert, und danach begann seine Laufbahn in der Jazzszene der Stadt. Sein Studienort war dann Boston. Nach dem USA-Aufenthalt begann seine internationale Karriere als Bassist, Bandleader – und Komponist.
«Uncertainty» heißt die Zusammenstellung von acht eigenen Titeln, die er mit den wesentlich jüngeren E-Gitarristen David Doruzka, Pianisten Vit Kristan, dem französischen Saxophonisten Antonin-Tri Hoang und schwedischen Schlagzeuger Jon Fält eingespielt hat. Jedes Stück steht für sich, hat eine andere instrumentale Zusammensetzung. Und ist das erste Stück mit dem deklamatorischen Titel «Smell of change» noch flotter E-Gitarren-Jazz, so ist im zweiten der Wandel da und im dritten schließlich vollzogen: hin zu einer meditativen und lyrischen Dichte, die sich weitgehend der Instrumenten-Akrobatik enthält, und die man durchaus als Ausflug in die «Ungewissheit» erleben kann.

In ihren jüngsten Aufnahmen folgen Altjazzer Jaromir Honzak («Uncertainty») und Neujazzer Tomas Liska («Bercheros Odyssey») weiterhin den Vorgaben der Bass-Linien. Dass diese Wahrung einer guten Musik-Tradition dem Treiben der doch so freiheitsliebenden Improvisations-Musiker erst die Form gibt, in der sich dann ihre sprühenden Ideen oder – im Gegenteil – ihre Hingabe in tiefe Gefühlswelten ergießen können, beweisen einmal mehr diese beiden lyrischen, ja meditativen Alben.
Beide Alben haben – bei allen Unterschieden – schließlich doch eines gemeinsam: Es sind ihre klaren bass-lines, die ihre musikalische Fantasien auf Linie halten. Sie erst machen aus der Gratwanderung zwischen Klängen und Atmosphären, aus den Stückchen und den Teilen ein zusammenhängendes Ganzes. Vielleicht ist dies ja auch das höchste an der hohen Kunst des Bass-Spiels. Und sollte den beiden Bassisten darum gegangen sein: mission accompli. ■
Tomas Liska & Pente: Bercheros-Odyssey, Audio-CD, Supraphon
Jaromir Honzak & Band: Uncertainty, Audio-CD, Supraphon
.
.
.
.
«Kingdom of Heaven» – Lieder von Heinrich Laufenberg u.a.
.
«Stand vf, stand vf, du sele min»
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.
Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.
Und doch ist die Romantisierung des Mittelalters, die einst im 19. Jahrhundert begann, auch heute noch in vollem Schwange. Die Bilder vom edlen Recken, der schönen Jungfrau, der trutzigen Feste, vom bunten Turnier, dem weltvergessenen Kloster, dem rauen und dennoch guten Leben sind tief ins kollektive Bewusstsein der Populärkultur eingebrannt und werden in Belletristik, Musik, Film und Parallelgesellschaften wie der «Society of Creative Anachronism» immer wieder wohlfeil bedient.
Nicht, dass die vorliegende CD romantisierender Mittelalter-Kitsch wäre. Die Produktion – die sicher nur zufällig den Titel mit einer Kreuzfahrerschmonzette von Ridley Scott aus dem Jahre 2005 teilt – ist durch und durch hochklassig und akademisch im besten Sinne, besteht das Ensemble Dragma mit Agnieska Budzińska-Bennett (Gesang, Harfe, Drehleier), Jane Achtmann (Vielle, Glocken) und Marc Lewon (Gesang, Plektrumlaute, Vielle) doch aus drei arrivierten Spezialisten für mittelalterliche Musik. Sie konzentriert sich thematisch auf das Werk von Heinrich Laufenberg, jenes alemannischen Mönches, der wohl um das Jahr 1390 in Freiburg im Breisgau geboren wurde und am 31. März 1460 in Johanniterkloster zu Straßburg verstorben ist. Hinzu treten Werke zeitgenössischer Liederdichter.

Heinrich von Laufenberg (aus der Handschrift des Buchs der Figuren, die 1870 in Straßburg verbrannt ist)
Dass wir heute überhaupt Lieder von Heinrich Laufenberg hören können, grenzt an ein Wunder, sind die mittelalterlichen Codices, die seine Lieder ursprünglich enthielten (es waren wohl um die 120 Stück), doch beim Angriff auf Straßburg im Deutsch-Französischen Krieg 1870 zerstört worden. Kurz vorher jedoch hatte der Kirchenliedforscher Philipp Wackernagel in einer umfangreichen Edition Laufenbergs Texte herausgegeben. Auch sind über viele unterschiedliche Wege Melodien zu 17 Texten auf uns gekommen, sodass es heute möglich ist, Laufenberg in Text und Musik zu erleben. Allerdings wissen wir – und darauf weist Marc Lewon in seinem höchst informativen Booklet-Text ganz deutlich hin – nicht, wie die Noten dem Text tatsächlich zuzuordnen sind, und zwar weil nur Noten ohne jegliche Strukturierung oder Textbezug überliefert worden sind. Zudem ist nicht klar, ob die Noten komplett überliefert wurden oder ob manch eine nicht von einem Forscher des 19. Jahrhunderts – eine damals durchweg gängige Praxis – «nachempfunden» wurde. Die vorliegende nun Rekonstruktion kann sich durchweg hören lassen. So tönt Agnieska Budzińska-Bennett in den der Christusminne zugehörigen Liedern wie «Es taget minnencliche“ oder im berühmten «Benedicite» des Mönchs von Salzburg förmlich wie vom Himmel her, so glatt, gleißend hell und dennoch mit einer gewissen Grundwärme timbriert klingt ihr Stimme. Ausgesprochen anregend und abwechslungsreich gestaltet auch Mark Lewon seine Lieder, beispielsweise «Ein lerer rúft vil lut », einem Diskurs über das rechte Leben und den rechten Glauben.

Ausschnitt der Wolfenbütteler Lautentabulatur
Aber auch die Instrumentalstücke, die sich auf dieser CD finden, werden von den drei Musikern des Ensemble Dragma (die in drei Tracks von Hanna Marti und Elizabeth Ramsey unterstützt werden) auf technisch und gestalterisch höchstem Niveau musiziert. Auf ein besonderes Schmankerl, die diese CD dem Alte-Musik-Aficionado bietet, muss hier gesondert hingewiesen werden. Denn neben den Liedern und Instrumentalstücken Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen bringt diese Produktion erstmals komplett jene Stücke, die der sogenannten «Wolfenbütteler Lautentabulatur» entstammen, einer fragmentarischen Quelle aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die erst vor ein paar Jahren entdeckt wurde und die älteste bisher bekannte Lautentabulatur überhaupt darstellt. Marc Lewon präsentiert seine auf seiner intensiven Beschäftigung mit der Tabulatur basierende Rekonstruktion. Und auch dies ist ein echter Ohrenschmaus.

Das Ensemble Drama präsentiert mit seiner Produktion «Kingdom of Heaven» Lieder Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen sowie das komplette Material der Wolfenbütteler Lautentabulatur. Die atmosphärisch ausgesprochen dichte, hervorragend musizierte und philologisch exquisit gearbeitete Produktion kann rundum und ohne Abstriche empfohlen werden.
Und so ist das, was dem Hörer hier 78 Minuten lang entgegentönt, so derartig perfekt musiziert, dass man am Ende den Eindruck hat, hier eben doch idealen Klängen aus einem idealisierten Mittelalter zu lauschen. Ob die Stimmen und Instrumente eines Mönches im kalten und zugigen Kloster oder die des über schlammige und schlechte Wege von Weiler zu Weiler ziehenden Spielmannes so geschniegelt geklungen haben mögen? Der Realität näher mögen wohl René Clemencics Aufnahmen mittelalterlicher Musik sein, doch die vorliegende CD ermöglicht es dem Hörer, einen Blick ins «Kingdom of Heaven» zu erhaschen.■
Kingdom of Heaven – Musik von Heinrich Laufenberg und seinen Zeitgenossen, Ensemble Dragma, Label Ramee (RAM 1402), Audio-CD
.
.
.
.
Guillaume Connesson: «Lucifer», Cellokonzert (Jérôme Pernoo, Jean-Christophe Spinosi)
.
Infernalisches Klangspektakel
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 Schlägt man das Booklet zu dieser Neuveröffentlichung aus dem Hause Deutsche Grammophon auf, so ist dort über den 1970 in einem Vorort von Paris geborenen Komponisten Guillaume Connesson folgendes zu lesen: «Der 1970 geborene Guillaume Connesson ist zu jung, um sich jenem ideologischen und ästhetischen Diktat beugen zu müssen, das die vorangegangene Generation von Komponisten eingeengt hat. Seine Musik, immer wohlklingend und oft spektakulär hat eine Vielzahl von Einflüssen in sich aufgesogen. Seine ganze persönliche Welt ist das ‚Work in Progress’, welches aus jener Mischung von Pragmatismus und Naivität erwächst, die das Markenzeichen aller großen Schöpfer von Musik ist.»
Schlägt man das Booklet zu dieser Neuveröffentlichung aus dem Hause Deutsche Grammophon auf, so ist dort über den 1970 in einem Vorort von Paris geborenen Komponisten Guillaume Connesson folgendes zu lesen: «Der 1970 geborene Guillaume Connesson ist zu jung, um sich jenem ideologischen und ästhetischen Diktat beugen zu müssen, das die vorangegangene Generation von Komponisten eingeengt hat. Seine Musik, immer wohlklingend und oft spektakulär hat eine Vielzahl von Einflüssen in sich aufgesogen. Seine ganze persönliche Welt ist das ‚Work in Progress’, welches aus jener Mischung von Pragmatismus und Naivität erwächst, die das Markenzeichen aller großen Schöpfer von Musik ist.»
Obwohl man Elogen wie diese von Bertrand Dermontcourt nicht sonderlich lieben muss, so ist an diesen Worten schon etwas dran. Connesson, der heute eine Professur für Orchestration am Conservatoire National de Région d’Aubervilliers bekleidet, schöpft definitiv und vollkommen sorglos aus dem Vollen. Da beste Beispiel ist da das hier eingespielte Ballet en deux actes sur un livret du compositeur «Lucifer», das 2011 uraufgeführt wurde. Die enorm farbenreiche, geradezu glitzernde Partitur des «Lucifer» deckt stilistisch so ziemlich alles zwischen dem Sacre, Sandalenfilmmusik aus dem Hause Metro Goldwyn Mayer und groovigem Jazz ab. Ein buntes, wildes, ziemlich ungehemmtes Treiben, das in seiner gewissen Prinzipienlosigkeit rundum höchst unterhaltsam und darum auch – im Gegensatz zu so vielen, vielen Kompositionen der Moderne und Postmoderne – in jedem Falle massenkompatibel ist. Massenkompatibel sind übrigens auch die Thematik der Ballettmusik und auch das von der Deutschen Grammophon gestaltete Cover, das einen düsteren Wasserspeier an der Kathedrale Notre Dame in Paris zeigt. Frakturähnliche rote Buchstaben präsentieren den Namen «Lucifer». Es ist das Dunkle, Gothicmäßige, Gruselig-Abgründige, das hier mit Werk und Aufmachung bemüht, bedient und schlussendlich verkauft werden. Nicht umsonst wird das Konzert für Violoncello und Orchester, das ebenfalls auf der CD enthalten ist, verschwiegen. Die CD kommt also daher als böte sie eine Art Soundtrack für das Wave-Gothic-Festival Leipzig. Trifft die Phrase «Classic goes Pop» irgendwo zu, dann sicher hier. Das dürfte auch im Sinne Connessons sein, der mit seiner Musik (nicht nur) in Frankreich bestens ankommt und eine Reihe unterschiedlichster Preise, beispielsweise den vom Institut de France vergebenen Cardin-Preis (1998), den Nadia und Lili Boulanger-Preis (1999) oder – im Jahre 2006 – den Grand Prix Lycéen des Compositeurs erhalten hat. Guillaume Connesson hat von Beginn seiner Karriere an Elemente des Pop zu Themen seines Werkes gemacht hat, etwa in «Techno Parade», «Disco-Toccata» oder «Night Club». Warum also nicht auch hier?

Komponist Guillaume Connesson (links) und Dirigent Jean-Christophe Spinosi während der Aufnahmearbeiten zu “Lucifer”
Tritt man nun einen Schritt vom Marketing zurück und hört der Musik aufmerksam zu, dann präsentiert sich «Lucifer» als durchaus packende neue Musik, als eine neue Musik, die in der Lage ist, auch den der arrivierten «Klassik» nicht ganz so nahe stehenden Hörer zu fesseln. Das Werk, im Prinzip zwar eine Ballettmusik, aber laut Connesson gleichzeitig eine «große Symphonie», ist in sieben Abschnitte unterteilt, denen der Komponist einen Titel und jeweils einen kleinen Text voranstellt. Es wird – die Überraschung ist nicht groß – von «Le Couronnement du Porteur de Lumière» bis zum «Épilogue» der Fall Luzifers vom größten aller Engel zum verstoßenen König der Hölle «erzählt», allerdings verquickt mit Elementen der Prometheus-Sage. Es ist die Liebe zu einer Menschenfrau, die seine Verurteilung und seinen Fall herbeiführt. Im Épilogue tritt schließlich der Mensch «an sich» auf, der die Krone des Luzifer findet und sich – hier hat die Symbolik etwas unschön Gewolltes – von dieser dunklen Macht enorm fasziniert zeigt.
Zur Musik: Das Werk eröffnet mit der Krönungsszene Lucifers («Le Couronnement du Porteur de Lumière»). Musikalisch ist das zunächst schon ziemlich packend. Wilde Skalen in allen Instrumentengruppen, entfernt orientalische Klänge und starke Betonung des rhythmischen. Dann ein plötzlicher Stimmungswechsel. Streicherglissandi leiten einen nach Science Fiction klingen Abschnitt ein, eine liebliche Oboenmelodie schleicht sich ein, der Gesang wird von Celli ausgenommen. Das Orchester wird satter und baut einen Höhepunkt von düsterer Größe im üppigsten Cinemascope-Sound auf. Zu dieser Musik hätte Cecil B. DeMilles Moses problemlos das Rote Meer teilen können. Dann Rückkehr zum Bacchanal. Der zweite Satz «Le voyage de Lucifer» ist als Scherzo angelegt. Streicher, Holzbläser und der üppig bestückte Percussionsapparat rasen in wilder Jagd jazzig dahin. «La Recontre», die Begegnung Lucifers mit der Menschenfrau, sieht Connesson als das «Herz» des Werkes. Tatsächlich ist auch dies ein höchst hörenswertes Stück Musik. Geheimnisvoll tastend der Beginn, langsam etabliert sich – um Verdi zu zitieren – eine «melodie lunghe, lunghe, lunghe» in den Violinen. Der Satz gewinnt zusehends an Fülle, an Körper und entwickelt sich zu einer rauschhaft-orgiastischen Liebesmusik, die sich erneut auf eine wuchtige Metro-Goldwyn-Mayer Klimax hinwälzt, die nicht nur von fern an den frühen Mahler erinnert. Nach «La Recontre» ist es dann aber mit dem Einfallsreichtum vorbei. Sicher, auch die sich anschließenden Sätze «Le Procès», «La Chute», «L’Ailleurs» und «Épilogue» klingen gut, aber sie bringen nichts Neues. Immer und immer wieder rasende Skalen, Jazzrhythmen, Breitwandklänge. Hinzu kommt, dass der Eklektizismus überhand nimmt. Immer wieder fühlt man sich erinnert. Mal klingt Connesson nach Howard Shore (Le Procès) und mal nach Vaughan Williams’ «Sinfonia antartica» und dem «Sacre» (L’Ailleurs). Schließlich scheint der Épilogue des «Lucifer» klanglich und atmosphärisch fast den «Epilogue» der «London Symphony» (ebenfalls Vaughan Williams) imitieren zu wollen. Nach knapp 40 Minuten, die den Hörer angesichts des durchaus ansprechenden Klangspektakels wohl bei Laune halten, stellt man sich dennoch unweigerlich die Frage, ob das nun Musik ist, die über ihren knallbunten Eventcharakter hinaus etwas aussagt, etwas trägt oder ob sie das überhaupt will. Das etwas aufgepfropft wirkende «Programm» legt es zwar nahe, zurück bleibt aber der schale Geschmack einer eigentümlichen Leere.
Uneingeschränkt zu loben ist das atemberaubende Spiel des Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi, das sich mit Elan auf diese musikalische Spielwiese wirft und sich mit rechtem Gusto austobt, sodass die Funken nur so fliegen. Wenn Connessons «Lucifer» lediglich den Anspruch hätte, ein Werk sein zu wollen, das zeigen möchte, was an Klang und Virtuosität aus einem großen Orchester herausgekitzelt werden kann, dann wäre dieses als Plädoyer für die Möglichkeiten des Orchester bestens gelungen.

«Irrsinnige Spielfreude»: Solo-Cellist Jérôme Pernoo
Viel Klangzauber bietet auch das 2008 entstandene Cellokonzert in fünf Sätzen, die – so Connesson wiederum auf «zwei Akte» aufzuteilen sind. Auch hier finden sich im Beiheft allerlei Erklärungen dazu, wie das Werk zu verstehen sei und das, obwohl das Stück durchaus ohne Verstehenshinweise auskommt. Auch das Cellokonzert ist im Wesentlichen ein virtuoses Stück, das nicht nur den Cellisten, sondern auch das Orchester vor recht heikle Aufgaben stellt, und zwar nicht nur die nackte Spieltechnik betreffend, sondern ganz besonders, was die Vielfältigkeit und rasante Wechselhaftigkeit im Audruck angeht. Kaum sind die blockhaft-vehementen ersten Minuten des ersten Satzes «Gratinique» (hier sollen kalbende Eisberge inspirierend Pate gestanden haben) vorbei, schon gilt es eine zauberhaft klagende Atmosphäre im Mittelteil zu erschaffen. Das sich direkt anschließende «Vif» bringt Atemlosigkeit und unglaubliche Rasanz. Dann eine große «naturmagische» Musik im «Paradisiaque», in der das Cello zu einem großen Gesang anhebt, der nostalgischer, sentimentaler und bittersüßer kaum daher kommen könnte. Die «Cadence» fordert dem Solocellisten alles ab, was menschenmöglich ist, rausgeschmissen wird im letzten Satz «Orgiaque» mit Bacchanal-Stimmung, Jazz und Dixiland-Reminiszenzen.

Das Cellokonzert und die Balletmusik «Lucifer» von Guillaume Connesson sind packende, glitzernde, virtuose Musikstücke, deren spektakulärer Charakter jedoch nicht unbedingt einen lang anhaltenden Eindruck hinterlässt. Die Ausführung durch den Cellisten Jérôme Pernoo und dem unter Jean-Christophe Spinosi spielenden Orchestre Philharmonique de Monte ist tadellos.
Cellist Jérôme Pernoo leistet hier spielerische und gestalterische Schwerstarbeit und wird dieser ausufernden, mäandernden, ja schon bald überladenen Cellopartie mit einer schon fast irrsinnigen Spielfreude gerecht. Das Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi stehen dem in nichts nach.
Und doch stellt sich im Anschluss die Frage: Was bleibt? ■
Guillaume Connesson: Lucifer & Cellokonzert, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Jean-Christophe Spinosi, Jérôme Pernoo, Deutsche Grammophon 481 1166. 1, Audio-CD
.
.
.
.
W. A. Mozart: Grandes Oeuvres à quatre mains (KV 497 & KV 501)
.
Mozart im Zwiegespräch
Christian Busch
.
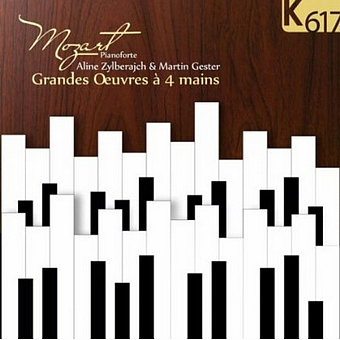 Das vierhändige Klavierspiel, die vielleicht intimste Form der Kammermusik, gehört zu den technisch heikelsten und interpretatorisch anspruchvollsten Herausforderungen, welche die Musik an die Ausführenden stellt. Zwei vermeintlich gleichberechtigte Partner treten auf engstem Raum – eine vollkommene Synthese suchend – in einen wirklichen Dialog. Ein Terrain für Geschwister, Paare und freundschaftlich verbundene Seelen – weniger für titanische Tastenlöwen mit ausgeprägtem Hang zur Selbstdarstellung.
Das vierhändige Klavierspiel, die vielleicht intimste Form der Kammermusik, gehört zu den technisch heikelsten und interpretatorisch anspruchvollsten Herausforderungen, welche die Musik an die Ausführenden stellt. Zwei vermeintlich gleichberechtigte Partner treten auf engstem Raum – eine vollkommene Synthese suchend – in einen wirklichen Dialog. Ein Terrain für Geschwister, Paare und freundschaftlich verbundene Seelen – weniger für titanische Tastenlöwen mit ausgeprägtem Hang zur Selbstdarstellung.
Schon von seinem geltungssüchtigen Vater Leopold etwas plakativ als «Erfinder der vierhändigen Klaviersonate» präsentiert, zählt Mozart unbestritten zu den Wegbereitern dieser Gattung der hohen Kunst mit überschaubarem Repertoire.
Was für den kleinen Wolferl auf dem Schoße eines Johann Christian Bach beginnt und sich in frühen Kompositionen für das geschwisterliche, durchaus auch publikumswirksame Zusammenspiel fortsetzt, findet in der F-Dur-Sonate KV 497 seine Krönung und Vollendung. Gerne als «Krone der Gattung» (Einstein) und «gewaltige Seelenlandschaft» bezeichnet, steht sie zeitlich und thematisch der «Prager» Symphonie (KV 504), aber auch dem «Don Giovanni» nahe. Als Mozart sie im August 1786 schreibt, verleiht er der subtilen Bespiegelung in Dur und Moll daher auch symphonische Dimensionen.
 Die Franziska von Jacquin, Tochter des befreundeten Wiener Botanikprofessors, gewidmete C-Dur-Sonate KV 521 übersendet er Ende Mai 1787 – am Todestag seines Vaters – an Gottfried von Jacquin mit den mahnenden Worten: «Die Sonate haben Sie die Güte ihrer frl: Schwester nebst meiner Empfehlung zu geben; – sie möchte sich aber gleich darüber machen, denn sie seye etwas schwer.» Das virtuose Werk, das den späten Wiener Klavierkonzerten verwandt ist, trumpft gleichfalls mit orchestralem Klang auf, ohne den dank der Solopassagen aller vier Hände – kammermusikalischen Rahmen zu verlassen. Ob er es mit ihr, einer seiner besten Schülerinnen, auf Schloss Waldenburg gespielt hat? Mit Sicherheit.
Die Franziska von Jacquin, Tochter des befreundeten Wiener Botanikprofessors, gewidmete C-Dur-Sonate KV 521 übersendet er Ende Mai 1787 – am Todestag seines Vaters – an Gottfried von Jacquin mit den mahnenden Worten: «Die Sonate haben Sie die Güte ihrer frl: Schwester nebst meiner Empfehlung zu geben; – sie möchte sich aber gleich darüber machen, denn sie seye etwas schwer.» Das virtuose Werk, das den späten Wiener Klavierkonzerten verwandt ist, trumpft gleichfalls mit orchestralem Klang auf, ohne den dank der Solopassagen aller vier Hände – kammermusikalischen Rahmen zu verlassen. Ob er es mit ihr, einer seiner besten Schülerinnen, auf Schloss Waldenburg gespielt hat? Mit Sicherheit.
Das Straßburger Musikerehepaar Aline Zylberajch & Martin Gester (Bild) hat sich nun in ihrer zweiten auf CD veröffentlichen Gemeinschaftsproduktion dieser beiden viel zu selten zu hörenden Sonaten Mozarts angenommen – zusammen mit dem Rondo in a-moll KV 511 (Martin Gester) und dem Andante und Variationen in G-Dur KV 501 (Label K 617).
Ihr Spiel lässt dabei keine Wünsche offen, ist geprägt von präziser Abstimmung, das den weiten Bogen von orchestraler Pracht symphonischen Ausmaßes bis zur privaten Intimität mühelos spannt. Das kraftvoll drängende Allegro, die galant singende Melodie, der leise, klagend-resignative Ton, all das spiegelt sich stimmig im blendend hellen Mozart-Sound. Da mag einer sagen, dies komme ihm bekannt vor, jedoch nicht in der Form des auf Salon-Frivolitäten verzichtenden, vertrauten Zwiegesprächs – im ständig wiederkehrenden Suchen und Finden – zweier ebenbürtiger Partner. Damit bietet die CD mit Werken aus der großen Schaffensperiode (zwischen «Figaro» und «Don Giovanni») einen weiteren Höhepunkt Mozart’schen Schaffens – für so manchen sicher eine Entdeckung. ■

Das Spiel des Pianisten-Ehepaares Aline Zylberajch & Martin Gester lässt bei Mozarts KV 479 & KV 511 keine Wünsche offen, ist geprägt von präziser Abstimmung, das den weiten Bogen von orchestraler Pracht symphonischen Ausmaßes bis zur privaten Intimität mühelos spannt.
Wolfgang Amadeus Mozart: Grandes Oeuvres à quatre mains (KV 497 & KV 501), Martin Gester and Aline Zylberajch, CD-Label K617 (Harmonia Mundi)
.
.
.
.
.
.
.
Interessante Musik-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Hans-Günter Heumann: «Keyboard gefällt mir!»
 Nach seiner bekannt gewordenen Reihe «Piano gefällt mir!» legt Bosworth nun mit «Keyboard gefällt mir!» ein Analogon für das Keyboard auf. Als Herausgeber amtet dabei Musikpädagoge Hans-Günter Heumann, zweifellos einer der rührigsten deutschen Arrangeure von Popmusik für Tasteninstrumente. Die gediegen präsentierte, mit sauberem Notenbild und übersichtlichem Layout gestaltete Anthologie versammelt 50 ältere und neuere Hits & Songs aus den Pop-Charts und der Welt des Films. Von Adele bis Rihanna und von «Amélie» bis «Twilight» reicht dabei das Spektrum. Jedes der einstimmig gesetzten Stücke hat Heumann mit Angaben zu Lead-Sound (Voice) und Tempo sowie mit den Griffbildern der jeweils verwendeten Akkorde versehen. Die Schwierigkeitsgrade der Sammlung bewegen sich zwischen leicht bis mittelschwer, sie decken ungefähr die Levels ab zweitem bis fünftem Unterrichtsjahr ab.
Nach seiner bekannt gewordenen Reihe «Piano gefällt mir!» legt Bosworth nun mit «Keyboard gefällt mir!» ein Analogon für das Keyboard auf. Als Herausgeber amtet dabei Musikpädagoge Hans-Günter Heumann, zweifellos einer der rührigsten deutschen Arrangeure von Popmusik für Tasteninstrumente. Die gediegen präsentierte, mit sauberem Notenbild und übersichtlichem Layout gestaltete Anthologie versammelt 50 ältere und neuere Hits & Songs aus den Pop-Charts und der Welt des Films. Von Adele bis Rihanna und von «Amélie» bis «Twilight» reicht dabei das Spektrum. Jedes der einstimmig gesetzten Stücke hat Heumann mit Angaben zu Lead-Sound (Voice) und Tempo sowie mit den Griffbildern der jeweils verwendeten Akkorde versehen. Die Schwierigkeitsgrade der Sammlung bewegen sich zwischen leicht bis mittelschwer, sie decken ungefähr die Levels ab zweitem bis fünftem Unterrichtsjahr ab.
Wünschbar für den zeitsparenden Einsatz im Keyboardunterricht wären noch Fingersatz-Angaben gewesen – doch auch so eine attraktive Zusammenstellung und sicher eine Bereicherung der Keyboard-Literatur, die viele stilistische Geschmacksrichtungen abdeckt. ■
Hans-Günter Heumann: Keyboard gefällt mir / Von Adele bis Twilight, 168 Seiten, Bosworth Music, ISBN 978-3865438003
.
.
Jakob David Rattinger: «L’univers de Marin Marais»
 Der im österreichischen Graz geborene Gamben-Virtuose und Regensburger Hochschullehrer für Alte Musik Jakob David Rattinger, Schüler u.a. der berühmten Schola Cantorum Baseliensis, ist einer der profiliertesten Vertreter seines Faches. Bekannt als exquisiter Kenner, Herausgeber und Interpret musikhistorischer Aufführungspraxen ist er international unterwegs in Hör- und Konzertsäälen. Bereits vor einigen Jahren erschien Rattingers erste solistische CD mit dem Titel «L’univers de Marin Marais», jetzt legt er die gleiche Einspielung als New Remastered Edition im TYXart-Audio-Label neu auf. Ihm zur Seite musizieren der Theorbist Rosario Conte und der Clavecinist Ralf Waldner, versammelt sind auf der Platte eine Reihe von bedeutenden altfranzösischen Gamben-Komponisten rund um diverse Werke des Lully-Adepten Marin Marais (1656-1728): A. und J.-B. Forqueray, Sainte-Colombe, F. Couperin u.a.
Der im österreichischen Graz geborene Gamben-Virtuose und Regensburger Hochschullehrer für Alte Musik Jakob David Rattinger, Schüler u.a. der berühmten Schola Cantorum Baseliensis, ist einer der profiliertesten Vertreter seines Faches. Bekannt als exquisiter Kenner, Herausgeber und Interpret musikhistorischer Aufführungspraxen ist er international unterwegs in Hör- und Konzertsäälen. Bereits vor einigen Jahren erschien Rattingers erste solistische CD mit dem Titel «L’univers de Marin Marais», jetzt legt er die gleiche Einspielung als New Remastered Edition im TYXart-Audio-Label neu auf. Ihm zur Seite musizieren der Theorbist Rosario Conte und der Clavecinist Ralf Waldner, versammelt sind auf der Platte eine Reihe von bedeutenden altfranzösischen Gamben-Komponisten rund um diverse Werke des Lully-Adepten Marin Marais (1656-1728): A. und J.-B. Forqueray, Sainte-Colombe, F. Couperin u.a.
Eine ebenso musikgeschichtlich interessante wie klanglich und interpretatorisch referentielle Aufnahme – keineswegs nur für Liebhaber der ehrwürdigen Viola da gamba. ■
Jakob Rattinger / Rosario Conte / Ralf Waldner: L’univers de Marin Marais, Stücke für Gambe / Theorbe / Clavecin, Audio-CD 66:35 Min. TYXart
.
.
.
Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Arianna Savall / Petter Udland Johansen: «Hirundo Maris»
.
«Ein Mädchen saß am Meeresstrand…»
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 «Diese Art Gedichte, die wir seit Jahren Volkslieder zu nennen pflegen, ob sie gleich eigentlich weder vom Volk noch fürs Volk gedichtet sind, […] – dergleichen Gedichte sind so wahre Poesie, als sie irgend nur sein kann; sie haben einen so unglaublichen Reiz, selbst für uns, die wir auf einer höheren Stufe der Bildung stehen, wie der Anblick und die Erinnerung der Jugend fürs Alter hat.»
«Diese Art Gedichte, die wir seit Jahren Volkslieder zu nennen pflegen, ob sie gleich eigentlich weder vom Volk noch fürs Volk gedichtet sind, […] – dergleichen Gedichte sind so wahre Poesie, als sie irgend nur sein kann; sie haben einen so unglaublichen Reiz, selbst für uns, die wir auf einer höheren Stufe der Bildung stehen, wie der Anblick und die Erinnerung der Jugend fürs Alter hat.»
Man mag zu Goethe stehen, wie man will, er hatte im Grundsatz oft recht. Auch diese Zeilen aus seiner Kritik zu der von Clemens Brentano und Achim von Arnim herausgegebenen Sammlung «Des Knaben Wunderhorn» verraten nicht nur etwas über die Art, wie man zu Beginn des 19. Jahrhunderts über das Volkslied dachte. Sie sind auch heute noch gültig und offenbaren die Basis für die zahlreichen Volksliedprojekte der Gegenwart, deren eines die jüngst veröffentliche Produktion «Hirundo Maris» (Die Seeschwalbe) von Arianna Savall und Petter Udland Johansen ist.
In ihrer Einführung zu dieser CD schreiben Savall und Johansen Zeilen wie diese: «Eine Sommernacht, der Mond ist voll, warm und man kann ihn fast berühren, und zahllose Sterne blicken hinaus in die Ewigkeit. Eine klare Nacht, die ruhige See und in der Ferne hören wir ein geheimnisvolles Lied, ein uraltes Lied, das näher und näher kommt, bis es schließlich ein Teil von uns ist und zu einem Lied der Gegenwart, des unmittelbaren Moments wird. Es ist, als erwachten diese alten Lieder, Balladen, Romanzen und Tänze zu neuem Leben, immer wenn sie gesungen, gespielt oder vorgelesen werden. Sie werden zu neuer, persönlicher Musik. Es ist so, als ob es ein einzigartiges Lied oder ein Stück Musik für jeden Menschen auf dieser Welt gäbe, das einzig und allein für ihn gemacht wurde.» (Booklet, S. 17, Übersetzung der Verfasser) Man kann das leicht als esoterisch angehauchtes Gerede abtun, aber den Kern der Sache trifft es in Verbindung mit Goethes Zitat bestens. Diese CD ist ein Zeichen des in der Gegenwart sich an vielen Stellen breit machenden Wunsches nach dem Rousseau’schen «Back-to-the-roots». Wir, die wir auf der «höheren Stufe» der Bildung stehen, wünschen uns das Einfache, ein simplifiziertes Leben, «Lessness», sehnen uns nach dem Althergebrachtem und werfen – sei es in Blockbustern wie dem «Herrn der Ringe», in historischen Romanen à la Elizabeth Chadwick, zu Klängen Enyas oder auch Stings, der ja vor nicht allzu langer Zeit die englische Renaissance entdeckte – einen sehnsuchtsvollen und melancholischen Blick zurück in die mythische Tiefe der vermeintlich menschlicheren Zeiten. Neo-Romantik, Verklärung und Weltflucht, das sind die Stichworte, auch was die vorliegende CD angeht.
Nicht, dass man mich falsch versteht: Schiebt man all dies zur Seite, dann kann man Savalls und Johansons Projekt ohne irgendwelche nennenswerte Probleme, ja sogar mit hohem Genuss goutieren. Die beiden Musiker, die instrumental von Sveinung Lilleheier, Miquel Àngel Cordero und David Mayoral unterstützt werden, präsentieren eine schöne Zusammenstellung von (im wesentlichen) norwegischen, katalanischen und sephardischen Liedern, die allesamt wunderschön instrumentiert sind und eine große Bandbreite an Stimmungen vorstellen, wobei insgesamt – nach knapp 80 Minuten Spielzeit fällt es schon auf – die melancholischen Töne dominieren. Das beginnt schon mit dem ersten Lied «El Mestre» (Der Schulmeister), das – natürlich – eine unglückliche Liebesgeschichte zum Thema hat. Geradezu zauberhaft ist das Arrangement von «Ya salió de la mar» (Sie kommt aus der See), wie aus dem Märchen klingt das zusätzlich mit Wellenrauschen unterlegte katalanische Lied «El Mariner» (Der Seemann), das den Ausgangspunkt für das katalansich-norwegische Projekt darstellt, da hier von der Liebe eines Mädchens aus dem Süden zu einem geheimnisvollen Seemann aus dem Norden die Rede ist.

Das Volksliedprojekt «Hirundo Maris» von Arianna Savall und Petter Udland Johansen präsentiert poetische Arrangements von katalanischen, norwegischen und sephardischen Traditionals, die allesamt zu überzeugen wissen. Es ist eine exzellent musizierte CD, die einen wehmütigen Blick auf eine vermeintlich schönere Vergangenheit wirft.
Arianna Savalls helle, wirklich glasklare Stimme und der galante Tenor von Petter Udland Johansen verweben sich zu einem höchst harmonischen Ganzen, das durchaus etwas Magisches hat, ja das den «unglaublichen Reiz» erkennbar macht, den Goethe dem Volkslied zuschreibt. Fast scheint es, als ob hier tatsächlich die «wahre Poesie» zu schimmern begänne. Daneben stehen Lieder wie das erotische «Buenas Noches» (Süße Nächte), das schon fast orientalischen Duft verströmt und von dem Spannungsfeld des sirenenhaften Gesanges und der glutvollen instrumentalen Rhythmik beherrscht wird, fast wie ein Fremdkörper. Ein ausgewogeneres Verhältnis von Melancholie und Lebenslust ist vielleicht das einzige, das man die Anlage des Projektes betreffend monieren könnte. Es ist aber eben die leise Trauer der Musiker Savall und Johansen über die Vergänglichkeit dieser Lieder, die im Wesentlichen Bestandteil der sich immer weiter auf dem Rückzug befindlichen «oral tradition» sind, die das Projekt «Hirundo Maris» prägt. Lässt man sich jedoch darauf ein, so wird man mit einer CD voller poetischer Musik belohnt. ■
Arianna Savall / Petter Udland Johansen: Hirundo Maris – Chants du Sud et du Nord, ECM New Series 2227, Audio-CD
.
.
.
.
Interessante Buch- und CD-Neuheiten – kurz vorgestellt
.
«Die Ärzte»: «Die beste Band der Welt»
 Das 7. Sonderheft des «Rock Classics» Magazins aus dem Wiener Media-Haus Slam widmet sich ausschliesslich und umfangreich der 30-jährigen deutschen Punk-Rock-Gruppe «Die Ärzte». Das kommerziell nach wie vor erfolgreiche «Ärzte»-Trio Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo González gibt dabei in verschiedenen längeren Interviews Interna und Trivia preis zu seiner Gründungszeit vor 30 Jahren, zu seiner Besetzungsgeschichte, zum menschlichen und musikalischen Umfeld der Gruppe und zu geplanten Zukunftsprojekten. Das Heft, inhaltlich informativ und layouterisch gelungen, enthält nicht nur zahllose Infos und Foto-Reports, sondern wird garniert mit der CD «No Fun!», die eine Fülle an klassischen Songs der deutschen Punk- und New-Wave-Szene bietet. ■
Das 7. Sonderheft des «Rock Classics» Magazins aus dem Wiener Media-Haus Slam widmet sich ausschliesslich und umfangreich der 30-jährigen deutschen Punk-Rock-Gruppe «Die Ärzte». Das kommerziell nach wie vor erfolgreiche «Ärzte»-Trio Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo González gibt dabei in verschiedenen längeren Interviews Interna und Trivia preis zu seiner Gründungszeit vor 30 Jahren, zu seiner Besetzungsgeschichte, zum menschlichen und musikalischen Umfeld der Gruppe und zu geplanten Zukunftsprojekten. Das Heft, inhaltlich informativ und layouterisch gelungen, enthält nicht nur zahllose Infos und Foto-Reports, sondern wird garniert mit der CD «No Fun!», die eine Fülle an klassischen Songs der deutschen Punk- und New-Wave-Szene bietet. ■
Slam Media: Magazin Rock Classics / Sonderheft Nr.7 – Die Ärzte, 132 Seiten, mit Audio-CD
.
.
Franz Hummel: Sinfonien «Hatikva» und «Fukushima»
 Das erklärte Anliegen des frisch gegründeten Audio-Labels TYXart ist es, «die emotionalen, geistigen und intellektuellen Anforderungen von Musikliebhabern mit hochwertigen künstlerischen Produkten zu bedienen» – fürwahr keine bescheidene Vorgabe, zumal in heutigen Zeiten des kommerziell maximierenden Mainstream-Betriebes.
Das erklärte Anliegen des frisch gegründeten Audio-Labels TYXart ist es, «die emotionalen, geistigen und intellektuellen Anforderungen von Musikliebhabern mit hochwertigen künstlerischen Produkten zu bedienen» – fürwahr keine bescheidene Vorgabe, zumal in heutigen Zeiten des kommerziell maximierenden Mainstream-Betriebes.
Doch die Konzeption scheint umgesetzt zu werden – zumindest nach den drei Start-Projekten des neuen CD-Labels zu urteilen. Neben einer bemerkenswerten Klassiker-Einspielung des 15-jährigen Klavier- und Kompositions-«Wunderkindes» Yojo Christen sowie den «Kollektiven Kompositionen» des Klavier-Trios «Zero» sind die beiden Sinfonien «Hatikva» (für Klarinette und Orchester) und «Fukushima» (für Violine und Orchester) des deutschen Komponisten und Pianisten Franz Hummel hervorzuheben. Ersterer liegt thematisch die gleichnamige israelische Hymne zugrunde, wobei «die leidvollen Erfahrungen des israelischen Volkes» durch die «Überhöhung von Freud und Leid, Aufschrei und Tragödie» verarbeitet werden, während «Fukushima» ursprünglich unter dem Eindruck der atomaren Zertörung von Hiroshima entstanden sei (so der Komponist im gut dokumentierenden Booklet), jetzt aber dem Gedenken der letztjährigen Atom-Opfer Japans verpflichtet ist. Der Komponist über seine «Katastrophen-Sinfonie»: «Es bleibt zu hoffen, dass die ungeheure Tragik von Fukushima ein weltweites Umdenken im Umgang mit den Naturgewalten bewirkt». ■
Franz Hummel: «Hatikva» für Klarinette&Orchester (Giora Feidman) / «Fukushima» für Violine&Orchester (Elena Denisova), Sinfonie-Orchester Moskau (Alexei Kornienko), Label TYXart, Audio-CD: 54 Minuten
.
.
«stimmband»: Lieder und Songs
 Noch ein Büchlein mehr mit «Liedern und Songs» zum «fröhlichen Singen und Beisammensein» – nach so vielen Jahrzehnten der pausenlosen Produktion unzähliger derartiger «lustiger Liederbüchlein»?
Noch ein Büchlein mehr mit «Liedern und Songs» zum «fröhlichen Singen und Beisammensein» – nach so vielen Jahrzehnten der pausenlosen Produktion unzähliger derartiger «lustiger Liederbüchlein»?
Ja. Doch diese Zusammenstellung, knapp und knackig «stimmband» genannt, ist von ganz anderer, ja besonderer Qualität. Denn von der landläufigen Dutzendware ähnlicher Text- und Melodien-«Reigen» unterscheidet diese üppige Zusammenstellung aus den Häusern Reclam und Carus eine Menge. Beispielsweise die enorme stilistische und inhaltliche Spannbreite, oder die geschmacklich feine Selektion der Melodien und (Lied-)Texte, oder die Sorgfalt bei Layout und Notengrafik, oder die musikalisch sinnvollen Ergänzungen bezüglich Akkordangaben und Tonart-Wahl, oder die stabile buchtechnische Verarbeitung sowie die Handlichkeit des Formats.
Der Band versammelt, jeweils melodisch einstimmig notiert und mit allen Strophen versehen, das altehrwürdige Volkslied ebenso wie den Jürgens-Schlager, das fremdsprachige Abendlied wie die Brecht-Moritat, den Polit-Song wie den Musical-Hit. Die inhaltlichen Themenkreise sind dabei Liebe & Freundschaft, Reise & Natur, Sehnsucht & Freiheit, Glaube & Friede, Jahr & Tag, Spaß & Tanz. Eine Gitarren-Grifftabelle sowie ein Titel-Register runden diese Komposition ab.
Die Herausgeber möchten «der Magie des Singens einen Raum geben» – das ist vollumfänglich gelungen. ■
K. Brecht & K. Weigele: stimmband – Lieder und Songs, 256 Seiten, Verlage Reclam und Carus, ISBN 978-3-15-018983-2
.
.
Weitere Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Musik für Cembalo: «Hommage à Zuzana Růžičková»
.
Cembalo-Einspielungen auf höchstem Niveau
Michael Magercord
.
 Ich muss mit einem Geständnis beginnen: Ich mag das Cembalo nicht. Einem guten Freund und Musikkenner gegenüber hatte ich die Ansicht vertreten, dass alle früheren Komponisten, hätte es das Pianoforte bereits zu ihrer Zeit gegeben, den satten Klang des Hammerklaviers gegenüber den dürren und schnarrenden Tönen eines zupfenden Cembalos umgehend eingetauscht hätten. Der Freund war entsetzt, Kommentar: «Du hast doch keine Ahnung».
Ich muss mit einem Geständnis beginnen: Ich mag das Cembalo nicht. Einem guten Freund und Musikkenner gegenüber hatte ich die Ansicht vertreten, dass alle früheren Komponisten, hätte es das Pianoforte bereits zu ihrer Zeit gegeben, den satten Klang des Hammerklaviers gegenüber den dürren und schnarrenden Tönen eines zupfenden Cembalos umgehend eingetauscht hätten. Der Freund war entsetzt, Kommentar: «Du hast doch keine Ahnung».
Meine erste Begegnung mit dem umstrittenen Instrument hatte ich in der Grundschule. Unsere Klassenlehrerin war begeisterte Cembalistin, und beim Musikunterricht, den es damals noch gab – selige Zeiten – begleitete sie damit unser Blockgeflöte. Der befreundete Musikliebhaber ist allerdings jemand, dessen Ansichten es trotz aller persönlichen Erfahrungen zu beachten gilt. Und mit der «Hommage an Zuzana Růžicková», einer Doppel-CD mit Werken der bekanntesten und wohl renommiertesten Cembalistin des vergangenen Jahrhunderts, bietet sich beste Gelegenheit, meine Vorbehalte in Frage stellen zu lassen.
Die nunmehr 85-jährige tschechische Cembalo-Virtuosin Zuzana Růžicková hat in ihrer aktiven Musikerlaufbahn wohl so alles eingespielt, was für das Cembalo an Notenliteratur vorhanden ist. Auf den beiden neu veröffentlichten CDs befinden sich einmal alte Musik in Form von Solo-Werken von Bach und Scarlatti, und zum anderen Stücke aus dem ausgehenden 20. Jahrhundert. Die Musikerin selbst weiß nur zu gut um die Vorbehalte gegenüber ihrem Instrument. Oft spielte sie in ihren Konzerten ein und dasselbe Stück zunächst auf dem Klavier, dann auf Cembalo, damit – wie sie sagte – das Publikum verstünde, was den Stücken abhanden komme, wenn sie nicht auf dem entsprechenden Instrument gespielt werden.
Was also macht das besondere des Cembalos aus? Das Cembalo erfordert nicht nur eine besonders saubere Anschlagtechnik, um störendes Schnarren zu vermeiden, sondern durch die Kürze des Nachklangs ist die Anschlagzahl höher als auf dem Klavier. Die Musik für Cembalo ist deshalb durch eine ganz eigene Rhythmik geprägt. Bei den älteren Werken merkt man, dass ihre Komponisten noch ganz ihrem Instrument verhaftet waren. Und es zeigt sich besonders bei den Stücken des manischen Sonatenschreibers Domenico Scarlatti – er komponierte über 500 Cembalo-Sonaten –, dass das Cembalo bei Werken aus dieser Zeit gegenüber Einspielungen am Klavier überlegen ist.
Den neuen Werken auf der zweiten CD hingegen merkt man an, dass hier das Cembalo und seine Klänge schon besonders ausgenutzt werden, um einen ganz eigenen Klangeffekt zu erzielen. Drei Einspielungen sind orchestriert, De Falla, Polenc und Martinu die Komponisten. Die Streicher und Blasinstrumente übernehmen die Passagen, an denen Töne gehalten werden, das Cembalo darf seine klanglichen Stärken ganz entfalten. Um welche Stärken es sich dabei handelt, zeigen besonders die beiden Solo-Werke der Moderne: Sechs kompositorische Kleinode von Victor Kabalis, dem 2006 verstorbenen Ehemann der Cembalistin, und Jan Rychlík, der seine vier musikalischen Portraits von barocken Cembalisten Zuzana Růžičková gewidmet hatte, rücken den Klang des Instruments ins Fantastisch-Sphärische.
Diese Musikauswahl sowohl bei den alten als auch neuen Werken bietet vermutlich selbst dem geübten Cembalo-Hörer einige Überraschungen. Und mir waren diese beiden recht unterschiedlichen und in sich jeweils abgeschlossenen, doch zusammengehörenden CDs eine Lehre – zumal von dieser Lehrerin. Zuzana Růžičková musste ihre Kindheit im Ghetto von Terezienstadt, im KZ Ausschwitz und schließlich im Lager von Bergen-Belsen verbringen und verlor ihren Vater im Holocaust. Ihre Kraft zur Aussöhnung mit dem Land der Täter hat sie gemäß eigenem Bekenntnis nicht zuletzt durch das Cembalospiel der Werke von Johann-Sebastian Bach gewonnen.

Diese Doppel-CD als Hommage an die grosse tschechische Tasten-Virtuosin Zuzana Růžičková, auf der vier der neueren Werke zum ersten Mal digital vorliegen, bietet eine wunderbare Revue all der überraschenden Möglichkeiten des Cembalos.
Kurzum: Diese Doppel-CD, auf der vier der neueren Werke zum ersten Mal digital vorliegen, bietet eine wunderbare Revue all der überraschenden Möglichkeiten des Cembalos, wohl selbst für bereits gestandene Liebhaber dieses Instruments. Für die anderen, die es noch werden wollen, oder sich wenigstens dem Versuch unterziehen möchten, einer zu werden, wurde damit eine geradezu ideale Zusammenstellung barocker und moderner Cembalo-Werke auf höchstem Niveau vorgelegt. ■
Supraphon: Hommage an Zuzana Růžičková – Cembalo-Werke von Bach, Scarlatti, De Falla, Kalabis, Poulenc, Rychlík, Martinů, Doppel-CD
.
.
.
.
.
.
Franz Schreker: «Das Weib des Intaphernes – Symphonie op. 1 – Psalm 116 – Lieder»
.
«Ich bin (leider) Erotomane»
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 Mit einem Augenzwinkern ist diese Selbsteinschätzung des Komponisten Franz Schreker zu verstehen. Schließlich entstammt sie seiner satirischen Selbstcharakteristik, die im April 1921 in den Wiener «Musikblättern des Anbruch» publiziert wurde. Schreker montierte sie aus Kritiken, die bis dato zu seinen Werken erschienen waren, und ihm als Komponisten und Menschen sowie seinem Werk quasi alle denkbaren und sich bisweilen völlig widersprechenden Eigenschaften zusprachen, so dass der kleine Text in der verzweifelten Frage gipfelt: «Wer aber – um Himmels Willen – bin ich nicht?»
Mit einem Augenzwinkern ist diese Selbsteinschätzung des Komponisten Franz Schreker zu verstehen. Schließlich entstammt sie seiner satirischen Selbstcharakteristik, die im April 1921 in den Wiener «Musikblättern des Anbruch» publiziert wurde. Schreker montierte sie aus Kritiken, die bis dato zu seinen Werken erschienen waren, und ihm als Komponisten und Menschen sowie seinem Werk quasi alle denkbaren und sich bisweilen völlig widersprechenden Eigenschaften zusprachen, so dass der kleine Text in der verzweifelten Frage gipfelt: «Wer aber – um Himmels Willen – bin ich nicht?»
Wer Franz Schreker war, das ist auch heute noch fast ein Geheimnis, seine Musik bleibt ein Geheimtipp. Bereits 1947, also nur 13 Jahre nach Schrekers Tod, konnte Joachim Beck, der in den späten zwanziger Jahren mehrfach in Kurt Tucholskys «Weltbühne» über den Komponisten geschrieben hatte, in der «Zeit» einen Artikel veröffentlichen, der den bezeichnenden Titel trägt: «Franz Schreker, ein Vergessener».
Wie konnte es dazu kommen? Schließlich war Schreker zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts als der führende deutsche Opernkomponist, ja als Messias des neuen Musikdramas gefeiert worden. Nun – Franz Schreker war Jude. Und als solcher gehörte er zu jenen Künstlern, die im nationalsozialistischen Deutschland zunächst beschimpft, verfemt und schließlich von der gleichgeschalteten Musikwissenschaft als «undeutsch» aus der Historie getilgt werden sollten. So liest man beispielsweise in der «Geschichte der Deutschen Musik» des strammen Nationalsozialisten Otto Schumann (der nach Ende des Krieges einfach Fäden aufhob und munter weiter publizierte) zu Schreker: «Wie wahl- und sinnlos das Judentum in der Verhimmelung seiner Gesinnungsgenossen vorgegangen ist, zeigt das Beispiel von Franz Schreker. Obwohl in seinen orchestralen Farbmischungen, seiner verstiegenen Theatralik und schmeichelnden Gehaltlosigkeit der vollendete Gegensatz zu Schönberg, wurde er ‘in Fachkreisen’ als ein Gott der Musik gepriesen. Dabei erklärt sich dieser jüdische Fachgeschmack ganz einfach daraus, dass Schreker in seinen Dirnen- und Zuhälteropern die Verzückungen käuflicher Sinnlichkeit mit allen Mitteln des modernen ‘Musikdramas’ feierte.» Fortan war Schreker aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden, zumal er 1934 – wohl in Folge der nationalsozialistischen Hetze – einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall erlitt und verstarb. Anders also als im Falle manch eines anderen Komponisten gab es keine Fortsetzung des kompositorischen Schaffens im Verlauf des Dritten Reiches und nach Ende des Weltkrieges, die ihn im Bewusstsein der Musikinteressierten hätte halten können.
Schrekers Œuvre versank in einem Dornröschenschlaf, in dem es sich seither – man muss es trotz der zunehmenden Versuche, seine Opern auf deutsche Bühnen zu bringen (wie in jüngerer Zeit beispielsweise am Bonner Theater) und Einspielungen seiner Werke vorzunehmen, sagen – immer noch befindet.
Bei genauem Hinsehen sind aber auch die Einspielungen seines Werkes – mit einigen Ausnahmen – nicht wirklich aktuell, sodass sich auch hier nicht die Tendenz zu einer angemessenen Schreker-Renaissance zeigt. Man muss dankbar für das sein, was überhaupt vorliegt. Auch die von Cappriccio jüngst herausgegebene 3 CD-Box bringt nicht wirklich etwas Neues, sondern fasst Aufnahmen des Labels zusammen, die alle schon vor geraumer Zeit in Einzelaufnahmen erschienen sind. Interessanterweise steht im Zentrum dieser Aufnahmen der «unbekannte Schreker», was der Box wiederum einen speziell exotischen Charakter verleiht. Unbekannte Werke eines mehr oder minder unbekannten Komponisten vorzulegen scheint auf den ersten Blick so mutig, dass man wohl gewiss sein darf, dass es sich um ein Panoptikum kompositorischer Gemmen handeln muss. Das ist streckenweise tatsächlich auch der Fall. Ausgesprochen faszinierend ist beispielsweise die Einspielung des Melodrams «Das Weib des Intaphernes». Sicher, die Textvorlage des Vielschreibers Eduard Stucken (der – welch eine Ironie des Schicksals! – im übrigen ein regimetreuer Nationalsozialist und Unterzeichner des «Gelöbnisses treuester Gefolgschaft» war), ist literarisch mäßig. Dafür ist sie außerordentlich farbig und gibt dem bestens aufgelegten Sprecher Gert Westphal reichlich Gelegenheit zu glänzen.
Die den Text psychologisch auslotende Musik Schrekers weist diesen als das aus, was er im Grunde ist: ein Mann der Oper. Das 20 Minuten währende Werk, das eine Geschichte von Bosheit, verderbter Lust, Verzweiflung und Rache erzählt, erinnert in seiner dunklen musikalischen Schwüle nicht selten an Richard Strauss’ «Salomé», und das WDR-Rundfunkorchester unter der Leitung von Peter Gülke schafft es ohne entscheidende Abstriche, die irisierende Klangwelt Schrekers sinnlich zum Leben zu erwecken.
Gleiches gilt für Schrekers schon fast monumentale Vertonung des 116. Psalms, der durch Gülke, das WDR-Orchester sowie den WDR-Rundfunkchor Köln mustergültig dargestellt wird. Wenig reizvoll ist Schrekers op. 1 – nicht so sehr aufgrund der Aufnahme, sondern als Werk. Hier hört man noch sehr viel Epigonales, bisweilen hat man das Gefühl, eine verschollene Übungssymphonie des jungen Brahms zu hören.
Die zweite CD, die ebenfalls WDR-Aufnahmen Gülkes umfasst, widmet sich dem Liedkomponisten, Dichter und Arrangeur Schreker. Hier nun kann man bei allem Wohlwollen gegenüber Schreker nicht umhin, mehr Schwächen als Stärken erkennen zu müssen. Der Textdichter Schreker ist wenig innovativ und gänzlich in seiner Zeit verhaftet. Texte wie «Immer hatt’ ich noch Glück im Leben» oder «Wollte ich hadern mit Glück und Schicksal» sind nachgerade peinlich. Da ändert auch die Rezitation der Texte durch Westphal nichts. Die vorgestellten Orchesterlieder teilen diese Schwäche. Auch dass Mechthild Georgs schwerer Mezzo klanglich nicht überzeugen will und ihre Diktion oft mehr als mäßig ist, hilft nicht weiter.

Die vom CD-Label Capriccio herausgegebene Box mit Werken Schrekers verdeutlicht sowohl die Stärken des absolut zu unrecht vergessenen Komponisten als auch seine Schwächen. Insgesamt eine verdienstvolle, auch qualitätsvoll eingespielte Zusammenfassung, die Lust auf das weitere Œuvre Schrekers macht.
Die dritte CD bringt schließlich Schreker-Bearbeitungen für Klavier, die sein Schüler Ignaz Stasvogel vorgenommen hat. Pianist Kolja Lessing interpretiert die ausgesprochen gut bearbeiteten Stücke klangschön, durchsichtig und ohne jegliche Sentimentalität, die sich in der kleinen Suite «Der Geburtstag der Infantin» schnell einschleichen und den reizvollen Miniaturen den Charakter von «Salonmusik» verleihen könnte. Dabei ist Lessings Spiel keinesfalls nüchtern, sondern durchwegs engagiert. Höhepunkt dieser CD ist Stasvogels Bearbeitung von Schrekers «Kammersymphonie», die nicht nur Lessings stilsichere Herangehensweise unterstreicht, sondern auch Stasvogels Fähigkeit, die klangliche Vielfalt der Schrekerschen Orchestrationskunst kongenial auf das Klavier zu übertragen. ■
Franz Schreker: Das Weib des Intaphernes – Psalm 116 – Kammersinfonie – Lieder, Mechthild Georg, Gerd Westphal, WDR-Rundfunkchor und -orchester, Peter Gülke, Kolja Lessing, Capriccio, 3 Audio CD
.
.
.
.
Josquin Desprez: Missa Ave maris stella & Marienmotetten
.
«Josquin ist der Noten Meister»
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 Es war kein geringerer als Reformator Martin Luther, der die Worte schrieb, die hier als Überschrift verwendet werden. Es sind Worte der Bewunderung des einen, der auch Musiker ist, für den anderen, der nur Musiker ist. Diese Bewunderung fußt auf einer einfachen, aber dennoch vollkommen zutreffenden Begründung, die Luther seinem Leser natürlich nicht vorenthält: «Josquin ist der noten meister, die habens müssen machen, wie er wolt; die anderen Sangmeister müssens machen, wie es die noten haben wollen.» Während die anderen Sangmeister Luthers Ansicht nach bloße Tonsetzer sind, die sich den komplexen Regeln der Kompositionskunst unterwerfen müssen – der Wittenberger Doktor mag hier sowohl an die Vorgänger Josquins, also an Dufay und Ockeghem, als auch an seine Zeitgenossen Isaac, Obrecht oder de La Rue denken -, so ist Josquin hingegen der Herr der Kompositionskunst, die ihm lediglich als Werkzeug dient, um seine musikalischen Ideen umzusetzen.
Es war kein geringerer als Reformator Martin Luther, der die Worte schrieb, die hier als Überschrift verwendet werden. Es sind Worte der Bewunderung des einen, der auch Musiker ist, für den anderen, der nur Musiker ist. Diese Bewunderung fußt auf einer einfachen, aber dennoch vollkommen zutreffenden Begründung, die Luther seinem Leser natürlich nicht vorenthält: «Josquin ist der noten meister, die habens müssen machen, wie er wolt; die anderen Sangmeister müssens machen, wie es die noten haben wollen.» Während die anderen Sangmeister Luthers Ansicht nach bloße Tonsetzer sind, die sich den komplexen Regeln der Kompositionskunst unterwerfen müssen – der Wittenberger Doktor mag hier sowohl an die Vorgänger Josquins, also an Dufay und Ockeghem, als auch an seine Zeitgenossen Isaac, Obrecht oder de La Rue denken -, so ist Josquin hingegen der Herr der Kompositionskunst, die ihm lediglich als Werkzeug dient, um seine musikalischen Ideen umzusetzen.
Die Ideen, die Josquin umtrieben, waren revolutionär, besonders was das Verhältnis von Musik und Text betrifft. Hatte der Text zuvor kaum Einfluss auf die musikalische Gestalt der Komposition, so rückt er bei ihm deutlich ins Zentrum des Interesses und wird zunehmend zu dem Element, an dem sich die musikalische Gestalt orientiert, dem sie dient. Auf diese Weise tritt das «kühl Errechnete» (Werner Oehlmann) in den Hintergrund und es tritt dem Hörer eine überwältigend melodische, warme, fließende und unmittelbare Musik entgegen, deren hochartifizielle Struktur kaum wahrnehmbar ist, sodass der unbefangene Hörer zunächst glaubt, es mit ganz einfacher, ja natürlicher Musik zu tun zu haben. In Theun de Vries’ Josquin-Roman «Die Kardinalsmotette» (1960) wird das Erleben, das durch die Begegnung mit der Musik Josquins ausgelöst werden kann, trefflich beschrieben: «Im Chor vernahm ich viele Stimmen, von denen jede für sich zu singen schien, sie stiegen auf und nieder auf unsichtbaren Leitern über- und nacheinander, manchmal paarweise, manchmal kreuzten sie einander auf ihren Bahnen gleich wie Kometen und schleppeten einen langen Schweif aus Harmonien hinter sich her, schwebend hielten sie einander im Gleichgewicht und trotz der kunstvollen Verschlingungen war alles stark und durchsichtig wie ein Silbergerüst im Raum. […] Dass die Macht der Musik unbegrenzt ist, hatte ich stets mehr geahnt als gewusst; jetzt erfuhr ich es durch eigenes Erleben, ein für allemal.»

Manfred Cordes und das Ensemble Weser-Renaissance legen mit ihrer Einspielung von Marienmotetten und der «Missa Ave maris stella» aus der Feder Josquin Desprez' sowohl eine gut klingende als auch eine durchweg stimmig interpretierte Aufnahme vor, die Josquins Ausnahmestellung unter den Musikern seiner Epoche überzeugend unterstreicht.
Besonders deutlich werden die Qualitäten seines kompositorischen Idioms in den 25 Marienmotetten Josquins, von denen das Bremer Ensemble «Weser-Renaissance» unter der Leitung von Manfred Cordes, seines Zeichens Musiktheoretiker und Rektor der Hochschule für Künste Bremen, sieben Stück bei cpo eingespielt hat. Hinzu tritt die «Missa Ave maris stella». Das Ensemble «Weser-Renaissance» ist in der Alte-Musik-Szene nicht unbekannt, hat es in der Vergangenheit doch unter anderem sehr beachtliche Schütz-, Praetorius-, Lassus- und Hassler-Einspielungen vorgelegt. Doch das sich in dieser Einspielung aus acht Sängern zusammensetzende Ensemble füllt mit dieser CD keine Marktlücke und muss sich entsprechend an berühmten Ensembles messen, beispielsweise am Orlando Consort, an den Tallis Scholars, der Chapelle Royale oder am Hilliard Ensemble.
Und obgleich das keine leichte Aufgabe ist, so gelingt sie doch erfreulich gut. Zum einen gefällt der Klang der Aufnahme. Im leichten Hall der Bassumer Stiftskirche entwickeln die Sänger einen warmen, tragenden und körpervollen Ton, nicht zu scharf in den hohen Lagen des Diskants, weich in den Unterstimmen, wenngleich aus diesem Grund nicht immer konsequent durchsichtig. Doch gerade das Weiche ist es, was den spezifisch menschlichen Ton dieser Musik, die ja in keinem Fall unnahbar klingen darf, unterstreicht. Hinzu treten die hohe gestalterische Sicherheit und die interpretatorische Solidität von Cordes und seinem Ensemble, die dafür sorgen, dass der Hörer keinen Moment daran zweifelt, dass diese Kompositionen den Anspruch haben, den vertonten Text auszuloten. Ganz herrlich gelingt das dem Ensemble beispielsweise im berühmten «Ave Maria, gratia plena» à 4, das man bei keinem der anderen oben angeführten Ensembles inniger zu hören bekommt. Gleiches gilt für die tadellos gestaltete Kombinationsmotette «Virgo salutiferi», deren himmlischer Cantus firmus («Ave maria, gratia plena») hier eben jene silbrige Qualität besitzt, von der de Vries spricht. Lediglich Manfred Cordes’ Entscheidung, die «Miss Ave maris stella» nicht am Stück, sondern satzweise von den anderen Marienmotetten unterbrochen musizieren zu lassen, befremdet. Sicher, so erhält die CD einen imaginären Rahmen, die Motetten werden mehr oder minder zum Oridinarium in Bezug gesetzt, aber überzeugend und vor allem nötig war das nicht. ●
Josquin Desprez: Missa Ave maris stella / Marienmotetten, Weser-Renaissance / Manfred Cordes, Audio CD, CPO 2011
.
.
.
Steve Reich: «WTC 9/11» (Kronos Quartet)
.
«One of the towers just in flames»
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 Das Attentat auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 war die Initialkatastrophe des neuen Jahrtausends. Es ist kaum möglich, die Bilder der beiden brennenden und zerstörten Türme aus dem Gedächtnis zu verbannen, die Bilder der Männer und Frauen, die Hand in Hand aus den brennenden Gebäuden sprangen, der Feuerwehrleute, die staubbedeckt bis zur Erschöpfung nach Überlebenden suchten. Kann man dem mit einem Kunstwerk, einem Stück Musik begegnen?
Das Attentat auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 war die Initialkatastrophe des neuen Jahrtausends. Es ist kaum möglich, die Bilder der beiden brennenden und zerstörten Türme aus dem Gedächtnis zu verbannen, die Bilder der Männer und Frauen, die Hand in Hand aus den brennenden Gebäuden sprangen, der Feuerwehrleute, die staubbedeckt bis zur Erschöpfung nach Überlebenden suchten. Kann man dem mit einem Kunstwerk, einem Stück Musik begegnen?
Der amerikanische Komponist Steve Reich hat es versucht – und es ist ein kurzes, aber höchst intensives Werk dabei herausgekommen, das «WTC 9/11» heißt und nun beim Label Nonesuch auf CD erschienen ist. Bei dem Werk handelt es sich um eine Auftragsarbeit für das Kronos-Quartet, das auch die Einspielung übernommen hat. «WTC 9/11» ist ein Opus für drei Streichquartette, von denen zwei im Vorfeld aufgezeichnet wurden und eines live spielt. Hinzu treten im Vorfeld aufgezeichnete Stimmen. Das Werk ist kurz, knapp 16 Minuten dauernd.
Die Sätze haben unterschiedliche Bezüge zum Anschlag. So bringt der erste Satz («9/11») Tonaufzeichnungen des NORAD (North American Aerospace Defense Command) und des FDNY (New York Fire Department), die während des Attentats mitgeschnitten wurden. Der zweite Satz («2010») bringt Tonaufzeichnungen aus Gesprächen mit Augenzeugen, die sich im Jahre 2010 an die Katastrophe erinnern. Der dritte («WTC») kombiniert Erinnerungen von jüdischen Frauen, die monatelang im Medical Examiner’s Office in New York saßen, um dort – der jüdischen Tradition folgend – während der Shmira Psalmen und Passagen aus der Bibel zu sprechen, mit Gesängen eines Kantors aus einer der großen Synagogen New Yorks.
Die Musik selbst nutzt durchweg erkennbare Stilmittel. So verlängert Reich die Vokale des gesprochenen Textes, was einen gewissen Verfremdungseffekt hat, eines der Quartette spielt ununterbrochen Tonwiederholungen, die wie ein ständiges Warnsignal die ersten beiden Sätze durchziehen. Eines der anderen Quartette orientiert sich an der Sprachmelodie der aufgezeichneten Stimmen, stützt diese und zieht Material daraus. Das ist sehr intensive Musik, die die Anspannung und die Angst derjenigen Menschen, deren Stimmen der Hörer begegnet, eindringlich transportiert.
Der zweite Satz beginnt zunächst mit Stimmen vor einem rauschend-brummenden Cluster, bevor die Tonwiederholungen wieder einsetzen, und zwar gerade in jenem Moment, da bei den sprechenden Personen die übermächtige Erinnerung an die Ereignisse wieder einsetzt («the first plane went straight into the building»). Das ist schon eindruckvoll, wie Reich durch die stilistischen Verbindungen des ersten und zweiten Satzes zeigt, wie der Moment des Erinnerns das Geschehen in seiner gänzlichen Gefühlsintensität augenblicklich aktualisiert. Bei Reich – das wird ganz deutlich – ist auch im Jahre 2010 immer noch 9/11.
Erst im letzten Satz wandelt sich das musikalische Geschehen. Die nervösen Tonwiederholungen enden und das Werk nimmt den Charakter eines altertümlichen Klageliedes an, in das sich die biblischen Gesänge des Kantors wie von selbst hineinfinden: «Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!», und: «Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und bringe dich an den Ort, den ich bereitet habe.»
WTC – das bedeutet für Reich auch «World To Come», und so scheint der Satz und mit ihm das Werk zunächst noch einen tröstlichen Ausgang zu finden. Und doch: die letzten Minuten gehören einem Sprecher, der auf etwas anders hinweist: «The world to come, I don’t really know what that means, and there’s the world right here.» In dieser Montage zeigt sich nicht nur die Unbegreiflichkeit der «world to come», deren Tröstlichkeit nicht mehr unbedingt für jeden valide ist, sondern auch die Tatsache, dass wir täglich mit den Geschehnissen der «world right here», mit Ereignissen wie dem Anschlag vom 11. September konfrontiert werden und in dieser gegenwärtigen Welt mit der Gefahr solcher Katastrophen weiterleben müssen. Konsequenterweise kehrt Reich dann auch musikalisch zum Anfang des Werkes zurück und lässt in den letzten Sekunden erneut den Warnton erklingen – leiser ist er wohl, aber er ist immer noch da.

Steve Reichs kompositorische Auseinandersetzung mit den New Yorker Terroranschlägen vom 11. September 2001 ist durchweg gelungen: «WTC 9/11» ist ein höchst intensives Musikstück, das gedanklich wie musikalisch dicht ist und die Intensität der Ereignisse für die Augenzeugen ausgesprochen plastisch präsentiert. Lediglich die Kopplung mit den «Dance Patterns» und dem «Mallett Quartet» wirkt unangemessen.
Wenig passend hingegen scheint mit die Kombination dieses durchweg außergewöhnlichen Werkes mit dem «Mallet Quartet» (2009) für Vibraphone und Marimbas, glänzend gespielt vom Ensemble Sō Percussion, und dem kurzen Stück «Dance Patterns» aus dem Jahre 2002. Nichts gegen die Stücke an sich: das ist sehr rhythmusbetonte, gut klingende, schnelle, spielerische, nicht selten jazzige Musik, die fraglos ins Ohr geht. Was sie hier aber soll, wird nicht deutlich. Nach der Intensität von «WTC 9/11» ist diese Musik an dieser Stelle überflüssig; man hat den Eindruck, die CD sei einfach noch auf eine Gesamtspielzeit von ohnehin schmalen 36 Minuten gestreckt worden. Dabei hätten die rund 16 Minuten Spielzeit des «WTC 9/11» vollkommen gereicht… ■
Steve Reich, WTC 9/11 – Kronos Quartet, Audio CD, Nonesuch 2011
.
.
.
Alan Hovhaness: Exile-Symphony (Boston Modern Orchestra Project)
.
«Ich komponiere, weil ich komponieren muss»
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
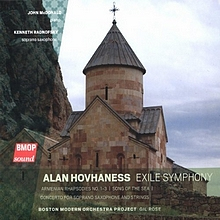 «Ich kann diese billige Ghetto-Musik nicht hören». Das ist starker Tobak und nichts Geringeres als eine wahrlich vernichtende Kritik, zumal sie nicht von irgend jemandem stammt, sondern von Leonard Bernstein. Ziel des Spottes war die erste Symphonie des Tanglewood-Stipendiaten Alan Hovhaness, der 1911 als Alan Vaness Chakmakjian geboren wurde. Doch Bernstein war nicht der einzige Komponist in Tanglewood, der nichts mit der Musik des jungen Amerikaners armenisch-schottisch Herkunft anfangen konnte. Auch Aaron Copland lehnte seine Musik strikt ab. Gleiches gilt für Vigil Thomson.
«Ich kann diese billige Ghetto-Musik nicht hören». Das ist starker Tobak und nichts Geringeres als eine wahrlich vernichtende Kritik, zumal sie nicht von irgend jemandem stammt, sondern von Leonard Bernstein. Ziel des Spottes war die erste Symphonie des Tanglewood-Stipendiaten Alan Hovhaness, der 1911 als Alan Vaness Chakmakjian geboren wurde. Doch Bernstein war nicht der einzige Komponist in Tanglewood, der nichts mit der Musik des jungen Amerikaners armenisch-schottisch Herkunft anfangen konnte. Auch Aaron Copland lehnte seine Musik strikt ab. Gleiches gilt für Vigil Thomson.
Die Ablehnung dreier einflussreicher Männer der amerikanischen Musikwelt mag ein Grund dafür sein, dass Hovhaness’ Musik auch in Europa so gut wie unbekannt geblieben und so gut wie nie im Konzertsaal zu erleben ist. Ein anderes Moment, das dazu geführt hat, in den Kreisen der europäischen E-Musik peinlich berührt und mit einem Anflug an Schamesröte standhaft an Hovhaness vorbeizublicken, ist die schlecht zu leugnende Tatsache, dass seine musikalische Sprache schnell so klingen kann wie esoterisch angehauchte, an asiatischen Klängen orientierte Entspannungsmusik. Räucherstäbchen, Mantras, «Om» und Hovhaness als stimmungsvoller Soundtrack. Derlei kann man sich, beschäftigt man sich nicht weiter mit Philosophie und Œuvre des Komponisten, schon schnell als Meinung und endgültiges Urteil zurechtlegen. Spätestens jedoch, wenn der Hörer dann noch über eines der populärsten Werke des Komponisten stolpert, das pünktlich zu Beginn der Heydays der New-Age-Bewegung in den USA im Jahre 1970 erschien und den verdächtigen Titel «And God Created Great Whales» trägt, ist das letzte Quentchen Offenheit gegenüber Hovhaness dahin. Denn wenn einer hingeht und auf Tonband gebannte Walgesänge in einer klasssichen Komposition unterbringt, so kann man doch wohl kaum noch von einer ernstzunehmenden Komposition eines ernstzunehmenden Komponisten reden, oder?
Doch, man kann. Denn wendet man sich weg vom allzu einfachen Esoterik-Vorwurf, so kann man in Hovhaness Kompositionen, die in ihrer Art vollkommen individuell sind, einen Kontrapunkt zu der akademisch arrivierten Musik seiner Zeit (Copland, Bernstein) erkennen. Denn brachte Amerika auf der einen Seite den Intellekt fokussierende seriell orientierte Komponisten hervor, so gab es mit Hovhaness auf der anderen Seite einen naturverbunden Mystizismus, der aus der Überzeugung des Komponisten hervorging, dass die technisierte Gegenwart die Seele des Menschen zerstört habe und der Künstler dabei helfen müsse, die Menschheit spirituell zu erneuern.
Das erkannten dann schließlich auch eine Reihe anderer Künstler wie beispielsweise John Cage, Martha Graham, Leopold Stokowski und Fritz Reiner, die Hovhaness unterstützten. Dieses Jahr wäre er, der schließlich doch zu einem der großen alten Männer der ameriakanischen Musikszene aufstieg, einhundert Jahre alt geworden. Europa hat davon kaum Notiz genommen und auch der CD-Markt hat nicht allzuviel zu diesem Ereignis produziert.
Eine löbliche Ausnahme ist eine Produktion des Labels BMOP Sound, dem Hauslabel des «Boston Modern Orchestra Project», einem der führenden amerikanischen Orchester im Sektor der neuen Musik. Gründer und Dirigent Gil Rose hat sich zum Hovhaness-Jahr nicht lumpen lassen und eine Reihe von Werken des Komponisten auf einer CD neu eingespielt, die vorwiegend aus dessen früher Phase stammen. Das früheste ist der 1933 entstandene «Song of the Sea», und man darf glücklich darüber sein, dass dieses zweiteilige Stück für Klavier und Streichorchester nicht jener großen Vernichtung von Frühwerken anheim gefallen ist, die Hovhaness zwischen 1930 und 1940 durchgeführt hat. Es präsentiert einen Komponisten mit Sinn für große, unmittelbar verständliche melodische Bögen und sinnliche Klangfarben, einen Nachfolger Sibelius’ und Verwandten Vaughan Williams – einen späten Spätestromatiker also.
Dieser kaum sechs Minuten währenden Miniatur mit dem herrlich aufspielenden BMPO unter Rose und einem höchst delikat gestaltenden John McDonald am Klavier folgt die 1936 entstandene erste Symphonie, die den Beinamen «Exile» führt. Das 1939 in England vom BBC Orchestra unter der Leitung von Leslie Heward uraufgeführte Werk gedenkt des Völkermorders an den Armeniern im Umkreis der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Höchst eindrucksvoll erhebt sich im ersten Satz (Andante espressivo – Allegro) über einer Ostinato-Figur eine orientalisch angehauchte klagende Klarinettenmeldie, die weiter durch die einzelnen Holzbläsergruppen wandert, wobei sie immer wieder einmal durch «heroische» Fanfaren unterbrochen wird. Plötzlich brechen nervöse Streicher in die feierliche Klage herein, die Stimmung ändert sich: kriegerische Nervosität kommt auf. Das ist wahrlich nicht schlecht gemacht, weder was Meldodieführung, Instrumentation noch was die Dramaturgie des Satzes angeht. Ganz besonders begeistert die Spielkultur des BMPO, das minutiös jenen Wunsch umsetzt den Hohvaness einmal in einem Interview gegenüber Bruce Diffie geäußert hat: Er wolle keinen Klangbrei, sondern dass man jeden Ton der Komposition höre. Besser als hier geschehen ist, kann man das kaum umsetzen. Herrlich auch der an mittelalterliche Tanzweisen erinnernde Ton des zweiten Satzes (Grazioso), der die ruhige Stimmung des vorangegangenen Andante espressivo wieder aufgreift.
Im dritten Satz, der bisweilen als «Triumph» bezeichnet wird, kehren die kriegerischen Fanfaren des ersten Satzes ebenso wieder, wie die nervöse Ostinato-Figur der Streicher, jetzt jedoch eingebettet in eine wiederum altertümlich anmutende Choralmelodie, die das Werk zu einem hymnischen Abschluss bringt. In einer seiner Bewerbungen für ein Stipendium der Guggenheim-Stiftung schreibt Hovhaness 1941: «Ich schlage vor, einen heroischen und monumentalen Kompositionsstil zu schaffen, der einfach genug ist, um jeden Menschen zu inspirieren, frei von Modeerscheinungen, Manierismus und falscher Bildung, dafür direkt, ehrlich und immer ursprünglich, aber nie unnatürlich.» Die «Exile Symphony» hat dieses Programm bereits fünf Jahre zuvor umgesetzt.

Im Hovhaness-Jahr präsentiert das Boston Modern Orchestra Project unter der Leitung von Gil Rose einen interessanten Einblick in das Frühwerk des hierzulande zu wenig bekannten Komponisten Alan Hovhaness. Neben einer eindringlichen Wiedergabe der «Exile Symphony» und der drei «Armenian Rhapsodies» präsentiert diese CD erstmals das hörenswerte «Concerto for Soprano Saxophone and Strings». Ein gelungenes Plädoyer für einen nicht selten missverstandenen Komponisten.
An die armenische Thematik schließen die 1944 entstandenen drei «Armenian Rhapsodies» an. Das musikalische Material zu diesen kurzen Orchesterstücken stammt aus Hovhaness’ Zeit als Organist der St. James Armenian Apostolic Church in Watertown. Tatsächlich sind die drei Rhapsodien zusammen genommen ein Panoptikum armenischer Folklore und Sakralmusik. Da hört man lebhafte Tänze, ernsten Hymnen und untröstliche Weisen, allesamt für Streicher gesetzt, wobei an Intensität besonders die tief empfundene, klagende dritte Rhapsodie hervorsticht.
Schließlich wird die CD abgerundet durch das späte Konzert für Sopransaxophon und Streichorchester aus dem Jahre 1988, das – obgleich es ausgesprochen schön musiziert wird (hervorragend: Kenneth Radnowsky am Saxophon) – in dieser Zusammenstellung ein wenig fehl am Platze wirkt. Denn obwohl Hovhaness einmal sagte, man könne seine späten von seinen frühen Kompositionen im Grunde nicht unterscheiden, so ist das doch nicht ganz richtig, und das Konzert für Sopransaxophon ist dafür ein gutes Beispiel: Obschon Hovhaness auch hier die kompositorischen Elemente seiner Frühzeit nutzt, so tritt in der Melodik der armenische Tonfall zurück und ein sphärenhaftes Idiom, das seit der zweiten Symphony (Mysterious Mountain, 1955) Hovhaness’ Markenzeichen geworden war, dominiert. Zudem begegnet man traditionalistischen musikalischen Konventionen. Im ersten und letzten Satz begegnen wir gar der Fuge (Hovhaness war lebenslang ein großer Bewunderer der Bach’schen «Kunst der Fuge»), im zweiten einem entzückenden langsamen Walzer und schließlich einem Abschnitt, der wie eine Hommage an die Wiener Klassik anmutet. Und doch: Schön ist es in jedem Fall, das Werk nun überhaupt in einer Einspielung vorliegen zu haben. ■
Alan Hovhaness, Exile-Symphony – Boston Modern Orchestra Project, Audio-CD, BMOP/sound 2011
.
.
.
Gustav Mahler: «Sinfonie Nr. 3 in d-moll» (Jonathan Nott)
.
Solides Interpretieren, aber ohne Leidenschaft
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 «Daß ich sie Symphonie nenne, ist eigentlich unzutreffend, denn in nichts hält sie sich eben an die herkömmliche Form.» Mit diesem Satz, der uns von Natalie Bauer-Lechner in ihren «Erinnerungen an Gustav Mahler» berichtet wird, charakterisiert der Komponist 1895 seine dritte Symphonie, in deren Komposition er gerade steckt. Es ist ein musikalisches Ungetüm, ein Gigant des Genres, ein Werk, dessen Außmaße alles bisher dagewesene übertrifft. Mahler wird damit seinem Anspruch, in der Gattung Symphonie «an sich» die Welt erschaffen zu wollen, gerecht, wobei die Dritte ihm strukturell Probleme bereitet: «Aus den großen Zusammenhängen zwischen den einzelnen Sätzen, von denen mir anfangs träumte, ist nichts geworden, jeder einzelne steht als ein abgeschlossenes und eigentümliches Ganzes für sich da: keine Wiederholungen, keine Reminiszenzen», sagt der Komponist ein Jahr später. Doch das ist natürlich – wie so oft bei Mahlers Selbstäußerungen – nur die halbe Wahrheit, schließlich lassen sich immer wieder, beispielsweise zwischen dem ersten und dem letzten Satz, motivische und strukturelle Bezüge finden, die den Koloss zusammenhalten.
«Daß ich sie Symphonie nenne, ist eigentlich unzutreffend, denn in nichts hält sie sich eben an die herkömmliche Form.» Mit diesem Satz, der uns von Natalie Bauer-Lechner in ihren «Erinnerungen an Gustav Mahler» berichtet wird, charakterisiert der Komponist 1895 seine dritte Symphonie, in deren Komposition er gerade steckt. Es ist ein musikalisches Ungetüm, ein Gigant des Genres, ein Werk, dessen Außmaße alles bisher dagewesene übertrifft. Mahler wird damit seinem Anspruch, in der Gattung Symphonie «an sich» die Welt erschaffen zu wollen, gerecht, wobei die Dritte ihm strukturell Probleme bereitet: «Aus den großen Zusammenhängen zwischen den einzelnen Sätzen, von denen mir anfangs träumte, ist nichts geworden, jeder einzelne steht als ein abgeschlossenes und eigentümliches Ganzes für sich da: keine Wiederholungen, keine Reminiszenzen», sagt der Komponist ein Jahr später. Doch das ist natürlich – wie so oft bei Mahlers Selbstäußerungen – nur die halbe Wahrheit, schließlich lassen sich immer wieder, beispielsweise zwischen dem ersten und dem letzten Satz, motivische und strukturelle Bezüge finden, die den Koloss zusammenhalten.
Ein anderer Zusammenhalt wird durch die inhaltliche Grundidee des Werkes gegeben. Mahler will mit seiner Symphonie ein Spiegelbild der Welt schaffen: «Nun denke Dir ein so großes Werk, in welchem sich in der Tat die ganze Welt spiegelt – man ist, sozusagen, selbst nur ein Instrument, auf dem das Universum spielt.» Diese aus dem Arbeitssommer 1896 an seine Geliebte Anna von Mildenburg gerichteten Zeilen zeigen, dass sich Mahler zu diesem Zeitpunkt nicht nur als Schöpfer seines Kunstwerkes verstand, sondern als Teil des großen Ganzen, als Esoteriker, als Medium in einem rekreativen universellen Prozess. Und eben jener Prozess sollte durch die dritte Symphonie in Kunst gegossen werden.
Damit der Prozess der parallelen Neu- und Wiederschaffung der Welt für den Hörer durchschaubar wird, stellt Mahler den einzelnen Sätzen zunächst Titel voran und gibt während der Kompositionen immer wieder ausführliche Deutungsansätze preis. Der grundsätzliche Aufbau ist klar. Das Werk ist «eine in allen Stufen der Enwicklung in schrittweiser Steigerung umfassende musikalische Dichtung. Es beginnt mit der leblosen Natur und steigert sich bis zur Liebe Gottes», schreibt der Komponist und präzisiert diese «Stufenleiter» folgendermaßen: 1. Satz: «Einleitung: Pan erwacht/folgt sogleich/Nro. I Der Sommer marschiert ein/(,Bacchuszug‘)»; 2. Satz «Was mir die Blumen ([Nachtrag]: auf der Wiesen) erzählen»; 3. Satz «Was mir die Thiere/im Walde/erzählen»; 4. Satz «Was mir der Mensch erzählt»; 5. Satz «Was mir die Engel erzählen»; 6. Satz «Was mir die Liebe erzählt».
Diese im Autograph vermerkten Satzbezeichnungen hat Mahler allerdings wieder verworfen, wohl wissend, dass sie für die Kritik ein gefundenes Fressen sein würden. Und recht hatte er; Bis heute macht die Vorstellung, dass Mahler hier eine in der (göttlichen) Liebe gipfelnde Kosmologie entworfen haben könnte, vielen Exegeten Schwierigkeiten. Schließlich wird Mahlers Werk gern von hinten her verstanden, also von der Neunten bis zur Vierten rückwärts, und da entpuppt sich der Komponist ja eher als Meister der Bruchs, des Risses, der sich durch die Conditio humana zieht. Und dann in der Dritten so ein süßlich-seliges, ja «affirmatives» Ende, so ein verklärend-hymnischer Ausblick? Vielen Hörern erscheint dies als peinliches Scheitern auf hohem Niveau. Man möchte am liebsten wegobjektivieren, was durchaus subjektiv gemeint ist, und zwar so, wie es Hans Heinrich Eggebrecht in seinem Mahler-Buch so trefflich formuliert: Laut Eggebrecht ist das Wort «mir» innerhalb der Satzbezeichnungen das für das Verständnis des Werkes entscheidende, denn durch dieses wird deutlich, dass «das Ich des Komponisten, sein subjektives Empfindungsleben, zum Medium der Erzählung objektiviert ist: Was die Musik mitteilt, ist das durch ein Ich hindurchgegangene Sich-Erzählen der Welt – […].»
Doch heute begegnet der Hörer der Dritten nicht mehr über die Titel; Wir wissen zwar, dass es sie gab, müssen aber eigenständig zu einem Verständnis finden. Tatsächlich darf vermutet werden, dass Mahler auch während der Komposition seiner späteren Werke Titel im Kopf herumspukten, die er uns aber vorenthält, wie er abermals Natalie Bauer-Lechner während der Arbeit an der Vierten verrät: «Von einer Benennung des Werkes in den einzelnen Sätzen, wie in früheren Zeiten, will Mahler nichts mehr wissen. ‚Ich wüßte mir wohl die schönsten Namen dafür, doch werde ich sie den Trotteln von Richtenden und Hörenden nicht verraten, daß sie sie mir wieder aufs albernste verstehen und verdrehen.»
Nun hat sich einer der gegenwärtig interessantesten Mahler-Dirigenten daran gemacht, seine Deutung dieses in vieler Hinsicht problematischen Kolosses vozulegen. Jonathan Notts Einspielungen der zweiten und besonders der neunten Sinfonie Mahlers mit den Bamberger Symphonikern haben in letzter Zeit Furore gemacht, und so ist die Erwartungshaltung hoch. Konnte er sich mit diesen Einspielungen durchaus mit den in Legion vorliegenden Mahler-Deutungen messen, so haben doch auch bei der Dritten viele namhaften Kollegen Exzeptionelles vorgelegt, denen gegenüber es sich zu positionieren galt. Von Adrian Boult, über Horenstein, Bernstein, Kegel, Abbado bis hin zu Michael Tilson Thomas und Semyon Bychkov: Mahlers Dritte ist einer der Messlatten in jeder Diskographie, auch in jener Jonathan Notts – eine Messlatte, die in diesem Fall zu hoch lag. Jonathan Notts Einspielung mit den Bamberger Symphonikern, die hier von der Bayerischen Staatsphilharmonie unterstützt werden, ist keine Offenbarung. Tatsächlich ist sie über weite Strecken solide, aber eben auch durchnittlich, bisweilen sogar uninteressant, ja langweilig.

Jonathan Notts Deutung der dritten Sinfonie Mahlers ist solide, aber nicht exzeptionell. An die Einspielungen der Zweiten und der Neunten reicht sie mit Abstand nicht heran. Die Stärken der Aufnahme liegen in den Vokalsätzen und im melodiösen Adagio. Insgesamt eine leider eher blasse Interpretation.
Das Hauptproblem der Aufnahme ist die «Erste Abteilung», also der mit 872 Takten gigantische Kopfsatz des Werkes, denn Nott und dem Orchester gelingt es im Ganzen nicht, die Innenspannung des Satzes herzustellen. Nach der forschen Hornfanfare des Anfangs beginnt Nott bereits zu bremsen, sodass die Musik nicht in ihren Fluss findet. Die ganze Exposition wirkt so, als würde das Werk stillstehen. Pausen – und derer gibt es reichlich – werden nicht spannungsvoll überbrückt bzw. mitmusiziert, wodurch immer wieder eigentümliche Leerräume entstehen, die so wirken, als hätte das Orchester komplett aufgehört zu musizieren und wäre in die Kantine gegangen. Abschiedssinfonie bei Mahler also?
Nun, später, wenn Mahler einen Marsch gegen den nächsten setzt, wenn das Organisch-Mäandernde des Satzes einsetzt, dann gewinnt die Darstellung an Esprit. Letzterer fehlt aber auch oft in der Datailarbeit. Phrasen werden nicht auf einen Punkt hin musiziert, vieles klingt erstaunlich fade. Auch die Binnensätze zeichnen sich durch eine gewisse Einfallslosigkeit in der Gestaltung des Details aus. Da kann man das hervortretende Trompetenmotiv am Ende des zweiten Satzes kaum hören, und die Flügelhorn-Episoden des dritten Satzes dürften einiges mehr an süßem Sentiment haben.
Das ist alles nicht wirklich mangelhaft musiziert, aber eben nur lauwarm und nicht mit der für eine amibitionerte Mahler-Aufnahme notwendigen Leidenschaft. Recht schön gelingen die beiden Vokalsätze, wobei besonders Mihoko Fujimuras heller und leicht geführter Alt gefällt. Auch den besten Altistinnen macht «Zarathustras Nachtwandlerlied» bisweilen Schwierigkeiten: oft wird gedrückt und mit zu großem Ton oder zu viel Vibrato Audruck geheischt: Fujimura hingegen schwebt förmlich durch den Satz, was dessen Mystizismus hervorragend bekommt. Leider neigt sie dazu, zischende Schlusslaute wegzulassen, sodass der Text bisweilen sinnentleert klingt (immer wieder: «Oh Men….» statt «Oh Mensch»).
Gut gelingt auch das «Bimmbammbaumeln» des Chorsatzes, der gestalterisch bei den Knaben des Bamberger Domchors und den Damen der Bamberger Symphoniker in guten Händen ist. Das (oft kritisierte) große Schluss-Adagio dann ist wohl der am überzeugendesten gestaltete der reinen Orchestersätze. ▀
Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 3, Bamberger Symphoniker, Bayerische Staatsphilharmonie, Mihoko Fujimura, Jonathan Nott, Tudor 7170
.
.
.
.
Richard Strauss: «Arabella» (George Solti)
.
Klassische Aufnahme eines missverstandenen Werkes
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 Richard Strauss’ Oper «Arabella» hatte es nie so richtig leicht. Man sah das Werk, das die letzte Zusammenarbeit des Komponisten mit Hugo von Hofmannsthal sein sollte, als lauen Aufguss des «Rosenkavaliers» und müden Versuch, an den Erfolg desselben anzuschließen. Schließlich fühlte sich Strauss 1927 nach der Komposition der ästhetizistischen und antikisierenden «Ägyptischen Helena» vollkommen «abgebrannt» und forderte seinen kongenialen Librettisten dazu auf, die Vorlage für eine heitere Spieloper zu liefern – und legte ihm nahe: «Es darf sogar ein zweiter Rosenkavalier sein…», schließlich habe er «in diesem Stimmungsgebiet noch nicht [sein] Letztes gesagt.» Hofmannsthal beginnt mit der Arbeit. Er verschmelzt den Stoff seiner bereits 1910 entstandenen Novelle «Lucidor – Figuren zu einer ungeschriebenen Komödie» mit dem 1924 wieder ins Schubfach gelegten Komödienentwurf «Der Fiaker als Marquis» zum Libretto der «Arabella», wobei er Strauss, der sich ganz auf einen zweiten «Rosenkavalier» einschießt, erläutert, dass er diesen nicht bekommen wird, denn «der Ton der ‚Arabella’ wieder unterscheidet sich sehr von dem des ‚Rosenkavalier’. Es ist beidemal Wien – aber welch ein Unterschied liegt dazwischen – ein volles Jahrhundert! Das Wien unter Maria Theresia – und das Wien von 1866. […] Die Atmosphäre der ‚Arabella’ […] ist gewöhnlicher. Dem ganzen zweifelhaften Milieu dieses kassierten Rittmeisters Waldner haftet etwas Ordinäres an, ein ganz ordinäres und gefährliches Wien umgibt diese Figuren […].»
Richard Strauss’ Oper «Arabella» hatte es nie so richtig leicht. Man sah das Werk, das die letzte Zusammenarbeit des Komponisten mit Hugo von Hofmannsthal sein sollte, als lauen Aufguss des «Rosenkavaliers» und müden Versuch, an den Erfolg desselben anzuschließen. Schließlich fühlte sich Strauss 1927 nach der Komposition der ästhetizistischen und antikisierenden «Ägyptischen Helena» vollkommen «abgebrannt» und forderte seinen kongenialen Librettisten dazu auf, die Vorlage für eine heitere Spieloper zu liefern – und legte ihm nahe: «Es darf sogar ein zweiter Rosenkavalier sein…», schließlich habe er «in diesem Stimmungsgebiet noch nicht [sein] Letztes gesagt.» Hofmannsthal beginnt mit der Arbeit. Er verschmelzt den Stoff seiner bereits 1910 entstandenen Novelle «Lucidor – Figuren zu einer ungeschriebenen Komödie» mit dem 1924 wieder ins Schubfach gelegten Komödienentwurf «Der Fiaker als Marquis» zum Libretto der «Arabella», wobei er Strauss, der sich ganz auf einen zweiten «Rosenkavalier» einschießt, erläutert, dass er diesen nicht bekommen wird, denn «der Ton der ‚Arabella’ wieder unterscheidet sich sehr von dem des ‚Rosenkavalier’. Es ist beidemal Wien – aber welch ein Unterschied liegt dazwischen – ein volles Jahrhundert! Das Wien unter Maria Theresia – und das Wien von 1866. […] Die Atmosphäre der ‚Arabella’ […] ist gewöhnlicher. Dem ganzen zweifelhaften Milieu dieses kassierten Rittmeisters Waldner haftet etwas Ordinäres an, ein ganz ordinäres und gefährliches Wien umgibt diese Figuren […].»
Das Werk also, dem man aufgrund der Strauss’schen Initialidee vom zweiten «Rosenkavalier» noch heute vorwirft, es sei ein Abklatsch, überziehe das humorige Metier, neige schon ein wenig zu sehr ins Land der ewig-lächelnden Operette und sei im Grunde zu seicht und substanzlos, dieses Werk war von Seiten Hofmannsthals vollkommen anders intendiert. Tatsächlich ist die Geschichte um die verarmte Grafentochter aus dem Wien der 1860er Jahre keine platte «Boy-meets-girl»-Story à la Courths-Mahler. Sicher, Hofmannsthals Libretto hat Schwächen. Der erste Akt ist zu lang, so dass auch Strauss Mühe hat, ihn durchgehend griffig und einfallreich zu gestalten. Die doppelte Liebesgeschichte überrascht nicht, schließlich hat dergleichen auch schon ein Shakespeare vorgelegt. Der Verlauf der Handlung ist furchtbar absehbar.
Und doch: Hofmannsthal gelingt eine abgründige Wiener Gesellschaftsstudie des ausgehenden 19. Jahrhunderts, auf deren Folie die Liebesgeschichte der Arbella und ihrer Schwester Zdenka nur scheinbar harmlos dahinschwebt. Tatsächlich werden durch die Liebesgeschichte jedoch ganz andere Themen offenbar: Es geht in «Arabella» letztlich um Macht, Geld, Käuflichkeit, Sexualität, Unterdrückung und Unterwerfung. Blickt man aus dieser Persepektive auf die «Arabella», so offenbart sich ein Werk, das nicht einfach auf der durch melodiöse «Walzerseligkeit» ausgelösten Erfolgswoge mitschwimmen, sondern die dunklen Geheimnisse thematisieren will, die nur ein ganz kleines Stück unter der glänzenden Wiener Welt jener Jahre lauerten. Nicht umsonst spielt Hofmannsthals Oper im Fasching – zu jener Zeit also, in der nichts das ist, was es scheint.
Eine der wahrlich großen Aufnahmen jenes oft missverstandenen Werkes entstand im Jahre 1957 unter der Leitung von George Solti, der für dieses Projekt erstmals mit den Wiener Philharmonikern zusammentraf. Groß ist diese Einspielung aufgrund einer ganzen Reihe von Umständen. Zum einen ist sie von historischer Bedeutung, weil sie der Auftakt zu einer Reihe von fulminanten Opern-Aufnahmen darstellt, die Solti und die Wiener in Folge gemeinsam produzierten. Zweitens ist die Besetzung mehr als luxuriös. Lisa Della Casa ist vielleicht die Arabella des 20. Jahrhunderterts; kein Wunder, dass man sie bald die «Arabellissima» nannte, hat man doch selten ein stimmigeres Rollenportrait gehört. Ihre Fähigkeit, dem mädchenhaften «in der Schwebe sein» Arabellas Plastizität zu verleihen, ist ebenso außergewöhnlich wie die Süßigkeit der Überzeugung, mit der sie sich dem «richtigen» Mann (Mandryka) unterwirft, der «auf Zeit und Ewigkeit» ihr «Gebieter» sein wird.
Ebenso schlüssig, wie Della Casa den Entwicklungsprozess der Arabella von der etwas flatterhaften Arabella zur bürgerlichen Ehefrau Schiller’scher Manier darstellt, legt Hilde Güden die Zdenka an. Das Changieren in den ersten beiden Akten zwischen der (aufgezwungenen) Hosenrolle des Zdenko und der sich stark in ihr regenden Weiblichkeit der Zdenka ist für jede Darstellerin ein Drahtseilakt, den die Gueden bestens bewältigt, um die Figur im letzten Akt zu einer Arabella in nichts nachstehenden Schönheit aufblühen zu lassen.

Georg Soltis Einspielung der «Arabella» von Richard Strauß aus dem Jahre 1957 ist ein Meilenstein der Diskographie und mit Lisa Della Casa, Hilde Güden und George London ideal besetzt. Sie zeigt die thematische Vielschichtigkeit des mit Voruteilen belasteten und eher vernachlässigten Werkes bestechend auf.
George London gibt einen virilen Mandryka, jeder Zoll ein «echter Mann», der nicht nur über finanzielle Potenz zu verfügen scheint. London liegt die emotionale Bandbreite dieser Rolle – bei deren Anlage Strauss sich weidlich an dem den Ungarn gern zugesprochene Klischee vom «Himmelhoch-jauchzend-zum-Tode-betrübt» bedient hat – ganz ausgesprochen, und es zeigt sich seine Meisterschaft in der Gestaltung komplexer Figuren. Anton Dermota (Matteo) ist der ideale verzweifele junge Held. Gekrönt wird das Ganze von Otto Edelmanns Grafen Waldner, dessen zweifelhafte Integrität als Familienoberhaupt und Hallodritum der Edelmannschen komödiantischen Ader bestens liegt.
Schießlich zeigt die Einspielung, dass es Solti eben nicht nur um den oberflächlichen Gehalt des Werkes geht, sondern auch um dessen psychologische und musikalische Tiefenstruktur. Solti und die ganz exquisit spielenden Wiener Philharmoniker genießen nicht nur die Süffigkeit der Partitur, sondern durchleuchten das enge Geflecht aus Leitmotiven und Selbstzitaten, machen Bezüge deutlich, leisten beste Charakterisierungsarbeit und sind bei aller Üppigkeit stets auf Transpanzenz bedacht. ▀
Richard Strauss, Arabella, Doppel-CD, Wiener Philharmoniker – George Solti, Documents (Music Alliance Membran) / ADD
.
.
.
.
Franz Liszt: «Dante Sinfonie» (Martin Haselböck)
.
Spannender interpretatorischer Zugriff
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
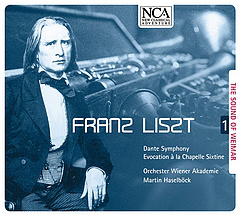 «Unmusik» sei das, meinte Johannes Brahms zu Franz Liszts «Symphonie nach Dantes Divina Commedia», meist kurz «Dante-Sinfonie» genannt. Gerecht war dieses Urteil sicher nicht, da es wahrscheinlich seiner Abneigung gegenüber des Protagonisten der «Neudeutschen» ebenso entsprang wie seiner grundsätzlichen Einschätzung der kompositorischen Fähigkeiten seines Kollegen: «Das Wunderkind, der reisende Virtuose und der Salonmensch haben den Komponisten ruiniert, ehe er recht begonnen hatte.» Es ist indes eine Tatsache, dass die «Dante Symphonie» bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad erreicht hat wie ihre kurz zuvor entstandene Schwester die «Faust-Symphonie», wobei die Gründe hierfür dem Verfasser nicht wirklich klar sind, zeigt das Werk doch mindestens so tiefe Inspiration, brillante Orchestrierungskunst und dramaturgisches Geschick wie das Werk über den «Faust».
«Unmusik» sei das, meinte Johannes Brahms zu Franz Liszts «Symphonie nach Dantes Divina Commedia», meist kurz «Dante-Sinfonie» genannt. Gerecht war dieses Urteil sicher nicht, da es wahrscheinlich seiner Abneigung gegenüber des Protagonisten der «Neudeutschen» ebenso entsprang wie seiner grundsätzlichen Einschätzung der kompositorischen Fähigkeiten seines Kollegen: «Das Wunderkind, der reisende Virtuose und der Salonmensch haben den Komponisten ruiniert, ehe er recht begonnen hatte.» Es ist indes eine Tatsache, dass die «Dante Symphonie» bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad erreicht hat wie ihre kurz zuvor entstandene Schwester die «Faust-Symphonie», wobei die Gründe hierfür dem Verfasser nicht wirklich klar sind, zeigt das Werk doch mindestens so tiefe Inspiration, brillante Orchestrierungskunst und dramaturgisches Geschick wie das Werk über den «Faust».
Liszt hatte sich bereits in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts intensiv mit Dantes «Göttlicher Komödie» beschäftigt. Kurz bevor er 1848 endgültig nach Weimar ging, hatte er bereits erste Ideen zu einer Sinfonie nach Dante notiert. 1849 liegt dann die «Dante-Sonate» vor, die allerdings erst 1861 publiziert wird. 1855 geht Liszt direkt nach Abschluss der «Faust-Symphonie» an die Komposition der «Dante-Symphonie» und schließt diese wohl ein Jahr später ab. Die Uraufführung findet am 7. Oktober 1857 unter Leitung des Komponisten in Dresden statt und fällt durch. Liszt ist sich bewusst, dass er das Werk nicht intensiv genug geprobt hatte und sieht das Positive im Negativen: «Die Dresdner Aufführung war mir notwendig, um darüber zur Objektivität zu gelangen. Solange man nur mit dem toten Papier zu tun hat, verschreibt man sich leicht. Musik verlangt nach Klang und Wiederklang!»
Der ursprüngliche Gedanke Liszts war es, eine dreiteilige Symphonie zu schreiben, wobei jeder Teil einen Abschnitt der «Göttlichen Komödie» Dantes reflektieren sollte. Im Juni 1855 schrieb er an Anton Rubinstein, dass die beiden ersten Sätze «L’Enfer» und «La Purgatoire» rein instrumental gestaltet werden würden, dass im Schlussteil «Le Paradis» dann allerdings noch ein Chor hinzutritt. Ebenso würde eine Windmaschine zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sollten unter Zuhilfenahme der gerade von Daguerre entwickelten Diorama-Technik während der Aufführung Dante-Illustrationen von Bonaventura Genelli in den Aufführungsraum projiziert werden. Doch weder die Windmaschine noch die Projektionen waren in Dresden zu hören bzw. zu sehen. Aber auch die Struktur des Werkes änderte Liszt vor der Uraufführung. Er korrespondiert zur Enstehungszeit auch mit Richard Wagner, dem späteren Widmungsträger des Werkes, über dessen Aufbau. Doch während Wagner keinen Zweifel daran hat, dass Liszt die ersten beiden Teile trefflich gelingen würden, so wies er ihn darauf hin, dass in seinen Augen eine musikalische Schilderung des Paradieses nicht möglich wäre, ja dass schon Dantes Dichtung eben im «Paradies» am schwächsten sei. Als Konsequenz dieser Kritik ließ Liszt die Dreiteiligkeit des Werkes zwar fallen, fügte allerdings in diesem Zuge an das «Purgatorio» noch ein von einem Frauenchor gesungenes «Magnificat» an, dessen ätherischer Gestus zwar auf das Paradies verweist, dieses aber nicht en détail schildert.
Rechtzeitig zum Lisztjahr erscheint nun mit Martin Haselböcks Einspielung der «Dante-Symphonie» eine neue Darstellung dieses Werkes, ein Umstand, der schon einmal zu begrüßen ist, weil überhaupt nur sehr wenige gut Einspielungen vorliegen, wobei hier Giuseppe Sinopolis ausgesprochen individuelle und kompromisslose Interpretation herausragt. Daneben ist hervorzuheben, dass Martin Haselböck und das Orchester Wiener Akademie nicht nur eine weitere Aufnahme zur schmalen Diskographie beisteuern, sondern dass diese Aufnahme auch noch etwas besonderes ist, spielt das Orchester doch ausschließlich auf Originalinstrumenten des 19. Jahrhunderts. Bereits im vergangenen Jahr hat diese Vorgehensweise bei der Neueinspielung der Berlioz’schen «Symphonie fantastique» durch Jos van Immerseel und die Anima Eterna für einiges an Aufsehen gesorgt, weil hier besonders die beiden letzten Sätze durch in bisher nie so gehörte Klänge beeindruckten (wobei der Rest eher ein flaues Gefühl hinterließ). Haselböck und seinem Orchester indes wäre zu wünschen, dass die Aufnahme einen ähnlich Ruck durch die Musikwelt senden könnte, denn von dem insgesamt ganz außergewöhnlich hohen interpretatorischen Niveau der Aufnahme abgesehen, so ist allein der hier dargebotene Liszt-Klang ein wahrlich epiphanisches Erlebnis. Tendiert das moderne Orchester durch die Dominanz der hohen Streicher zu einem geschmeidig-hellen Klang, zu schon fast unumgänglicher Brillanz, so treten diese hier deutlich in den Hintergrund. Es offenbart sich ein eher herb-dunkler Ton und eine – bei Liszts Orchesterwerken nicht immer leicht herzustellende – Durchsichtigkeit der Faktur, die auch den kritischen Liszt-Hörer zu begeistern vermag.
Schon die mottohaften ersten Posaunenrufe des «Inferno», die nach den Worten skandiert werden, die auf Dantes Höllentor eingegraben und entsprechend in der Partitur notiert sind («Per me si va nella ciattà dolente…. – Durch mich hindurch gelangt man zu der Stadt der Schmerzen…»), lassen aufhorchen. Das klingt hart, rauh, düster und ohne jeden Glanz. Ebenso unerbittlich antworten die Hörner mit dem Leitmotiv, dem Liszt den Vers «Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate! – Lasst alle Hoffnungen fahren, ihr, die ihr eintretet!») zuordnet. Dazwischen die trockenen Schläge der Pauken, das Grummeln der Grancassa und des Tamtams, das kratzend von den tiefen Streichern vorgestellte Tritonus-Thema des Satzes – all das macht in dieser Aufnahme schon gruseln und zeigt auf, wie viel Liszt der Instrumentierungskunst eines Berlioz verdankt. Haselböck und seine Mannen stürzen sich mit hörbarer Begeisterung in die dankbare Aufgabe, die Höllenqualen plastisch erfahrbar zu machen, wobei der Liszt-Spezialist Haselböck bei seinem Dirigat stets darauf achtet, dem Lisztschen Diktum zur Kunst des Dirigierens: «Wir sind Steuermänner, keine Ruderknechte» gerecht zu werden. Und so ist die Einspielung durch intensive Nutzung des Rubato gekennzeichnet, von einem organischen Atmen mit der Musik und von einem untrüglichen Gespür für die Umsetzung der dramatisch-bildhaften Dimension des Werkes. Haselböck und sein Orchester Wiener Akademie sind allerdings keine einfallslosen Haudraufs. Auch der lamentohafte Mittelteil des ersten Satzes, der musikalisch von sanften Klängen der Violinen, der Flöten und der Harfen gekennzeichnet ist – er schildert die Begegnung mit den berühmten und zu Höllenqualen verdammten Liebenden Paolo Malatesta und Francesca da Rimini -, gelingt ganz vorzüglich.

Martin Haselböck und das Orchester Wiener Akademie präsentieren einen klanglich und interpretatorisch spannenden Zugriff auf die zu unrecht selten gespielte «Dante-Symphonie», die sich hier als eine der bedeutendsten und interessantesten Orchester-Kompositionen Liszts offenbart.
Im «Purgatorio» dann das Kontrastprogramm zum infernalischen Eingangssatz. Es ist kein Fegefeuer, das uns Liszt hier präsentiert, sondern eher ein kühler, aber hoffnungsvoller Zustand, in dem sich die Seele befindet. Sanft blasende Hörner, Flöten, das Englischhorn und die Harfe geleiten den Hörer über im Piano wogenden Violinen in einen eigentümlich zeitlosen Klangraum, der erst in der Lamento-Fuge des Mittelteils Fahrt aufnimmt und Struktur gewinnt. Das Orchester Wiener Akademie zeigt auch hier, was für ein versiert gestaltender Klangkörper es ist. Von der Brutalität des Vorangegangenen ist nichts mehr spürbar, stattdessen warmer Ton, delikate Gestaltung und eine in jedem Moment luzide Darstellung der Fuge, wobei Haselböck deutlich aufzeigt, wo sich beispielsweise ein Bruckner kompositorisch an Liszt anlehnt (z.B. Ziffer K ff).
Das dem Purgatorium folgende «Magnificat» weist ebenso in die Zukunft. Sicher, wenn die herrlich intonierenden Frauenstimmen des «Chorus Sine Nomine» einsetzen, dann meint man sich zunächst in die Gralswelt eines Richard Wagner versetzt. Beim zweiten Hören indes zeigen sich auch Bezüge zur späteren Sakralmusik Frankreichs. Viel sphärischer kann man das – ohne die Schwelle zum Kitsch zu überschreiten – nicht machen. Haselböcks Entscheidung für den ersten der zwei komponierten Schlüsse ist mehr nachvollziehbar, ist dies sanft entschwebende Ende dramaturgisch doch um ein Vielfaches schlüssiger als der plötzliche Jubelton des zweiten Finales.
Als Dreingabe gibt es noch die «Evocation á la Chapelle Sixtine» aus den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Liszt war mittlerweile nach Rom übergesiedelt und hörte dort in der Sixtinischen Kapelle regelmäßig die Werke Palestrinas. Aus dieser Beschäftigung mit den Alten erwuchs zunächst ein Klavierwerk mit dem Titel «À la Chapelle Sixtine Miserere de Allegri et Ave verum corpus de Mozart», das eine Kombination der beiden genannten Werke darstellt, und das er später für Orchester bearbeitete. Die Koppelung der beiden Werke wirkt einigermaßen überflüssig, doch auch dieses eine Viertelstunde währende Werk präsentieren Haselböck und das Orchester Wiener Akademie ebenso stilsicher wie die «Dante-Symphonie». ▀
Franz Liszt: Dante Sinfonie & Evocation á la Chapelle Sixtine / Martin Haselböck – Orchester Wiener Akademie / New Classical Adventure NCA 2011
.
.
.
.
Die historische Aufnahme: Rostropowitsch – Cello-Suiten von J.S. Bach
.
Verliebt in Musik
Michael Magercord
.
 «Prager Frühling» ist alle Jahre, und verliebt sind im Mai an der Moldau so manche, aber nicht in jedem Jahr hinterlässt das größte mitteleuropäische Festival der klassischen Musik derart schöne musikalische Spuren des Frühlingsgefühls wie diese Einspielung aller sechs Cello-Suiten von Bach durch den damals frisch verliebten Musiker Mstislaw L. Rostropowitsch.
«Prager Frühling» ist alle Jahre, und verliebt sind im Mai an der Moldau so manche, aber nicht in jedem Jahr hinterlässt das größte mitteleuropäische Festival der klassischen Musik derart schöne musikalische Spuren des Frühlingsgefühls wie diese Einspielung aller sechs Cello-Suiten von Bach durch den damals frisch verliebten Musiker Mstislaw L. Rostropowitsch.
Tief ins Archiv des Tschechischen Rundfunks musste gegriffen werden, um die Aufnahmen der beiden Aufführungen vom 26. und 27. Mai des Jahres 1955 herauszufischen, die sich nun auf dieser Doppel-CD befinden. Der damals 24-jährige russische Cellist hatte sich zuvor bereits auf dem Konservatorium in Moskau nicht zuletzt durch seine Interpretation dieser Cello-Suiten einen Namen gemacht. Viele Cellisten trauen sich eigentlich erst auf der Höhe ihrer Spielkunst an Bachs Meisterwerke. Lange Zeit galten sie gar als unspielbar, erst als Robert Schumann eine Klavierbegleitung hinzufügte und die Cellosätze dafür etwas vereinfachte, wurden sie wieder öfter gespielt. Der Cellist Pablo Casal war es, der sie schließlich Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts als erster komplett und solo aufführte.

Einst als unspielbar eingestuft: Bach-Autograph der 6. Cello-Suite
Heute wiederum hat eigentlich jeder Cellist von Rang die Suiten aufgeführt oder gar eingespielt, Mstislaw Rostropowitsch sogar mehrfach. Legendär ist sein spontanes Konzert im November 1989 vor der politisch zwar schon gefallenen, aber noch bestehenden Berliner Mauer nahe des Checkpoint Charlie, und ebenso jene als DVD erhältliche Einspielung in der Basilika Sankt Madeleine der burgundischen Abtei Vézelay 1991. Und immer wieder hat der 2007 verstorbene Musiker dabei seine zuvor gemachte Einspielung als fehlerhaft kritisiert.
Davon wird auch diese nun vorliegende Aufnahme aus den jungen Jahren wohl nicht ausgespart geblieben sein, wenngleich nicht überliefert ist, was genau ihm daran nicht gefallen hat. Da lässt sich also wunderbar spekulieren, denn vielleicht könnte es die jugendliche Art des Herangehens an die Stücke gewesen sein, die sein Missfallen in den reifen Jahren gefunden haben mag. Und vielleicht war ja die etwas ungestüme Ausführung eben seiner Verliebtheit geschuldet, die ihn in den Tagen in Prag überkam. Dort hatte er nämlich die russische Sängerin Galina Wischnewskaja, die ebenfalls auf dem «Prager Frühling» konzertierte, kennengelernt. Es muss heftig gefunkt haben, denn nur vier Tage nach der Rückkehr nach Moskau verehelichten sich beide miteinander. Es heißt, Rostropowitsch hätte nicht einmal die Gelegenheit gehabt, seine zukünftige Frau vor der Ehe singen gehört zu haben.

Diese bereits über 55 Jahre zurückliegende Aufführung der Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach durch Mstislaw Rostropowitsch taugen ihrer ungewöhnlich gestümen, aber nie ungestümen Ausführung wegen sowohl als Referenzaufnahme als auch zum Hörgenuss für den Liebhaber einzigartiger Musik.
Soll man also sagen, in dieser Ausführung der Bachschen Meisterwerke steckt noch nicht die tiefe reife Liebe, dafür aber eine umso stürmische Verliebtheit? Es handelt sich jedenfalls um eine der kürzesten also auch schnellsten Einspielungen der Cello-Suiten, die dabei trotzdem nichts an Präzision zu wünschen übrig lassen. Einzig der schwersten, nämlich der fünften Suite meint man anzumerken, dass der später so souveräne Cellist noch nicht ganz auf der Höhe seines Könnens angelangt war. Diese Suite erfordert eine besondere Spieltechnik auf den heutigen 4-saitigen Instrumenten, waren doch zu Bachs Zeiten Cellos noch meist 5-saitig. Es mag die Hemmnis vor den technischen Schwierigkeiten sein, die dazu führt, dass diese Suite in dieser Aufnahme um etliches länger dauert, als in den Aufnahmen des reiferen Instrumentalisten oder auch jenen anderer Cellisten. Doch schon in der anschließenden, lange Zeit als völlig unspielbar geltenden sechsten Suite kann man wieder dieselbe Spielfreude der vier vorherigen vernehmen.
Diese Aufnahmen können wohl getrost in die Reihe der Referenzaufnahmen der Cello-Suiten von Bach aufgenommen werden, und zugleich sind sie ein Hörgenuss für Liebhaber großartiger Musik. Und dass hier alles noch Mono abgespielt wird, dürfte bei einem Einzelinstrument wahrlich kein sonderlichen Nachteil darstellen. Nicht einmal der miteingespielte Applaus am Ende der jeweiligen Suiten stört das Hören, denn er zeigt noch eine weitere angenehme Seite jener Zeit: Damals schien das Publikum erwachsen und von reifer Liebe zur Musik beseelt, jedenfalls applaudiert es reichlich, aber nicht mit dem unreifen Überschwang, wie man ihn in den Konzertsälen heutzutage allzu oft ertragen muss, und der am Schluss eines Werkes kaum mehr Raum lässt für eine kurze nachdrückliche innere Rückschau auf das zuvor Gehörte und die würde vielleicht eine wirklich gereifte Liebe zur Musik erst ermöglichen… ▀
Johann Sebastian Bach: Cello Suites BWV 1007-1012, Mstislaw Rostropowitsch (Live-Aufnahme 1955, Rudolfinum Prag), Doppel-CD, Supraphon 2011
.
.
Sergei Rachmaninow: Zweite Sinfonie (Antonio Pappano)
.
Solides Plädoyer für genaue Arbeit an der Partitur
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 «Es war die qualvollste Stunde meines Lebens», schrieb Sergei Rachmaninow über die Uraufführung seiner ersten Symphonie im Jahre 1897. Eigentlich hatte für den jungen, ehrgeizigen Komponisten alles recht gut ausgesehen. 1892 hatte er mit einer Gold-Medaille im Fach Komposition in der Tasche das Moskauer Konservatorium verlassen und war seitdem recht erfolgreich damit beschäftigt, sich in der russischen Musikszene einen Namen zu machen. 1895 hatte er die erste Symphonie fertiggestellt, und am 27. März 1897 war der große Tag der Uraufführung gekommen. Alexander Glasunow würde dirigieren. Doch dies entpuppte sich eher als nachteilig, konnte Glasunow doch offensichltich nichts mit dem Werk anfangen und dirigierte es mehr schlecht als recht herunter – böse Zungen behaupteten sogar, Glasunow sei – man kannte ihn kaum anders – betrunken gewesen. Doch dem nicht genug. César Cui, ein Mitglied des einflussreichen «Mächtigen Häufleins», sah sich genötig, in seiner Besprechung dem Erstlingswerk und seinem Komponisten den Todesstoß zu versetzen: «Wenn es in der Hölle ein Konservatorium gäbe, in dem einem der Studenten die Aufgabe gestellt werden würde, eine programatische Symphonie zum Thema ‚Die sieben Plagen Ägyptens’ zu komponieren, und wenn jener dann eine solche Symphonie produzierte, wie es Rachmaninow getan hat, so hätte er sich seiner Aufgabe brillant entledigt und die Bewohner der Hölle wären wahrhaftig begeistert.»
«Es war die qualvollste Stunde meines Lebens», schrieb Sergei Rachmaninow über die Uraufführung seiner ersten Symphonie im Jahre 1897. Eigentlich hatte für den jungen, ehrgeizigen Komponisten alles recht gut ausgesehen. 1892 hatte er mit einer Gold-Medaille im Fach Komposition in der Tasche das Moskauer Konservatorium verlassen und war seitdem recht erfolgreich damit beschäftigt, sich in der russischen Musikszene einen Namen zu machen. 1895 hatte er die erste Symphonie fertiggestellt, und am 27. März 1897 war der große Tag der Uraufführung gekommen. Alexander Glasunow würde dirigieren. Doch dies entpuppte sich eher als nachteilig, konnte Glasunow doch offensichltich nichts mit dem Werk anfangen und dirigierte es mehr schlecht als recht herunter – böse Zungen behaupteten sogar, Glasunow sei – man kannte ihn kaum anders – betrunken gewesen. Doch dem nicht genug. César Cui, ein Mitglied des einflussreichen «Mächtigen Häufleins», sah sich genötig, in seiner Besprechung dem Erstlingswerk und seinem Komponisten den Todesstoß zu versetzen: «Wenn es in der Hölle ein Konservatorium gäbe, in dem einem der Studenten die Aufgabe gestellt werden würde, eine programatische Symphonie zum Thema ‚Die sieben Plagen Ägyptens’ zu komponieren, und wenn jener dann eine solche Symphonie produzierte, wie es Rachmaninow getan hat, so hätte er sich seiner Aufgabe brillant entledigt und die Bewohner der Hölle wären wahrhaftig begeistert.»
Rachmaninow bricht zusammen. Es folgt eine Phase von drei Jahren, in denen sein Leben von einer anhaltenden Kompositionsblockade und Depressionen geprägt ist. Im Jahr 1900 sucht der Komponist den Arzt und Hypnotiseur Nikolai Dahl auf, der ihm dabei hilft, seine Krise zu überwinden. Schon im Folgejahr entsteht mit dem zweiten Klavierkonzert sein wohl populärstes Werk überhaupt, für das er 1904 den begehrten Glinka-Preis erhält.
Dass er sich überhaupt noch einmal daran macht eine Symphonie zu schreiben, ist nach dieser Vorgeschichte schon fast verwunderlich. Doch in den 1906 und 1907 greift Rachmaninow, der die Winter jener Jahre in Dresden verbringt, genau eben jenes Projekt an, vielleicht um es sich und der Welt zu beweisen, dass er auch als Symphoniker taugt. Am 8. Februar 1908 ist es abermals soweit. Die Uraufführung der zweiten Symphonie findet unter der Leitung des Komponisten in St. Petersburg statt. Das neue Werk ist ein Erfolg und wird schnell von vielen Orchestern weltweit aufgegriffen.
Und doch: Während das Publikum das Werk insgesamt eher positiv aufnimmt, so ist die Kritik nicht durch und durch glücklich. tatsächlich bürgert es sich schnell ein, das Werk für Aufführungen massiv zu kürzen, so dass das gut einstündige Werk oft nur noch 35 Minuten dauerte. Der britische Komponist Robert Simpson greift in seinem 1967 publizierten Buch «The Symphony» konzentriert eben jene Argumente auf, die ein solches Vorgehen stützten. Die zweite Symphonie sei deutlich schlechter als ihre Vorgängerin, da sie ständig versuche, «lyrische Themen zu forcierten Höhepunkten aufzublähen», und sie neige dazu, «in oberflächliche Sentimentalität abzurutschen.» Das Werk sei «diffus» und wähle stets den «leichten romantischen Weg aus einem Problem». Darum sei dessen Kürzung notwendig, damit es nicht «unter seinem eigenen Gewicht zusammenbreche.»
Erst seit etwa den siebziger Jahren wird das Werk in der Regel in voller Länge gespielt (wobei sich viele Dirigenten auch heute noch die Wiederholungen sparen). Seit dieser Zeit sind auch eine Reihe von Gesamtaufnahmen der Symphonien entstanden, und die Einzelaufnahmen des Werkes sind geradezu Legion, obwohl Werk und Komponist immer noch so manchem ernstzunehmenden Musikliebhaber ein Dorn im Auge sind. Da hört und liest man allenthalben, seine Musik sei zu melodienselig, seine Themen zu sentimental, seine Instrumentation zu dick, seine Kompositionen zu wenig innovativ, kurz: Rachmaninow sei ein affirmativer Komponist mit einem kläglichen Hang zum lyristischen Kitsch. Besonders verdächtig ist vielen Hörern der populär-romantische Ton – den Rachmaninows kompositorisches Idiom unbestritten hat –, und der dazu führt, dass sich verschiedentlich Popmusiker an seinen Themen bedienten und sie zu Popsongs umgestalteten. Da macht auch die zweite der drei Symphonien Rachmaninows keine Ausnahme. In den späten Siebzigern coverte und schluchzte alles, was Rang und Namen hatte, Eric Carmens «Never fall in love again», eine Schmonzette, die auf dem Adagio der Zweiten basiert.

Antonio Pappanos Einspielung der zweiten Symphonie von Rachmaninow ist solide, aber nicht überdurchschnittlich. Die Stärke der Aufnahme ist das klangschöne Adagio. Doch bleibt die Darstellung des Gesamten im Üblichen stecken und wirkt über weite Strecken austauschbar.
Und so mag der eingefleische Rachmaninow-Kritiker sich fragen: Noch eine Einspielung der zweiten Symphonie? Muss das denn wirklich sein? Was können denn Antonio Pappano und sein Orchestra dell’Accademia Nazionale die Santa Cecilia über das Werk sagen, was Svetlanov, Maazel und besonders André Previn noch nicht gesagt haben? Nun, über das Werk erfährt man beim Hören der aus Konzertmitschnitten aus dem Jahre 2009 zusammengestellten Aufnahme nicht viel Neues. Sie ist keine Offenbarung, sie ist aber auch nicht durch und durch langweilig oder gar schlecht musiziert. Tatsächlich ist sie eher ein Plädoyer für genaue Arbeit an der Partitur. Pappano ist sehr akribisch mit der genauen Umsetzung der Anweisungen des Komponisten beschäftigt, ohne dass er sich darin verliert. Da lassen sich die nuancierten Vorgaben Rachmaninows durch die Bank weg und ohne die Partitur vor Augen hören, ein Umstand, der beispielsweise bei Maazel und auch bei Jansons nicht immer eintritt.
Daneben fällt es dem Opernspezialisten Pappano natürlich nicht schwer, die unterschiedlichen Stimmungen innerhalb der einzelnen Sätze spannungsvoll herauszuarbeiten, wobei er durchaus einen Hang dazu hat, die technicolorfarbenen Lyrismen satt auszukosten. Tatsächlich ist es darum auch die Wiedergabe des langsamen Satzes, die mich am meisten überzeugt. Den Kopfsatz empfinde ich bei Maazel deutlich packender, nervöser, aufreibender, die Wildheit des Scherzos bricht bei Previn noch deutlicher durch, das ad astra-Finale, bei aller Kunstfertigkeit der Zusammenführung aller Themen in meinen Augen der schwächste Satz, kann mich auch hier nicht fesseln: Das ist zwar alles prächtig, virtuos, flott, aber am Ende doch irgendwie leer.
Das Adagio aber, mit dem höchst sensibel und klangschön spielendem Alessandro Carbonare an der Klarinette, ist Rachmaninow in Reinkultur. Da wird nicht nur deutlich, wie sehr der Komponist – bei aller Beherrschung der Form – Melodiker war, sondern auch, wie stark Pappanos Ohr von der Oper und vom Gesang geprägt ist. Tatsächlich erschließt es sich vom ersten Ton an, warum diese Melodie von der Popkultur aufgegriffen wurde. Im positiven Sinne schlichter und kantabler kann man nicht komponieren. Das ist Herz, das ist Schmerz, das ist «der Liebe Lust und der Liebe Leid», das ist unmittelbar verständliche Musik. Ich glaube fast, Verdi – hätte er diesen Satz jemals gehört – hätte (wie schon in Sachen Bellini) bewundernd von «Melodie lunghe, lunghe, lunghe» gesprochen.
Als – im Grunde überflüssiger – Lückenfüller wurde die kleine sinfonische Dichtung «Der Zaubersee» des russischen Komponisten Anatoli Liadow beigefügt, die hier eine so durchschnittliche Wiedergabe erfährt, dass sich mir der «Zauber» nicht so recht erschließen will. ▀
Antonio Pappano / Orchestra dell Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Sergei Rachmaninow, 2. Sinfonie – Anatol Ljadow, Der Verzauberte See – EMI Classic / DDD
.
..
______________________________________
Geb. 1974 in Hildesheim/D, Studium der Germanistik und Anglistik, bis 2007 Lehrauftrag an der TU Braunschweig, langjährige Erfahrung als freier Rezensent verschiedener niedersächsischer Tageszeitungen sowie als Solist und Chorist, derzeit Angestellter in der Erwachsenenbildung und Student der Psychologie.
.
.
.
.
Frank Martin: «Messe für Doppelchor» u.a.
.
Chormusizieren von beeindruckender Gestaltungskraft
Walter Eigenmann
.
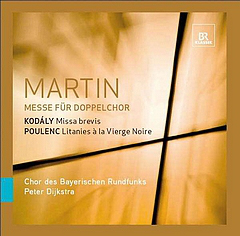 Mit dem Genfer Frank Martin, dem Pariser Francis Poulenc und dem Kecskeméter Zoltán Kodály gruppieren Dirigent Peter Dijkstra und sein Bayerischer Elitechor auf ihrer ersten gemeinsamen Disk sprituell inspirierte Chorwerke dreier sowohl stilistisch und klangästhetisch wie kompositionstechnisch sehr unterschiedlicher Zeitgenossen des frühen 20. Jahrhunderts. Gemeinsam wiederum ist diesem Komponisten-Trio ihre längst «klassische» Modernität – und eben ihre biographisch verbürgte ursprüngliche (wenngleich unterschiedlich ausgeprägte) Religiösität. Diese ist bei Martin gerade durch seine berühmte Doppelchor-A-capella-Messe (innerhalb eines reichen liturgischen bzw. geistlichen Vokal-Oeuvres) referentiell dokumentiert; auch Poulencs Schaffen verzeichnet gewichtige religiös motivierte Chorkompositionen, während Kodálys Gesamtwerk nur wenige, aber interessante (allerdings seltener aufgeführte) liturgisch intendierte Werke aufweist.
Mit dem Genfer Frank Martin, dem Pariser Francis Poulenc und dem Kecskeméter Zoltán Kodály gruppieren Dirigent Peter Dijkstra und sein Bayerischer Elitechor auf ihrer ersten gemeinsamen Disk sprituell inspirierte Chorwerke dreier sowohl stilistisch und klangästhetisch wie kompositionstechnisch sehr unterschiedlicher Zeitgenossen des frühen 20. Jahrhunderts. Gemeinsam wiederum ist diesem Komponisten-Trio ihre längst «klassische» Modernität – und eben ihre biographisch verbürgte ursprüngliche (wenngleich unterschiedlich ausgeprägte) Religiösität. Diese ist bei Martin gerade durch seine berühmte Doppelchor-A-capella-Messe (innerhalb eines reichen liturgischen bzw. geistlichen Vokal-Oeuvres) referentiell dokumentiert; auch Poulencs Schaffen verzeichnet gewichtige religiös motivierte Chorkompositionen, während Kodálys Gesamtwerk nur wenige, aber interessante (allerdings seltener aufgeführte) liturgisch intendierte Werke aufweist.

Gesangsensemble von europäischem Spitzenformat: Der Chor des Bayerischen Rundfunks bei Radioaufnahmen
Poulencs 14 Litaneien «à la Vierge Noire» für dreistimmigen Frauenchor (hier in der Originalfassung mit Orgel eingesungen), mehr noch die achtteilige «Missa brevis» Kodálys garnieren diese Chor-CD mit teils üppiger Klangsinnlichkeit, teils entrückter Sphärik, dann wieder mit jubilierender Hymnik oder (kontrastierend) mit inbrünstig deklamierendem Meditieren. Massgeblich untermalend hier bei beiden Werken das registersichere, differenziert eingehörte Spiel des Organisten Max Hanft (an der «romantisch» disponierten Wöhl-Orgel der Münchner Herz-Jesu-Kirche).

Musikalische Spiritualität von höchster Authentizität: Anfang des Credo aus der Messe für Doppelchor von Frank Martin
Den Schwerpunkt dieser Disk bildet jedoch Frank Martins halbstündige Doppelchor-Messe, vom BR-Chor bereits im Frühling 2007 mit dem erst 29-jährigen Dijkstra im 1’500 Plätze großen Orlando-Saal der Germeringer Stadthalle für das damals extra neu gegründete Label «BR-Klassik» eingesungen. Martins A-capella-Messe, vom Komponisten fast sieben Jahre lang buchstäblich erarbeitet – Martin: «Diese Messe ist eine Sache zwischen Gott und mir» – und erst 40 Jahre nach ihrer Entstehung uraufgeführt – Martin: «Ich kannte damals nicht einen Chorleiter, der sich für dieses Werk hätte interessieren können» -, stellt in ihrer rhythmischen Differenziertheit, ihrer klanglichen Expressivität in allen vier Stimmlagen, ihrer Weite der Phrasierung und Atmung, ihrer satztechnischen Durchhörbarkeit, ihres weiten emotionalen Spektrums vom quasi-gregorianischen Unisono über fugative Strukturen bis hin zu clusterartigen Klangschichtungen höchste sprach- und interpretationstechnische Anforderungen auch an Berufsensembles.

Eine gültige, auch liturgisch «unbefleckte» Zuhörerschaft in ihren Bann ziehende, über weite Strecken gar maßgebliche Produktion.
Der Chor sang eine nicht nur stets lupenrein intonierte und mit enormem dynamischem Spektrum aufwartende, auch Martins eng am Wort orientierte Chormusik expressiv formende, dabei sehr stimmpräzis agierende CD ein, sondern transponierte adäquat den hohen spirituellen, urpersönlich empfundenen Gehalt in Martins Werk. Letzteres natürlich v.a. Verdienst des Dirigenten, dem offenbar gleichsam ein Instinkt für diese gestenreiche, buchstäblich wortreiche liturgische Vokalmusik zur Verfügung zu stehen scheint. Dabei haben sich Dijkstra und sein Chor durchaus gegen hochstehende Interpretationen anderer Formationen durchzusetzen, etwa des «Sixteen»-Ensembles unter Christopher (2005) oder des «Westminster Cathedral Choir» (O’Donnell/1998). – Eine gültige, auch liturgisch «unbefleckte» Zuhörerschaft in ihren Bann ziehende, über weite Strecken gar maßgebliche Produktion. ■
Martin: Messe für Doppelchor / Kodály: Missa brevis / Poulenc: Litanies à la Vierge Noire; Chor des Bayerischen Rundfunks / Peter Dijkstra; Label BR-Klassik
.
.
Martin Grubinger: «Drums `N` Chant»
.
Hohe Affinität zur Spiritualität verlangt
Christian Schütte
.
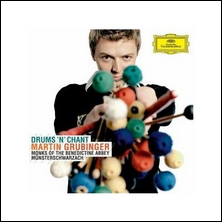 Die gregorianischen Gesänge von Mönchen in vielfältigster Weise auf Tonträgern zu produzieren ist wahrlich keine Novität mehr. Wie im Beiheft zu dieser neuen Aufnahme mit dem Perkussionisten Martin Grubinger sowie Mönchen der Benediktinerabtei Münsterschwarzach und weiteren Musikern zurecht hingewiesen wird, tragen diese Produktionen oftmals allzu sehr die Züge von sphärischer Wohlfühlmusik, was an Sinn und Zweck der gregorianischen Gesänge weit vorbeigeht.
Die gregorianischen Gesänge von Mönchen in vielfältigster Weise auf Tonträgern zu produzieren ist wahrlich keine Novität mehr. Wie im Beiheft zu dieser neuen Aufnahme mit dem Perkussionisten Martin Grubinger sowie Mönchen der Benediktinerabtei Münsterschwarzach und weiteren Musikern zurecht hingewiesen wird, tragen diese Produktionen oftmals allzu sehr die Züge von sphärischer Wohlfühlmusik, was an Sinn und Zweck der gregorianischen Gesänge weit vorbeigeht.
Grubinger wollte diese CD nun trotzdem und ganz anders produzieren, hat es erfolgreich geschafft, den «Hüter der Gregorianik in Münsterschwarzach», Pater Rhabanus, zur Kooperation zu überzeugen. Dabei sind Gregorianik-Aufnahmen benutzt worden, die mit den Mönchen aus Münsterschwarzach schon vor einiger Zeit entstanden und von der Deutschen Grammophon als Archivaufnahmen produziert wurden. Martin Grubinger hat dazu eine Reihe von Musikern gewinnen können, weitere Percussionisten, aber auch zum Beispiel den Oboisten Albrecht Mayer und andere Instrumentalisten. Entstanden ist so eine Kombination der vorhandenen gregorianischen Gesänge mit neu komponierten Instrumental- und Percussionselementen.
Das Beiheft zur CD verrät, Martin Grubinger wolle, dass sich der Hörer mit den Inhalten beschäftige, sich auf die Texte konzentriere. Immerhin sind die lateinischen Texte dazu mit abgedruckt. In einigen Stücken ist das auch unbedingt notwendig, da Percussion und Instrumente so stark im klanglichen Vordergrund stehen, dass ein Verstehen des Textes ohne Mitlesen kaum möglich ist.
Neben klassischem Schlagwerk hat Grubinger sich ganz bewusst dazu entschieden, auch Instrumente aus der afrikanischen und der arabischen Musik zu verwenden – um zu zeigen, dass die katholische Kirche eine in der ganzen Welt verbreitete Gemeinschaft ist, die nicht an einen bestimmten kulturellen Raum gebunden ist. So sind die Gesänge überwiegend von einer sehr prägnanten Instrumentalbegleitung geprägt, immer wieder gibt es ausgedehnte Soli der Percussion oder der Melodie-Instrumente.
Diese stark instrumental bestimmte Seite der Einspielung bringt immer wieder die Gewichtung des Textes, das Verhältnis von Text und Begleitung in Gefahr. Grundlage sind und bleiben die gregorianischen Gesänge, eine musikalische Ausdrucksform, die eben durch die Reinheit des Vokalen besticht und lebt, darum keine Ergänzungen braucht. Auch wenn das klangliche Ergebnis durchaus hörendes Interesse weckt, geraten insgesamt die Texte und damit die unbedingt notwendige Basis dieser Musik zu sehr in den Hintergrund.

Auch wenn das klangliche Ergebnis durchaus Hörinteresse weckt, geraten insgesamt die Texte und damit die unbedingt notwendige Basis dieser Musik manchmal zu sehr in den Hintergrund. «Drums `N` Chant» hat experimentellen Charakter, verknüpft schwierig vermittelbare Klänge&Stilrichtungen - ist aber dadurch gewiss als Stil-Experiment beachtenswert.
Diese Aufnahme ist mehr unter dem Begriff Weltmusik zu fassen, hat vor allem experimentellen Charakter und verknüpft Klänge und Stilrichtungen miteinander, die schwierig miteinander in Beziehung zu setzen sind. Und obwohl im Booklet stets betont bleibt, Pater Rhabanus sei von dem Projekt überzeugt worden, so bleibt doch die Frage zurück, wie in engeren und auch weiteren Kreisen von Menschen mit wie auch immer gearteter hoher Affinität zur Kirche, zur Gläubigkeit und zur Strenge diese CD tatsächlich ankommt. Zweifel und Ablehnung sollten hier vielleicht kalkuliert werden. ■
Martin Grubinger / Benediktinerabtei Münsterschwarzach: Drums `N` Chant, Audio-CD, Deutsche Grammophon / Universal
.
.
.
Isabel Willenberg: «Vertraulich»
.
Ein vertontes Tagebuch
Stephan Urban
.
 Isabel Willenberg wurde 1982 geboren und begann bereits im Alter von 16 Jahren bei verschiedenen Coverbands zu singen. Schon bald (und selbst während ihres Medizinstudiums, das sie 2008 beendete) begann sie zu komponieren und Songtexte zu schreiben. Trotz des erfolgreich abgeschlossenen Studiums wandte sich Isabel Willenberg von der Medizin ab, um sich voll und ganz auf ihre große Leidenschaft, die Musik, zu konzentrieren, was sicherlich keine leichte Entscheidung gewesen ist.
Isabel Willenberg wurde 1982 geboren und begann bereits im Alter von 16 Jahren bei verschiedenen Coverbands zu singen. Schon bald (und selbst während ihres Medizinstudiums, das sie 2008 beendete) begann sie zu komponieren und Songtexte zu schreiben. Trotz des erfolgreich abgeschlossenen Studiums wandte sich Isabel Willenberg von der Medizin ab, um sich voll und ganz auf ihre große Leidenschaft, die Musik, zu konzentrieren, was sicherlich keine leichte Entscheidung gewesen ist.
Aber zweifellos eine gute, wie Ihr Debüt-Album «Vertraulich» beweist. Der Titel wurde wohl gewählt, weil die Songs primär sehr persönliche Texte enthalten, die teilweise einem privaten Tagebuch entnommen sein könnten. Die Tatsache, dass Isabel Willenberg mit ihrer medizinischen Ausbildung über ein zweites Standbein verfügt, trug wohl dazu bei, sich nicht unbedingt auf den Geschmack eines bestimmten Publikums konzentrieren zu müssen und konsequent die eigenen Vorstellungen umsetzen zu können. Es bleibt zu wünschen, dass dieser mutige Zugang mit dem entsprechenden Erfolg belohnt wird.
Die Tracks 1 «A plan of care and kindness» und 3 «Autumn» wurden nur mit einer Martin-Gitarre, Typ DC-1E, die Klaviertracks einerseits mit einem Yamaha C3 Flügel – Track 4 «free», Track 6 «Gedankenvögel» (der einzig deutschsprachige Text), Track 7 «Broken Flower», Track 8 «Your cry» – andererseits mit einem Galaxy II Steinway mit VST-Software – Track 2 «Memories», Track 5 «Standing still», Track 9 «My friend» – in einem professionellen Tonstudio aufgenommen. Das hört man zweifelsfrei: Eine glasklare, intime, sehr unmittelbare Aufnahme mit unkomprimierter Dynamik ist hier entstanden.
Und so kommt nach dem Starten der CD Isabel Willenberg aus Kleve mit ihrem musikalischen Begleiter Christian Spelz auf Besuch und trägt ihre zwischen Pop und Jazz schwebenden Balladen direkt im Hörraum des geneigten Zuhörers vor. Ihre Stimme verfügt über ein angenehmes Timbre und eine seltsame Art von Energie, die einen gewissen Wiedererkennungswert besitzt. Sie trägt ihre Texte sehr selbstbewusst und virtuos vor. Einige Textstellen werden von Christian Spelz mit zweiter Stimme dezent begleitet, wobei – leider, möchte ich fast sagen – die Terzenseligkeit, wie z.B. bei Simon&Garfunkel oder wie in der Volksmusik üblich, vermieden wird. Zumeist singen sie strengere Intervalle oder unisono, das hört sich ziemlich interessant an.
Schade finde ich allerdings, dass sie ihre Lieder mit Ausnahme eines einzigen Songs in englischer Sprache präsentiert – und das, obwohl das Album einen deutschsprachigen Titel trägt. Das ist ein wenig irreführend, und ich bin auch der Meinung, dass Texte in der Muttersprache des Künstlers oft emotionaler und berührender vorgetragen werden können.

«Vertraulich» ist ein überzeugendes Debüt-Album mit sehr persönlichen Texten, die mit sparsamer Begleitung in intimer Atmosphäre und in hervorragender Tonqualität vorgetragen werden
So, wie ihre Musik gemacht ist, läuft Isabel Willenberg sowieso keinesfalls Gefahr, in irgendwelche Schubladen, die nach «deutschem Schlager» riechen, gesteckt zu werden, warum also englische Texte? Sollten hier Gedanken an internationale Vermarktung dahinterstecken? Da ist die Konkurrenz auf diesem Musiksektor wohl übermächtig, im deutschsprachigen Raum hingegen sähe ich bessere Chancen, wenn diese Lyrik emotional und verständlich dargeboten würde. So ist auch nur bei dem Song «Gedankenvögel» leicht herauszuhören, dass es hier wohl nicht zuletzt um ihre Entscheidung bezüglich der Hinwendung zur Musik geht und sie ihren Zuhörern Mut machen möchte, ebenfalls den eigenen Weg zu gehen und etwaige Zweifel zu überwinden.
In «Broken flowers» geht es wohl um die Auseinandersetzung mit dem Tod eines geliebten Menschen, wohingegen der Opener «A plan of care and kindness» von ihren Erlebnissen in Kenia geprägt ist, wo sie viereinhalb Monate in einem Krankenhaus gearbeitet hat.
Das aus meiner Sicht etwas langweilig gestaltete Booklet enthält sämtliche Texte, die üblichen Danksagungen und einen als Einbegleitung gedachten Text von Rainer Maria Rilke. Weitere Werke dieser interessanten Künstlerin dürfen mit Spannung erwartet werden. ■
Isabel Willenberg, Vertraulich, Audio-CD – Hörproben
.
.
.
.
.
Greg Alper Band: «Fat Doggie»
.
Die Fusion-Wundertüte
Stephan Urban
.
 Es war 1978, die große Zeit der Discomusik und des «Studio 54». Wollte man als Jazzmusiker auch einmal gutes Geld verdienen, kam man damals an diesem Stil kaum vorbei, und wollte man dabei auch noch Würde bewahren, dann musste man den Ansatz so wählen, dass der Jazz-Anteil nicht an belanglose Fahrstuhlbeschallungsmusik erinnerte. Aufmüpfiger und progressiver sollte das schon sein.
Es war 1978, die große Zeit der Discomusik und des «Studio 54». Wollte man als Jazzmusiker auch einmal gutes Geld verdienen, kam man damals an diesem Stil kaum vorbei, und wollte man dabei auch noch Würde bewahren, dann musste man den Ansatz so wählen, dass der Jazz-Anteil nicht an belanglose Fahrstuhlbeschallungsmusik erinnerte. Aufmüpfiger und progressiver sollte das schon sein.
So lag es auch nahe, sich bewährter Konzepte zu bedienen, zum Beispiel beim druckvollen Funk eines James Brown oder auch Herbie Hancock, der ja ab den frühen 70ern auf manchen Alben gezeigt hatte, wie man das richtig macht.
Bei der Einstiegsnummer «Hole In Your Pocket» – von Ray Anderson gesungen – orientiert man sich eindeutig am Disco Funk. Manche DJ’s werden sich vermutlich speziell dieses Songs wegen über diese CD-Neuveröffentlichung freuen, war er doch jahrelang eine gesuchte Rarität. Anderson ist zwar alles andere als ein guter Sänger, aber er versucht hier halbwegs erfolgreich, die Shouter-Qualitäten von James Brown nachzuahmen. Da dies ein sehr rhythmusbetonter Song ist, stört dann auch die eine oder andere falsche Intonation nicht sehr.
Auch die Titelnummer schlägt in die gleiche Kerbe, wobei aber die üppigen Bläsersätze hier durchaus angenehm an die frühen «Chicago» erinnern, und auch der Jazz-Anteil hier bereits ungleich größer ist.
«Give It Up» klingt wie eine mit dem «Godfather Of Funk» eingespielte Jamsession, ist hektisch, aber dennoch groovig, und das Blech erinnert an die entsprechende Sektion bei der Formation «Tower Of Power». Somit bleibt an der insgesamt gebotenen Dynamik rein gar nichts auszusetzen.
Der erste bisher unveröffentlichte Track «Three’s A Crowd» bietet eine Jazz-Funk-Mischung erster Güte. Das Trombone-Solo von Ray Anderson klingt, als würde er durch die Posaune schreien, so wie es damals auch Namensvetter Ian Anderson durch seine Querflöte gerne tat, und dürfte eine wohl nicht unerhebliche Inspiration für einen anderen bekannten New Yorker Posaunisten und seinen Stil gewesen sein, nämlich Joseph Bowie von der «Funk-Jazz-Band Defunkt». Überhaupt gibt es hier herrlich schmutzigen Funk zu hören, dargeboten mit übersprudelnder Spielfreude. Verwunderlich, dass es dieser Titel nicht schon auf das seinerzeitige Album geschafft hat.
«Huevos Nuevos» hat nicht nur einen lateinamerikanischen Titel, es kommt auch stilistisch aus der Latin-Fusion-Ecke. Im musikalischen Schmelztiegel des New York der späten 70er Jahre waren ja Latin-Sounds fast eine Pflichtübung, und das Stück weiß sowohl rhythmisch als auch musikalisch zu überzeugen.
«The Cantatta Baratta» und «Suite For Renee» emulieren nahezu perfekt den Fusion Sound von Billy Cobham und der Brecker Brothers, die – auch New Yorker – an diesen Aufnahmen nicht beteiligt waren. «Suite For Renee» endet mit einem wahren Percussion-Feuerwerk, das die perfekte Überleitung auf das moderate, ebenfalls südamerikanisch angehauchte «Many Moods» bietet. Dieser zweite Bonus Track ist von der Harmonik her der vielleicht jazzigste Song dieses Albums. Die lyrischen Solis von Greg Alper und Gitarrist Chuck Loeb betonen hier perfekt die leicht melancholische Stimmung.
Im gleichen musikalischen Farbton geht es mit «Five Verses For» dann weiter, und man stellt fest, dass diese Platte gegen Ende hin immer jazziger wird, hier sind sogar einige kurze Free-Jazz-Elemente zu orten. Auch hört man gegen Ende immer stärker den – von Herb Alper selbst zugegebenen – Einfluss Frank Zappas auf seine Kompositionen heraus. Und ob nun auch noch John Klemmer für die Abschlussnummer «Don’t Ever Let Me Catch You» Pate gestanden haben mag, sei der Beurteilung des geneigten Hörers überlassen.

Ein erstaunlich vielseitiges Remaster-Funk-Album, dessen Jazzorientierung mit jedem Song ständig zunimmt. Die erste Liga der New Yorker Session Musiker der 70er Jahre bemüht sich hier auf Greg Alpers Solodebüt redlich, den von ihm wohl angestrebten Spagat zwischen anspruchsvoll und kommerziell zu vollziehen. Die Stärke dieser Produktion ist aber gleichzeitig ihre Schwäche: Der spürbare Wille, das größtmögliche Spektrum des Fusion-Jazz abzudecken, geht ein wenig zu Lasten der Homogenität. Gregory Alper hat hier aber auf jeden Fall viel Mut bewiesen und eine hochwertige Fusion-Scheibe abgeliefert.
Obwohl sich die Musik eindeutig am Jazz-Funk der späten 70er-Jahre orientiert, ist sie in Würde gealtert und klingt erstaunlich modern und aktuell. So war es sicher eine gute Entscheidung, die seinerzeitige – mittlerweile völlig vergriffene – Vinyl-LP auf CD wieder zu veröffentlichen. Leider wurde das durchaus originelle Originalcover vollkommen verändert, es findet sich aber zumindest als Abbildung im Booklet wieder.
Zum Klang der mehr als dreißig Jahre alten Aufnahme sei gesagt, dass der durchaus voller und körperlicher sein könnte, vor allem der akustische Bass von Ernie Provencher, der manchmal ein wenig hohl klingt. Das Remaster ist aber durchaus geglückt, die Aufnahme ist dynamisch weitgehend unkomprimiert, die einzelnen Instrumente sind präzise zu orten, das Gesamtgefüge wirkt gut balanciert.
Kurzum: Ein erstaunlich vielseitiges Remaster-Funk-Album, dessen Jazzorientierung mit jedem Song ständig zunimmt. Die erste Liga der New Yorker Session Musiker der 70er Jahre bemüht sich hier auf Greg Alpers Solodebüt redlich, den von ihm wohl angestrebten Spagat zwischen anspruchsvoll und kommerziell zu vollziehen.
Die Stärke dieser Produktion ist aber gleichzeitig ihre Schwäche: Der spürbare Wille, das größtmögliche Spektrum des Fusion-Jazz abzudecken, geht ein wenig zu Lasten der Homogenität. Gregory Alper hat hier aber auf jeden Fall viel Mut bewiesen und eine hochwertige Fusion-Scheibe abgeliefert. ■
Greg Alper Band, Fat Doggie, CD-Remaster, Audio-CD, Label First Hand (Harmonia Mundi)
.
Titel
1. Hole in Your Pocket
2. Fat Doggie
3. Give It Up
4. Threes a Crowd
5. Huevos Nuevos
6. Tha Cantatta Baratta
7. Suite for Renee
8. Many Moods
9. Five Verses For
10.Don’t Ever Let Me Catch You
.
.
Gustav Mahler: «Lied von der Erde» (Klavierfassung)
.
Interessante Rarität, doch fragwürdige Vortragsmanieren
Christian Schütte
.
 Zwei Gedenkjahre zu Ehren Gustav Mahlers reichen sich die Hand – 2010 ist sein 150. Geburtsjahr, im 2011 sein 100. Todestag. Da versteht es sich von selbst, dass die Plattenindustrie mit einer Reihe von Neuerscheinungen auf das Werk Mahlers aufmerksam machen und einer möglichst breiten Öffentlichkeit präsentieren will.
Zwei Gedenkjahre zu Ehren Gustav Mahlers reichen sich die Hand – 2010 ist sein 150. Geburtsjahr, im 2011 sein 100. Todestag. Da versteht es sich von selbst, dass die Plattenindustrie mit einer Reihe von Neuerscheinungen auf das Werk Mahlers aufmerksam machen und einer möglichst breiten Öffentlichkeit präsentieren will.
Das «Lied von der Erde» entstand in den Jahren 1908/09, geht auf Texte alter chinesischer Lyrik (in einer neuen deutschen Textfassung von Hans Bethge) zurück und wurde posthum 1911 unter der Leitung von Bruno Walter uraufgeführt. Die sechs Lieder mit den Titeln «Das Trinklied vom Jammer der Erde», «Der Einsame im Herbst», «Der Pavillon aus Porzellan», «Am Ufer», «Der Trunkene im Frühling» und «Der Abschied» werden abwechselnd von einem Tenor und einem Alt (oder Bariton, wobei die Besetzung mit einer Alt- bzw. Mezzosopranstimme die gängigere ist) gesungen, Mahler hat den Zyklus als groß besetzte, sinfonische Musik angelegt. Das «Lied von der Erde» hat sich, trotz der komplizierten Inhalte der Texte, bis heute seinen Platz auf den Spielplänen der Orchester und Konzerthäuser bewahrt.
Bereits im September 1989 haben Brigitte Fassbaender, Thomas Moser und Cyprien Katsaris eine von Mahler autorisierte Fassung für Klavier eingespielt, die jetzt neu auf CD vorliegt. Eine absolute Rarität im Reigen der zahlreiche Einspielungen.
Mahler hat den Orchestersatz sehr farbig und differenziert instrumentiert. Schon mit den ersten Klängen des «Trinklieds» verbreitet sich der Eindruck, dass mit nur Klavier diese Farbigkeit schwierig zu erreichen ist. Wer die Orchesterfassung gut kennt, wird diese Feststellung mit wehmütiger Erinnerung daran einige Male treffen müssen. Cyprien Katsaris ist zweifelsohne ein versierter und kompetenter Mann am Flügel, zieht alle Register seines Könnens – und kann trotzdem die klanglichen Stimmungen der Lieder nur schemenhaft einfangen, weil das Klavier eben doch sehr viel eindimensionaler bleibt, als es einem vollbesetzten Orchester möglich ist.

Es gibt zahllose Einspielungen der Orchesterfassung des «Liedes von der Erde», die Mahlers Größe in diesem Werk ungleich besser zum Ausdruck bringen als diese Klavierfassung. Die zwei verdienten und hochkarätigen Sänger Brigitte Fassbaender und Thomas Moser erweisen sich hier keinen guten Dienst, indem sie sich gerade dieses Liederzyklus’ angenommen haben.
Ein Grund dafür, dass Mahler neben der Orchesterfassung diese reduzierte Klavierfassung herausgegeben hat, könnte sein, dass er auf diesem Wege eine größere Konzentration auf den Text ermöglichen wollte, der in den Klangmassen des Orchesters allzu oft arg in den Hintergrund gerät. Leider lassen Artikulation und Textverständlichkeit sowohl bei Brigitte Fassbaender, mehr noch bei Thomas Moser einige Wünsche offen, so dass auch in dieser Hinsicht die Klavierfassung keinen deutlichen Vorteil bringt. Thomas Moser zeigt zudem hörbare und massive Schwierigkeiten mit der Höhe seiner Stimme, neigt zum Stemmen und Schleifen der Töne, verengt dadurch den Klang und trübt insbesondere in den absoluten Spitzentönen die Intonation gefährlich ein.
Brigitte Fassbaender neigt schon in «Der Einsame im Herbst» zum Ansingen der Töne von unten, was ihrem Vortrag insgesamt große Unklarheit verleiht. Sie tut sich schwer damit, große Linien zu formen, kommt so nie dahin, mit der Stimme einfach nur über der Begleitung zu schweben – gerade diese Fähigkeit ermöglicht es aber, in dieser Komposition zu einer besonderen Tiefe des Ausdrucks zu kommen. Mehr noch leidet dann der großartige «Abschied» unter diesen stilistisch fragwürdigen Vortragsmanieren.
Am Ende bleibt also der Eindruck zurück, dass diese Neuveröffentlichung vielleicht nicht zu den notwendigsten in den beiden Mahler-Jahren gehören mag. Es gibt zahllose Einspielungen der Orchesterfassung des «Liedes von der Erde», die Mahlers Größe in diesem Werk ungleich besser zum Ausdruck bringen als diese Klavierfassung. Die zwei verdienten und hochkarätigen Sänger erweisen sich hier keinen guten Dienst, indem sie sich gerade dieses Liederzyklus angenommen haben. Akribische Sammler von Raritäten werden indes sicher ihr Interesse an der Einspielung finden – wer sich allerdings zum ersten Mal diesem Werk nähern möchte, dem sei der Griff zu dieser CD nicht nahegelegt. ■
Gustav Mahler: Lied von der Erde, Klavier-Fassung, Brigitte Fassbaender / Thomas Moser / Cyprien Katsaris, Apex CD-Label (Warner)
.
Harriet Quartet: «Insomnia»
.
Originell, spannungsgeladen, angenehm
Stephan Urban
.
 Das neue Album «Insomnia» des Harriet Quartet ist für Menschen mit einem Hang zu beruhigender Wohlfühlmusik gemacht – doch man möchte den geneigten Hörer keineswegs einschläfern, sondern vielmehr auf höchstem Niveau unterhalten. Es ist Musik im so weiten Spannungsfeld zwischen skandinavischer Volksmusik, Jazz, Folk und anspruchsvollem Pop. Die Band spielt völlig entspannt, federnd und luftig, mitunter banale Harmoniefolgen, die durch ihre schlichte Schönheit bezaubern, dann wieder komplexere Motive, die durch die lockere Lässigkeit und Spielfreude, mit der sie hervorgebracht werden, leicht zugänglich sind und trotzdem nachhaltig beeindrucken.
Das neue Album «Insomnia» des Harriet Quartet ist für Menschen mit einem Hang zu beruhigender Wohlfühlmusik gemacht – doch man möchte den geneigten Hörer keineswegs einschläfern, sondern vielmehr auf höchstem Niveau unterhalten. Es ist Musik im so weiten Spannungsfeld zwischen skandinavischer Volksmusik, Jazz, Folk und anspruchsvollem Pop. Die Band spielt völlig entspannt, federnd und luftig, mitunter banale Harmoniefolgen, die durch ihre schlichte Schönheit bezaubern, dann wieder komplexere Motive, die durch die lockere Lässigkeit und Spielfreude, mit der sie hervorgebracht werden, leicht zugänglich sind und trotzdem nachhaltig beeindrucken.
Harriet Müller-Tyl, eine gebürtige Norwegerin, hat 1993 ihren Lebensmittelpunkt vom norwegischen As nach Wien verlegt, blieb ihrer Heimat aber weitgehend verbunden, und wienerische Einflüsse sind hier nicht zu hören. Sie verfügt über eine klare, zwischentonreiche Stimme mit hohem Wiedererkennungswert. Begleitet wird sie von Bertl Mayer (der sonst bei der großartigen Alegre Correa Band – in Wien eine lokale Größe – tätig ist) an der Mundharmonika, von Heimo Trixner an einer – von der Spielart her – dezenten Jazzgitarre, sowie schließlich von Oliver Steger, der sehr engagiert einen sonor und vielschichtig klingenden Kontrabass zupft. Der Sound dieses Kontrabasses hat mich übrigens so beeindruckt, dass ich versucht habe, nähere Informationen darüber einzuholen. Leider kann Oliver Steger keine näheren Angaben zu seinem Instrument machen, nur, dass es rund hundert Jahre alt ist und aus Ungarn stammt.
Heimo Trixner verwendet eine «Blade Thinline Telecaster», deren Sound hervorragend zu dieser Musik, zu diesem Ensemble, passt.
Erstaunlich ist dabei, dass es sich hier um ein Erstlingswerk handelt. Völlig selbstbewusst werden – abgesehen von zwei Traditionals – ausschließlich Eigenkompositionen zu Gehör gebracht.
Eigenwillig auch, dass die Sprache gewechselt wird, beinahe abwechselnd kommen die Songs in norwegischer oder in englischer Sprache daher, wobei ich das norwegische Idiom zwar nicht verstehe, es passt aber besser zu dieser Musik, gibt ihr etwas Bezauberndes, Sehnsuchtsvolles, etwas Mystisches. Eigentlich wäre es nur konsequent gewesen, alle Lieder in dieser Sprache zu texten.
Die Songs fließen nur so dahin, ganz selbstverständlich klingt das, es ist eine sehr eigenständige Musik, die zwischen der Kargheit des Nordens und südländischem Feuer oszilliert. Auch wenn das wie ein Widerspruch klingt – es ist keiner, das passt, und das muss genau so sein.
Harriet Müller-Tyl ist damit weit mehr als eine weitere Norwegerin, die Musik im Spannungsfeld von Kari Bremnes, Mari Boine Persen, Solveig Slettahjell oder Maria Pihl hervorbringt. Sie tut das nämlich mit großer Klasse, auf hohem Niveau, und sie hat sich zwischen diesen Damen ihren eigenen, ganz speziellen Claim abgesteckt. Mal sehen, was hier sonst noch gefördert wird.
Diese Scheibe ist den Künstlern offensichtlich leicht gefallen, und sie ist derart gut und ausgereift geworden, dass es schwer sein wird, diesem Debut-Album eine noch bessere Produktion folgen zu lassen. Die Messlatte liegt also hoch und man darf diesbezüglich erstmal gespannt sein…
Die Aufnahmen haben am 11. und 12. Juni 2006 im Studio von Thomas Mauerhofer stattgefunden. Dieses Studio verfügt über eine bestechend gute Ausrüstung. Ohne hier langweilen zu wollen: Es finden ein relativ kleiner Mixer mit nur 10 Stereokanälen, unter anderem die berühmten Neumann-Mikrofone U87, KM-184 und TLM-193, sowie diverse gut beleumundete AKG-, Sennheiser- und Shure-Modelle Verwendung. Unter anderem kommen von Profis völlig zu Recht gerühmte Studer/Revox und Telefunken 672/676a und 372s Mikrofonverstärker zum Einsatz.
Ebenso sei die Nutzung eines Lexicon 300 erwähnt, eines professionellen Effektprozessors, der, sparsam eingesetzt, für einen unglaublich körperhaften und natürlichen Sound sorgen kann. Auch bei den Produktionen von Kari Bremnes, die nicht zuletzt für ihre klanglich perfekten Produktionen bekannt ist, findet dieses Gerät Verwendung.
Somit ist auch die Tonqualität zu erwähnen: Viel besser geht das nicht, eine intime, Gänsehaut erzeugende Aufnahme, die nicht das geringste Nebengeräusch unterschlägt, den Kontrabass beinahe körperlich an seinen Platz stellt und die Stimme völlig frei mit allen Atemgeräuschen im Raum entstehen lässt.

Interessante, spannungsgeladene, aber immer angenehme Musik, dieses neue Album «Insomnia» des Harriet Quartet. Ein großartiges Debut, eine hochwertige Produktion - schön, dass es so etwas noch gibt!
Zu einer perfekten Produktion gehört auch ein perfektes Artwork. Das Cover ist dezent in schwarz-weiß gehalten, keine schnöde Plastikschachtel, vielmehr hochwertiger Karton. Leider gibt es hier nicht viel mehr als Basisinformationen, dafür aber ein hübsches Booklet mit allen Texten dazu.
Schade auch, dass es bis zum Oktober 2010 gedauert hat, bis die Produktion veröffentlicht werden konnte. An dieser Stelle sollte dem kleinen, aber feinen cracked-an-egg-Label wohl Dank ausgesprochen werden, dass man sich getraut hat, dem Harriet-Quartet diese Chance zu geben. Ich würde diesem Label einen gebührenden Erfolg fraglos gönnen und werde mich ganz sicher in nächster Zeit auch mit anderen Produktionen dieser Herkunft näher befassen. ■
Harriet Quartet: Insomnia, Audio-CD, Cracked-An-Egg (Lotus Records)
.
.
Thomas Stabenow: «Die Klavierstücke»
.
Hochkarätige Werke, feines Musizieren
Klaus Nemelka
.
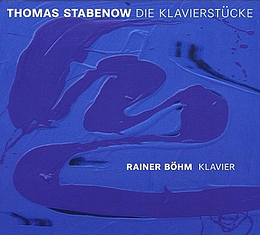 Ein Landespreis für Musik ist eine feine Sache, steht durch ihn doch sozusagen von höchster Stelle fest, wer die Besten in einer musikalischen Kategorie eines Bundeslandes sind. Über die Grenzen des «Ländle» hinaus kann der Jazzpreis Baden-Württemberg auch als eine Art Orientierung darüber verstanden werden, wer so die Jazz-Größen in Deutschland sind. Wenn also Rainer Böhm, der baden-württembergische Jazz-Preisträger des Jahres 2010, mit Thomas Stabenow, dem baden-württembergischen Jazz-Preisträger von 1986, gemeinsame Sache macht, kann daraus sehr feine Musik entspringen.
Ein Landespreis für Musik ist eine feine Sache, steht durch ihn doch sozusagen von höchster Stelle fest, wer die Besten in einer musikalischen Kategorie eines Bundeslandes sind. Über die Grenzen des «Ländle» hinaus kann der Jazzpreis Baden-Württemberg auch als eine Art Orientierung darüber verstanden werden, wer so die Jazz-Größen in Deutschland sind. Wenn also Rainer Böhm, der baden-württembergische Jazz-Preisträger des Jahres 2010, mit Thomas Stabenow, dem baden-württembergischen Jazz-Preisträger von 1986, gemeinsame Sache macht, kann daraus sehr feine Musik entspringen.
Somit war Pianist Rainer Böhm, der die Werke des Jazz-Musikers Thomas Stabenow «vertonen» sollte, für die Umsetzung des «Klavierstücke»-Projektes die erste Wahl. Bei einer Tour der beiden Preisträger mit Ingrid Jensen und Jürgen Seefelder konnten Böhm und Stabenow in München auch noch Jason Seizer, dessen «Pirouet Studio» und den dort zur Verfügung stehenden «Steinway»-Flügel für das Projekt gewinnen.
Der Kontrabassist, Komponist, Produzent und Hochschullehrer Thomas Stabenow ist u.a. mit Johnny Griffin, Charlie Rouse, Clifford Jordan, Albert Mangelsdorff, Mel Lewis, Jimmy Cobb aufgetreten, hat als «sideman» auf über 150 LPs und CDs mitgewirkt, sowie 3 LPs und 26 CDs auf seinem eigenem Label «Bassic-Sound» aufgenommen. Als Mitglied der «Peter Herbolzheimer Rhythm Combination & Brass» war Thomas Stabenow zudem mit Stan Getz, Chaka Khan, Dianne Reeves, Eartha Kitt und Al Jarreau auf der Bühne.
Rainer Böhm hat unter anderem beim «Jazz Hoeilaart International Belgium» und beim internationalen Jazzwettbewerb in Getxo (Spanien) den Preis für den besten Solisten gewonnen, seine CDs wurden mehrfach mit dem Vierteljahrespreis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.
Bei den «Klavierstücken» handelt es sich um Werke, die sich bei Thomas Stabenow über einen längeren Zeitraum angesammelt hatten. Die Umsetzung dieser musikalischen Ideen – neben dem «Tagesgeschäft» der Auftritte und der Lehrtätigkeit an der Musikhochschule Mannheim – sah Stabenow als eminent wichtig an. Ein Vorgehen übrigens, welches er, wie er betont, vom dem österreichischen Pianisten Fritz Pauer gelernt hatte: Eine musikalische Idee zum Abschluss zu bringen, koste es, was es wolle, um Platz für neue Ideen zu schaffen.
Dass er diese Ideen Rainer Böhm anvertraut und nicht selbst eingespielt hat, hielt Stabenow für ratsam, da er, um sein internationales Niveau als Kontrabassist zu halten, das Klavierspielen vernachlässigen musste, er aber für seine Stücke höchstes Niveau (zurecht) für durchaus angemessen hält.

Die rundum gelungene CD bietet für den Jazz-Kenner 16 Piano-Titel von Thomas Stabenow, hervorragend «vertont» durch den Pianisten Rainer Böhm. Schade, dass die Gesamt-Spieldauer mit nur 37 Minuten etwas gar mager ausfiel. Aber davon abgesehen eine qualitativ hochstehende Einspielung – genau richtig als Geschenk unter den Weihnachtsbaum des Jazzpiano-Freundes!
Dass das Repertoire von Thomas Stabenows Werken nicht nur exzellent umgesetzt, sondern auch äußerst vielfältig ist, wird schon beim ersten Durchhören der CD klar: Bereits der erste Track «Bass erstaunt» bietet die Möglichkeit, mit einem Bass-Ostinato über eine phrygische Skala zu improvisieren. Wer da schon staunt, will weiterhören: Der Titel «Mon Ami», entsprungen aus einer Co-Komposition mit seiner Tochter, ist ein leichter Valse-Musette und erinnert durch seine Akkordfolge an «Autumn Leaves». «Amagansett» und «Via Petrarca» wiederum zeigen eine schöne Nähe zum Bach‘schen Wohltemperierten Klavier. «Pirx» ist ein eleganter Jazz-Waltz, der unter anderem auch auf Johannes Enders CD «Homeground» verewigt wurde.
Überhaupt findet man die einzelnen Tunes vielfach auch in Versionen hochkarätiger Kollegen von Stabenow: So wurde der «Hit» dieser CD, «Chutney», unter anderem von Wolfgang Haffners «International Jazz Quintet», von «Trombonefire» oder dem Bundesjugendjazzorchester (noch unter der Leitung des inzwischen leider verstorbenen Peter Herbolzheimer) interpretiert.
«Plaun a plaun», rätoromanisch für cool oder «gemächlich», erinnert im Thema an Katschaturian, bevor das Stück sich im Improvisationsteil dann als grooviger Moll-Blues entpuppt. Die Namensidee zum Stück «Plusquamparfait» kombiniert die grammatikalische Form, dass ein Geschehen zeitlich vor einem anderen vergangenen Geschehen eingeordnet wird, mit einer leckeren französischen Nachspeise…
Die rundum gelungene CD bietet für den Musikkenner schließlich noch ein Extra-Schmankerl: Die Noten zur CD gibt’s als kostenlosen Download auf der Website von Thomas Stabenow. ■
Thomas Stabenow: Die Klavierstücke, Rainer Böhm (Piano), Audio-CD, 37 Min, Bassic Sound.
.
_______________________________
Geb. 1970, früher Journalist bei verschiedenen österreichischen und deutschen Medien, lebt als PR-Manager und Jazz-Freund in Wien/A
.
.
.
Noten-Leseprobe
.
.
Erik Satie: «L´œuvre pour piano» (Aldo Ciccolini)
.
«Alle Jahre wieder» und nie langweilig – oder doch?
Michael Magercord
.
 Es ist wieder einmal soweit: Alle ungefähr drei Jahre wieder legt EMI-Classics die schon vor bald dreißig Jahre erstmals komplett eingespielten Werke für Klavier von Erik Satie vor, jedes Mal mit einem neuen Cover-Design. Bloß alter Wein in neuen Schläuchen also? Sicher nicht, denn diese Einspielung durch den Pianisten Aldo Ciccolini ist ein Schatz in der Truhe von EMI. Diese fünf CDs bringen sechs Stunden ununterbrochenen Hörgenuss – und ein Genuss ist es immer wieder, die Werke Saties zu hören. Es sind Kleinode der Klaviermusik, das längste dauert exakt sechs Minuten, das kürzeste gerade einmal 14 Sekunden, und insgesamt kommt die komplette Einspielung auf 212 Einzel-Takes.
Es ist wieder einmal soweit: Alle ungefähr drei Jahre wieder legt EMI-Classics die schon vor bald dreißig Jahre erstmals komplett eingespielten Werke für Klavier von Erik Satie vor, jedes Mal mit einem neuen Cover-Design. Bloß alter Wein in neuen Schläuchen also? Sicher nicht, denn diese Einspielung durch den Pianisten Aldo Ciccolini ist ein Schatz in der Truhe von EMI. Diese fünf CDs bringen sechs Stunden ununterbrochenen Hörgenuss – und ein Genuss ist es immer wieder, die Werke Saties zu hören. Es sind Kleinode der Klaviermusik, das längste dauert exakt sechs Minuten, das kürzeste gerade einmal 14 Sekunden, und insgesamt kommt die komplette Einspielung auf 212 Einzel-Takes.
Schon das erste Take «Allegro», das auch die erste bekannte Komposition von Satie ist, zeigt seine ganze Meisterschaft der Kürze und Konzentration. Neun Takte, die der Komponist nach zwanzig Sekunden als komplettes Stück beschließt. Das Stück – oder sollte man sagen: Werk – scheint mit seinem Fließen gar nicht zu enden und endet eben doch. Satie soll zur Aufrechterhaltung dieses Eindrucks noch eine Überbrückungspassage von ein paar Takten gestrichen haben, die ihm das Stück zu arg in die Länge gezogen hätte, ohne wirklich etwas hinzuzufügen. Eine musikalische Postkarte von der Atlantikküste oder poetischer: ein Haiku. Auch wenn Satie in der Folge seiner Kompositoinstätigkeit viele Phasen und Perioden durchgemacht hat, die vom Walzer bis zur strengen klassischen Form reichen, so blieb die Kürze und Konzentration seine Methode, und der Hörer dankt ihm für diesen kleinen aber feinen Genuss bis heute.
Es ist natürlich auch immer ein Genuß, sich über die Werke und die oft abstrusen Titelbezeichnungen den Komponisten als Menschen auszumalen. Wer seine Stücke etwa «Gurkenembryos», «träumender Fisch» oder «bürokratische Sonate» nennt, muss jemand gewesen sein, der sich als Mensch so ernst nahm, dass er sich nicht ernst nahm. Ein wahrlich schräger Vogel soll es auch gewesen sein, der dem jungen Erik Satie das Dasein als schräger Vogel schmackhaft gemacht hatte. Sein Onkel nämlich, der sich auch noch «Onkel Seevogel» nannte, aber eher als das schwarze Schaf der Familie galt, hatte sich kaum um die familiäre Reederei gekümmert als vielmehr um schlüpfrige Theater-Revues – und seinen Neffen in diese Welt eingeführt. Mit dieser Erfahrung aus den jungen Jahren hatte auch der noch jugendliche Pianist und Komponist Erik Satie später kein Problem, sich umgehend in die Szene um den Pariser Montmartre heimisch zu fühlen und doch genau zu verstehen, was eigentlich gespielt wird, heißt es in einer Biographie, denn sein Sinn für das Absurde des Lebens sei dank des Onkels schon früh geschärft gewesen. Der genussvoll diese seltsam betittelten Werke Hörende jedenfalls ist dem Onkel dafür noch immer dankbar…
Es ist weiter natürlich auch ein Genuss, sich auf die ganz unterschiedlichen Ausführung dieser Stücke zu konzentrieren, wobei die Einspielung von Aldo Ciccolini als eine der richtungsweisenden Interpretationen gelten darf. Satie wurde bis in den Beginn der 80er Jahre kaum gespielt, die großen Solisten mieden diese so ernstfrei daher kommende ernste Musik. Der französiche Pianist mit süditalienischen Wurzeln besass aber vielleicht genug neapolitianische Chupze, um sich gleich an eine Kompletteinspielung zu wagen. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten wurden einige Stücke, allen voran die Gymnopedies und Gnossiennes, oft aufgenommen, und alles scheint nun möglich, von elegisch romantisch, wie etwa vom jungen englischen Pianisten Ronan O’Hara, oder steif und kalt. Schon der Vergleich der Längen ergeben interessante Aufschlüsse über die Interpretierbarkeit dieser Musik. Wo zum Beispiel John White, der spielt, als komme die Musik aus einem betonungslosen Automaten – was Satie sicher auch gefallen hätte –, die «Träumerei des Armen» in 2:43 Minuten absolviert, benötigt Aldo Ciccolini für dasselbe Stück in seiner, die jeweiligen Klangstimmungen aufnehmenden Art der Interpretation gerade einmal eine Minute.

Erik Saties «L´œuvre pour piano» mag eine bereits dreißig Jahre alte Einspielung von Aldo Ciccolini sein, die aber ihre ständige Wiederauflage immer wieder aufs Neue rechtfertigt: Melancholisch, wo es soll, spritzig, wo es muss – und langweilig, wie es besser nicht geht.
Diese CD-Box Einspielung ist also ein Genuss in vielerlei Hinsicht, und selbst nach sechs Stunden klingen die kurzen, oftmals im besten Sinne eintönigen Werke beim Hörer noch lange nach. Langeweile sollte ja eigentlich keine Kategorie der Kunstkritik sein, hier aber sei sie einmal erlaubt, denn es soll der Soziologe und Musiktheoretiker Theodor Adorno gewesen sein, der Saties Musik abschätzig mit der Begriff «Philosophische Langeweile» belegte. Der genusssüchtige und dankbare Hörer fasst diese Bezeichnung seiner geliebten Eintötigkeiten aus der Feder von Erik Satie in der Interpretation von Aldo Ciccolini allerdings als Lob auf – denn ist nicht diese Art der Langeweile die vielleicht menschenwürdigste aller menschlich-geistigen Regungen? ■
Erik Satie, L´œuvre pour piano, Aldo Ciccolini (Klavier), 5 CD-Box, EMI Classics 50999 648361 2 6
.
.
.
.
Franz Schubert / Jörg Widmann: Oktette
.
Qualitätsvolle Interpretation «exotischer» Kammermusik
Christian Schütte
.
 Das Oktett ist eine exotische Form innerhalb der Kammermusik: Nur wenige Komponisten haben überhaupt für diese Besetzung geschrieben, und eine einheitliche Besetzungsform gibt es auch nicht.
Das Oktett ist eine exotische Form innerhalb der Kammermusik: Nur wenige Komponisten haben überhaupt für diese Besetzung geschrieben, und eine einheitliche Besetzungsform gibt es auch nicht.
Franz Schubert hat zwei Oktette geschrieben, eines nur für Holzblasinstrumente und Horn, und eben jenes Oktett in F-Dur für Klarinette, Fagott, Horn, Streichquartett und Kontrabass. Er knüpft damit an ein Vorbild an, nämlich Ludwig van Beethovens Septett op. 20, das bis auf die zweite Violinstimme genau so besetzt ist wie Schuberts Oktett. Bei aller Referenz an dieses Werk ist Schuberts Komposition doch ein höchst individuelles Stück, das vor allem Hinweise darauf gibt, was er mit dem Werk beabsichtigte. Form und Dimension des Oktetts sind in mehrfacher Hinsicht groß. Nicht nur, dass mit einer Gesamtlänge von etwas über einer Stunde das Oktett den zur Entstehungszeit üblichen Rahmen der Dauer von Kammermusik sprengt, auch in der formalen Anlage wollte Schubert offenbar hoch hinaus. Einerseits erklärte er selbst, sich mit dem Oktett den «Weg zur großen Sinfonie» bahnen zu wollen – was er kurze Zeit später auch tat –, andererseits ist die Anlage in sechs Sätzen gar nicht sinfonisch, lässt äußerlich vielmehr Anknüpfungspunkte an mehrsätzige Formen wie Suite oder Divertimento vermuten. Man kann darin genauso gut ein Experimentieren mit verschiedenen Satzformen erkennen, um auf diese Weise ein wenig für die «große Sinfonie» zu üben. Wie dem auch sei, das Oktett ist somit in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Stück, das kompositorisch durchweg mit hoher Raffinesse der Satzgestaltung, farbenreichem Ausloten der Instrumente, kraftvoller rhythmischer und filigraner melodischer Gestaltung für sich einnimmt. Auch mit dem Gegenüber von konzertanten und sinfonischen Formen spielt Schubert hier ausgiebig, scheint etwa der Beginn des zweiten Satzes Adagio ein Klarinettenkonzert en miniature zu sein.
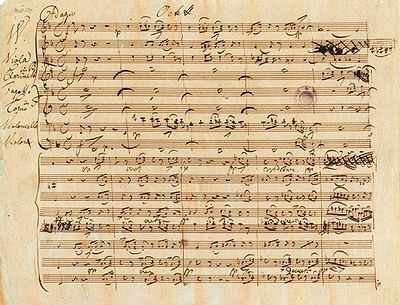
«Raffinierter Satz, kraftvolle Rhythmik, filigrane Melodik»: Autograph des 1. Satzes von Schuberts Oktett in F-Dur, D 803
Jörg Widmann hat sich in seinem recht umfangreichen kammermusikalischen Schaffen immer wieder unmittelbar auf Franz Schubert bezogen. Für das Artemis-Quartett etwa, das einige seiner Streichquartette zur Uraufführung brachte, ist es schon eine kleine Tradition geworden, Widmanns und Schuberts Streichquartette in ihren Programmen miteinander zu verbinden – ganz im Sinne des Komponisten.
Jörg Widmanns Oktett aus dem Jahr 2004 ist auf der Doppel-CD nun erstmalig eingespielt. Im direkten Vergleich zu seinen Streichquartetten etwa fällt beim Oktett sofort auf, dass Widmann sich hier wesentlich stärker an der musikalischen Welt Schuberts orientiert. Zwar lassen gleich in den ersten Takten bestimmte Harmonien erkennen, dass hier ein zeitgenössischer Komponist am Werk war, der diese wenigen Harmonien in ein Klangbild mit Reminiszenzen sowohl an Schubert als auch an nachromantische Strömungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts einflechtet. Was beim ersten Hinhören noch verwundert, entfaltet sich im Verlauf immer mehr zu einem Eindruck gekonnter und klug kalkulierter Referenz an Schubert. Nicht um bloßes Nachempfinden geht es hier, das würde dem Komponisten Widmann auch in keiner Weise entsprechen. Im Lauf des Stücks bewegt sich Widmann vielmehr immer weiter von Schubert weg, ein Ausgangspunkt zu Beginn stößt gleichsam eine Entwicklung an, das kompositorische Vorbild immer freier zu behandeln. Dabei erreicht Widmann freilich auch nicht die Schubert’schen Dimensionen. Gut 25 Minuten brauchen die fünf Sätze, deren Titel erkennen lassen, dass Widmann eine sehr viel intimere, zurückgezogenere Auffassung von seinem Stück hat. Intrada, Menuetto, Lied ohne Worte, Intermezzo, Finale – das klingt alles sehr viel spielerischer, auch einfacher als bei Schubert –, was jedoch keineswegs simpler oder schlichter bedeutet.
Die musikalische Ausführung beider Werke verdient größtes Lob. Schließlich ist das Instrumentalisten-Oktett auch mit vorzüglichen Musikern besetzt. Jörg Widmann selbst spielt Klarinette, Dag Jensen Fagott, und Sibylla Mahni Horn. Das Streicher-Quintett ist beim Widmann-Oktett zusammengesetzt aus Widmanns Schwester Caroline und Florian Donderer, Violinen, Hanna Weinmeister, Viola, Gustav Rivinius, Cello, sowie Yasunori Kawahara, Kontrabass. Das Schubert-Oktett spielen Isabelle van Keulen und Veronika Eberle, Violinen, Rachel Roberts, Viola, Tanja Tetzlaff, Cello, und Yasunori Kawahara, Kontrabass.
Bei Schubert legen die Musiker in ihrer Interpretation großen Wert darauf, das orchestrale, sinfonische Moment des Werkes zu betonen, ohne dabei in einen zu groben, dickflüssigen Klang zu fallen – alles bleibt leicht, transparent und durchhörbar, macht in den komplexer instrumentierten Passagen dabei gleichwohl fast vergessen, dass doch nur acht Instrumente beteiligt sind.

Sowohl das Oktett von Schubert als auch jenes von Jörg Widmann wird von den ausführenden Kammermusikern auf dieser CD-Novität aus dem Hause Avi-Music sehr transparent, sehr durchhörbar interpretiert. Eine interessante Gegenüberstellung - insgesamt eine deutliche Empfehlung für Freunde der - auch etwas spezielleren - Kammermusik.
Diese Interpretationsweise setzt sich in Widmanns Stück fort, wobei die Musiker hier einen wesentlich breitwandigeren Klang anstreben, der Widmanns eher horizontal angelegte Kompositionsstruktur nachempfindet. Dabei klingen die Farben der verschiedenen Instrumente ganz ähnlich wie bei Schubert. Das verlangt Widmanns Stück an den Stellen, an denen er sich gezielt auf Schubert bezieht; andere Passagen verlangen demgegenüber ganz andere Farben, solche der Musik des 21. Jahrhunderts. Die Musiker verstehen es, diesen Spagat kongenial umzusetzen.
Die Einspielung ist insgesamt eine unbedingte Empfehlung für Freunde der – auch etwas spezielleren – Kammermusik. ■
Franz Schubert / Jörg Widmann: Oktette; Avi-Service for music, Doppel-CD, Produktion im Auftrag von Deutschlandradio, (Live-Aufnahme vom Kammermusik-Festival Spannungen – Konzert im Wasserkraftwerk Heimbach / Juni 2009), LC 15080, Stereo, DDD
.
.
.
.
Friedrich Gernsheim: Die Klavierquintette
.
«Anmutig lächelnd wie ein Wiener Mädchenauge»
Dr. Markus Gärtner
.
 «Durch die Plastik und Klarheit seiner Tonschöpfungen und die ihnen innewohnende Poesie und Frische erscheint Gernsheim unter den Componisten der Gegenwart besonders befähigt, bei weiterer künstlerischer Entwicklung berufen zu sein, im edelsten Sinne des Wortes zu voller Popularität und Anerkennung seiner Werke zu gelangen.»
«Durch die Plastik und Klarheit seiner Tonschöpfungen und die ihnen innewohnende Poesie und Frische erscheint Gernsheim unter den Componisten der Gegenwart besonders befähigt, bei weiterer künstlerischer Entwicklung berufen zu sein, im edelsten Sinne des Wortes zu voller Popularität und Anerkennung seiner Werke zu gelangen.»
Der fromme Wunsch, den das Mendel-Reissmannsche «Musikalische Conversations-Lexicon» hier formuliert, ist nicht in Erfüllung gegangen. Zu Lebzeiten geachtet und geehrt, begann der Pianist und Komponist Friedrich Gernsheim schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aus den Köpfen der musikinteressierten Öffentlichkeit zu verschwinden.
Doch das Interesse der Tonträgerindustrie, welche mittlerweile auch die angeblich zweite und dritte Reihe deutscher Komponisten hinter und neben den großen Namen auf Verkaufspotenzial prüft – und dabei nolens volens mithilft, eine Musikgeschichte zu entwerfen, die sich auch für die Nebenarme des großen Stromes interessiert –, kommt Gernsheim, beinahe ein Jahrhundert nach seinem Tod, zugute: Es lässt das Bild eines vor allem kammermusikalisch wirkenden Tonkünstlers entstehen, der in Abhängigkeit von Johannes Brahms der vorwärtstreibenden Entwicklung der «Zukunftsmusik» um Liszt und Wagner nicht folgen wollte.
Gernsheim gehört damit zum Block derjenigen Komponisten, die in der Geschichtsschreibung im Allgemeinen mit den Etiketten «Konservativer», «Akademiker» oder auch «Formalist» gekennzeichnet werden. Gleichzeitig zeigt er sich als ein ganz bestimmter Künstlertypus, wie ihn die zweite Hälfte des 19. Jahrhundert hervorgebracht hat: akademisch ausgebildet, international wirkend und doch bereits von Zeitgenossen als rückwärtsgewandt eingestuft. Ein Spezifikum dieser Komponisten, zu denen sich, ohne immer alle drei Kriterien zu erfüllen, Heinrich von Herzogenberg, Robert Fuchs, Julius Roentgen oder Hermann Goetz rechnen ließen, ist immer wieder die Orientierung an der Instrumentalmusik, und zwar im Besonderen an der Kammermusik inklusive deren Ästhetik des «Reinen» – ein Genre, welches eben schon durch die kleine Besetzung allem markschreierischen Bombast entgegengesetzt ist. Neben dem Streichquartett treiben auch immer wieder Besetzungen mit Klavier und Streichern diese Tonkünstler zur Komposition.
Entsprechend des eigenen Selbstverständnisses – «producing recordings of the huge amount of top-notch classical music that the concert halls and major record companies are ignoring» – hat sich das Label «Toccata Classics» nun auch um Friedrich Gernsheim verdient gemacht. Die vorliegende CD mit den beiden Klavierquintetten des Komponisten ist geprägt von großer Seriosität, sowohl was die Musik als auch deren Darbietung anbelangt. Hier werden keine angeblichen «Schätze» gehoben, die man am liebsten gleich wieder im Meer des Vergessens versenken möchte. Nein, Gernsheims Musik ist für ihre Zeit zwar keineswegs hochinnovativ, klingt aber dafür ungekünstelt und bietet Themen, die sowohl melodisch als auch mit Blick auf deren Verarbeitung gut erfunden sind. Das unterscheidet ihn von vielen seiner «konservativen» Kollegen, und auch Brahms arbeitet ja oftmals mit eher zähen thematischen Grundgedanken.

«Nicht innovative, aber ungekünstelte» Brahms-Nachfolge: Partitur-Auszug von «In memoriam – Klage-Sang für Streichorchester & Orgel» op. 91 von Friedrich Gernsheim
Der Kopfsatz des ersten Quintetts von 1875/76 beginnt gleich mit einem zwar instrumental gedachten, aber gleichzeitig gut memorierbaren ersten Themenblock. Auch das Scherzo weiß zu fesseln und mit dem Hörer tatsächlich seine Scherze zu treiben, indem es diesen, was das Ende des Satzes betrifft, mehrfach an der Nase herumführt.
Das zweite Quintett von 1896 zeigt sich etwas zugeknöpfter, erscheint insgesamt zurückgenommener und im Hauptthema des ersten Satzes auch weniger eingängig. Der Akzent liegt hier mehr auf dem folgenden Seitensatz, der sich tänzerisch-charmant als «eine echte Melodie aus dem Heimatland der Kammermusik» zeigt, wie Anton Ursprung in seiner Besprechung der Erstausgabe der Partitur formulierte, «anmuthig lächelnd wie ein Wiener Mädchenauge, noch dazu auf das Reizvollste instrumentiert und ausnehmend lieblich von dem düsteren, leidenschaftlichen Hintergrunde des ersten Hauptmotivs abgehoben» (Musikalisches Wochenblatt 29 [1898], S. 617-619, hier S. 619). Graziös ist allerdings auch das Scherzo, welches mit seinen dreieinhalb Minuten mehr Intermezzo- denn Satzcharakter aufweist.

Die Aufnahme kann nicht nur durch die gleichzeitig vitale wie feinfühlige Interpretation überzeugen, sondern macht zudem Lust darauf, weitere Werke Friedrich Gernsheims – z. B. seine Symphonien – kennenzulernen.
Das Zusammenspiel des Art Vio Quartetts mit dem Pianisten Edouard Oganessian kann nur gelobt werden. Fein staffeln die Musiker Lautstärkeunterschiede, ohne auf die große Geste zu verzichten. Das verleiht der Musik eine ihr gut zu Gesicht stehende kräftige Note, die den Hörer positiv an die Hand nimmt, vorliegende Quintette genauer kennenzulernen. Die Aufnahme kann nicht nur durch die gleichzeitig vitale wie feinfühlige Interpretation überzeugen, sondern macht zudem Lust darauf, weitere Werke Friedrich Gernsheims – z. B. seine Symphonien – kennenzulernen. ■
Friedrich Gernsheim: Piano Quintet No. 1 in D minor, op. 35; Piano Quintet No. 2 in B minor, op. 63; Art Vio String Quartet; Edouard Oganessian, piano; Toccata Classics
.
.
.
M: Weinberg: «Sonaten für Viola solo / Sonate für Viola & Klavier»
.
Die Grenzen der Viola musikalisch ausgelotet
Christian Schütte
.
 Mieczyslaw Weinberg, russischer Komponist polnischer Abstammung, erlebt in diesem Sommer durchaus einen kleinen Boom. Die Bregenzer Festspiele (21. Juli bis 22. August) widmen ihm einen programmatischen Schwerpunkt: mit einem Symposium mit Vorträgen und Diskussionen zu Weinbergs kompositorischem Schaffen, vor allem aber mit der Aufführung einer Reihe von Werken: seine Opern «Die Passagierin» und «Das Porträt», Konzerte mit Orchesterwerken, Kammermusik u.v.m.
Mieczyslaw Weinberg, russischer Komponist polnischer Abstammung, erlebt in diesem Sommer durchaus einen kleinen Boom. Die Bregenzer Festspiele (21. Juli bis 22. August) widmen ihm einen programmatischen Schwerpunkt: mit einem Symposium mit Vorträgen und Diskussionen zu Weinbergs kompositorischem Schaffen, vor allem aber mit der Aufführung einer Reihe von Werken: seine Opern «Die Passagierin» und «Das Porträt», Konzerte mit Orchesterwerken, Kammermusik u.v.m.
Weinberg wurde 1919 in Warschau geboren und studierte dort zunächst Klavier, bevor er 1939 in die damalige Sowjetunion übersiedelte. Er studierte bis 1941 weiter am Konservatorium in Minsk, wirkte ab 1943 als freischaffender Komponist und Pianist. Er lebte in Moskau und gehörte zu den engen Freunden Dmitri Schostakowitschs.
1953 wurde Weinberg, der Jude war, beschuldigt, auf der Halbinsel Krim die Gründung einer jüdischen Republik propagiert zu haben. Die Beschuldigung war jedoch vollkommen unberechtigt, Schostakowitsch setzte sich erfolgreich für Weinbergs Freilassung aus der Haft ein. Das ist nur ein Beispiel für ein insgesamt von schweren Belastungen geprägtes Leben, dem Weinberg gleichwohl eine Fülle von Werken abrang. Über 20 Symphonien, sechs Opern, eine Reihe von kammermusikalischen Werken für die verschiedensten Genres, Filmmusik u.v.m. schuf er.

Mieczyslaw Weinberg (1919-1996)
Dem Kammermusiker Weinberg widmet sich die Bratschistin Julia Rebekka Adler mit ihrer jüngsten Doppel-CD. In deren Zentrum stehen die vier Sonaten für Viola solo, daneben die Bearbeitung einer Sonate für Klarinette und Klavier sowie eine weitere Solosonate aus der Feder Fyodor Druzhinins.
Den Anfang macht die Sonate op. 28. Sie stammt aus dem Jahr 1945 und ist im Original für Klarinette und Klavier geschrieben. Der erste Satz erinnert unweigerlich an den musikalischen Stil der großen russischen Komponisten der Zeit – Weinbergs enge private Verbindung zu Schostakowitsch dürfte hier auch ihre musikalischen Spuren hinterlassen haben. Ebenso sind in den folgenden Sätzen aber Anklänge an russische und jüdische Folklore zu vernehmen, die in einer ebenso dichten persönlichen Beziehung zum Komponisten stehen. Somit ist die Sonate sicher ein probates Beispiel für Weinbergs individuellen Stil, den Julia Rebekka Adler durch einen vollen, warmen, manchmal auch schweren und schwermütigen Viola-Ton mit großer Klarheit zum Ausdruck bringt, Jascha Nemtsow begleitet sie dabei ebenso dezent wie kongenial am Klavier.
Die Solosonaten für Viola geben Adler beste Möglichkeiten, das so oft im Schatten der Violine stehende und missbilligte Instrument von ganz neuen Seiten zu zeigen. Die erste, op. 107, stammt aus dem Jahr 1971 und ist Fyodor Druzhinin gewidmet.
Diese Sonate ist die einzige bislang veröffentlichte. Die Sonate Nr. 2 (op. 123) von 1978 ist dem damaligen Bratscher des Borodin-Quartetts zugedacht, die dritte (op. 135) und vierte (op. 136) von 1985 bzw. 1986 dem zu der Zeit amtierenden Solobratscher des sowjetischen Staatsorchesters. Diese sehr persönlichen Widmungen erklären einerseits die Wahl der Solosonate – so war kein Begleiter nötig – andererseits aber auch die ausgebliebene Verbreitung dieser ohnehin sehr speziellen Musik.
Alle vier Sonaten vereint ein ebenso unterschiedlicher wie Extreme einfordernder Anspruch an die spieltechnischen Fertigkeiten des Bratschers. Auch wenn Weinbergs mitunter sehr düstere und melancholische Tonsprache einen solchen Begriff fast zu verbieten scheint, sind die Sonaten in ihrem Anspruch wahre Virtuosenmusik. Keine äußere Virtuosität wird hier ausgestellt, sondern eine ganz verinnerlichte, konzentriert auf ein perfektes Beherrschen des Instruments. Auch und gerade in dieser Hinsicht beglaubigt Julia Rebekka Adler ihr ambitioniertes Projekt, sich diesen nahezu in Vergessenheit geratenen Werken anzunehmen.
Ebenfalls auf der Doppel-CD eingespielt ist die Sonate für Viola solo des russischen Komponisten und Bratschisten Fyodor Druzhinin (Hörbeispiel auf Youtube), geboren 1932 in Moskau. Ab 1944 studierte er Viola an der Musikschule des Moskauer Konservatoriums, ab 1950 am Konservatorium bei Wadim Borissowski, dessen Platz im Beethoven-Streichquartett er 1964 einnahm. Später unterrichtete er selbst am Moskauer Konservatorium, dessen Viola-Abteilung er ab 1980 leitete.
Druzhinin ist Widmungsträger bedeutender Werke für Viola, u.a. Alfred Schnittkes, Grigori Frids und der Sonate für Viola Op. 147 von Dmitri Schostakowitsch, dessen letzte Komposition, die Druzhinin auch uraufgeführt hat. Neben seiner eigenen pädagogischen Tätigkeit komponierte er mehrere Werke für Viola.
Wahrscheinlich hat Weinberg Druzhinins Sonate für Viola solo gekannt, sie stammt aus dem Jahr 1959 und ist somit einige Jahre vor der Sonate entstanden, die Weinberg dem Bratscher und Komponisten widmete. Was jedenfalls den Grad an Komplexität und Anspruch an den Musiker angeht, steht Druzhinins Sonate den Werken Weinberg in nichts nach, der leidenschaftliche und versierte Bratscher, der Druzhinin Zeit seines Lebens war, klingt da mit jeder Note durch – und wird ebenso von Julia Rebekka Adler umgesetzt.

Die Einspielung dieser Weinbergschen Viola-Werke durch Julia Rebekka Adler ist eine warme Empfehlung für ausgesprochen interessierte Freunde der Bratsche, die hier durch eine vorzügliche Interpretation ein Dokument an die Hand bekommen, wie weit die Grenzen dieses Instruments verlaufen können.
Die Aufnahme ist genau zum richtigen Zeitpunkt entstanden, rückt Weinberg derzeit nicht zuletzt durch Veranstaltungen an so prominenten Orten wie Bregenz verstärkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Gleichwohl bleibt die Einspielung vor allem eine warme Empfehlung für ausgesprochen interessierte Freunde der Viola, die hier durch eine vorzügliche Interpretation ein eindrucksvolles Dokument an die Hand bekommen, wie weit die Grenzen dieses Instruments verlaufen können. ■
Mieczyslaw Weinberg: Sonaten für Viola solo – Sonate op. 28 für Klarinette und Klavier (Version für Viola und Klavier); Fyodor Druzhinin: Sonate für Viola solo, Julia Rebekka Adler (Viola), Jascha Nemtsow (Klavier), Doppel-Audio-CD, Neos Music & Bayerischer Rundfunk
.
.
.
Themen-Links
List of violists – Ulrike Jaeger – Echo-Klassik – SulPonticello –
David Gorton: «Trajectories»
.
«Neue Musik» in alten Bahnen
Michael Magercord
.
 Die Neue Musik gibt es nun schon so lange, dass man durchaus von alter und neuester Neuer Musik sprechen kann. Doch wo verläuft die Grenze zwischen Neuer und Neuester Musik? Wie in allen Künsten sind die Schnittlinien zwischen alt und neu fließend, es lassen sich jedoch Trends und Tendenzen heraushören, die einen kommenden Umschwung andeuten. Und in jüngster Zeit scheinen vor allem die jüngeren Komponisten wieder eine erleichterte Hörbarkeit ihrer Werke anzustreben, oder anders gesagt: Es entkrampft sich einiges in der Szene der Neuen Musik.
Die Neue Musik gibt es nun schon so lange, dass man durchaus von alter und neuester Neuer Musik sprechen kann. Doch wo verläuft die Grenze zwischen Neuer und Neuester Musik? Wie in allen Künsten sind die Schnittlinien zwischen alt und neu fließend, es lassen sich jedoch Trends und Tendenzen heraushören, die einen kommenden Umschwung andeuten. Und in jüngster Zeit scheinen vor allem die jüngeren Komponisten wieder eine erleichterte Hörbarkeit ihrer Werke anzustreben, oder anders gesagt: Es entkrampft sich einiges in der Szene der Neuen Musik.
Doch es gibt daneben natürlich noch die Exponenten der «guten alten» Neuen Musik, jene nämlich, die sich dem Experiment und der Herausforderung von Hörern und Musikern verschrieben haben, und die sich die kompositorische Freiheit nehmen, sich gänzlich dem Zwang der künstlerischen Innovation zu ergeben.
Ein Zeugnis dieser fast drei Jahrzehnte lang die Szenen bestimmenden Kompositionen legt noch einmal die CD «Trajectories» (Youtube-Video) ab – zu deutsch «Flugbahnen» -, auf der Werke der Kammermusik des britischen Komponisten David Gorton (geb. 1978) versammelt sind. Die erst jetzt veröffentlichten Aufnahmen stammen aus den Jahren 2005 und 2006, haben also nach den Maßstäben des Genres einige Zeit auf dem Buckel. Es sind Beispiele einer hochinnovativen Musik, in der alles ausprobiert wird, was klassische Musikinstrumente hergeben.
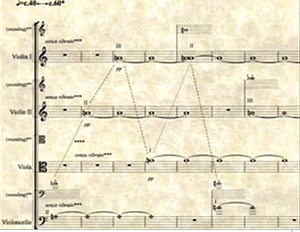
«Sphärischer Klangbrei mit Hilfe von Drittelston-Stimmung»: Partitur-Auszug von David Gortons Streichquartett «Trajectories»
Was also ist das bestimmende Element dieses ältlichen Neuen? Es ist das Detail. Jedes einzelne Werk ist eine Reihung von Kleinstkompositionen, Note für Note sind gleich wichtig. Und manches Mal werden durch eine Anhäufung von Details gerade die Details zum Verschwinden gebracht: David Gorton nutzt dazu so genannte Mikrostimmungen, läßt also die Stimmung der Instumente um einen Drittelton verschieben, woraus oftmals lediglich ein sphärischer Klangbrei wird, etwas, das man heutzutage «Soundscape» nennt. Will man als Hörer in diesen Tonlandschaften nicht völlig orientierungslos umherwandeln, ist Konzentration gefordert, um sich selbst eine hierachische Abfolge zu erstellen, die daraus schließlich ein gesamtes Stück entstehen lässt.

Neue Musik an der «Grenze des Spielbaren»: Der englische Komponist David Gorton
Der deutsche Komponist Bernd Franke hatte einmal bei einer Veranstaltung im Prager Goethe-Institut die Frage: «Wozu braucht man Neue Musik?» beantwortet mit der Gegenfrage: «Wozu braucht man Musik?» Laut Booklet der CD von David Gorton soll dessen Musik an der Grenze des Spielbaren (Hörbeispiel) gehen, hinter der sich dann ein neuer Horizont auftue. Doch stellt sich die Frage, was dahinter liegen mag: das Unspielbare, das Unhörbare, die sinnfreie Innovation also? Diese Grenze allerdings hat auch die Musik von David Gorton (Video-Hörbeispiel aus «Erinnerungsspiel») nicht überschritten, und der für den Hörer vielleicht größte Gewinn liegt darin, dass diese CD auf musikalische Weise die Möglichkeit gibt, etwas zu erfahren von der Moderne und ihrer Fähigkeit, die Konzentration und Innovation auf etwas zu verlegen, was im Grunde keine Sinnfrage zuläßt: auf Elemente, Atome, Quanten – kurz: auf Details.

«Trajetories» von David Gorton ist eine Abfolge von sehr ähnlichen Stücken der sogenannten Neuen Musik, die sich aber in den bereits alten Bahnen dieses Genres bewegt: Absolute Innovation und konzentrationsfordernde Detailfreude. Das alles gereicht – auch dank der ausführenden Musiker – zumindest phasenweise durchaus zum «Hörgenuss».
Aber es ist eben doch Musik auf dieser CD, und es sind eben doch noch Musiker, die mit herkömmlichen Instrumenten für Hörbarkeit sorgen. Ein wunderbarer Einfall ist auch die Gegenüberstellung ein und desselben Stückes, der Sonate für Cello-Solo, in zwei Varianten: einer Studioaufnahme und einem Live-Mitschnitt. Es offenbaren sich gewaltige Abweichungen der zeitlichen Betonung unterschiedlicher Passagen. Und es zeigt sich die Überlegenheit der spontanen Fassung, der gegenwärtigen Konzentration und Unwiederholbarkeit der Live-Darbietung. Auch im weichen Geigenspiel von Peter Sheppard Skaerved im Titelstück, dem Streichquartett «Trajectories», wird deutlich, dass selbst derartige Musik eben doch Musik ist. Überhaupt sind es die Ausführenden, denen wohl zu danken ist, dass die Reihung von Bruchstücken als Stücke hörbar werden. Und der Dank kommt dabei sicher nicht nur vom Hörer, sondern vom Komponisten – sollte er jedenfalls. ■
David Gorton, Trajectories: Sonate für Cello solo (Studioaufnahme), Streichquartett Trajectories, Sonate für Cello solo (Live-Mitschnitt) – Neil Heyde (Cello), Peter Sheppard Skaerved (Violine), Roderick Chadwick (Klavier), Kreutzer Quartett, Label Divine Art / Metier
.
.
Thomas Mann: «Mein Wunschkonzert»
.
Musikalisches Vermächtnis eines «Zauberers»
Christian Busch
.
 Es ist kein Geheimnis, dass Thomas Manns Verhältnis zur Musik nicht nur ein inniges und intensives, ein – wie er selbst gesteht – «Liebesverhältnis» war, sondern auch eines, das in wechselseitiger Beziehung zu seinem Werk stand. Umso interessanter mutet nun die neu als CD im Hörverlag veröffentlichte Aufnahme eines 1954 – ein Jahr vor seinem Tod – von dem Autor selbst kommentierten «Wunschkonzerts» im Süddeutschen Rundfunk. Sie ermöglicht den Blick in die Schreibstube – in das Denken, Weben und Fühlen – des bedeutendsten deutschen Erzählers und mutet an wie ein musikalisches Vermächtnis des 79-Jährigen an die Nachwelt.
Es ist kein Geheimnis, dass Thomas Manns Verhältnis zur Musik nicht nur ein inniges und intensives, ein – wie er selbst gesteht – «Liebesverhältnis» war, sondern auch eines, das in wechselseitiger Beziehung zu seinem Werk stand. Umso interessanter mutet nun die neu als CD im Hörverlag veröffentlichte Aufnahme eines 1954 – ein Jahr vor seinem Tod – von dem Autor selbst kommentierten «Wunschkonzerts» im Süddeutschen Rundfunk. Sie ermöglicht den Blick in die Schreibstube – in das Denken, Weben und Fühlen – des bedeutendsten deutschen Erzählers und mutet an wie ein musikalisches Vermächtnis des 79-Jährigen an die Nachwelt.
.
Vom Dionysischen zum Apollinischen

«Weihevolles Entzücken, Erschauern und Erbeben, rauschhaftes Schluchzen»: Das Grals-Motiv aus dem Lohengrin-Vorspiel von Richard Wagner (Hörbeispiel auf Youtube)
Mit dem Vorspiel zum 1. Akt der Oper «Lohengrin» führt uns der Dichter gleich in medias res zur Hauptinspirationsquelle seines Schaffens: Richard Wagner. Erinnerungen an die ersten Besuche des Lübecker Stadttheaters werden da wach, wo der junge Mann die ersten und unauslöschlichen Eindrücke vom Gralsmotiv empfangen hatte – die gleichen, welche später die Figur des kleinen Hanno in den «Buddenbrooks» über die raue Wirklichkeit des Daseins hinwegheben: «Es war über ihn gekommen mit seinen Weihen und Entzückungen, seinem heimlichen Erschauern und Erbeben, seine plötzlichem, innerlichem Schluchzen, seinem ganzen überschwänglichen und unersättlichen Rausche…». Schon Nietzsche hatte die «opiatische, narkotische Wirkung» des Vorspiels in seiner dionysischen Gewalt erkannt, die Hannos Lebens- und Willenskraft – noch am Vorabend seines schulischen Versagens – untergraben. Wie zum Trotze beschwört Mann indes in Anlehnung an Richard Strauss das vollendete Formbewusstsein des Vorspiels, bevor er der Musik demütig weicht.
.
Ut musica poesis
Das pastorale Erlebnis, das Claude Debussys impressionistisches «Prélude à l’après-midi d’un Faune» in Töne fasst, stand Pate bei Hans Castorps Traum im Kapitel «Fülle des Wohllauts» aus dem Roman «Der Zauberberg». Auch hier belebt die Musik in ihrer elektrisierenden und inspirierenden Wirkung das Seelenleben eines seiner Hauptprotagonisten, dem im Stumpfsinn und in der Eintönigkeit des Davoser Sanatoriums gefangenen Castorp, dem sich ein Grammophon «als ein strömendes Füllhorn heitern und seelenschweren künstlerischen Genusses» erweist. Die Töne der völligen Selbstvergessenheit, der hohen Idylle in glänzender Natur und des absoluten Stillstands der Zeit verwandeln sich in Thomas Manns Prosa in Worte der «Fülle des Wohllauts», die der Meister mit hörbarem Genuss und entzückter Stimme vorträgt, was zur Sternstunde der Kunst selbst gerät. Wenn der «Roman eine Symphonie» (T. Mann) sein soll, werden aus Tönen Worte: Ut musica poesis.
.
Bekenntnis zur Romantik
Doch vor allem – damit keine Missverständnisse aufkommen – bekennt sich Thomas Mann explizit und unmissverständlich zur Romantik und dem deutschen Lied. Franz Schuberts «Winterreise», der «schönste» Zyklus, der von der unerwiderten Liebe eines einsamen und ausgestoßenen Träumers und Wanderers in einer von restaurativer Kälte geprägten Zeit handelt, liegt da nahe, ließen sich doch wohl auch hier viele Parallelen zu Thomas Manns Biographie herstellen. Spricht aus dem eher unscheinbaren Lied Nr. 17 «Das Dorf» der verbitterte, rastlose und desillusionierte Flüchtling, dem kein Exil zur Heimat wurde?: «Ich bin zu Ende mit allen Träumen / Was will ich unter den Schläfern säumen?» Oder verklärt die Musik tatsächlich die «tiefe Melancholie und Verzweiflung» (T. Mann)?
Auch Eichendorffs von Robert Schumann im Liederkreis vertontes Gedicht «Zwielicht» gehört nicht unbedingt zu den berühmtesten, dennoch hat es sich einen Platz im Herzen des Zauberers errungen. Misstrauen, das Bewusstsein einer Übergangszeit, Bedrohung durch den Krieg prägen es. Doch wie sehr dem 79-jährigen Schriftsteller die Eichendorff’sche Dichtung der Leichtigkeit und Unbeschwertheit abgeht, verrät er – beinahe entrüstet und unwillig – im Nachsatz.
.
Huldigung der Schönheit und der Form
Ein wenig ironisch erscheint es, wenn Thomas Mann sein Wunschkonzert mit einer Ouvertüre, der Leonoren-Ouvertüre Beethovens, beschließt und sich mit ihr – ganz apollinisch – der erhabenen Humanität und Brüderlichkeit der Klassik zuwendet. Auch hier hat der Held seines Romans «Dr. Faustus», Adrian Leverkühn, ein früh prägendes Fidelio-Erlebnis, das bei allen Bedenken gegen das einfach «Gute und Schöne» die letzte – wie eine Apotheose aufsteigende – Botschaft des letzte Weisheiten berührenden Autors bleibt.

Der Literat zwischen Musikern: Thomas Mann mit den Dirigenten Bruno Walter (l.) und Arturo Toscanini in Salzburg 1935
Thomas Mann – obwohl von Alter und Krankheit gezeichnet – versteht das Spiel von Offenlegung und Verschleierung, von asketischer Selbstbeschränkung und subtiler Verführungskunst einerseits und der großbürgerlichen Verantwortung des Dichterfürsten andererseits. So stellt das bewegende Dokument Thomas Manns Verhältnis zur Musik mikroskopisch und doch eindrucksvoll dar. Es offeriert mehr als nur einen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Zauberers, sondern stellt ein Abbild von dessen tiefer Verwurzelung in der geliebten Welt der Töne dar. Für sein Verhältnis zur Musik gilt, was für alles galt, was er liebte: «Sehnsucht ist darin und schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze keusche Seligkeit.» (Thomas Mann, «Tonio Kröger»)

Thomas Manns «Wunschkonzert» hält als bewegendes Dokument das Verhältnis des Dichters zur Musik mikroskopisch und eindrucksvoll fest.
Dem Hörverlag sei gedankt für das umfangreiche, informative, weitere Anregungen und Quellen aufgreifende CD-Booklet sowie die Aktualisierung durch historische Aufnahmen (u.a. von Bruno Walter mit den Wiener Philharmonikern aus dem Jahre 1936) aus der privaten Plattensammlung von Thomas Mann. ■
Thomas Mann, Mein Wunschkonzert, Hörverlag, ISBN 978-3-86717-564-7
.
.
Themen-verwandte Links
Thomas Mann: Buddenbrooks – Migrant Thomas Mann
.
.
Georg Schroeter & Marc Breitfelder: «Sugar & Spice»
.
Uriger Blues und Rock ’n’ Roll
Stephan Urban
.
 Dem Vernehmen nach sind Georg Schroeter & Marc Breitfelder aus Kiel seit mehr als 20 Jahren nicht nur in ganz Europa unterwegs, sie sind auch schon in Amerika mit großem Erfolg aufgetreten. Bei der Baltic Blues Challenge 2009 sowie der German Blues Challenge 2009 belegten sie jeweils den ersten Platz, und sie können unter anderem auch auf Auftritte mit Tony Sheridan, Gottfried Böttger oder auch Abi Wallenstein zurückblicken.
Dem Vernehmen nach sind Georg Schroeter & Marc Breitfelder aus Kiel seit mehr als 20 Jahren nicht nur in ganz Europa unterwegs, sie sind auch schon in Amerika mit großem Erfolg aufgetreten. Bei der Baltic Blues Challenge 2009 sowie der German Blues Challenge 2009 belegten sie jeweils den ersten Platz, und sie können unter anderem auch auf Auftritte mit Tony Sheridan, Gottfried Böttger oder auch Abi Wallenstein zurückblicken.
Durch die harte Arbeit an vielen Bühnenauftritten und der nötigen Professionalität wurde der Pianist Georg Schroeter zu einem der bekanntesten Boogie-Woogie- und Blues-Interpreten im deutschen Raum. Er bewegt sich traumhaft sicher durch alle Musikrichtungen, die Spaß machen; sein Spektrum reicht von Jazz und Blues über Rock ’n’ Roll und Country bis hin zum Soul. Selbst wenn er die Stilrichtungen mischt, wirkt das nicht überladen, und der geneigte Hörer muss zu dem Schluss kommen: so gehört sich das, so muss das sein!
Marc Breitfelder wiederum ist ein Meister auf der Mundharmonika; über ihn schrieb die Süddeutsche Zeitung (Zitat): «Ein Ritt durch Tonlandschaften. Nordafrikanische Alpenhornbläser tauchen in einer Oase auf, eine E-Gitarre wummert und er hat auch noch Zeit, zwischendurch mal einen kleinen Schrei ins Mikro zu stoßen. Verzweifelt hält man Ausschau nach dem Orchester. Doch es steht nur einer der weltbesten Mundharmonikaspieler auf der Bühne.»
Beste Voraussetzungen also für die neue Einspielung der beiden Musiker: «Sugar & Spice». Als Gäste musizieren namhafte Musiker wie Albie Donnely, Rene Detroy, Tim Engel, David Herzel, Martin Röttger, Klaas Wendling, Söhnke Liethmann, Jan Mohr, Lars Vegas, Dirk Vollbrecht und Sven Zimmermann. Vokalistische Unterstützung liefern Anna Kaiser, Tom Ripphahn und Abi Wallenstein; produziert wurde großteils von Tom Ripphahn bzw. Georg Schroeter.
Auf den ersten Blick präsentieren uns die beiden trotz wechselnder Begleitband hier urigen Blues und Rock n’ Roll wie aus einem Guss, wobei Fremd- und Eigenkompositionen beinahe ununterscheidbar dargeboten werden. Nur die zwei Kompositionen aus John Fogerty’s Feder (Mastermind/CCR), nämlich «Long as i can see the Light» und die Schlussnummer «Who’ll stop the Rain», passen hier irgendwie nicht dazu. Denn diesen Covers fehlt die freche Lässigkeit der anderen Songs, hier wirken die Musiker, sowohl was die Darbietung als auch das Arrangement betrifft, ein wenig übermotiviert, und so beginnen diese Songs schon stark, können bald vor lauter Kraft nicht mehr gehen… Weniger wäre hier mehr gewesen.
Bei «Sugar & Spice» fehlt mir insgesamt ein wenig die Glaubwürdigkeit, die den Blues von beispielsweise John Lee Hooker oder Tony Joe White so besonders macht. Dies hier ist mit deutscher Perfektion abgekupfert, ein solides, durchaus Spaß machendes und auch zum Beinewippen animierendes Abziehbild der ganz großen Vorbilder.

«Sugar&Spice» ist ehrlicher Blues & Rock n´ Roll, der gute Laune macht, zum Mitwippen verleitet und dabei handwerklich nahezu perfekt präsentiert wird.
Aufgenommen wurde die CD im Label Analoghaus, ich hab da ein wenig geschmökert und festgestellt, dass dieses Studio über gediegenes Equipment verfügt und so ist die Aufnahme auch sehr klar und durchhörbar geworden. Aber auch diesbezüglich fehlt das letzte Quäntchen Glaubwürdigkeit: Der Sound tendiert bei höheren Lautstärken zur Lästigkeit, und richtige Klangfülle mit Saft muss man woanders suchen. Für diese Musik ist das zu hell, zu durchsichtig, es fehlt die klangliche Patina, die zu solchen Aufnahmen einfach dazugehört. Auch aufnahmetechnisch wäre hier aus meiner Sicht mehr drinnen gewesen.
Das Werk ist immerhin sowohl im CD-Format als auch als hochwertiges Vinyl-Doppelalbum (mit CD-Beigabe!) erschienen. Als alter Analog-Fan hätte ich daher gerne letztere Ausgabe zum Rezensieren bekommen, vielleicht klingt das ja entscheidend besser?
Trotzdem: die Protagonisten sind hier «wild ambitioniert» ans Werk gegangen und bieten uns eine sehr gute Scheibe mit hohem Spaßfaktor an. In Schweden sind die beiden ja schon heimliche Stars und erhoffen sich wohl mit diesem Album auch den Durchbruch auf dem heimischen Markt. Ob das gelingt, mag ich dahingestellt lassen, Richtung und Ambition stimmen jedenfalls – und mal ganz ehrlich: Man muss froh sein, dass solche Musik, solche Scheiben überhaupt noch gemacht und veröffentlicht werden! ■
Georg Schroeter / Marc Breitfelder, «Sugar & Spice», Audio-CD, Analoghaus
.
Track-Liste
1. Sugar & Spice (Schroeter, Breitfelder, Ripphahn) 3:22 2. Can't Be Satisfied (Mc Kinley Morganfield) 4:07 3. Palace Of The King (Nix, Russell, Dunn) 3:32 4. Long As I Can See The Light (Fogerty) 3:52 5. Rock'n'Roll Queenie (Schroeter) 4:12 6. Respect Yourself (Schroeter) 4:29 7. I Just Want To Make Love To You (Willie Dixon) 7:00 8. Here And Now (Tom Ripphahn) 4:37 9. Shake Your Boogie (Joseph Lee Williams) 3:32 10. Blue Bird Blues (Sonny Boy Williamson) 8:20 11. Little Piece Of Paper (Schroeter, Ripphahn) 5:45 12. The Rose (McBroom) 5:41 13. Session @ Linnemann's (Schroeter/Breitfelder/Mohr) 2:25 14. Who'll Stop The Rain (Fogerty) 4:00
.
 ___________________________________
___________________________________
Geb. 1958, gelernter Schriftsetzer, seit 1982 in einem Versicherungskonzern in juristischer Funktion tätig, Musikenthusiast, Leseratte und technikbegeistert, vor allem im High-End-Bereich, lebt in Wien
.
.
Zoryana & Olena Kushpler: «Slawische Seelen»
.
Fesselnde Darbietung russischer Liedkunst
Jörn Severidt
.
 Da diese meine Einschätzung einer neuen CD-Produktion des ukrainischen Musik-Schwesternpaares Zoryana und Olena Kushpler schließlich – das sei schon verraten – betont positiv enden wird, sei mir erlaubt, mit ein paar kritischen Anmerkungen zu beginnen. Umso mehr, als ich beim Erhalt dieser CD kaum Lust hatte, auch nur die Plastikfolie aufzureißen – und mich somit fast um den Genuss eines ungewöhnlichen musikalischen Erlebnisses betrogen hätte.
Da diese meine Einschätzung einer neuen CD-Produktion des ukrainischen Musik-Schwesternpaares Zoryana und Olena Kushpler schließlich – das sei schon verraten – betont positiv enden wird, sei mir erlaubt, mit ein paar kritischen Anmerkungen zu beginnen. Umso mehr, als ich beim Erhalt dieser CD kaum Lust hatte, auch nur die Plastikfolie aufzureißen – und mich somit fast um den Genuss eines ungewöhnlichen musikalischen Erlebnisses betrogen hätte.
Woher der anfängliche Widerwille? Nun, an der Oberfläche sprach aus meiner Sicht einfach alles gegen diese CD: Ein sinnloser Titel; ein Layout, das sich an die Kuschelklassik-Kundschaft zu wenden scheint; Lieder mit Klavierbegleitung von vier Komponisten, die mir allesamt nicht als Schöpfer solcher Werke bekannt waren; und das Ganze dann auch noch russisch gesungen – wer braucht das denn?
Doch zum Glück ist mir das österreichische Label Capriccio (mit seiner hier kürzlich besprochenen Wellesz-CD) noch in guter Erinnerung, und so gab ich dieser Veröffentlichung die Chance, die sie, wie sich dann herausstellte, mehr als verdient hat. Denn während ich meine Abneigung gegen die Marketing-Aspekte bis heute nicht überwunden habe, so war ich doch bereits nach dem ersten Hören von dieser Musik begeistert und (beinahe) auch bereit, die im Beiheft aufgestellte Behauptung, die russische Liedtradition sei der deutschen ebenbürtig, zu unterschreiben. Auch durch die Sprache empfand ich keinerlei Minderung des musikalischen Gesamteindrucks, im Gegenteil: sie lässt die inhaltliche Dimension umso glaubwürdiger erscheinen.
Das ist letztlich wenig überraschend, erfreuen sich doch auch Schubert, Wolff und Strauß einer weltweiten Anhängerschaft, die die deutschen Texte kaum verstehen dürften. In diesem Fall liegt außerdem ein äußerst informatives Beiheft vor (dies scheint bei Capriccio die dankenswerte Regel zu sein), das in die Gefühlswelt der einzelnen Komponisten und Lieder einstimmt. Auch die deutschen Übersetzungen der Liedertitel sind hilfreich, ich musste mich in keinem Fall fragen, was hier denn nun wohl kommuniziert werden solle – Musik ist eben eine echte Lingua Franca.
Vertreten sind mit Tschaikowski, Rachmaninow, Rimski-Korsakow und Mussorgski vier hochrangige Komponisten der russischen Romantik, die sicherlich keinerlei Vorstellung mehr bedürfen. Mussorgski ist mit 23 Minuten Spielzeit am stärksten repräsentiert, Tschaikowski wurden 12, den anderen beiden Komponisten jeweils 9 Minuten eingeräumt. Es hätte also mehr auf die CD gepasst, doch möglicherweise wollte man bei Capriccio die sehr hohe Qualität des eingespielten Materials nicht verwässern. Immerhin lässt sich diese Platte von vorn bis hinten durchhören, ohne dass auch nur einen Moment lang Langeweile aufkäme.
Die Darbietung der Interpretinnen, des ukrainischen Schwesternpaares Olena und Zoryana Kushpler, ist vollendet. Olena Kushpler meistert die ans Symphonische grenzenden Stürme Rachmaninows ebenso wie die grazile Feinsinnigkeit Mussorgskis. Sie schafft es, in Fortissimo-Passagen Tiefe und Ausdrucksstärke zu vermitteln, ohne ihre Schwester jemals an die Wand zu spielen. Diese wiederum verfügt über einen üppigen, satten Mezzosopran, der mich gelegentlich (trotz der anderen Stimmlage) an Jessye Norman erinnert. Bei aller Kraft bleibt ihre Stimme immer kontrolliert und klar artikuliert, verzichtet ihrerseits ebenfalls darauf, das Klavier in den Hintergrund zu drängen. Hier wird nicht gegeneinander, sondern miteinander musiziert und dabei echte Liedkunst erreicht.

«Dramatik des stimmlichen Ausdrucks»: Zoryana Kushpler (hier am Wiener Opernball 2010)
Los geht es mit Tschaikowski, dessen sehnsuchtsvoll schwelgende und doch nie aufdringlich dramatische Romanzen (wie sie im Russischen genannt werden) vom ersten Moment an gefangen nehmen. Es fehlen der Hang zum Großen und zu gelegentlicher Härte, die einen Teil der symphonischen und Kammermusik dieses Komponisten kennzeichnen. Tatsächlich erreicht Tschaikowski in den hier ausgewählten Werken eine Einheit von Inhalt und Ausdruck, sowie ein Gleichgewicht von Emotion und musikalischer Kontrolle, die diese Lieder auf das Niveau des schubertschen Oeuvres heben. Beeindruckend!
Bei Rachmaninow, dessen Beiträge im Beiheft mit «Schmerzen» überschrieben sind, wird in Sachen expressiver Dramatik deutlich zugelegt. Wer Strauß‘ «Vier letzte Lieder» liebt (und wer tut das nicht?), wird dahinschmelzen. Hier begeisterte mich das Klavierspiel. Ich musste sofort nachsehen, ob Olena Kushpler nicht vielleicht auch Rachmaninows Werke für Soloklavier eingespielt habe. (Ich hätte sie sofort bestellt, doch leider steht eine solche Aufnahme noch aus).
Die vier Lieder von Rimski-Korsakow unterscheiden sich untereinander recht deutlich, steigern sich vom intim anmutenden Wiegenlied über introvertiert sinnende Sehnsuchtsbezeugungen bis zum opernhaften, stürmischen Sturm-und-Drang-Lied. Bei Letzterem erinnerte mich die reiche, opernhafte Dramatik des stimmlichen Ausdrucks spontan an Gundula Janowitz. Beeindruckend, wie gut Zoryana Kushpler ihren Ausdruck dem Repertoire anpasst und somit die Unterschiede zwischen den Komponisten auch bei äußerlich ähnlichem Repertoire erfahrbar macht.
Mussorgski ist sicherlich einer der ungewöhnlichsten, am schwersten einzuordnenden russischen Komponisten. Von seinen neun hier eingespielten Werken bilden die ersten sieben den Zyklus «Kinderstube». Mit dessen erstem Ton wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Vorbei ist es mit schwelgender Dramatik und volltönigem Innerstes-nach-außen-Stülpen. Mussorgskis inhaltlich alltäglichen Erzählungen, deren Texte er selbst verfasste, werden in einer Art kindlich anmutendem Sprechgesang vorgetragen, der mit seiner spärlichen, wie selbstvergessen mäandernden Klavierbegleitung fast kabarettistische Züge trägt. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich den Komponisten deutlich später eingeordnet, denn eine ähnliche Mischung aus Naivität und Erfindungsreichtum erfordert ein Maß an Selbstreflexion, das der romantischen Periode eigentlich per definitionem abging.

Die neue CD der Musik-Schwestern Zoryana und Olena Kushpler gibt gleichzeitig einen schönen Überblick über die russische Liedtradition, macht Lust auf viel mehr, nimmt den Hörer gefangen und überrascht musikalisch immer von neuem. «Slawische Seelen» sei allen Liederfreunden und Liebhabern russischer Musik ans Herz gelegt.
Da Mussorgski, wie bereits erwähnt, am meisten Spielzeit bekommt, entsteht eine Art Zweiteilung, denn wenn sich auch die Lieder der anderen drei Komponisten bereits deutlich voneinander unterscheiden, so stehen sie im Vergleich zu Mussorgski doch in der gleichen Ecke.
Die Aufnahmequalität bewegt sich auf ebenso hohem Niveau wie die bereits lobend erwähnte Darbietung der Kushpler-Schwestern. Sibilanten (Zischlaute) sind der Fluch des Tonmeisters bei Vokalmusikaufnahmen, und ein Nachklang beim scharfen S hat sich auch hier nicht ganz vermeiden lassen. Wenn man bedenkt, wie reich an Zischlauten die russische Sprache ist, muss die technische Leistung dennoch als überaus gelungen gewürdigt werden.
Eine CD, die gleichzeitig einen Überblick über die russische Liedtradition gibt, Lust auf viel mehr macht, den Hörer gefangen nimmt und immer wieder überrascht. Sie sei Liederfreunden und Liebhabern russischer Musik gleichermaßen ans Herz gelegt. ■
Zoryana Kushpler (Mezzosporan) & Olena Kushpler (Klavier), Slawische Seelen (Slavonic Souls) – Lieder von Tschaikowsky, Rachmaninow, Rimsky-Korssakow und Mussorgsky, Audio-CD, Capriccio Digital
.
Inhalt – Tschaikowsky: Mein Genius; Nur wer die Sehnsucht kennt; Inmitten des Balles op. 38 Nr. 3; Ich öffnete meine Fenster op. 63 Nr. 2; Es war im frühen Frühling op. 38 Nr. 2 / Rachmaninoff: Oh nein; Ich erwarte dich op. 14 Nr. 1; Wie schmerzt es mich op. 21 Nr. 12; Im Schweigen der Nacht op. 4 Nr. 3; Alles nahm er mir weg op. 26 Nr. 2 / Rimsky-Korssakoff: Leise der Abend erlischt op. 4 Nr. 4; Es ist nicht der Hauch des Windes von oben op. 43 Nr. 2; Die Wolken ziehen sich zurück op. 42 Nr. 3 / Mussorgsky: Liederzyklus Die Kinderstube; Wiegenlied des Jerjomuschka; Gopak
.
.
.
Egon Wellesz: Klavierkonzert & Violinkonzert
.
Musikalisches Ringen um Schönheit
Jörn Severidt
.
 Mal ehrlich: Wen überrascht es nicht, zu hören, dass Egon Wellesz (1885-1974) um die Mitte der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts zu den angesehensten und meistgespielten zeitgenössischen Komponisten im deutschsprachigen Raum gehörte? Und doch war dem so, Wellesz war sowohl als Komponist als auch als Musikwissenschaftler anerkannt, unter anderem entschlüsselte er als erster die byzantinische Notenschrift und galt als eine führende Kapazität in Fragen der Barockmusik.
Mal ehrlich: Wen überrascht es nicht, zu hören, dass Egon Wellesz (1885-1974) um die Mitte der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts zu den angesehensten und meistgespielten zeitgenössischen Komponisten im deutschsprachigen Raum gehörte? Und doch war dem so, Wellesz war sowohl als Komponist als auch als Musikwissenschaftler anerkannt, unter anderem entschlüsselte er als erster die byzantinische Notenschrift und galt als eine führende Kapazität in Fragen der Barockmusik.
Dann kam der Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland und der Jude Wellesz wurde über Nacht zu einem polizeilich Gesuchten, dessen als «entartet» eingestuftes Werk von allen Spielplänen gestrichen war. Wellesz ging nach England, wo er seine musikologischen Forschungen an einem eigens für ihn gegründeten Lehrstuhl an der Universität von Oxford fortsetzen durfte und weiter an seinem sowohl umfangreichen wie vielseitigen Oeuvre arbeitete. Nach dem Krieg beeilte man sich um eine Rehabilitierung des verstoßenen Sohnes, es regnete geradezu Auszeichnungen und Ehrbekundungen, doch Aufführungen des musikalischen Werkes blieben die Ausnahme.
Umso erfreulicher ist es da, dass das österreichische Label «Capriccio» nun diese künstlerisch und klanglich sehr gelungene Einspielung des Klavierkonzertes von 1933 und des Violinkonzerts von 1961 vorlegt. Anhand dieser zwei Konzerte, das frühere von gut 20, das spätere von über 30 Minuten Spieldauer, wird die künstlerische Entwicklung und Persönlichkeit des Egon Wellesz nachvollziehbar.
Die CD begann für mich mit einer echten Überraschung, denn von den ersten Tönen an erinnerte mich das Klavierkonzert in seiner unmittelbaren Bildhaftigkeit weder an Spätromantik noch an Moderne, sondern an das vierte Klavierkonzert Beethovens. Wie dieses Werk, beginnt auch Wellesz’ Konzert mit einer lyrischen, introvertiert-mäandernden Solostimme, die mit dem Orchester geradezu zu ringen scheint. Innerhalb weniger Takte identifizierte ich diese Solostimme mit einem Individuum, dem sich eine unwirtliche, von Dissonanz und Widersprüchen geprägte Welt entgegenstellt. Es entsteht das Bild eines vereinzelt umherirrenden Menschen, getrieben von der Suche nach Schönheit, aber auch nach Aussöhnung und Hoffnung. Dies sind die großen Themen Beethovens. Natürlich bricht Wellesz sie im Prisma der Erfahrungen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, sein Individuum erscheint namenlos, heimatlos, ihm fehlen der Idealismus, der machtvolle Glaube an die Möglichkeit einer heilen Welt. Doch der Konflikt an sich, das Ringen um Schönheit, sind gleich.
Dies mag manchem zu bildhaft erscheinen, doch mir drängt es sich auf, dieses Werk als Beschreibung der Lebenssituation des Komponisten zu sehen: Im Jahr 1933, dem Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland also, beginnt Wellesz’ Welt endgültig, zu zerfallen und ihrem Untergang entgegen zu streben.

«Karge, kraftvolle, dissonante, spätromantische, klar strukturierte und artikulierte Tonsprache»: Aus Wellesz’ «Deutschem Lied» (R. Dehmel) für Mittlere Singstimme und Klavier (Universal Edition 1915)
.
Im ersten Satz steigert sich das desorientierte Umherirren des Individuums zu einem fast panischen Ausbruchsversuch, bevor im zweiten Satz Momente der Ruhe einkehren. Das geistige Bild ist das eines Menschen, der eine hektische Großstadt hinter sich gelassen hat und nun auf die freie Flur hinaustritt. Im abschließenden, am deutlichsten spätromantisch anmutenden Satz führt Wellesz Individuum und Umgebung in einer vorwärtsdrängenden Gemeinschaft zusammen, deren innere Spannungen und Widersprüche dennoch bis zum Finale erhalten bleiben.
.
Egon Wellesz: Oktett op. 67 (Kammermusikgruppe Atout)
.
Musikalisch charakterisieren das Werk sowohl barocke, als auch klassische Strukturen im Orchesterteil, in denen auch in dieser Schaffensphase bereits gelegentlich an Mahler und Bruckner erinnernde Klangteppiche ausgebreitet werden. Sie kontrastieren mit der Stimme des Klaviers, in welcher klassischer Ausdruck durch die Brille der schönbergschen Formsprache gesehen erscheint. Zugegeben, Wellesz schafft hier wenig wirklich Neues, doch man muss die geistige Freiheit des Komponisten bewundern, der eklektisch auszuwählen vermag, ohne sich einer Epoche oder einer Stilrichtung völlig zu verschreiben.

Margarete Babinsky
Wer die Violinkonzerte von Schönberg (dessen Schüler Wellesz zwei Jahre lang war) und Berg mag, mit denen es bei seiner Uraufführung zu seinen Gunsten verglichen wurde, der sollte sich das Violinkonzert von Wellesz nicht entgehen lassen. Drei Jahrzehnte nach dem Klavierkonzert entstandenen, ist es durchdrungen vom Geist der so genannten Zweiten Wiener Schule, wenngleich es auch auffällige Unterschiede gibt. Einerseits basieren alle Sätze auf demselben Material, andererseits sind es ihrer vier, Wellesz verleiht seinem Konzert also die formale Struktur einer Symphonie.

David Frühwirth
Wellesz Tonsprache ist gleichzeitig karg und kraftvoll, dissonant und spätromantisch, dabei sowohl klar strukturiert als auch artikuliert. In den ersten drei Sätzen bleibt das Orchester als Ganzes im Hintergrund, aus dem es nur gelegentlich in bedrohlichem, teils militärisch anmutendem Aufbegehren nach vorne drängt und so den Rahmen schafft, in dem sich die Solostimmen bewegen. Solostimmen, denn es sind mehrere, mit denen die erst nach und nach Dominanz erreichende Violine in Dialog tritt. Sie alle umgibt ein Gefühl der Einsamkeit, des Strebens nach etwas Verlorenem. Erst im vierten Satz steuert die Musik einer Katharsis entgegen, wobei die Orchesterpassagen nun an Gustav Mahlers Klangwelt erinnern. Eine lange, intensive Kadenz unterbricht das eruptive Finale, dem die Violine eine Art Nachwort in den höchsten Registern hinzufügt, dessen letzte, schwebende Töne noch lange nachzuklingen scheinen, haarsträubend in ihrer emotionalen Ambivalenz – Wellesz weigert sich bis zuletzt, seine Welt zu vereinfachen oder ihre inneren Konflikte zu lösen.
Die Aufnahme ist von sehr guter Qualität. Beide Solisten überzeugen, vermögen eine spezifische Sprache zu finden, die Wellesz nicht zu weit an seine Vorbilder annähert. Auch in den virtuosesten Passagen der langen Violinkadenz bleibt der musikalische Bezug in jedem Augenblick erhalten. Das Rundfunksinfonie-Orchester Berlin verzichtet dankenswerterweise darauf, Spannung durch extreme Lautstärken zu unterstreichen und verwebt sich unter der offenkundig kompetenten Leitung von Roger Epple mit den Solostimmen.
Eine CD, die Liebhabern der deutschen Spätromantik und der Moderne gleichfalls ans Herz gelegt sei, die jedoch auch diejenigen angenehm überraschen dürfte, denen diese Epochen eher fern liegen. ■
Egon Wellesz, Piano Concerto op. 49 & Violin Concerto op. 84, Margarete Babinsky (Klavier), David Frühwirth (Violine), Berliner Radio Sinfonieorchester (Roger Epple), Capriccio (CAP5027)
.
.
____________________________________
Geb. 1968 in Göttingen/D, Studium der Finnougristik, Skandinavistik und Germanistik in Göttingen, Turku (Finnland) und Hamburg, breite musikalische Interessen und Aktivitäten, verheiratet mit einer Finnin, Vater zweier zweisprachiger Töchter, lebt als Deutsch-Lehrer in Rovaniemi/Finnland
.
.
Alexej Gorlatch (Piano): Chopin, Schumann, Debussy
.
Großes Gespür für Stimmungsdifferenzen
Christian Schütte
.
 Der 1988 in Kiew geborene Pianist Alexej Gorlatch kann bereits auf eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen zurückblicken: 2008 gewann er den Deutschen Musikpreis, der erstmals seit 15 Jahren wieder an einen Pianisten ging; beim AXA Dublin International Piano Competition erreichte er 2009 die höchste Auszeichnung für die Interpretation eines zeitgenössischen Werkes; er gewann die Silbermedaille beim Leeds International Pianoforte Competition und ging als erster Preisträger und Gewinner des Publikumspreises aus dem Anton Rubinstein Wettbewerb in Dresden hervor. Eine stolze Bilanz für einen jungen Pianisten, der für seine erste Solo-CD Werke von Frédéric Chopin, Robert Schumann und Claude Debussy aufgenommen hat.
Der 1988 in Kiew geborene Pianist Alexej Gorlatch kann bereits auf eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen zurückblicken: 2008 gewann er den Deutschen Musikpreis, der erstmals seit 15 Jahren wieder an einen Pianisten ging; beim AXA Dublin International Piano Competition erreichte er 2009 die höchste Auszeichnung für die Interpretation eines zeitgenössischen Werkes; er gewann die Silbermedaille beim Leeds International Pianoforte Competition und ging als erster Preisträger und Gewinner des Publikumspreises aus dem Anton Rubinstein Wettbewerb in Dresden hervor. Eine stolze Bilanz für einen jungen Pianisten, der für seine erste Solo-CD Werke von Frédéric Chopin, Robert Schumann und Claude Debussy aufgenommen hat.
Gerade Chopin und Schumann scheinen sich hier wie von selbst zu verstehen, denn wenn ein debütierender Pianist pünktlich zum Jubiläumsjahr zweier bedeutender Komponisten für sein Instrument eine CD aufnimmt, liegt diese Referenz mehr als nahe.
Alexej Gorlatch beginnt mit Chopin und hat sich für die «Etudes» op. 10 entschieden. Diese Sammlung von zwölf Etüden, veröffentlicht 1833, zählt zu den populärsten Kompositionen Chopins überhaupt, und zu wahren Klassik-Schlagern der Klavierliteratur sind etwa die Etüden Nr. 3 und Nr. 12 geworden.
Alexej Gorlatch spielt insgesamt einen angenehm unaufdringlichen, nicht nur auf äußere Virtuosität setzenden Chopin. Virtuosität kommt in den Etüden, die Chopin als wahrhaftige Bravourstücke geschrieben hat, ohnehin ins Spiel, und Gorlatch zeigt sich den spieltechnischen Anforderungen mit großer Klarheit und Präzision gewachsen. Überhaupt beweist er großes Gespür dafür, sich in die sehr unterschiedlichen Stimmungen der Etüden einzufinden.
Schumanns «Fantasiestücke» op. 12 sind sein erster Klavierzyklus, komponiert 1837. Der Titel ist an E.T.A. Hoffmanns Fantasiestücke in Callots Manier angelehnt, er steht damit auch in unmittelbarer Verbindung zu einem Fantasie-Begriff, wie ihn zu jener Zeit vor allem Novalis prägte. So tragen alle acht Stücke des Zyklus Namen, die ganz dem romantischen Gedankengut entstammen: «Des Abends», «Warum?», «In der Nacht», «Traumes Wirren» etc.
Alexej Gorlatch verwendet für diese Stücke keinen allzu schwelgerischen oder gar sentimentalen Ton, um etwa den Titeln der Stücke gerecht werden zu wollen, vielmehr lässt er einen klaren, durchsichtigen, manchmal gar harten Schumann erklingen. Besonders in den sehr expressiven Stücken wie «Aufschwung», «In der Nacht» oder «Traumes Wirren» verleiht indes gerade diese äußerlich recht «unromantische» Herangehensweise den Stücken besondere Nachhaltigkeit.
Mehr Raum für Süße, Sentiment und Schwelgen in den Klängen nimmt Gorlatch sich in den vier «Préludes» von Claude Debussy («Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir», «Ce qu’a vu le vent d’ouest», «La fille aux cheveux de lin» und «Feux d’artifice»). Zwischen 1903 und 1913 veröffentlichte Debussy zwei Hefte mit jeweils zwölf Präludien für Klavier. «Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir», «Ce qu’a vu le vent d’ouest» «und La fille aux cheveux de lin» stammen aus dem ersten, «Feux d’artifice» aus dem zweiten Heft.
Allein, dass jedes der Stücke einen Titel trägt, der auf einen außermusikalischen Inhalt verweist, zeigt auf, dass Debussy mit seinen Préludes nicht nur eine Sammlung von Klavierstücken veröffentlicht hat, sondern dass jede einzelne Komposition eine Art musikalisches Porträt dessen ist, was durch die Titel assoziiert wird – schließlich ist Debussy einer der entscheidenden Vertreter des musikalischen Impressionismus’.
Alexej Gorlatch legt seinen Debussy mit sehr breitem Ton an, lotet dabei die filigranen harmonischen Strukturen fein aus. Es ist sicher möglich, diese Stücke insgesamt schlanker und unter weniger Verwendung des Pedals zu spielen. Gleichwohl findet Gorlatch zu einer sehr individuellen, entschlossenen Interpretation, die gerade in dieser Qualität noch ein wenig über seine Herangehensweise an Chopin und Schumann hinausgeht. ■
Alexej Gorlatch (Klavier), Chopin: Etüden op.10; Schumann: Fantasiestücke op. 12; Debussy: 4 Préludes, Ram-Classics
.
Hörproben – Alexej Gorlatch auf Youtube
.
.
.
.
Sol Gabetta (Cello): Elgar, Dvorák, Respighi, Vasks
.
Wie aus zwei Güssen
Michael Magercord
.
 Was war zuerst, Film oder Filmmusik? Die Kolumbusfrage der modernen Musikkultur scheint leicht zu beantworten sein: Die Musik. Und wie eine Bestätigung erscheint die neue CD der Cellistin Sol Gabetta mit Einspielungen des Cellokonzertes von Edward Elgar und weiteren kürzeren Stücken des englischen Komponisten sowie Antonín Dvoráks und Ottorino Respighis.
Was war zuerst, Film oder Filmmusik? Die Kolumbusfrage der modernen Musikkultur scheint leicht zu beantworten sein: Die Musik. Und wie eine Bestätigung erscheint die neue CD der Cellistin Sol Gabetta mit Einspielungen des Cellokonzertes von Edward Elgar und weiteren kürzeren Stücken des englischen Komponisten sowie Antonín Dvoráks und Ottorino Respighis.
Es sind durchweg Werke, die sich als neoromantisch bezeichnen lassen, also der hartnäckigen Spätform der himmelhochjauchzenden und zu Tode betrübten Ausdrucksform des 19. Jahrhunderts frönen, und trotzdem bereits zur Musik des 20. Jahrhunderts gerechnet werden.
Einer der großen Exponenten dieser Richtung war Edward Elgar, der auch – und vielleicht nicht ganz zurecht – als der Vater der leichten britischen Musik gesehen wird. Doch gerade sein Cellokonzert, das er direkt im Anschluss an den Ersten Weltkrieg noch unter dem Eindruck des schrecklichen Gemetzels komponierte, ragt aus seinem populärem Werk heraus, und es zeigt, dass Musik des 20. Jahrhundert möglich war, selbst wenn man sich nicht auf die Experimente des 20. Jahrhunderts einliess, die Komponisten wie Strawinsky oder Schönberg seinerzeit vorantrieben.
Die Antriebskräfte dieses Werkes scheinen in der Sehnsucht nach einer besseren Welt und in der Düsternis der bestehenden zu liegen, und der weiche, ja fast seufzende Ton der argentinischen Cellistin Sol Gabetta nimmt diese Stimmung vollends auf. Kein überflüssig virtuoses Spiel überfällt den Hörer, ungetrübt darf der sich der Trübsal ergeben… Man kann dieses Werk durchaus berechtigter Weise auch gebrochener interpretieren, so aber ist es geblieben, was es war: Eine Elegie, ein Klagelied – und es ist zu Musik geworden, die ihre Stimmung schafft und über (oder unter?) den Augenschein des Lebens legt. Filmmusik eben, die auch ohne Film ihre Wirkung entfaltet.
Die auf der CD drei folgenden, vierminütigen Stücke Elgars, von denen zwei dann tatsächlich in Filmen verwendet wurden, sind zwar aus fröhlicheren Tagen des Komponisten, nichts desto trotz ebenso romantisch, wenn auch ein wenig mehr himmelhoch jauchzend denn zu Tode betrübt. Der Auswahl des Briten sind noch zwei ähnliche Stücke der böhmischen Frohnatur Antonín Dvorák sowie ein Adagio des Italieners Ottorino Respighi aus dem Jahr 1924 beigefügt, der sich ebenfalls hartnäckig jeder Neuerung in der Musik widersetzte. Insgesamt unterliegt diese CD einer durchdachten Dramaturgie, die durch nichts gestört wird.
Aber halt, da ist doch noch die zweite CD! Ein – modern gesprochen – Bonustrack mit einem viertelstündigen Cello-Solo des lettischen Komponisten Peteris Vasks, das die Cellistin auch oft als Zugabe auf ihren Konzerten spielt. Es ist ein recht charakteristisches Stück der baltischen Neuen Musik, schroff und doch gleichsam mit dieser typischen nordischen Weite, das von der Cellistin ganz andere Qualiäten abfordert als die Werke der Neoromatik. Kaum vorstellbar, wie es sich in die vorherige CD eingepaßt hätte. Die Plattenfirma hat gut daran getan, nicht zusammengefügt zu haben, was nicht zusammengehört. So nämlich haben wir nicht nur eine CD aus einem Guß, sondern zwei: Eine für die Liebhaber der elegischen Cellomusik, und dazu eine ganz andere, hochmodern und spannend – und Achtung: dies könnte die Filmmusik von morgen sein! ■
Sol Gabetta (Cello), Elgar – Cello Concerto, u.a., Danish National Symphonic Orchestra (Mario Venzano), Sony Music 88697630812
.
Inhalt
CD 1
Edward Elgar
Concerto for Cello and Orchestra – Sospiri – Salut d’amour – La capricieuse
Antonín Dvorák
Waldesruh’ – Rondo für Cello und Orchester
Ottorino Respighi
Adagio con Variazioni
CD 2
Peteris Vasks
Gramata cellam – Cellobuch
 ______________________________________
______________________________________
Michael Magercord
Geb. 1962, früher als Journalist bei der Berliner Tageszeitung taz und als «Stern»-Korrespondent in Peking tätig, verschiedene Buchpublikationen, lebt als Feature-Autor und Reporter des Hörfunks in Prag/Tschechien.
.
.
Alice Sara Ott: Chopin – «Complete Waltzes»
.
Pianistik voller wunderbarer Leichtigkeit
Jan Bechtel
.
 Im Jahre 1810 wird in Polen ein Mann geboren, der bis heute als einer der bedeutendsten und wegweisendsten Pianisten und Komponisten des 19. Jahrhunderts angesehen wird: Frédéric François Chopin (eigentlich: Fryderyk Franciszek Waltyr Chopin; polnisch auch Fryderyk Franciszek Waltyr Szopen).
Im Jahre 1810 wird in Polen ein Mann geboren, der bis heute als einer der bedeutendsten und wegweisendsten Pianisten und Komponisten des 19. Jahrhunderts angesehen wird: Frédéric François Chopin (eigentlich: Fryderyk Franciszek Waltyr Chopin; polnisch auch Fryderyk Franciszek Waltyr Szopen).
Sein Geburtsdatum ist nicht genau belegt, und so weiß man heute nicht mehr, ob Chopin, wie in seiner Taufurkunde vermerkt ist, am 22. Februar 1810 oder erst am 1. März 1810 (wie er es selber angab) geboren wurde. Sein Geburtsort ist Zelazowa-Wola (Herzogtum Warschau); mit sechs Jahren erhält der Junge den ersten Klavierunterricht, da man seine außerordentliche Begabung erkannt hatte. Sein Lehrer wird der böhmische Violinist und Komponist Wojciech Adalbert Zwyny, der den jungen Chopin von 1816 bis 1822 unterrichtet. Ab 1822 (bis 1829) nimmt er am Konservatorium bei Joseph Elsner zusätzlich Unterricht in Musiktheorie.
Schon früh wird er ein Liebling der Salons und reißt die polnischen Aristokraten immer wieder zu Begeisterungstürmen hin. 1831 übersiedelt er dann endgültig von Polen nach Paris (von 1829 und 1831 war er ständig zwischen Warschau, Wien und Paris hin und her gependelt). Auch in Paris wird er schnell zum Liebling des dortigen Publikums in den Salons der Stadt. Der Konzertsaal ist nie wirklich Chopins Terrain gewesen, und er steht jedes Mal vor einem Auftritt «Höllenqualen» aus, weil ihn die «anonyme Menge» des Publikums zutiefst irritiert und ihm «die Luft zum Atmen nahm». In den feinen Salons, in denen nur wenige Betuchte und Aristokraten verkehren, fühlt sich Chopin viel freier und kann seine ganze Virtuosität frei entfalten.
Sein Privatleben ist eigentlich eher ruhig, von Krankheit gezeichnet. Einzig das Verhältnis zu George Sand, einer berühmten französischen Schriftstellerin, bringt ein bisschen «Aufregung» in Chopins Leben. Es ist insgesamt die längste Beziehung, die Chopin zu Lebzeiten eingegangen ist. Warum es zum Bruch zwischen Chopin und Sand kam, ist bis heute nicht ganz geklärt.
Im Verlauf des Jahres 1847 verschlechtert sich Chopins Gesundheitszustand rapide, und 1848 gibt er sein letztes öffentliches Konzert im Hause Pleyel. Am 17. Okotber 1849 stirbt Frédéric Chopin mit nur 39 Jahren in seiner Wohnung am Place Vendôme in Paris. Todesursache ist vermutlich die ihn schon länger quälende Mukoviszidose. Er wird auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris beigesetzt. Sein Herz wird auf eigenen Wunsch nach Warschau gesandt und dort in der Heiligkreuz-Kirche beigesetzt. Heute wird Frédéric Chopin als der polnische Nationalkomponist angesehen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts war Chopin, ähnlich wie Franz Liszt, Vorbild für einige der bedeutendsten Pianisten-Komponisten, unter ihnen etwas Sergej Rachmaninow und Alexander Skrjabin, die Chopin zu einigen ihrer Kompositionen anregte.
Chopin schuf seine Walzer für Klavier in den Jahren zwischen 1827 und 1846/47. Seine «Valses» haben in engerer Bedeutung nichts mit dem Wiener Walzer eines Johann Strauß (Sohn) und anderer Walzer-Komponisten zu tun. Sie sind im besten Sinne Salonmusik (einzig die Walzer op. 70 haben ein wenig von dem typischen «Tanzwalzer»-Charme, wenn auch nur sehr rudimentär). Chopins erster Walzer ist der Walzer As-Dur KK Iva Nr. 13 von 1827 (KK = Krystyna Kobylanska. Thematisches-biographisches Werkverzeichnis). In der Folge schreibt Chopin noch weitere Walzer, unter ihnen die berühmt gewordenen Walzer Es-Dur op.18 (Grande Valse brillante, 1831), Des-Dur op.64 Nr. 1 («Minutenwalzer», 1846/47) und op. post. 69 Nr.1 («Abschiedswalzer», 1835). Die Walzer op.64, die nur einige Jahre vor seinen Tod (1846/47) entstanden, sind der letzte Beitrag Chopins zur Gattung des Walzers für Klavier.
Anlässlich des aktuellen 200-Jahr-Jubiläums Chopins hat die DGG ein Album mit sämtlichen Walzern des Komponisten mit der jungen deutsch-japanischen Pianistin Alice Sara Ott herausgegeben. Alice Sara Ott wird 1988 in München als Tochter eine deutschen Vaters und einer japanischen Mutter geboren. Schon früh entdeckt sie die Liebe zum Klavier und wird bald, zunächst gegen den Willen der Mutter, zur Konzertpianistin ausgebildet. Seitdem hat sie einige Auszeichnungen und Stipendien erhalten. Sie hat einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon Gesellschaft (DG). Die Aufnahme der Walzer Chopins ist ihre zweite für das «Gelblabel», nachdem sie zuvor die «Etudes pour l‘ execution transcendante» von Franz Liszt eingespielt hatte.
Alice Sara Ott ging es, nach eigenem Bekunden, bei der Aufnahme der Walzer nicht darum, eine besonders introvertierte und intellektuelle Einspielung der Werke vorzulegen, sondern den «Duft» der Werke nachzuspüren. Sie sieht in jedem Walzer ein für sich abgeschlossenes Werk und arbeitet dessen «Eigenheiten» akribisch heraus. Dabei gelingt es Ott allerdings, eine wunderbare Leichtigkeit zu erzeugen und die «Stimmung» der einzelnen Stücke sehr schon einzufangen. Es geht ihr, wie man aus jedem Ton hört, nicht um eine eitle Selbstdarstellung. Alice Sara Ott steckt mit ihrer Spielfreude sogar regelrecht an und man könnte die knapp 60 Minuten lange CD immer und immer wieder hören. Sicher kann man jetzt einwenden, dass es schon eine Reihe namhafter Einspielungen dieser Walzer mit etablierten Pianisten gibt, und es mag die Frage laut werden, ob bei einer solch hochkarätigen Auswahl eine Neueinspielung der Werke nötig war. Dazu kann ich persönlich nur sagen: Es ist sicher richtig, dass es viele hervorragende Aufnahmen der Walzer gibt, u. a. von Vladimir Ashkenasy, dessen Gesamteinspielung der Chopin-Werke für Klavier solo ja eine absolute Referenz darstellt. Dennoch bietet Alice Sara Otts Interpretation eine gelungene Alternative zu den etablierten Aufnahmen. Wer Chopin einmal betont jugendlich-frisch und aus einem anderen «Blickwinkel» erleben möchte, der ist bei dieser japanisch-deutschen Künstlerin genau richtig.
Die Tempi sind manchmal vielleicht etwas sehr forsch, aber niemals zu schnell. Otts Spiel ist wunderbar transparent und macht einfach Lust auf mehr. Wenn man ihr zuhört, dann werden die Schwierigkeiten, die diese Musik u. a. interpretatorisch mit sich bringt, in die Bedeutungslosigkeit verbannt. Ihr leichter, perlender Anschlag passt wunderbar zu diesen Walzern. Für mich, der ich selbst auch – wenngleich sozusagen nur für den Hausgebrauch – Pianist bin, ist diese Neueinspielung der Walzer eine absolute Bereicherung und Entdeckung. Ich kann nur jedem Liebhaber von klassischer Musik bzw. Klaviermusik raten, sich diese Aufnahme zuzulegen und sich selbst ein «Bild» zu machen. Sie ist in jedem Fall eine willkommene Ergänzung der etablierten Einspielungen und muss sich hinter diesen keinesfalls verstecken! ■
Alice Sara Ott: Chopin, Complete Waltzes, Deutsche Grammophon Gesellschaft
.
.
.



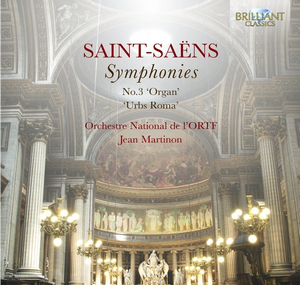

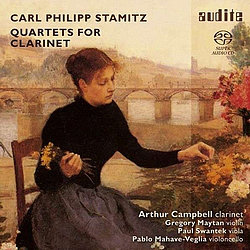 Der Komponist Carl Philipp Stamitz hatte ein Musikerleben geführt, wie es dem romantischen Bild eines Künstlerlebens entsprach. Er selbst war kein Romantiker, dafür lebte er 50 Jahre zu früh. Doch rastlos war er seit seinem 25. Lebensjahr durch die damalige Welt der Musik gehetzt, von Paris bis Dresden, zunächst als Violinen- und Bratschenvirtuose, dann als versierter Komponist von hochmodischer Musik, die an den fürstlichen Höfen angesagt war. Achtzig Symphonien sind so entstanden, eine erhoffte Anstellung aber verschaffte ihm das unermüdliche Werken nicht. Nach zwanzig Jahren Wanderleben heiratete er, ließ sich in Greiz, dem Heimatort seiner Frau nieder, zeugte vier Kinder, die alle früh verstarben, und schließlich starb er 56-jährig 1801 in Jena, verarmt. Drängt sich da nicht langsam ein Vergleich auf mit einem anderen Musiker seiner Zeit?
Der Komponist Carl Philipp Stamitz hatte ein Musikerleben geführt, wie es dem romantischen Bild eines Künstlerlebens entsprach. Er selbst war kein Romantiker, dafür lebte er 50 Jahre zu früh. Doch rastlos war er seit seinem 25. Lebensjahr durch die damalige Welt der Musik gehetzt, von Paris bis Dresden, zunächst als Violinen- und Bratschenvirtuose, dann als versierter Komponist von hochmodischer Musik, die an den fürstlichen Höfen angesagt war. Achtzig Symphonien sind so entstanden, eine erhoffte Anstellung aber verschaffte ihm das unermüdliche Werken nicht. Nach zwanzig Jahren Wanderleben heiratete er, ließ sich in Greiz, dem Heimatort seiner Frau nieder, zeugte vier Kinder, die alle früh verstarben, und schließlich starb er 56-jährig 1801 in Jena, verarmt. Drängt sich da nicht langsam ein Vergleich auf mit einem anderen Musiker seiner Zeit?






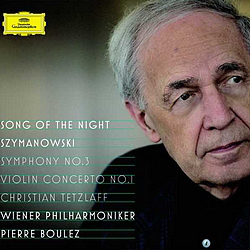



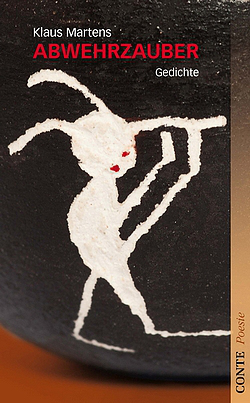
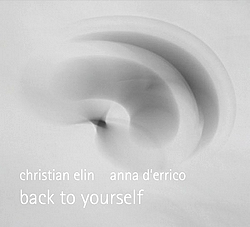








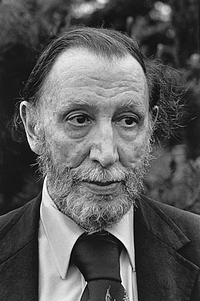
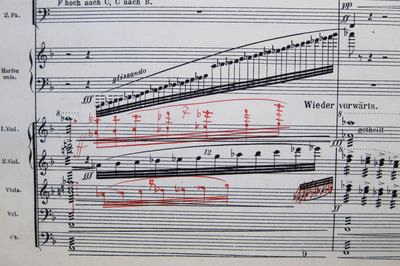














































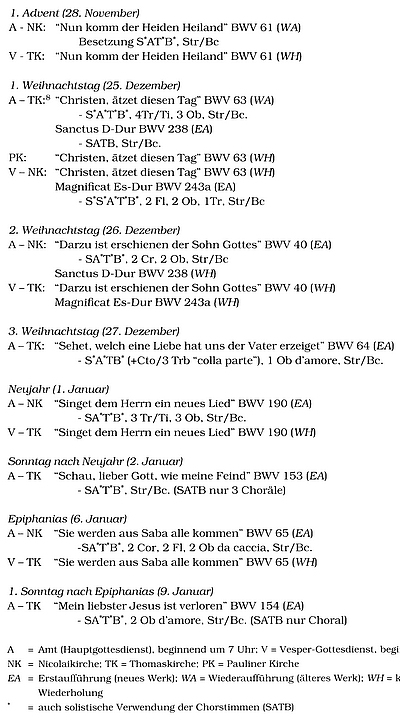
































leave a comment