Christian Linder: Heinrich-Böll-Biographie
.
Vom «Schwirren des heranfliegenden Pfeils»
Dr. Wilma Ruth Albrecht
.
 Christian Linders kürzlich veröffentlichte 617-Seiten-Biografie ist in Anlehnung an eine Metapher von Jean Paul «Das Schwirren des heranfliegenden Pfeiles» betitelt. Neuigkeiten über Heinrich Böll (1917-1985, 1972 Literaturnobelpreis) gibt es nicht. Neu ist allein der Blick, den Biograf Linder auf seinen Biografenden Böll wirft, und apart ist die Form wie sich der Biograf mit seinem Biografenden in Beziehung setzt – versucht Linder doch, wie in der Nachbemerkung ausgeführt, «ein Leben und ein Werk aus sich selbst heraus zu erklären und zu erkunden, wie ich diese Methode mit meinem eigenen Leben verbinden könnte.»
Christian Linders kürzlich veröffentlichte 617-Seiten-Biografie ist in Anlehnung an eine Metapher von Jean Paul «Das Schwirren des heranfliegenden Pfeiles» betitelt. Neuigkeiten über Heinrich Böll (1917-1985, 1972 Literaturnobelpreis) gibt es nicht. Neu ist allein der Blick, den Biograf Linder auf seinen Biografenden Böll wirft, und apart ist die Form wie sich der Biograf mit seinem Biografenden in Beziehung setzt – versucht Linder doch, wie in der Nachbemerkung ausgeführt, «ein Leben und ein Werk aus sich selbst heraus zu erklären und zu erkunden, wie ich diese Methode mit meinem eigenen Leben verbinden könnte.»
Diese mit geckenhafter Attitüde verbundene Doppelimmanenz ist deshalb ein problematischer Ansatz, weil ein Leben nicht «aus sich selbst heraus» erklärt werden kann, dieses sich vielmehr im hermeneutischen Zirkel windet; auch kann ein Werk nicht allein über die Biografie eines Künstlers bzw. Schriftstellers erschlossen werden.
Linder unterlegt seiner Biografie diese existentielle Fragestellung: «Zu fragen ist […] ob sein Werk aufgrund dieser durch die individuelle Besonderheit seiner Person und seiner Herkunft zu erklärenden Erkenntnischancen und Irrtümern unserem Blick aufs Leben und auf den Tod neue Sehweisen hinzufügen konnte; was Böll zum Beispiel unter ´Heimat´ verstand und ob das in seinen Büchern aufscheinende, meistens funzlig, sentimental-heimelig wirkende Dämmerlicht auf den alten Bildern, mit denen im Kopf er durch das Leben gereist ist und die er schreibend aufgestellt hat auf der Suche nach der verlorenen Heimat, für uns wirklich begehbare ´Heimwege´ bedeuten (wohin auch immer); aus welchen Erinnerungen nicht nur seines Gedächtnisses, sondern auch seines Körpers sein Werk überhaupt zusammengebaut ist…»
Diese Leitfragen will der Biograf in drei breit angelegten Kapiteln: «Der Reisende», «Der Staub der Trümmer» und «Das Imperium» beantworten.
Im ersten Kapitel wertet Linder vor allem Bölls «Briefe aus dem Krieg» aus und findet Bekanntes heraus: Böll wurde von Léon Bloys konservativ-mystischem Denken, das sich mit eigenen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg verband, erheblich beeinflußt:
«Seine Kritik an der katholischen Amtskirche wegen ihrer Nähe zu den Reichen und der ´inhumanen Ellenbogenmentalität der Wohlstands-Katholiken´ hat Böll später in seinem Werk weitergeschrieben, in der direkt inspirierten und manchmal wörtlichen Nachfolge Bloys – dieser Einfluss findet sich von den frühen Nachkriegstexten über den Roman Ansichten eines Clowns von 1963 bis zu den letzten Romanen ‘Fürsorgliche Belagerung’ von 1979 und ‘Frauen vor Flusslandschaften’ von 1985.»
Von Bloy übernommen sind auch zentrale Motive und Themen wie Armut, Liebe, Religion und das Verhältnis zur modernen, kapitalistisch bestimmten Zeit.
Im zweiten Kapitel sucht Linder nach Bölls Hauptidentität als Schriftsteller. Er spürt sie vor allem in der eignen Familie, in den Trümmern und im Staub des Jahres 1945 auf. Sie erlaubten es Böll, Gerichtstag über Verursacher dieser Trümmerlandschaft, großes Kapital, Militär, konservative Politiker und autokratische Kirche, zu halten «und dem Verlauf der politischen Geschichte Widerstand» entgegenzusetzen, «indem er sein Leben und das seiner Familie und ihrer Privatmythologien erzählt…»
Nach Wiederaufbau, politischer, sozialer und wirtschaftlichen Restauration und der angeblich vor allem konsumgeprägten ´nivellierten Mittelstandsgesellschaft´ (Helmut Schelsky) des ´rheinischen Kapitalismus´ (Jürgen Becker) der alten Bundesrepublik Deutschland verflüchtigte sich freilich der Anklagegegenstand zunehmend. Das Sujet von Bölls Literatur und das kleinbürgerlich, heimatliche, von Kindheitsmustern geprägte Lebensideal illusionierte sich. Die Erkenntnis der Vergeblichkeit des Tuns führte auch Böll in zunehmende Depression, förderte seine Hinwendung zu kirchlicher Mystik und ließ ihn Trost in deren Sakramenten suchen.
Das dritte Kapitel kreist um die Bedeutung Bölls als «politischer Schriftsteller» und um dessen politisches Engagement. Böll war auch als um interessensbezogen-praktische «Einigkeit der Einzelgänger« (Dieter Lattmann) bemühter Autor kein exponierter politisch-realistischer Schriftsteller, verstand vielmehr sein «Schreiben als Verteidigung und Konservierung von Kindheit und der Stunde der Einfachheit.« Bölls Art des Schreibens rieb sich jedoch an der (bundes-) deutschen gesellschaftlichen Wirklichkeit und wirkte dadurch ebenso politisch wie seine moralischen, im humanen Christentum verankerten Forderungen (in) seiner politischen Publizistik aggressiv erschienen.

Der Schriftsteller als moralische Instanz: Manuskript-Auszug der «Verlorenen Ehre der Katharina Blum»
Linder führt seine assoziativen Gedankengänge so breit wie möglich aus. Er stützt sich auf lange Zitate aus Bölls Briefen und Artikeln, Ausführungen von Theoretikern und Kritikern sowie eitel-gefälligen Bölleinschätzungen durch Leute, mit denen Böll zeitweilig zu tun hatte, etwa dem Münstereifler Deutschlehrer und Autor Heinz Küpper, oder dem Biografen Linder selbst. Den Text überfrachten zu viele Wiederholungen und zu unkritische Einschätzungen; dies besonders am Schluss, wenn sich Linder als Böllspurensucher an Zeitzeugen der verfemten Juden von Drove (Kreuzau) heranmacht.
Im Gegensatz zu Linder kann ich nicht erkennen, dass Bölls Werk fremd daherkommt, sondern sehe eher, dass Böll als Schriftsteller «Grundsatzthemen der Nachkriegszeit» (um eine Biografenformel zu zitieren) aufgegriffen und gestaltet hat. Diese Grundsatzthemen wirken auch heute historisch nach und sind teilweise so aktuell wie etwa (nun freilich ganzdeutsche) Kriegsbeteiligung, Finanz- und Wirtschaftskrise, Arm-Reich-Gegensatz, amtskirchliche und religiöse Gegenaufklärung unterschiedlicher Schattierungen, politische Korruption und moralische Korrumpierung. Insofern könnte es dem nun erweiterten Sozialgebilde Deutschland gut anstehen, gegen die Zeit und ihren Geist schreibende Autoren wie Heinrich Böll – auch als ´moralische´ Instanz – zu haben.
Diese Böll-Biografie ist grottenschlecht geschrieben. Sie ist kaum lesbar. Sie muß auch nicht gelesen werden. ■
Christian Linder: Das Schwirren des heranfliegenden Pfeils – Heinrich Böll – Eine Biographie, Matthes&Seitz Verlag, 616 Seiten, ISBN 978-3-88221-656-1
.
_________________________________
Geb. 1947 in Ludwigshafen/D, Promotion in Sozialwissenschaften, seit 1972 beruflich als Wissenschaftlerin, Stadt- & Regionalplanerin und Lehrerin tätig, 1989-1999 ehrenamtliche Stadtverordnete sowie Fraktions- und Ausschussvorsitzende im Rat der Stadt Bad Münstereifel, zahlreiche fachwissenschaftliche, essayistische und politische Publikationen und Online-Beiträge, lebt in Bad Münstereifel/D
.
.
.
.
.
.
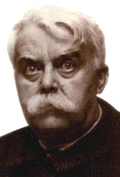







leave a comment