Das Zitat der Woche
.
Die treffenden Aussprüche des Aristoteles
Diogenes Laertios
.
Es werden folgende besonders treffende Aussprüche auf Aristoteles zurückgeführt.
Auf die Frage, was die Lügner für einen Gewinn von ihren Lügen haben, antwortete er: »Daß man ihnen nicht glaubt, auch wenn sie die Wahrheit sagen.« Als man ihm vorwarf, daß er einem Taugenichts ein Almosen gegeben, sagte er: »Mein Mitleid galt nicht seinem Verhalten, sondern dem Menschen.« Oft pflegte er zu seinen Freunden und Schülern, wo auch immer im Tageslicht er verweilte, zu sagen: »Das Gesicht empfängt sein Licht von der umgebenden Luft, die Seele aber das ihre von dem Unterricht.« Oft auch sagte er mit starker Betonung: »Die Athener hätten den Getreidebau und die Gesetze erfunden; allein das Getreide zwar wußten sie zu verwerten, nicht aber die Gesetze.« »Die Wurzeln der Bildung«, sagte er, »sind bitter, ihre Früchte aber sind süß.« Auf die Frage, was schnell veralte, sagte er: »Der Dank.« Gefragt, was die Hoffnung sei, sagte er: »Der Traum eines Wachenden.« Als ihm Diogenes eine getrocknete Feige reichte, sagte er sich, daß, wenn er sie nicht annähme, jener ein beißendes Wort gegen ihn in Bereitschaft hätte, er nahm sie also an mit den Worten, Diogenes sei nicht nur um seine Feige, sondern auch um sein Witzwort gekommen. Und als er ihm wieder eine reichte, nahm er sie, hob sie nach Knabenart hoch in die Luft und gab sie mit den Worten »O großer Himmelssohn« zurück.
Dreierlei, pflegte er zu sagen, ist nötig für die Erziehung und Geistesbildung: Naturanlage, Belehrung, Übung. Als er von einem Verleumder hörte, der ihn verunglimpfte, sagte er: »Wenn ich abwesend bin, mag er mir auch Geißelhiebe verabreichen.« Die Schönheit, pflegte er zu sagen, sei eine bessere Empfehlung als jeder Brief. Andere schreiben das Wort in dieser Fassung dem Diogenes zu, während er selbst die Wohlgestalt für ein Geschenk Gottes erklärt hätte. Sokrates erklärte sie angeblich für eine Gewaltherrschaft (Tyrannis) von kurzer Dauer, Piaton für ein Vorrecht der Natur, Theophrast für einen schweigenden Betrug, Theokrit für einen elfenbeinernen Schaden, Karneades für ein Königtum ohne Leibwächter.Auf die Frage nach dem Unterschied zwischen Gebildeten und Ungebildeten antwortete er: »Er ist so groß wie der zwischen Lebenden und Toten.« Die Bildung, sagte er, sei in glücklichen Zeiten eine Zierde, im Unglück eine Zuflucht. Diejenigen Eltern, die ihren Kindern eine gute Bildung gegeben hätten, seien weit achtungswerter als die, welche sie bloß zeugten: denn die letzteren schenkten ihnen nur das Leben, die ersteren aber den Vorzug, tadellos zu leben.
Zu einem, der sich seiner Abkunft aus einer großen Stadt rühmte, sagte er: »Nicht darauf kommt es an, sondern darauf, daß man eines großen Vaterlandes auch würdig sei.« Die Frage, was ist ein Freund?, beantwortete er mit der Erklärung: »Eine Seele, die in zwei Leibern wohnt.« Die Menschen, sagte er, seien teils so karg, als ob sie ewig leben, teils so verschwenderisch, als ob sie im nächsten Augenblick sterben würden. Als einer ihm die Frage vorlegte: »Wie kommt es, daß wir mit schönen Leuten uns gern recht lange unterhalten?«, entgegnete er: »So kann nur ein Blinder fragen.«
Als ihm einer mit der Frage kam, welcher Gewinn ihm aus der Philosophie erwachsen wäre, sagte er: »Daß ich ohne Befehl tue, was andere nur aus Furcht vor den Gesetzen tun.« Auf die Frage, wie die Schüler sich am besten in ihrem Fortschreiten förderten, antwortete er: »Wenn sie denen, die einen Vorsprung hätten, nacheilten, ohne auf die Rückständigen zu warten.« Einen Schwätzer, der ihn mit seinem Gewäsch überschüttet hatte und fragte: »Ich bin dir doch nicht zur Last gefallen?«, fertigte er mit den Worten ab: »Nicht im mindesten, denn ich habe gar nicht auf dich geachtet.« Auf den Vorwurf, den man ihm machte, daß er einem Unwürdigen eine Unterstützung habe zuteil werden lassen – denn auch in dieser Form tritt die Sache auf -, antwortete er: »Nicht dem Menschen galt meine Gabe, sondern der Menschlichkeit.« Auf die Frage, wie wir uns gegen unsere Freunde zu verhalten haben, erwiderte er: »Gerade so, wie wir wünschen, daß sie sich gegen uns verhalten.« Die Gerechtigkeit erklärte er für diejenige Seelentugend, die einem jeden zuweist, was ihm gebührt.
Als schönste Mitgabe für das Alter erklärte er die Bildung. Favorin berichtet im zweiten Buch seiner Denkwürdigkeiten, er habe immer wieder gesagt: »Viele Freunde, kein Freund«, ein Ausspruch, der sich auch im siebenten Buche der Ethik findet.
Das sind die Denksprüche, die ihm beigelegt werden. ■Aus Diogenes Laertios: Über Aristoteles; in: Ein Panorama europäischen Denkens – Texte aus drei Jahrtausenden (Hrg. L. Marcuse), Diogenes Verlag 1977
.
.
.
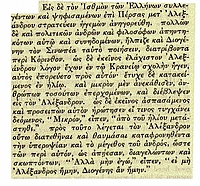





leave a comment