Franz Liszt: «Dante Sinfonie» (Martin Haselböck)
.
Spannender interpretatorischer Zugriff
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
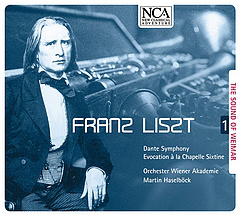 «Unmusik» sei das, meinte Johannes Brahms zu Franz Liszts «Symphonie nach Dantes Divina Commedia», meist kurz «Dante-Sinfonie» genannt. Gerecht war dieses Urteil sicher nicht, da es wahrscheinlich seiner Abneigung gegenüber des Protagonisten der «Neudeutschen» ebenso entsprang wie seiner grundsätzlichen Einschätzung der kompositorischen Fähigkeiten seines Kollegen: «Das Wunderkind, der reisende Virtuose und der Salonmensch haben den Komponisten ruiniert, ehe er recht begonnen hatte.» Es ist indes eine Tatsache, dass die «Dante Symphonie» bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad erreicht hat wie ihre kurz zuvor entstandene Schwester die «Faust-Symphonie», wobei die Gründe hierfür dem Verfasser nicht wirklich klar sind, zeigt das Werk doch mindestens so tiefe Inspiration, brillante Orchestrierungskunst und dramaturgisches Geschick wie das Werk über den «Faust».
«Unmusik» sei das, meinte Johannes Brahms zu Franz Liszts «Symphonie nach Dantes Divina Commedia», meist kurz «Dante-Sinfonie» genannt. Gerecht war dieses Urteil sicher nicht, da es wahrscheinlich seiner Abneigung gegenüber des Protagonisten der «Neudeutschen» ebenso entsprang wie seiner grundsätzlichen Einschätzung der kompositorischen Fähigkeiten seines Kollegen: «Das Wunderkind, der reisende Virtuose und der Salonmensch haben den Komponisten ruiniert, ehe er recht begonnen hatte.» Es ist indes eine Tatsache, dass die «Dante Symphonie» bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad erreicht hat wie ihre kurz zuvor entstandene Schwester die «Faust-Symphonie», wobei die Gründe hierfür dem Verfasser nicht wirklich klar sind, zeigt das Werk doch mindestens so tiefe Inspiration, brillante Orchestrierungskunst und dramaturgisches Geschick wie das Werk über den «Faust».
Liszt hatte sich bereits in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts intensiv mit Dantes «Göttlicher Komödie» beschäftigt. Kurz bevor er 1848 endgültig nach Weimar ging, hatte er bereits erste Ideen zu einer Sinfonie nach Dante notiert. 1849 liegt dann die «Dante-Sonate» vor, die allerdings erst 1861 publiziert wird. 1855 geht Liszt direkt nach Abschluss der «Faust-Symphonie» an die Komposition der «Dante-Symphonie» und schließt diese wohl ein Jahr später ab. Die Uraufführung findet am 7. Oktober 1857 unter Leitung des Komponisten in Dresden statt und fällt durch. Liszt ist sich bewusst, dass er das Werk nicht intensiv genug geprobt hatte und sieht das Positive im Negativen: «Die Dresdner Aufführung war mir notwendig, um darüber zur Objektivität zu gelangen. Solange man nur mit dem toten Papier zu tun hat, verschreibt man sich leicht. Musik verlangt nach Klang und Wiederklang!»
Der ursprüngliche Gedanke Liszts war es, eine dreiteilige Symphonie zu schreiben, wobei jeder Teil einen Abschnitt der «Göttlichen Komödie» Dantes reflektieren sollte. Im Juni 1855 schrieb er an Anton Rubinstein, dass die beiden ersten Sätze «L’Enfer» und «La Purgatoire» rein instrumental gestaltet werden würden, dass im Schlussteil «Le Paradis» dann allerdings noch ein Chor hinzutritt. Ebenso würde eine Windmaschine zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sollten unter Zuhilfenahme der gerade von Daguerre entwickelten Diorama-Technik während der Aufführung Dante-Illustrationen von Bonaventura Genelli in den Aufführungsraum projiziert werden. Doch weder die Windmaschine noch die Projektionen waren in Dresden zu hören bzw. zu sehen. Aber auch die Struktur des Werkes änderte Liszt vor der Uraufführung. Er korrespondiert zur Enstehungszeit auch mit Richard Wagner, dem späteren Widmungsträger des Werkes, über dessen Aufbau. Doch während Wagner keinen Zweifel daran hat, dass Liszt die ersten beiden Teile trefflich gelingen würden, so wies er ihn darauf hin, dass in seinen Augen eine musikalische Schilderung des Paradieses nicht möglich wäre, ja dass schon Dantes Dichtung eben im «Paradies» am schwächsten sei. Als Konsequenz dieser Kritik ließ Liszt die Dreiteiligkeit des Werkes zwar fallen, fügte allerdings in diesem Zuge an das «Purgatorio» noch ein von einem Frauenchor gesungenes «Magnificat» an, dessen ätherischer Gestus zwar auf das Paradies verweist, dieses aber nicht en détail schildert.
Rechtzeitig zum Lisztjahr erscheint nun mit Martin Haselböcks Einspielung der «Dante-Symphonie» eine neue Darstellung dieses Werkes, ein Umstand, der schon einmal zu begrüßen ist, weil überhaupt nur sehr wenige gut Einspielungen vorliegen, wobei hier Giuseppe Sinopolis ausgesprochen individuelle und kompromisslose Interpretation herausragt. Daneben ist hervorzuheben, dass Martin Haselböck und das Orchester Wiener Akademie nicht nur eine weitere Aufnahme zur schmalen Diskographie beisteuern, sondern dass diese Aufnahme auch noch etwas besonderes ist, spielt das Orchester doch ausschließlich auf Originalinstrumenten des 19. Jahrhunderts. Bereits im vergangenen Jahr hat diese Vorgehensweise bei der Neueinspielung der Berlioz’schen «Symphonie fantastique» durch Jos van Immerseel und die Anima Eterna für einiges an Aufsehen gesorgt, weil hier besonders die beiden letzten Sätze durch in bisher nie so gehörte Klänge beeindruckten (wobei der Rest eher ein flaues Gefühl hinterließ). Haselböck und seinem Orchester indes wäre zu wünschen, dass die Aufnahme einen ähnlich Ruck durch die Musikwelt senden könnte, denn von dem insgesamt ganz außergewöhnlich hohen interpretatorischen Niveau der Aufnahme abgesehen, so ist allein der hier dargebotene Liszt-Klang ein wahrlich epiphanisches Erlebnis. Tendiert das moderne Orchester durch die Dominanz der hohen Streicher zu einem geschmeidig-hellen Klang, zu schon fast unumgänglicher Brillanz, so treten diese hier deutlich in den Hintergrund. Es offenbart sich ein eher herb-dunkler Ton und eine – bei Liszts Orchesterwerken nicht immer leicht herzustellende – Durchsichtigkeit der Faktur, die auch den kritischen Liszt-Hörer zu begeistern vermag.
Schon die mottohaften ersten Posaunenrufe des «Inferno», die nach den Worten skandiert werden, die auf Dantes Höllentor eingegraben und entsprechend in der Partitur notiert sind («Per me si va nella ciattà dolente…. – Durch mich hindurch gelangt man zu der Stadt der Schmerzen…»), lassen aufhorchen. Das klingt hart, rauh, düster und ohne jeden Glanz. Ebenso unerbittlich antworten die Hörner mit dem Leitmotiv, dem Liszt den Vers «Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate! – Lasst alle Hoffnungen fahren, ihr, die ihr eintretet!») zuordnet. Dazwischen die trockenen Schläge der Pauken, das Grummeln der Grancassa und des Tamtams, das kratzend von den tiefen Streichern vorgestellte Tritonus-Thema des Satzes – all das macht in dieser Aufnahme schon gruseln und zeigt auf, wie viel Liszt der Instrumentierungskunst eines Berlioz verdankt. Haselböck und seine Mannen stürzen sich mit hörbarer Begeisterung in die dankbare Aufgabe, die Höllenqualen plastisch erfahrbar zu machen, wobei der Liszt-Spezialist Haselböck bei seinem Dirigat stets darauf achtet, dem Lisztschen Diktum zur Kunst des Dirigierens: «Wir sind Steuermänner, keine Ruderknechte» gerecht zu werden. Und so ist die Einspielung durch intensive Nutzung des Rubato gekennzeichnet, von einem organischen Atmen mit der Musik und von einem untrüglichen Gespür für die Umsetzung der dramatisch-bildhaften Dimension des Werkes. Haselböck und sein Orchester Wiener Akademie sind allerdings keine einfallslosen Haudraufs. Auch der lamentohafte Mittelteil des ersten Satzes, der musikalisch von sanften Klängen der Violinen, der Flöten und der Harfen gekennzeichnet ist – er schildert die Begegnung mit den berühmten und zu Höllenqualen verdammten Liebenden Paolo Malatesta und Francesca da Rimini -, gelingt ganz vorzüglich.

Martin Haselböck und das Orchester Wiener Akademie präsentieren einen klanglich und interpretatorisch spannenden Zugriff auf die zu unrecht selten gespielte «Dante-Symphonie», die sich hier als eine der bedeutendsten und interessantesten Orchester-Kompositionen Liszts offenbart.
Im «Purgatorio» dann das Kontrastprogramm zum infernalischen Eingangssatz. Es ist kein Fegefeuer, das uns Liszt hier präsentiert, sondern eher ein kühler, aber hoffnungsvoller Zustand, in dem sich die Seele befindet. Sanft blasende Hörner, Flöten, das Englischhorn und die Harfe geleiten den Hörer über im Piano wogenden Violinen in einen eigentümlich zeitlosen Klangraum, der erst in der Lamento-Fuge des Mittelteils Fahrt aufnimmt und Struktur gewinnt. Das Orchester Wiener Akademie zeigt auch hier, was für ein versiert gestaltender Klangkörper es ist. Von der Brutalität des Vorangegangenen ist nichts mehr spürbar, stattdessen warmer Ton, delikate Gestaltung und eine in jedem Moment luzide Darstellung der Fuge, wobei Haselböck deutlich aufzeigt, wo sich beispielsweise ein Bruckner kompositorisch an Liszt anlehnt (z.B. Ziffer K ff).
Das dem Purgatorium folgende «Magnificat» weist ebenso in die Zukunft. Sicher, wenn die herrlich intonierenden Frauenstimmen des «Chorus Sine Nomine» einsetzen, dann meint man sich zunächst in die Gralswelt eines Richard Wagner versetzt. Beim zweiten Hören indes zeigen sich auch Bezüge zur späteren Sakralmusik Frankreichs. Viel sphärischer kann man das – ohne die Schwelle zum Kitsch zu überschreiten – nicht machen. Haselböcks Entscheidung für den ersten der zwei komponierten Schlüsse ist mehr nachvollziehbar, ist dies sanft entschwebende Ende dramaturgisch doch um ein Vielfaches schlüssiger als der plötzliche Jubelton des zweiten Finales.
Als Dreingabe gibt es noch die «Evocation á la Chapelle Sixtine» aus den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Liszt war mittlerweile nach Rom übergesiedelt und hörte dort in der Sixtinischen Kapelle regelmäßig die Werke Palestrinas. Aus dieser Beschäftigung mit den Alten erwuchs zunächst ein Klavierwerk mit dem Titel «À la Chapelle Sixtine Miserere de Allegri et Ave verum corpus de Mozart», das eine Kombination der beiden genannten Werke darstellt, und das er später für Orchester bearbeitete. Die Koppelung der beiden Werke wirkt einigermaßen überflüssig, doch auch dieses eine Viertelstunde währende Werk präsentieren Haselböck und das Orchester Wiener Akademie ebenso stilsicher wie die «Dante-Symphonie». ▀
Franz Liszt: Dante Sinfonie & Evocation á la Chapelle Sixtine / Martin Haselböck – Orchester Wiener Akademie / New Classical Adventure NCA 2011
.
.
.
.















leave a comment