Thomas O. H. Kaiser: «Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit»
.
Gute Recherche – in schlechte Form gegossen
Bernd Giehl
.
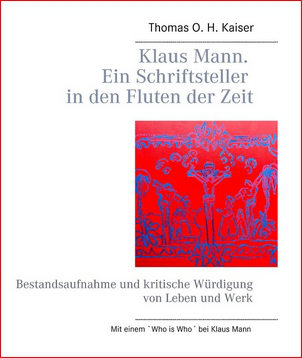 Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.
Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.
Dass Klaus Manns Leben es wert ist, nacherzählt zu werden, zeigt Autor Dr. Thomas O.H. Kaiser auf fast jeder Seite. Geboren als ältester Sohn des berühmten Schriftstellers Thomas Mann – nur seine Schwester Erika war ein Jahr älter – wächst Klaus Mann in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Der Vater darf nicht gestört werden – er ist schließlich ein wichtiger Mann, der ein «Werk» schafft –; die Mutter ist oft leidend und einmal für mehrere Monate in einem Lungensanatorium in der Schweiz.

Originär, schwul, genial: Klaus Mann (1906-1949)
Und so wachsen Klaus Mann und seine fünf Geschwister in der Obhut von allerlei Dienstmädchen auf. Seine Distanz zum Vater ist entsprechend groß; wo Thomas Mann durch und durch bürgerlich ist, gibt Klaus Mann den Bohemien. Wo der Vater versucht, seine Homosexualität zu verbergen, lebt der Sohn sie offen aus. Er wird Schriftsteller wie sein Vater und tritt so in offene Konkurrenz zu einem, der sich selbst in der Nachfolge Goethes sieht und schon mit 54 Jahren den Nobelpreis bekommt. Er will alles vom Leben und legt sich dabei – anders als der Vater – keine Zügel an. In vielem, auch in seiner Drogensucht ist er maßlos. Grenzen existieren nicht für ihn. Das hat er spätestens in dem halben Jahr an der Odenwaldschule ausgetestet, wo er – vom Unterricht freigestellt – tun und lassen konnte, was er wollte (1922/23). Und dann kommen, als Klaus Mann gerade mal 27 Jahre alt ist, die Nazis an die Macht und die haben für einen bekennenden Schwulen und eher links orientierten Schriftsteller, der in seinen Werken tabuisierte Themen wie Homosexualität und Inzest behandelte, natürlich keine besonderen Sympathien, so dass Klaus Mann, ebenso wie sein Vater Thomas und sein Onkel Heinrich Mann – auch dieser ein berühmter Schriftsteller – im Frühjahr 1933 ins Exil geht.
Es ist ein spannendes Leben, das Kaiser sich zum Thema genommen hat. Wie schon gesagt: Es hätte etwas werden können. Nur hätte Thomas Kaiser in dem Fall seinem Hang zur Ausschweifung Zügel anlegen müssen. Natürlich kann man im Vorwort das Interesse an seinem Forschungsgegenstand begründen, nur sollte man dann nicht bei der Suche nach den verschwiegenen Außenstellen der Konzentrationslager in Südniedersachsen, der Heimat des Autors beginnen. Von dort ist es ein weiter Weg bis zum Schriftsteller Klaus Mann. Womöglich wäre das ja nicht der Erwähnung wert, wenn es nicht symptomatisch wäre für dieses Buch. Der Autor findet kein tragendes Prinzip, um seinen Stoff zu gliedern. 800 Fußnoten auf 380 Seiten Text – das ist zumindest ein Indiz, dass hier etwas nicht in Ordnung sein kann. Und wenn man dann noch sieht, dass die Fußnoten um ein Mehrfaches länger sind als der Text, sollte man sich vielleicht doch einmal überlegen, ob hier das Verhältnis noch stimmt.

Es ist schade um den Stoff, den sich Klaus-Mann-Biograph Thomas O.H. Kaiser vorgenommen hat. Denn Autor Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält.
Diese Fußnoten haben etwas Eigenartiges. Manchmal sind es Nebengedanken, die dem Autor ebenfalls noch wichtig sind (wie das auch sonst bei Fußnoten oft der Fall ist), oft jedoch fächern sie einen Gedanken des Haupttextes noch einmal auf. Man fragt sich dann, warum der Autor ihren Inhalt nicht einfach in den Haupttext übernommen hat. Manches hätte er sich auch einfach sparen können, so z.B. die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Nazis, die er erwähnt, die aber keine besondere Rolle im Leben von Klaus Mann spielen, anderes dagegen ist für das Verständnis der Hauptpersonen wichtig. Und so macht er es dem Leser schwer, der keine allzu große Lust hat, einen halben Satz des Haupttextes zu lesen, dann zur Fußnote zu springen, dann wieder einen Halbsatz zu lesen, ehe er sich mit der nächsten Fußnote auseinandersetzen muss. Auf diese Weise vergrault man auch gutwillige Leser.
Es ist schade um diesen Stoff. Thomas O. H. Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält. ■
Thomas O. H. Kaiser: Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit, 500 Seiten, Books on Demand, ISBN 978-3738611410
.
.
Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Das September-Streichholzrätsel im «Glarean Magazin»
.
Legen Sie zwei Streichhölzer so um, dass der Hirsch
nicht nach links, sondern nach rechts schaut
.
Lösung: —>(more…)
.
.
Weitere Streichholz-Rätsel im Glarean Magazin
.
.
.
.
Tomas Liska: «Bercheros Odyssee» / Jaromir Honzak: «Uncertainty» (CD’s)
.
Auf Linie gebracht –
2 neue Alben von Bassisten als Bandleader
Michael Magercord
.
 Ein Komponist für Filmmusik, der seine Wurzeln im Jazz verortet, gestand mir einmal, dass er, wenn er partout keinen Einfall für eine Melodie-Linie bekomme, zunächst entsprechend der filmischen Vorgaben eine Bass-Linie einspielt, auf der sich dann alles weitere finden lässt.
Ein Komponist für Filmmusik, der seine Wurzeln im Jazz verortet, gestand mir einmal, dass er, wenn er partout keinen Einfall für eine Melodie-Linie bekomme, zunächst entsprechend der filmischen Vorgaben eine Bass-Linie einspielt, auf der sich dann alles weitere finden lässt.
Musik, die bewegten Bildern unterlegt wird, folgt einer zuvor festgelegten Dramaturgie. Und ein wenig wirken die beiden vorliegenden Alben, in denen die Bassisten jeweils den Ton angeben, auch wie Filmmusik. Obwohl es keine Platten mit Filmmusik sind, sondern eher das, was man einmal «Konzeptalben» nannte: eine dreiviertel Stunde zusammenhängende Klanggebilde – das kann entweder großartig werden oder ganz besonders repetitiv enden.
Mit Tomas Liska und Jaromir Honzak, haben sich zwei versierte Jazz-Bassisten und ihre jeweiligen Formationen in ihren neuen Einspielungen – beide bei Supraphon – auf genau diese Gratwanderung begeben. «Bercheros Odyssee» nennt Tomas Liska, der jüngere von beiden, seine Komposition, die der Absolvent des Berliner Jazz-Instituts zusammen mit seinen Kommilitonen Fabiana Striffler (Geige), Simon Marek (Cello), Markus Ehrlich (Klarinette) und Natalie Hausmann (Tenorsaxophon) unter dem Bandnamen Pente eingespielt hat. Das Album folgt ganz und gar der Konzeptidee. Die sechs einzelnen Passagen heißen auch konsequenterweise «Parts», die ein zusammenhängendes Ganzes bilden sollen.
Liska war zuvor eher in der Weltmusik und im Bluegrass unterwegs. Mit dem Studium begann wohl die Reise durch philosophische und ästhetische Tiefen seines Faches. Seine CD gewordene Odyssey mit einem Titel, der aus den Namen seines Studienortes und dem des Indianerstammes der Cherokee zusammengesetzt wurde, kommt zunächst etwas intellektuell und ernst daher, verliert sich ab und zu im Free Jazz, um dann doch immer wieder kürzere Aufenthalte an bekannten Orten einzulegen: wenn nämlich die Geige oder das Cello folkloristisch ertönen, die Klarinette einen Gospel andeutet oder uns das Saxophon auf dem Balkan Station machen lässt – und trotzdem findet es zu einer lyrischen, unprätentiösen Einheit.
 Etwas traditioneller erscheint aufs erste Hören das Album des versierten Altjazzers Jaromir Honzak zu sein. Auch er hatte einst studiert, nur liegt das schon bald 30 Jahre zurück. Zehn Jahre zuvor hatte er seinen Militärdienst in einer Armeeband in Prag absolviert, und danach begann seine Laufbahn in der Jazzszene der Stadt. Sein Studienort war dann Boston. Nach dem USA-Aufenthalt begann seine internationale Karriere als Bassist, Bandleader – und Komponist.
Etwas traditioneller erscheint aufs erste Hören das Album des versierten Altjazzers Jaromir Honzak zu sein. Auch er hatte einst studiert, nur liegt das schon bald 30 Jahre zurück. Zehn Jahre zuvor hatte er seinen Militärdienst in einer Armeeband in Prag absolviert, und danach begann seine Laufbahn in der Jazzszene der Stadt. Sein Studienort war dann Boston. Nach dem USA-Aufenthalt begann seine internationale Karriere als Bassist, Bandleader – und Komponist.
«Uncertainty» heißt die Zusammenstellung von acht eigenen Titeln, die er mit den wesentlich jüngeren E-Gitarristen David Doruzka, Pianisten Vit Kristan, dem französischen Saxophonisten Antonin-Tri Hoang und schwedischen Schlagzeuger Jon Fält eingespielt hat. Jedes Stück steht für sich, hat eine andere instrumentale Zusammensetzung. Und ist das erste Stück mit dem deklamatorischen Titel «Smell of change» noch flotter E-Gitarren-Jazz, so ist im zweiten der Wandel da und im dritten schließlich vollzogen: hin zu einer meditativen und lyrischen Dichte, die sich weitgehend der Instrumenten-Akrobatik enthält, und die man durchaus als Ausflug in die «Ungewissheit» erleben kann.

In ihren jüngsten Aufnahmen folgen Altjazzer Jaromir Honzak («Uncertainty») und Neujazzer Tomas Liska («Bercheros Odyssey») weiterhin den Vorgaben der Bass-Linien. Dass diese Wahrung einer guten Musik-Tradition dem Treiben der doch so freiheitsliebenden Improvisations-Musiker erst die Form gibt, in der sich dann ihre sprühenden Ideen oder – im Gegenteil – ihre Hingabe in tiefe Gefühlswelten ergießen können, beweisen einmal mehr diese beiden lyrischen, ja meditativen Alben.
Beide Alben haben – bei allen Unterschieden – schließlich doch eines gemeinsam: Es sind ihre klaren bass-lines, die ihre musikalische Fantasien auf Linie halten. Sie erst machen aus der Gratwanderung zwischen Klängen und Atmosphären, aus den Stückchen und den Teilen ein zusammenhängendes Ganzes. Vielleicht ist dies ja auch das höchste an der hohen Kunst des Bass-Spiels. Und sollte den beiden Bassisten darum gegangen sein: mission accompli. ■
Tomas Liska & Pente: Bercheros-Odyssey, Audio-CD, Supraphon
Jaromir Honzak & Band: Uncertainty, Audio-CD, Supraphon
.
.
.
.
Das klassische Glarean-Tangram (51)
.
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.

Lösung: —>(weiterlesen…)
.
__________________________________
.
Das Tangram-Puzzle
 Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Schon in der uralten Kultur Chinas bedeutete das Quadrat die reinste Form einer Fläche, in sich vollkommen, und beim Tangram wird dieses in sich ruhende Quadrat nun aufgelöst in eine endlose Bewegung, wird es durch unablässige Veränderung zum Ausgangspunkt ungeahnter Gebilde, durch das Zusammenspiel seiner festen Elemente zum Quell des Neuen.
Die ersten Tangram-Bücher wurden zur Zeit des Ch’ing-Kaisers Chia Ch’ing (1796-1820) gedruckt, die früheste uns überlieferte Tangram-Publikation dort stammt aus dem Jahre 1813, doch das Grundprinzip des Spiels dürfte im asiatischen Raum schon lange vor Christi Geburt weit verbreitet gewesen sein. Eine frühe erste Veröffentlichung in Europa datiert aus dem Jahre 1805.
Inzwischen hat das Tangram einen wahren Siegeszug durch alle Kontinente angetreten, ist Gegenstand zahlreicher Bücher und Sammlungen geworden – und lädt unvermindert anregend und spannend ein zum Nachdenken, zum Knobeln, zum Sinnieren, ja vielleicht gar zum Philosophieren über die ewige Veränderung des ewig Gleichen…
Im «Glarean Magazin» finden sich regelmäßig interessante und berühmte Tangram-Aufgaben. Dabei wird das Lege-Puzzle erleichtert, wenn man sich aus Karton die sieben Grundelemente zurechtschneidet.
Sollten unter unseren Leserinnen und Lesern vielleicht sogar Tangram-«Erfinder» sein, so sind sie freundlich eingeladen, uns ihre neuen Figuren als Grafik-Datei zu senden! (we)
.
Ein Beispiel
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
.
.
111 Chess Tacticals (47)
.
Schwarz am Zuge gewinnt
 Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■
Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■
.
.
.
.
.
Arthur van de Oudeweetering: «Mustererkennung im Mittelspiel» (Schach)
.
Hervorragende Verdeutlichung
strategischer Zusammenhänge
Thomas Binder
.
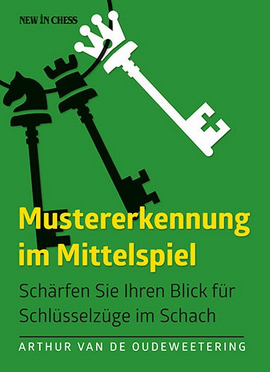 Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!
Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!
Erfahrene Trainer werden die These bestätigen, dass Erfolg im Schachspiel zu einem großen Teil an das Erkennen typischer Stellungsmuster und das Umsetzen der passenden Manöver gebunden ist. Sind diese Aspekte bei rein taktischen Stellungen sowie im Endspiel seit langem gut erforscht und auch trainingsmethodisch aufgearbeitet, halten komplexe Stellungen mit vorwiegend strategischem Gehalt noch viel Arbeit bereit. In letzter Zeit sind hierzu einige wichtige Bücher erschienen, so Bronzniks «Techniken des Positionsspiels im Schach» und Nunns «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach». Einen etwas anderen Zugang – über die Bauernstrukturen – wählt Flores Rios in «Chess Structures». Das vorliegende Buch ergänzt und bereichert diese Palette wesentlich.
Oudeweetering hat sein Buch in 4 größere Abschnitte mit insgesamt 40 Kapiteln gegliedert. Jedes einzelne bespricht eine typische Stellungskonstellation ausführlich in allen Aspekten.
Im 1. Teil geht es um «Figuren auf typischen Posten». Da kommen alte Bekannte vor, wie Springer auf f5 oder d6 (im Buch «Der Riesenkrake» genannt), Läufer auf langen Diagonalen oder eingesperrt auf h2, wie seinerzeit bei Spasski gegen Fischer.
Der 2. Teil widmet sich «kontraintuitiven Zügen». Dabei erliegt der Autor nicht der Versuchung, spektakuläre Wendungen vorzuführen, sondern bleibt auch hier seriös – fast wissenschaftlich. So lernen wir, unter welchen Umständen z.B. überraschende Rückzüge, Doppelbauern oder Bauernschläge «zum Rand» ihre Stärke ausspielen können.
Teil 3 ist typischen Opferwendungen gewidmet – aber eben nicht jenen, die man aus Taktikbüchern kennt und an deren Ende ein Matt oder Materialgewinn stehen. Hier geht es um positionelle Opfer mit Langfristwirkung. Aus dieser Materie die Gesetzmäßigkeiten heraus zu arbeiten und verständlich zu analysieren, ist für ihren Rezensenten die größte Stärke des ganzen Buches gewesen. Als Beispiel sei der Bauern-Vorstoß e5-e6 genannt. Mit dem Bauernopfer und dem verbleibenden Doppelbauern teilt Weiß die gegnerischen Kräfte in zwei Hälften, zwischen denen zumindest kurzfristig keine Koordination besteht.
Der 4. Teil schließlich betrachtet kurzzügige Manöver mit strategischem Gehalt, die zum Teil so konzentriert auch noch nicht vorgestellt wurden, etwa die Turmverdoppelung auf dem Umweg über die 2. Reihe.

Der internationale Meister und Schach-Autor Arthur van de Oudeweetering (*1966)
Jedes einzelne Kapitel beginnt mit einem ganz kurzen Einführungstext und endet mit einer ebenso knappen Zusammenfassung. In diesem Rahmen folgen dann pro Kapitel 6 bis 7 sorgfältig ausgewählte Partien. Der niederländische IM konzentriert sich dezidiert auf das jeweils besprochene Thema. Die Eröffnung wird entweder ganz ausgelassen oder unkommentiert wiedergegeben – was auf das gleiche hinausläuft, denn ein Diagramm ermöglicht in jedem Fall den Einstieg an der passenden Stelle. So konsequent ist der Autor auch am anderen Ende der Partie: Mündet das betreffende Motiv nicht direkt in den Partieschluss, wird der weitere Verlauf nur noch in Worten angedeutet.
Der relevante Ausschnitt hingegen wird in kurzen, gut gefassten Anmerkungen treffend erläutert. Abweichende Varianten sind auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt. Die Kommentare fokussieren sehr gut auf das konkret besprochene Thema. Sie sind zudem angenehm lesbar – vermutlich gleichermaßen das Verdienst des Autors und des Übersetzers Harald Keilhack.
Schachliche Schwächen sind aus Sicht des Rezensenten nicht auszumachen. Die inhaltliche und didaktische Aufbereitung setzen Maßstäbe. Ich sehe nur wenige Verbesserungsansätze: Die Kapitelüberschriften könnten manchmal etwas weniger blumig formuliert sein. Sie machen zwar neugierig, helfen aber nicht bei der Orientierung. Außerdem wäre ein zusätzlicher Mehrwert zu erreichen, wenn man die schon im Titel angesprochenen Muster auch optisch auf den Diagrammen hervorhebt. Dieses Element – heute in der computergestützten Schachpräsentation eine Selbstverständlichkeit – ist in der gedruckten Schachliteratur noch nicht so recht angekommen. Generell kämpft ja gerade bei solch komplexen Themen das Schachbuch einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen moderne Trainingsmittel und interaktive Medien. Bücher wie dieses zeigen, wie schade es wäre, wenn dieser Kampf auf Dauer verloren ginge.

Arthur van de Oudeweetering legt mit «Mustererkennung im Mittelspiel» ein vorzügliches Buch zu einem komplizierten Thema vor. Es gelingt ihm, dem Leser das Erkennen und Bewerten typischer Mittelspielstellungen nahe zu bringen. Neben fortgeschrittenen Schachspielern dürften vor allem Schachtrainer sehr von dieser Arbeit profitieren.
Fragen wir uns schließlich nach der Zielgruppe, die van de Oudeweetering mit seinem Buch erreicht. Mir fallen zuerst Schachtrainer ein. Sie finden hervorragende Ideen zur Verdeutlichung strategischer Zusammenhänge und zum Schulen des Blickes für typische Stellungsmuster – und das mit überlegt zusammengestellten Beispielpartien.
Wer als Spieler von diesem Werk profitieren möchte, wird sich auf eine anstrengende Arbeit einlassen müssen. Es geht eben nicht ohne konzentriertes Durcharbeiten der einzelnen Beispiele. Immerhin erleichtert die Aufteilung in übersichtliche Kapitel auch dieses Unterfangen. Freilich setzt das selbständige Arbeiten mit dem Buch ein schachliches Grundniveau voraus, das ich nicht unter einer Elo-Spielstärke von 1800 ansetzen würde – aufstrebende Jugendspieler einmal ausgenommen, denen «Mustererkennung im Mittelspiel» hiermit ausdrücklich empfohlen sei. ■
Arthur van de Oudeweetering: Mustererkennung im Mittelspiel – Schärfen Sie Ihren Blick für Schlüsselzüge im Schach, 300 Seiten, New in Chess, ISBN 978-90-5691-615-2
.
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Der neue Sudoku-Spass im «Glarean»
.
Die Sudoku-Rätsel-Puzzles im Juli 2015
.
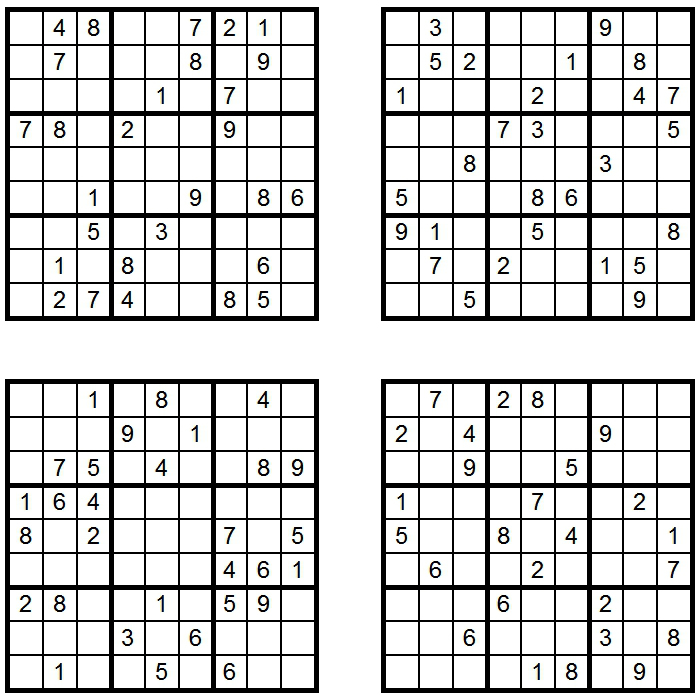
.Copyright 2015 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin
.
Sudoku – die Regeln
Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in
3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.
Jede Zeile, jede Spalte und jeder Block soll alle
Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten.
In ein paar der Felder sind bereits Zahlen vorgegeben.
Bei einem Sudoku darf es nur eine mögliche Lösung geben,
und diese muss rein logisch gefunden werden können.
.
Auflösung —> (more…)
.
.
Das neue Musik-Kreuzworträtsel im Juni 2015
.
Der Buchstaben-Musik-Rätselspaß !

.
Copyright© 2015/6 by Walter Eigenmann
Rätsel ausdrucken (pdf)
Lösung: —>weiterlesen
.
.
.
111 Chess Tacticals (46)
.
Weiß am Zuge gewinnt
 Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■
Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■
.
.
.
.
.
Der neue Sudoku-Spass im «Glarean»
.
Die Sudoku-Rätsel-Puzzles im April 2015
.
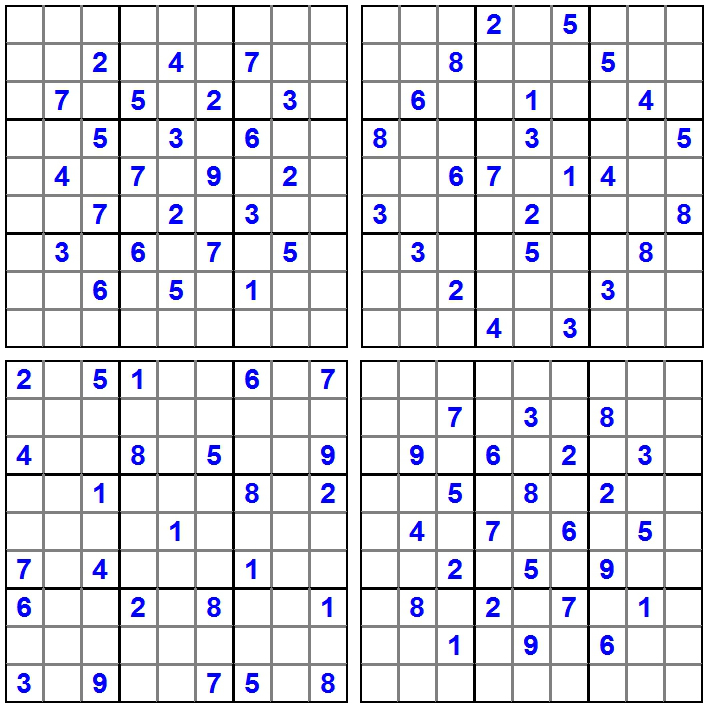
.Copyright 2015 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin
.
Sudoku – die Regeln
Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in
3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.
Jede Zeile, jede Spalte und jeder Block soll alle
Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten.
In ein paar der Felder sind bereits Zahlen vorgegeben.
Bei einem Sudoku darf es nur eine mögliche Lösung geben,
und diese muss rein logisch gefunden werden können.
.
Auflösung —> (more…)
.
.
Das klassische Glarean-Tangram (50)
.
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
Lösung: —>(weiterlesen…)
.
__________________________________
.
Das Tangram-Puzzle
 Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Schon in der uralten Kultur Chinas bedeutete das Quadrat die reinste Form einer Fläche, in sich vollkommen, und beim Tangram wird dieses in sich ruhende Quadrat nun aufgelöst in eine endlose Bewegung, wird es durch unablässige Veränderung zum Ausgangspunkt ungeahnter Gebilde, durch das Zusammenspiel seiner festen Elemente zum Quell des Neuen.
Die ersten Tangram-Bücher wurden zur Zeit des Ch’ing-Kaisers Chia Ch’ing (1796-1820) gedruckt, die früheste uns überlieferte Tangram-Publikation dort stammt aus dem Jahre 1813, doch das Grundprinzip des Spiels dürfte im asiatischen Raum schon lange vor Christi Geburt weit verbreitet gewesen sein. Eine frühe erste Veröffentlichung in Europa datiert aus dem Jahre 1805.
Inzwischen hat das Tangram einen wahren Siegeszug durch alle Kontinente angetreten, ist Gegenstand zahlreicher Bücher und Sammlungen geworden – und lädt unvermindert anregend und spannend ein zum Nachdenken, zum Knobeln, zum Sinnieren, ja vielleicht gar zum Philosophieren über die ewige Veränderung des ewig Gleichen…
Im «Glarean Magazin» finden sich regelmäßig interessante und berühmte Tangram-Aufgaben. Dabei wird das Lege-Puzzle erleichtert, wenn man sich aus Karton die sieben Grundelemente zurechtschneidet.
Sollten unter unseren Leserinnen und Lesern vielleicht sogar Tangram-«Erfinder» sein, so sind sie freundlich eingeladen, uns ihre neuen Figuren als Grafik-Datei zu senden! (we)
.
Ein Beispiel
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
.
.
Frank Schuster: «Das Haus hinter dem Spiegel» (Roman)
.
Ein Schach-Roman für Carroll-Liebhaber
Sabine & Mario Ziegler
.
 Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)
Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)
Der Klappentext verspricht einen «fantastischen Roman für Jung und Alt», und die ersten Kapitel lassen an ein Jugendbuch denken: Kurze, überschaubare Kapitel, die Handlung entführt den Leser in die Welt der beiden zehnjährigen Schwestern Lorina und Eliza. Zum Leitmotiv der Geschichte wird eine Schachfigur aus dem Spiel des Vaters. Diese Figur, eine schwarze Dame, wird von einer Elster entwendet. Was zunächst lediglich wie ein kleines Missgeschick anmutet, wegen dem der Vater seine angefangene Fernschachpartie mit einem Freund nicht wird fortsetzen können, entpuppt sich bald als viel größeres Problem: Es existiert eine parallele Welt «hinter dem Spiegel», in der Elizas «Zwilling» Alice mit ihrer Familie lebt. Aus einem nicht näher bezeichneten Grund vertauschen Alice und Eliza ihre Plätze in der jeweils anderen Welt. Als Medium dieser Verwandlung dient ein großer Spiegel, den die Familie vor Jahren in England erstanden hatte, und der aus dem Viktorianischen Zeitalter stammt – just aus der Zeit, in der Carroll den Roman von «Alice hinter den Spiegeln» verfasste. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfährt der Leser nach und nach immer mehr Details der unglaublichen Verwandlung von Eliza zu Alice. Für die Rückverwandlung am Ende ist – ähnlich wie bei Carroll – das Schachspiel von großer Bedeutung, das aber erst wieder in seinen Originalzustand zurückversetzt werden muss. Hier kommen der im gleichen Haus wie die Kinder wohnende Erfinder Herr Ritter, der Lehrer Herr Hundsen und der Psychologe Herr König ins Spiel. Nach vielen Schwierigkeiten gelingt es, eine Ersatzfigur für die schwarze Dame herzustellen, schließlich taucht auch das Original wieder auf, und zum guten Schluss kann die Rückverwandlung durchgeführt werden.
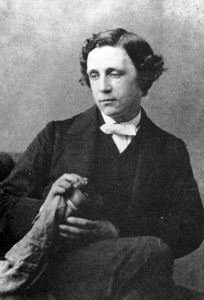
Lewis Carroll (Fotografie von 1863)
Zu diesem Zeitpunkt hat der Roman jedoch schon lange den Charakter eines Kinderbuchs verloren. Nicht nur werden die Kapitel zunehmend länger, auch die Wortwahl verändert sich. Wird zu Beginn auf Augenhöhe der Kinder berichtet, was etwa im Belauschen der Eltern (Kapitel 4) zum Ausdruck kommt, treten im Laufe der Erzählung zunehmend Wortspiele auf, die an die literarische Gattung des Nonsens erinnern, für den Carroll berühmt war. Das zentrale Kapitel ist das achte, in dem Eliza zur Verblüffung ihrer Mitschüler in Spiegelschrift folgendes Gedicht schreibt:
Verdaustig war’s, und glasse Wieben
rotterten gorkicht im Gemank.
Gar elump war der Pluckerwank,
und die gabben Schweisel frieben.
Es handelt sich hierbei um die erste Strophe des Gedichts «Der Zipferlake» («Jabberwocky») aus der Feder von Lewis Carroll, wie dem Vertretungslehrer Hundsen sofort klar ist. Frank Schuberts «Das Haus hinter den Spiegeln» ist voll von solchen Anspielungen: Der Goggelmoggel (im Original Humpty Dumpty) wird ebenso bemüht wie der Hutmacher aus Alice im Wunderland (in Gestalt der Deutschlehrerin «Frau Hutmacher» oder der weiße Ritter (in Gestalt des rettend eingreifenden Erfinders Herr Ritter). Neben solchen textimmanenten Andeutungen wird auf die historische Figur Carroll selbst verwiesen: Nicht zufällig ist «Karl-Ludwig Hundsen» die exakte Übersetzung seines bürgerlichen Namens Charles Lutwidge Dodgson (dieser Bezug wird auf S. 70 ausdrücklich hergestellt). Die Hinweise erschließen sich natürlich nur demjenigen, der Carrolls Biographie und seine Werke kennt. Für alle anderen bleibt vieles unverständlich und sogar verwirrend, etwa wenn in Kapitel 15 seitenlang Nonsenspoesie zitiert wird, die die Geschichte nicht voranbringt. Skurril wirkt, wenn Eliza als Gutenachtgeschichte eine weitere Nonsensballade aus der Feder von Carroll, «Die Jagd auf den Snark», vorgelesen wird.
Bisweilen verschwimmen die Ebenen: Eliza, das Ebenbild der Carroll’schen Alice, liest selbst Carrolls Roman (S. 79) – im Grunde also ihre eigene Geschichte.
Wie in der literarischen Vorlage so begegnen auch in Schusters Roman zahlreiche Schachbezüge, besonders in den letzten Kapiteln. Hierbei greift der Autor eine Stellung auf, die Carroll selbst zur Grundlage der Handlung in «Alice hinter den Spiegeln» machte. Folgendes Diagramm findet sich in der Ausgabe von «Through the Looking-Glass» aus dem Jahre 1871:

Dem Leser des Romans leuchten die Bezüge zu den Abenteuern der Alice sofort ein, wozu auch die Farbe «Rot» (statt «Schwarz») für den Nachziehenden passt; hier wird das Motiv der «roten Königin» wiederaufgegriffen, das sich bereits in «Alice im Wunderland» findet. Verwirrend ist allerdings – gerade für schachspielende Leser – dass diese Position aus der Fernpartie des Vaters stammen soll. Dies wird bereits auf S. 7 verdeutlicht, wo ausdrücklich zwei Elemente der Stellung genannt sind: «So konnte Papa einfach eine E-Mail an den Freund schicken, in der er zum Beispiel schrieb: ‚Weißer Bauer auf d2.‘ Und sein Freund mailte dann zurück: ‚Schwarze Königin von e2 auf h5.‘» Carroll selbst allerdings folgt bei den oben angegebenen Zügen bis zum Matt zwar den Schachregeln, nicht aber der Regel, beide Spieler abwesend ziehen zu lassen. Vielmehr stehen die Figuren auf dem Brett für die handelnden Personen in Carrolls Roman.
So würde der vollständige Ablauf bis zum Matt nach Carroll in heutiger Notation lauten:
1…Dh5 2.d4 und Dc4 3.Dc5 4.d5 und Df8 5.d6 und Dc8 6.d7 Se7+ 7.Sxe7 und Sf5 8.d8/D De8+ 10.Da6 (dieser Zug ist – schachlich betrachtet – illegal, da der weiße König im Schach der schwarzen Dame steht) 11.Dxe8#
Bei Schuster wird die Zugfolge nicht komplett wiedergegeben, aber durch die vorhandenen Anspielungen wird dem Carroll-kundigen Leser klar, dass für die Rückverwandlung von Alice in Eliza eben jene «Schachpartie» zu Ende gespielt werden muss.

Frank Schusters Schach-Roman «Das Haus hinter dem Spiegel» ist nicht ein eigentliches Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Für Lewis Carroll-Fans öffnet der Schusters Roman aber eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs.
Für wen ist also «Das Haus hinter dem Spiegel» geschrieben? Offensichtlich handelt es sich nicht um ein Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Es bleiben die Fans und Liebhaber der literarischen Vorlagen von Lewis Carroll. Für solche Liebhaber öffnet «Das Haus hinter den Spiegeln» eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs. ■
Frank Schuster: Das Haus hinter dem Spiegel, Roman, MainBook Verlag, 180 Seiten, ISBN 978-3944124728
.
.
.
__________________________________
Sabine Ziegler-Staub
Geb. 1982 im Saarland, Lehramtsstudium, Mitarbeit an einem Forschungsprojekt im Bereich Fachdidaktik der Mathematik, seit mehreren Jahren im Schuldienst und aktive Schachspielerin sowie Trainerin einer Schach-AG
Mario Ziegler
Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach
.
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Dominik Riedo und Karin Afshar – Ein literarisches E-Mail-Interview
.
Kairos – der richtige Zeitpunkt
oder
Kinski, Riedo, Schostakowitsch und … Kaffee
.
Dr. Karin Afshar
.
.

Dominik Riedo (* 28. Februar 1974 in Luzern/CH)
Ein Interview ist ein Gespräch, bei dem der eine Gesprächsteilnehmer den anderen zu einem zuvor festgelegten Thema befragt. Ziel eines Interviews ist die Erlangung von Information, entweder persönlicher oder sachlicher Art. Der Leser, der das Interview lesen wird, weiß bestenfalls hinterher mehr über den Befragten als er vorher wusste.
Ein Interview gelingt dann besonders gut, wenn sich der Befragende hinreichend über seinen Partner vorinformiert, sich ausdrucksstarke Fragen überlegt und sie in einen mehr oder weniger geordneten Zusammenhang bringt.
Der Befragte seinerseits muss während des Interviews eigentlich nichts weiter tun, als auf die Fragen so zu antworten, dass sowohl er als auch der Befragende mit den Antworten jeweils ihre Botschaft auf den Weg bringen.

Karin Afshar (* 1958 in der Eifel/D)
Es gibt etliche Fälle misslungener Interviews. Die meisten bekommen Leser oder Zuschauer oder Hörer nie zu sehen, aber hin und wieder macht eines in den Medien die Runde.
Ein echtes Skandal-Interview war eines mit Klaus Kinski, geführt mit einer jungen Reporterin, in einem Park (vielleicht Hamburg), im Beisein seiner Frau und einigen Fernsehleuten. Es ging um Kinskis damals gerade herausgekommenes Stück «Jesus Christus».
Nun war Kinski als «unmöglich», als enfant terrible bekannt, und was Interviews anging als störrisch verschrien. Ein Interview mit ihm also eine heikle Sache, die guter Vorbereitung bedurfte. Die junge Reporterin tappte gleich zu Beginn in ein erstes Fettnäpfchen, indem sie ihre Frage um das bedeutungsschwere Wort «ausgefallen» erweiterte. Das zweite Näpfchen stellte sich ihr in den Weg, als sie Kinski als «negativen Helden» bezeichnete, der sich nunmehr (überraschenderweise, ausgerechnet) des Neuen Testaments angenommen hätte… Kinski eskalierte sofort und ließ sich auch nicht mehr beruhigen. Der Rest des Interviews ist Geschichte.

Interview-Fettnäpfchen-Zerstörer Klaus Kinski (im legendären Park-Interview 1971)
Mein Gesprächspartner ist nicht Klaus Kinski (der ist auch inzwischen etliche Jahre tot), sondern ein lebender, kürzlich Geburtstag feiernder Schweizer Schriftsteller: Dominik Riedo. Als Nicht-Schweizerin und als Nur-noch-Sporadisch-Lesende kenne ich Herrn Riedo nicht. Eine Lücke, die ich schließe, indem ich im Netz recherchiere. Dominik Riedo studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in Zürich, Berlin und Luzern, von 2004 bis 2006 war er Lehrbeauftragter an der Universität Zürich, seit 1993 ist er Schriftsteller, Mitherausgeber von «Aufklärung und Kritik» (Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie), war 2010-2012 der Präsident des Deutschschweizer PEN-Zentrums und von 2007-2009 der Kulturminister der Schweiz. Er publiziert Bücher in verschiedenen Verlagen, betreibt eine Webseite und schreibt einen Blog, in dem er Aphorismen und Auszüge aus seinen Arbeiten einstellt. Ich lasse mir drei seiner neuesten Bücher (2014 erschienen) kommen.
Geplant ist ein E-Mail-Interview; diese Form von Interviews gewinnt immer mehr an Beliebtheit, folgt aber eben eigenen journalistischen Regeln, die man auch kennen sollte. Der größte Unterschied zu normalen Interviews ist der, dass die beiden Gesprächspartner nicht die Möglichkeit haben, eine gestellte Frage zu erweitern oder zu erörtern, sondern die Befragung und Beantwortung statischer sind und demzufolge strukturiert vorbereitet sein wollen. Zehn Fragen, so steht in den Leitlinien, die ich alsbald finde, sollten es in der Regel sein.
Ich schreibe Herrn Riedo eine erste Mail, um mich vorzustellen und um anzukündigen, dass demnächst meine Fragen kommen. Ich muss mich erst «warm laufen».
Frage: Was lesen Sie zurzeit? (Und ist es eher ein dickes oder dünnes Buch?)
Riedo: Proust und Lovecraft und Barnes.
Anlass zur Frage ist ein Zitat: «Literatur ist auf der einen Seite wie ein dickes Buch, auf der anderen wie ein dünnes. Im dicken, das im unmöglichen Idealfall ein Weltwälzer wäre, kann man sein ganzes Leben fortlesen, ohne aus dem Traum in die Realität niedersteigen zu müssen. Beim dünnen, das bis zu einem Wort, zu einem Zeichen nurmehr, zusammenschmelzen soll, wird durch das Gelesene eine plötzliche Einsicht in die Wirklichkeit bewirkt.»
Riedo: Man kann nicht sämtliche Literatur in einem Menschenleben lesen. Darum ist es vor allem wichtig, von elementaren Werken zumindest den Nukleus – also das, was ein bestimmtes Werk im Innersten zusammenhält, was es ausmacht und determiniert – zu verstehen; man sollte (selbst als unkreatives Wesen) zumindest begreifen, warum ein Autor ein solches Buch überhaupt schreiben wollte und konnte.
In einer späteren Mail, nachgefragt, wie es Proust jetzt «ginge»:
Riedo: Proust steckt fest. Der dritte Band ist zu zäh. Mal sehen, ob ich ihn durchgehe oder überwinde. Im Moment einiges andere auf dem Nachttisch.
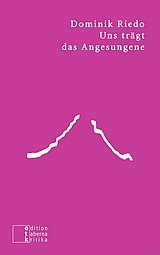
Dominik Riedo: «Uns trägt das Angesungene» – edition taberna kritika
Ich lese derweil in «Uns trägt das Angesungene». Es ist ein rosa-/magentafarbenes A6-formatiges Taschenbuch mit Textschnipseln, mit Angedachtem, farbig im Text belassenen Korrekturanmerkungen und geschwärztem Text. Sieht interessant aus. Der Klappentext hebt an mit der Frage, ob Skizze auch Werk sein kann, so unfertig wie sie ist. Das Buch werde zur doppelten Allegorie, in dem es die (Un)Fertigkeit einer offengebliebenen Korrektur schamlos ausstelle. Ich stolpere über das erste von zwei Attributen, die man Riedos Arbeit zuweist.
Frage: Was meinen die Rezensenten und auch der Verlag mit der «schamlosen Ausstellung» des (Un)fertigen? Sollten «wir» – die Leser – uns für etwas schämen – und vor welchem Hintergrund sollen wir uns schämen? Lassen Sie alle Scham fallen, weil Sie nicht schreiben, wie es sich «gehört»?
Riedo: Wieso, wie «gehörte» es sich? Oder halt dies: Ich soll mich doch wirklich nicht schämen, das Unfertige zu zeigen: Denn wann ist etwas schon nicht «unfertig‘? Das mit den Leserinnen und Lesern ist eine verzwickte Sache: Eigentlich wäre nicht (fast) alles, was man als Wort-Mensch so schreibt, für deren Augen. Aber irgendwie muss man halt leben.
Ein zweites Attribut ist «verstörend»… Bin erstaunt, bin kaum verwirrt, wegen der Korrekturen nicht (kannte ich schon aus anderen Büchern), aufgrund der Inhalte nicht, muss schmunzeln (viele Ideen! Wenn er das alles zu Erzählungen machte!), bin wiedermal bestätigt: die Welt ist verrückt, so wie sie ist. Und nicht dazu angetan, wirklich heimisch in ihr zu sein.
Frage: Ist das mehr oder weniger auch das, was Sie trägt? – Was Sie hier «ansingen»? – Eine Welt in Auflösung?
Riedo: Die Welt ist ver-rückt: Wenn es nur in den Büchern wäre, fände ich das äußerst anstrebenswert. Aber die Realität … Es ist nicht zu sagen, was heute alles «geht». Eine Lösung wird kommen: Hoffen wir, es ist nicht eine endgültige. Auf dass man immer wieder dagegen ansingen darf. Und doch alle etwas Ungesungenes im Kopfherz tragen können.
Das mit dem Ansingen kenne ich. Dass es in Riedos Angesungenem viele Tote, Morde, Rachegedanken gibt… eben, so ist die Welt. Ver-Rückt. In meinem Alltag fallen mir just in dieser Zeit die kurzen, zusammengedampften Symphonien von Darius Milhaud zu. Der schrieb dergleichen Anfang des 20. Jahrhunderts, verkürzte mal eben eine (klassische Form) 90-minütige Symphonie in vier Sätzen auf acht Minuten. Ankündigung unserer heutigen Zeit-Not? Ein Kürzest-Werk, aber eben auch ein Werk.
Frage: «… Wie in einer musikalischen Struktur …» – haben Sie ein bestimmtes Stück vor Ohren gehabt?
Riedo: Einige; aber vor allem meins: do re mi do ni ki … Aber es sei gegengefragt: Wenn ein fremder Text in mir plötzlich Saiten zum Klingen bringt: Sind das von Geburt her eingezogene oder doch eher literarisch vorgebildete? Die Frage besteht: Gibt es Liebe zu einem Text ohne Vorkenntnisse (mal abgesehen davon, dass man das Alphabet erlernt hat und gewisses Weltwissen) und/oder «Drauf-hinauf-gehoben-Werden»?
Frage: Welche Musik hören Sie und was ist mit der Harmonielehre oder Tonkunst?
Riedo: Wie der Patient sagen würde: Ich bin ein Liebhaber der Tonkunst: Viele tanzen nach meiner Pfeife.
Kein Nachhaken meinerseits, aber zur Gegenfrage fällt mir vieles ein. Das Thema «Musik», über das ich gerne weiter gefragt hätte, bei dem ich dann auf Hindemith und von ihm weiter auf «das Werk» bzw. den Werksbegriff gekommen wäre, bleibt unvollendet. Ich suche noch ein wenig in der «Unterweisung im Tonsatz» – im Vorwort schreibt Hindemith Lehrreiches zum Werksbegriff bzw. über den Umgang der Jüngeren mit der Anwendung des ihnen zur Verfügung stehenden Musikwerkzeugs… Es hätte zu Riedos Interview mit Philippe Bischof gepasst:
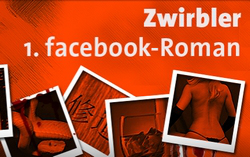
Die Facebook-Community als Schriftsteller-Kollektiv: der Zwirbler-Roman
Anlässlich einer Tagung des Kulturministerium.ch hatte Riedo als Kulturminister der Schweiz mit Philippe Bischof, dem Leiter des Luzerner Kulturhauses Südpol ein Gespräch geführt. Riedo hatte gefragt, ob die Schriftsteller eventuell zu elitär geworden seien und ob Theater immer mit Schriftstellern zu tun haben bzw. immer von Schriftstellern geschrieben sein müsse.
Bischof bestätigte, dass dies im Moment (immerhin schon 5 Jahre her), tatsächlich immer weniger der Fall sei. Es gebe eine starke Tendenz dahin, dass der Autor nicht mehr der Schriftsteller allein sei, sondern die Schauspieler, der Regisseur, der Dramaturg zusammen etwas wie einen Kollektivautor bildeten, der auch die Leute draußen, das Publikum und seine Befindlichkeit und persönlichen Bedürfnisse einbeziehe und als dokumentarisches Theater diese authentisch aufnehme.
Von der Bühne und den Dramatikern, von der Musik hätte ich zu den Schriftstellern und den Büchern übergeleitet… Dank (preisgünstiger) E-Book-Publikationsmöglichkeit gibt es immer mehr Autoren und auch immer mehr zielgruppenorientiertes Schreiben. Da wird der Leser miteinbezogen, der Autor schreibt, was sein Leser sich von der Geschichte wünscht, ja, sogar mehrere Autoren schreiben kollektiv an einer Geschichte (z.B. der Zwirbler-Roman, der erste Facebook-Roman).
Frage: Sind diese eigentlich noch Schriftsteller zu nennen? Was ist ein Schriftsteller heute noch?
Riedo: Man könnte es über die Gewerkschaft definieren: Beim AdS («Autorinnen und Autoren der Schweiz») wird nur aufgenommen, wer bestimmte Minimalkriterien erfüllt. Andererseits ist «Schriftsteller» keine geschützte Bezeichnung, war es noch nie. Und das ist vielleicht auch gut so. Stichwort: «Offen für alles Kommende» … Der Untergang kommt früh genug …
Frage: Ist Schreiben ein Ausdruck seiner selbst, oder ist Schreiben als Erfüllung der Bedürfnisse anderer, besonders der Leser zu denken?
Riedo: Das geht durchaus Hand in Hand.
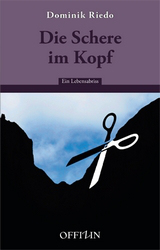
Dominik Riedo: «Die Schere im Kopf» – Offizin Verlag
«Die Schere im Kopf». Das Buch lässt mich nicht an sich heran, verärgert mich im Anlesen – und lässt mich «im Fenster der Nacht des Hierseins» – zurück, mit diesem «Herunterzählen» an Wörtern und Satzfetzen, bis hin zum letzten unverständlichen Wort. Ich bin alles andere als sicher, ob ich überhaupt verstehe, worum es geht. An manchen Stellen kann ich sogar vor Wut nicht weiterlesen.
Riedo: Auch ich war oft wütend angesichts des Textes. Aber er musste geschrieben werden. Und wäre es nur meinetwegen.
Frage: Provokation? Fishing for Widerspruch?
Riedo: Ne, nicht mehr … Das habe ich mit dem Kulturministerium hinter mir gelassen.
Fünf mal 24 Stunden hat der Erzähler in diesem Buch noch zu leben. Er liegt mit Krebs im Endstadium in einem Spitalbett und weiß, dass die Schmerzen trotz verabreichter Medikamente nicht mehr enden werden. Dennoch fürchtet er sich weniger vor dem elenden Ende, verspürt kaum Angst vor dem nahenden Tod, den er in seinem Überdruss willkommen heißt.
In aufeinanderfolgenden Bewusstseinsschüben beschreibt er nun sein abgelebtes Leben, zerreißt es rückblickend. Der Leser erfährt, dass der Erzähler früher einmal geglaubt hatte, das große Werk schreiben zu können, dass er zwar zwei Instrumente spielte, aber nicht ganz so musikalisch wie Mozart war. Er war Lehrer, einmal sogar Dozent an der Uni, arbeitete im Gefängnis (wo er feststellte, dass auch Verbrecher sich selbst beschwindeln) und hatte weitere Gelegenheitsjobs. Der Leser erfährt von den Frauen. 129 sollen es gewesen sein. Bei der Abrechnung überlegt der Sterbende, ob es ihm ein Trost wäre, wenn alle Menschen gleichzeitig mit ihm stürben. Fragmentarisch denkt er auch – an die Schweiz, an ihre unveränderbare Bürgerlichkeit und fasst zusammen, dass ihn auch das Reisen anwiderte, nachdem er alles bereist hatte.
Wie gesagt: das Buch widersetzt sich mir. Vielleicht wegen des Fragmentarischen, des «gestreamt» Vexierhaften – Vexierhaftes irritiert mich. Schostakovitsch und seine 15. Symphonie fallen mir ein. Sie beginnt mit dem Zitat aus Rossinis «Wilhelm Tell»-Ouvertüre. Das leichte, lockere Leben endet alsbald in Fragmenten und setzt sich mit dem Sterben auseinander. Es ist die letzte Symphonie des Russen, er ist schwerkrank und er komponiert unter stalinistischen Bedingungen, wandert dabei auf einem schmalen Grat zwischen ideologischer Vereinnahmung und künstlerischer Selbstverwirklichung, zwischen Leben und Tod. Ja, Schostakowitschs Musik evoziert Ähnliches wie die «Schere».
Die Schere im Kopf lege ich zur Seite. Sie schneidet meine Energie und meinen Elan ab. Auch die Antworten, die ich auf meine erste Mail bekomme, lege ich zur Seite. Jetzt spüre ich den Hauch des Proust-Effekts. Aufschieben, sage ich mir. Aufschieben, dann wird der rechte Augenblick kommen. Habe auch zur Zeit mit der Veröffentlichung der Aphorismen eines anderen jungen Mannes zu tun, fast gleicher Jahrgang, sogar ähnliche Gedanken.
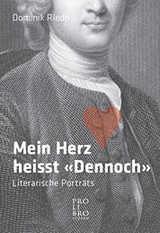
Dominik Riedo: «Mein Herz heisst ‘Dennoch’» – Pro Libro Verlag
Kurz vor Weihnachten schickt mir der Verlag pro libro aus Luzern das dritte Riedo-Buch: «Mein Herz heisst «’Dennoch’ – Literarische Porträts». Darin geht es um Schriftsteller und Denker, die anders als ihre Mitmenschen waren. Die Werke, die sie aus ihrer Andersartigkeit heraus geschrieben haben, werden heute bewundert. Den Erschaffenden aber machte das Anderssein zu schaffen. Sie haderten mit sich, mit der Welt, mit dem eigenen Werk. Riedo versammelt in diesem Buch literarische Porträts, die gewissermaßen den Finger auf die offene Wunde legen. Die Wunde ist die der Verdrängung des Haders der «Anderseienden» aus der heutigen Bewunderungsperspektive.
Sag ich doch! Mein Reden. Voller Vorfreude nehme ich das Buch in die Hand und vor die Augen. Riedo ist einer, der Einzelgänger zu mögen scheint. Seine Antworten zu sich selbst mögen da für ihn sprechen.
Frage: «Widerstand der Welt, den diese Denker und Schriftsteller erfuhren, aber auch Widerstand, den sie selbst der Welt entgegensetzten, der unbeirrbare Glauben der Porträtierten an das «Dennoch» – an die Keimzelle der unsterblichen Literatur.» Keimzelle? Unsterbliche Literatur?
Riedo: Unsterblich, denke ich, ist doch praktisch nichts. Die Keimzelle jedoch steckt in mir – und bringt ihre Triebe voran… Gegen den vorangegangenen Gegendruck …
Frage: Sind Sie ein lustig-melancholischer Mensch oder eher ein ernst-alberner? Oder ist die Frage zu persönlich?
Riedo: Beides wohl, wild durcheinander. Am ehesten ein melancholisch-heiterer.
Frage: Sie scheinen ein Faible für Einzelgänger zu haben oder sind Sie etwa selbst einer? Sehen Sie sich als einer?
Riedo: An der Party zu meinem 20. Geburtstag kamen 81 Gäste, an der zu meinem 40. Geburtstag noch 12 …
Und jetzt kommt die Kinski-Klippe, das Fettnäpfchen, in das ich treten könnte. Riedo war – wie bereits erwähnt – für zwei Jahre Schweizer Kulturminister – ein Zeitraum in seiner Biografie, den ich natürlich ansprechen muss.
Frage: Wie kam es überhaupt zu der Idee, Kulturminister werden zu wollen, sich als Kandidat zur Wahl (mittels Internet-Wahl aus 25 Kandidatinnen und Kandidaten) zu stellen?
Riedo: Weil ich, beim Sprung ins kalte Wasser, etwas lernen wollte.
Frage: Macht man das mal eben so? Haben Sie nicht genug zu tun gehabt?
Riedo: Ich mache eigentlich nichts «einfach so».
Frage: Wie haben Sie die 2 Jahre als Kulturminister verändert? Haben sie Sie verändert?
Riedo: Oh ja!
Meine zehn Fragen sind gestellt, und ich habe kein schlüssiges, rundum befriedigendes Bild. Ich habe gar nichts und muss erkennen, dass ich die falschen Fragen gestellt habe, und mir trotz allen Hin- und Herüberlegens kein Weg eingefallen ist, sie aufzubereiten. Riedo hat mich weite und inspirierte Denkwege zurücklegen lassen. Aber das Interview… wenn ich doch eine Tasse Kaffee mit ihm trinken könnte!
Es ergibt sich keine Gelegenheit. Im Gegenteil, ich entferne mich räumlich noch weiter von der Schweiz, fahre in den Norden, sitze in einem Bahnhofsrestaurant und – spreche mit Riedo.
Was trinken wir? Kaffee? Wie trinken Sie ihn? Mit Milch und ohne Zucker? – Der Kaffee kommt. Jetzt würde ich sie stellen – die wirklich wichtigen Fragen:
01. Wann können Sie am besten schreiben?
02. Wo kommen Ihnen so richtig gute Ideen?
03. Welche Stadt würden Sie gerne in nächster Zeit besuchen?
04. Haben Sie Freunde in Deutschland?
05. Welchen Film haben Sie kürzlich gesehen?
06. Haben Sie einen Lieblingsregisseur?
07. Trinken Sie lieber Kaffee oder lieber Tee? Eine Idee, warum das so ist?
08. Essen Sie gerne Fisch?
09. Welches ist Ihre derzeitige Lieblingsfarbe (hatte ich das nicht schon gefragt???)
10. Können Sie zeichnen?
Nichts mit Literaturwissenschaftlichem zu «Werk» und «Fragmentarismus», oder Lebensabrissen und Bewusstseinsströmen, genug des Zweifelns an der verrückten Welt, die uns dazu bringt, gegen sie anzuschreiben. Wozu? Um uns ein Denkmal zu setzen – oder uns am Leben zu erhalten? Wer dieses neue Interview liest, soll sich wohlfühlen und einen Menschen sehen, und sich darin wiederfinden – oder auch nicht. Etwas Riedo-haftes klingt in allen von uns… und sowohl ein Klaus Kinski als auch ein Dmitri Schostakowitsch waren als Künstler und als Menschen nicht einfach, noch unumstritten. Sie waren anders. Und dennoch!
Einen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Herr Riedo. ■
_________________________
Dies sind die Antworten, die mir Dominik Riedo auf meine obigen 10 Fragen gab:
01. Wenn mich an der Welt etwas stört, aber nicht in meinem Arbeitszimmer.
02. Beim Lesen.
03. Marsala. Ich werde März oder April dort sein.
04. Ja.
05. Verfilmungen von Philip K. Dick. Ich möchte einen Essay über ihn schreiben.
06. Orson Welles.
07. Kaffee. Weil ich als Kind bereits Mocca-Glacé über alles liebte. Aber warum das? Keine Ahnung.
08. Ich bin Vegetarier.
09. Schwarz.
10. Ich konnte es mal ganz gut und habe Freundinnen damit «beschenkt». Heute hab ich das etwas verloren.
.
Weitere Beiträge von Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Der neue Sudoku-Spass im «Glarean»
.
Die Sudoku-Rätsel-Puzzles im Februar 2015
.
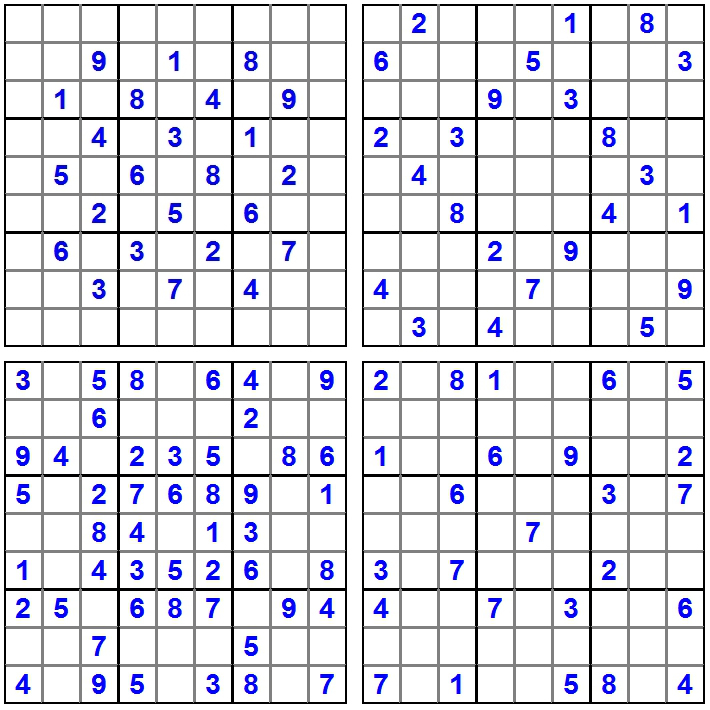 .
.
.Copyright 2015 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin
.
Sudoku – die Regeln
Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in
3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.
Jede Zeile, jede Spalte und jeder Block soll alle
Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten.
In ein paar der Felder sind bereits Zahlen vorgegeben.
Bei einem Sudoku darf es nur eine mögliche Lösung geben,
und diese muss rein logisch gefunden werden können.
.
Auflösung —> (more…)
.
.
Das neue Literatur-Kreuzworträtsel im Februar 2015
.
Denksport-Herausforderung für Literatur-Freunde

Copyright 2015/2 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin
.
Rätsel zum Ausdrucken (pdf)
.
Lösung: —>(more…)
.
.
.
.
Kent Nagano (Inge Kloepfer): «Erwarten Sie Wunder»
.
Die Rettung der Klassik
Christian Busch
.
.
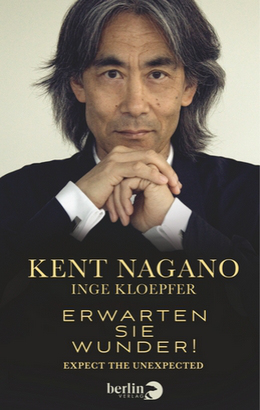 «Expect the Unextpected»
«Expect the Unextpected»
Die Klänge der Eröffnungskonzerte der neuen Pariser Philharmonie via ARTE noch im Ohr, weiß man in der Welt der Klassischen Musik schon lange, welche Töne angeschlagen werden müssen. Längst ist die Zeit der eitlen und sich um sich selbst und die Gründung immer neuer Plattenfirmen und Vermarktungsstrategien drehenden Stardirigenten vorbei. Boomte die Klassik in den 80er und 90er Jahren noch dank der neuen digitalen CD-Scheiben mit ihrem viel transparenteren und hörfreundlichen Klangbild, gehen die Nachfahren von Beethoven & Co. an vielen Orten längst am Stock. In den Zeiten knapper Kassen und allgegenwärtigem Multimedia-Rausch müssen die Liebhaber komplexer filigraner Orchesterkultur mitunter gesucht werden wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen. Das Durchschnittsalter in den Konzertsälen steigt bedrohlich und degeneriert zur exklusiven Matinée für Betagte und Betuchte. Da wird ein fast 400 Millionen schweres Projekt wie das der Pariser Philharmonie, welches das städtische Orchester von seiner angestammten – nahe dem Arc de Triomphe gelegenen – Salle Pleyel vertreibt, auch schon mal in die suburbane Zone des Parc de la Villette verlagert, in die schon fast prekär zu nennende soziale Randzone, wo jüngst die Attentäter von «Charlie Hebdo» ihr Fluchtauto wechselten. Und statt der VIP-Zone legt man jetzt Wert auf ein Lernzentrum «Abteilung Education», in der kulturelle Brücken zu Schulen und bildungsfernen Schichten geschlagen werden sollen. Ist die Lage wirklich so ernst?
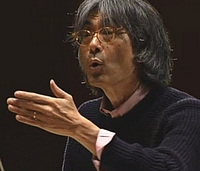
Stardirigent Nagano bei der Arbeit
Wirtschafts- und Sinnkrise
In dem jüngst erschienenen Buch «Expect the unexpected!» («Erwarten Sie Wunder») behandelt der amerikanische Dirigent Kent Nagano, unterstützt von der Koautorin Inge Kloepfer, mit soziologischen Sachverstand genau dieses Problem der schwindenden Stellung der klassischen Musik im Kulturleben. Aus unmittelbarer Nähe berichtet er am Beispiel von Detroit vom Niedergang der nordamerikanischen Orchesterlandschaft und den fatalen Folgen für die kulturelle Entwicklung in den Städten. Er empört sich gegen die schonungslose Ausbreitung von Materialismus, Konsumismus und reinem Utilitarismus in der westlichen Zivilisation, welche in der PISA-Studie ihren deutlichsten bildungspolitischen Niederschlag findet: Was zählt, sind Fähigkeiten, die den Menschen auf ihren funktionalen Nutzen reduzieren. Fächer wie Kunst und Musik, welche Kreativität, Vorstellungsvermögen und Inspiration fördern, kommen dort nicht vor. Dabei steht schon im Matthäus-Evangelium: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Plädoyer für die Rückbesinnung auf die Klassik
Er zeigt an vielen Beispielen seiner langjährigen, intensiven und fruchtbaren Auseinander-setzung mit den unsterblichen Werken auf, dass die schönen Künste vor dem Hintergrund eines generellen Wertewandels in den westlichen Industrieländern eine Antwort auf die Sinnkrise darstellen: «Sie […] machen den Alltag mehr als nur erträglich. Sie inspirieren uns, öffnen den Geist. Sie helfen uns, Unbegreifliches und Unerträgliches anzunehmen und als Teil unseres Lebens zu akzeptieren, daraus Kraft zu schöpfen und nicht daran zu verzweifeln.» Dabei erweist er sich als energischer und nimmermüder Verfechter der Quellen menschlicher Inspiration., der längst begriffen hat, dass heute die wichtigste Aufgabe der Dirigenten und Intendanten nicht in der Selbstverwirklichung egoistischer Eitelkeiten besteht, sondern in der Vermittlung zwischen Kunstwerk und Publikum: «Nennen Sie mich jetzt einen Träumer, einen Utopisten, wenn ich mir wünsche, dass ein jeder in seinem Leben unabhängig von Bildungsstand und Herkunft die sinnstiftende Kraft der Kunst erfahren können soll.»

Zweifellos ist Kent Naganos Klassik-Plädoyer «Erwarten Sie Wunder» das richtige Buch zur rechten Zeit – in seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung weitreichend, in seinen Zielsetzungen ehrgeizig. Den Autoren gebühren Dank und Beachtung!
Kindheit ohne neue Medien – dafür mit Klavier und Klarinette
So beginnt Nagano seine Ausführungen in seiner Kindheit an und erzählt von den Anfängen in Morro Bay, einem in den 50er Jahren multikulturell besiedelten Fischerdorf an der kalifornischen Pazifikküste, und von seinem ersten musikalischen Erzieher, dem Professor Korisheli. Im Vordergrund stehen dabei von Beginn an nie persönliche Erfolge, öffentliche Anerkennungen oder gar Preisverleihungen, sondern stets die ungetrübte Freude am gemeinschaftlichen Musizieren, am Gemeinsinn stiftenden Konzert- oder Probenerlebnis, bei dem Konflikte und Unterschiede an Bedeutung verloren: «Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt». Welche Zeit hätte dessen nicht bedurft, so könnte man fragen – liefert Nagano hier doch einen entschiedenen Gegenentwurf zu den stets von manipulativer Sprache der Medien und leicht konsumierbarer Unterhaltungselektronik geprägten aktuellen Kultur-Landschaft. Hier und da blitzen die Erfahrungen aus seinen vielen Stationen (Lyon, Manchester, Los Angeles, Berlin, München, Montreal, Hamburg) auf, offenbart er den Lesern in eingestreuten Intermezzi seinen eigenen Zugang zu den großen Komponisten, von Bach, Beethoven und Bruckner bis zu Schönberg, Messiaen, Ives und Bernstein. Wenn er über das Rätselhafte in Beethovens achter Symphonie spricht, enthüllt sich nebenbei: Der Weg ist das Ziel, das auch ungewöhnliche Wege rechtfertigt, indem Nagano mit seinem OSM (Orchestre symphonique de Montreal) volksnah in der Eishockey-Arena Richard Strauss’ «Heldenleben» präsentiert. Abgerundet wird sein Aufruf durch die Gespräche mit Zeitgenossen wie Helmut Schmidt (Politik), Kardinal R. Marx (Kirche), Yann Matei (Literatur), Julie Payette (Wissenschaft) und William Friedkin (Film). Was letzterer über Beethovens Symphonien sagt, gilt für die ganze Klassik: «Wer einmal […] die Tiefe der Musik erahnen konnte, wird sich ein Leben lang nach dieser Erfahrung sehnen. Es wird ihn immer wieder dorthin zurückziehen.»
Zweifellos ist Kent Naganos Klassik-Plädoyer «Erwarten Sie Wunder» das richtige Buch zur rechten Zeit – in seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung weitreichend, in seinen Zielsetzungen ehrgeizig. Den Autoren gebühren Dank und Beachtung! ■
Kent Nagano (Inge Kloepfer): Erwarten Sie Wunder – Expect the Unexpected, Berlin Verlag, 320 Seiten, ISBN 978-3827012333
.
.
.
.
Das klassische Glarean-Tangram (49)
.
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
Lösung: —>(weiterlesen…)
.
__________________________________
.
Das Tangram-Puzzle
 Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Schon in der uralten Kultur Chinas bedeutete das Quadrat die reinste Form einer Fläche, in sich vollkommen, und beim Tangram wird dieses in sich ruhende Quadrat nun aufgelöst in eine endlose Bewegung, wird es durch unablässige Veränderung zum Ausgangspunkt ungeahnter Gebilde, durch das Zusammenspiel seiner festen Elemente zum Quell des Neuen.
Die ersten Tangram-Bücher wurden zur Zeit des Ch’ing-Kaisers Chia Ch’ing (1796-1820) gedruckt, die früheste uns überlieferte Tangram-Publikation dort stammt aus dem Jahre 1813, doch das Grundprinzip des Spiels dürfte im asiatischen Raum schon lange vor Christi Geburt weit verbreitet gewesen sein. Eine frühe erste Veröffentlichung in Europa datiert aus dem Jahre 1805.
Inzwischen hat das Tangram einen wahren Siegeszug durch alle Kontinente angetreten, ist Gegenstand zahlreicher Bücher und Sammlungen geworden – und lädt unvermindert anregend und spannend ein zum Nachdenken, zum Knobeln, zum Sinnieren, ja vielleicht gar zum Philosophieren über die ewige Veränderung des ewig Gleichen…
Im «Glarean Magazin» finden sich regelmäßig interessante und berühmte Tangram-Aufgaben. Dabei wird das Lege-Puzzle erleichtert, wenn man sich aus Karton die sieben Grundelemente zurechtschneidet.
Sollten unter unseren Leserinnen und Lesern vielleicht sogar Tangram-«Erfinder» sein, so sind sie freundlich eingeladen, uns ihre neuen Figuren als Grafik-Datei zu senden! (we)
.
Ein Beispiel
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
.
.
111 Chess Tacticals (45)
.
Schwarz am Zuge gewinnt
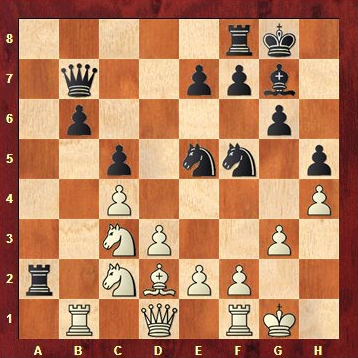 Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■
Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. – Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■
.
.
.
.
.
Das Januar-Streichholzrätsel im «Glarean Magazin»
.
Legen Sie eines der Streichhölzer so um, dass die Gleichung stimmt
.
Lösung: —>(more…)
.
.
Weitere Streichholz-Rätsel im Glarean Magazin
.
.
.
.
«Kingdom of Heaven» – Lieder von Heinrich Laufenberg u.a.
.
«Stand vf, stand vf, du sele min»
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.
Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.
Und doch ist die Romantisierung des Mittelalters, die einst im 19. Jahrhundert begann, auch heute noch in vollem Schwange. Die Bilder vom edlen Recken, der schönen Jungfrau, der trutzigen Feste, vom bunten Turnier, dem weltvergessenen Kloster, dem rauen und dennoch guten Leben sind tief ins kollektive Bewusstsein der Populärkultur eingebrannt und werden in Belletristik, Musik, Film und Parallelgesellschaften wie der «Society of Creative Anachronism» immer wieder wohlfeil bedient.
Nicht, dass die vorliegende CD romantisierender Mittelalter-Kitsch wäre. Die Produktion – die sicher nur zufällig den Titel mit einer Kreuzfahrerschmonzette von Ridley Scott aus dem Jahre 2005 teilt – ist durch und durch hochklassig und akademisch im besten Sinne, besteht das Ensemble Dragma mit Agnieska Budzińska-Bennett (Gesang, Harfe, Drehleier), Jane Achtmann (Vielle, Glocken) und Marc Lewon (Gesang, Plektrumlaute, Vielle) doch aus drei arrivierten Spezialisten für mittelalterliche Musik. Sie konzentriert sich thematisch auf das Werk von Heinrich Laufenberg, jenes alemannischen Mönches, der wohl um das Jahr 1390 in Freiburg im Breisgau geboren wurde und am 31. März 1460 in Johanniterkloster zu Straßburg verstorben ist. Hinzu treten Werke zeitgenössischer Liederdichter.

Heinrich von Laufenberg (aus der Handschrift des Buchs der Figuren, die 1870 in Straßburg verbrannt ist)
Dass wir heute überhaupt Lieder von Heinrich Laufenberg hören können, grenzt an ein Wunder, sind die mittelalterlichen Codices, die seine Lieder ursprünglich enthielten (es waren wohl um die 120 Stück), doch beim Angriff auf Straßburg im Deutsch-Französischen Krieg 1870 zerstört worden. Kurz vorher jedoch hatte der Kirchenliedforscher Philipp Wackernagel in einer umfangreichen Edition Laufenbergs Texte herausgegeben. Auch sind über viele unterschiedliche Wege Melodien zu 17 Texten auf uns gekommen, sodass es heute möglich ist, Laufenberg in Text und Musik zu erleben. Allerdings wissen wir – und darauf weist Marc Lewon in seinem höchst informativen Booklet-Text ganz deutlich hin – nicht, wie die Noten dem Text tatsächlich zuzuordnen sind, und zwar weil nur Noten ohne jegliche Strukturierung oder Textbezug überliefert worden sind. Zudem ist nicht klar, ob die Noten komplett überliefert wurden oder ob manch eine nicht von einem Forscher des 19. Jahrhunderts – eine damals durchweg gängige Praxis – «nachempfunden» wurde. Die vorliegende nun Rekonstruktion kann sich durchweg hören lassen. So tönt Agnieska Budzińska-Bennett in den der Christusminne zugehörigen Liedern wie «Es taget minnencliche“ oder im berühmten «Benedicite» des Mönchs von Salzburg förmlich wie vom Himmel her, so glatt, gleißend hell und dennoch mit einer gewissen Grundwärme timbriert klingt ihr Stimme. Ausgesprochen anregend und abwechslungsreich gestaltet auch Mark Lewon seine Lieder, beispielsweise «Ein lerer rúft vil lut », einem Diskurs über das rechte Leben und den rechten Glauben.

Ausschnitt der Wolfenbütteler Lautentabulatur
Aber auch die Instrumentalstücke, die sich auf dieser CD finden, werden von den drei Musikern des Ensemble Dragma (die in drei Tracks von Hanna Marti und Elizabeth Ramsey unterstützt werden) auf technisch und gestalterisch höchstem Niveau musiziert. Auf ein besonderes Schmankerl, die diese CD dem Alte-Musik-Aficionado bietet, muss hier gesondert hingewiesen werden. Denn neben den Liedern und Instrumentalstücken Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen bringt diese Produktion erstmals komplett jene Stücke, die der sogenannten «Wolfenbütteler Lautentabulatur» entstammen, einer fragmentarischen Quelle aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die erst vor ein paar Jahren entdeckt wurde und die älteste bisher bekannte Lautentabulatur überhaupt darstellt. Marc Lewon präsentiert seine auf seiner intensiven Beschäftigung mit der Tabulatur basierende Rekonstruktion. Und auch dies ist ein echter Ohrenschmaus.

Das Ensemble Drama präsentiert mit seiner Produktion «Kingdom of Heaven» Lieder Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen sowie das komplette Material der Wolfenbütteler Lautentabulatur. Die atmosphärisch ausgesprochen dichte, hervorragend musizierte und philologisch exquisit gearbeitete Produktion kann rundum und ohne Abstriche empfohlen werden.
Und so ist das, was dem Hörer hier 78 Minuten lang entgegentönt, so derartig perfekt musiziert, dass man am Ende den Eindruck hat, hier eben doch idealen Klängen aus einem idealisierten Mittelalter zu lauschen. Ob die Stimmen und Instrumente eines Mönches im kalten und zugigen Kloster oder die des über schlammige und schlechte Wege von Weiler zu Weiler ziehenden Spielmannes so geschniegelt geklungen haben mögen? Der Realität näher mögen wohl René Clemencics Aufnahmen mittelalterlicher Musik sein, doch die vorliegende CD ermöglicht es dem Hörer, einen Blick ins «Kingdom of Heaven» zu erhaschen.■
Kingdom of Heaven – Musik von Heinrich Laufenberg und seinen Zeitgenossen, Ensemble Dragma, Label Ramee (RAM 1402), Audio-CD
.
.
.
.
Der neue Sudoku-Spass im «Glarean»
.
Die Sudoku-Rätsel-Puzzles im Dezember 2014
.
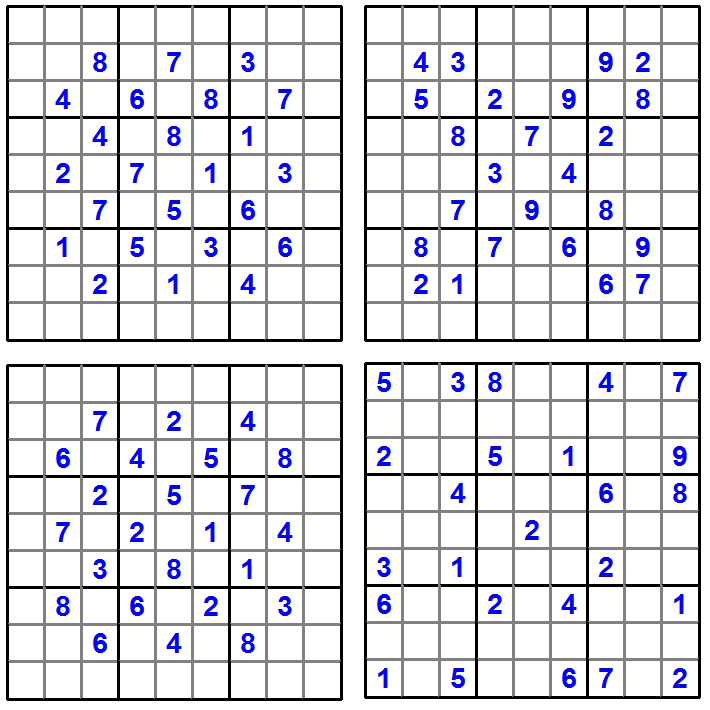 .
.
.Copyright 2014 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin
.
Sudoku – die Regeln
Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in
3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.
Jede Zeile, jede Spalte und jeder Block soll alle
Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten.
In ein paar der Felder sind bereits Zahlen vorgegeben.
Bei einem Sudoku darf es nur eine mögliche Lösung geben,
und diese muss rein logisch gefunden werden können.
.
Auflösung —> (more…)
.
.
Szilárd Rubin: «Der Eisengel» (Roman)
.
Die Vampirin von Törökszentmiklós
Günter Nawe
.
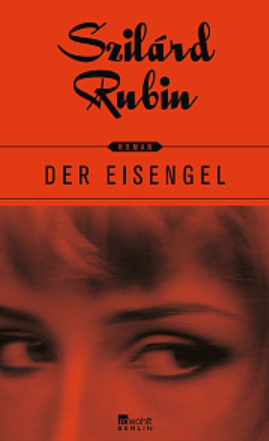 Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.
Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.
Wovon ist die Rede? Vom Roman «Eisengel». In Törökszentmiklós, einem ungarischen Provinznest, sorgt ein fünffacher Mord an jungen Mädchen für großes Aufsehen. Eine mehr als merkwürdige Geschichte – geschehen in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in Zeiten des ungarischen Poststalinismus.
Lange, so weiß es das ausführliche Nachwort zu diesem Roman, hat sich Szilárd Rubin mit diesem authentischen Fall befasst, der weit über das kriminelle Geschehen hinaus auch eine politische Dimension hat. Aufmerksam geworden ist Rubin auf den «Fall» durch die Fotografie einer jungen Frau, die einige Jahre zuvor hingerichtet worden ist. Piroska Janscó ist / war eine anmutige, schöne junge Frau und war doch die «Vampirin von Törökszentmiklós». Ihr wird dieses grausige Verbrechen zugeschrieben.
Unser Autor, als Schriftsteller und Journalist auftretend, will jedoch mehr wissen, als die Aktenlage ausweist, will die Hintergründe einer Mordserie, die zwischen Oktober 1953 und August 1954 geschah, kennenlernen. Bizarre Morde, ein unvorstellbares Verbrechen, das seinerzeit hohe Wellen geschlagen hat – In Törökszentmiklós und darüber hinaus. Verdächtigt der Morde wurden erst einmal sowjetischen Soldaten, die in Ortsnähe in Garnison lagen. Auch tauchten plötzlich die uralten Verdächtigungen auf von Ritualmorden, begangen von – natürlich – den Juden auf. Oder waren es Fremde? Es kam sogar zu Massendemonstrationen gegen die vermeintlichen Täter. Wir kennen ganz aktuell die Mechanismen von Verdrängung, Verdächtigungen und Verleumdungen. Bis endlich klar wurde: Gemordet «aus niederträchtigen Gründen», hat Piroska. Und so wurde sie für fünffachen Mord und einmaligem Mordversuch zum Tode verurteilt und hingerichtet.
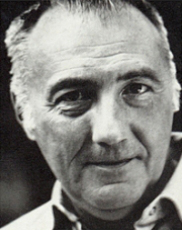
Rubin Szilárd (1927-2010)
So beginnt der Schriftsteller zu recherchieren. Er sucht die Tatorte auf, spricht mit den Familien, mit der Mutter der Mörderin, den Eltern der ermordeten Kinder und mit der Leiterin des Gefängnisses, in dem Piroska die letzten Stunden ihres Lebens verbracht hat. Nicht alle waren sehr auskunftsfreudig. Schon gar nicht die Polizei, die damals recht schlampig ermittelt hat, und sich immer noch nicht sehr auskunftsfreudig zeigt; genauso wenig wie die unantastbaren Russen.
Vieles in der Schilderung der «Zeugen» ist widersprüchlich. Der ermittelnde Schriftsteller entdeckt das Böse, das Grausige und Obsessive – gerade auch in der Bevölkerung. Ja, Piroska Janscó war eine Prostituierte, die bei den sowjetischen Soldaten ein- und ausging, sie kannte ebenso wie die Menschen um sie herum keine Moral. Wirklich nicht? Von der «Metaphysik der Sünde» spricht József Keresztesi und Freund des Autors in seinem klugen Nachwort. Und Szilard Rubin: « Und ich möchte nicht die existenzialistische These über die Unergründbarkeit der Welt darstellen, keine kafkaeske Parabel verfassen, sondern einen dem sozialistischen Geist verbundene, künstlerisch gut gelösten und authentischen Tatsachenroman schreiben.» Das ist Rubin unzweifelhaft gelungen, auch wenn manche Szene sich sehr kafkaesk liest und die «Unergründbarkeit der Welt» zweifelsfrei zu erahnen ist.

Der Roman «Der Eisengel» des ungarischen Autors Szilárd Rubin ist eine wunderbare und spannende Neuentdeckung. Die Geschichte der fünffachen Mörderin von Törökszentmiklós ist ein Krimi und doch mehr als das: eine faszinierende kleine literarische Sensation. Absolut lesenswert!”
Zurück zum «Fall» und zu Piroska, diesem «Eisengel», «kalt bis ans Herz hinan», liebende Mutter und gnadenlosen Mörderin, zu dieser Protagonistin eines außergewöhnlichen Romans. Mörderin und Heilige, der Engel und das Biest? Charakteristika, die stimmen und doch nicht stimmen. Folgen wir also dem Autor, der von seiner Heldin sagt: «Ich betrachte die Fotografie des Mädchens, unruhig und ratlos. Darüber stand: Die Täterin. Und unter dem Bild der Name Piroska Janscó. Dieses Bild vor mir erweckte zugleich Mitleid, Lust und Angst. In der Tiefe des trotzigen Blicks glühten die Falschheit und der Hochmut der Verführerin, in den katzenartigen Umrissen des Gesichts etwas, das sie auf rätselhafte und unheilverkündende Weise begehrenswert mache, und das konnte selbst durch die in ihren Zügen liegende Furcht eines in die Ecke gedrängten Raubtiers nicht gebannt werden.»
Gerade das also macht diesen Roman, bei dem so vieles im Ungefähren bleibt, trotz aller Brüche und Unschärfen, so einzigartig und lesenswert.
Der Leser, der einen Krimi erwartet hat, wird vielleicht enttäuscht sein. Der Leser, der sich auf das Abenteuer dieses Buches einlässt, hält einen brillanten, einen faszinierenden Roman in Händen, eine kleine literarische Sensation. ■
Szilárd Rubin: Der Eisengel, Roman, aus dem Ungarischen von Timea Tankó, Rowohlt Verlag, ISBN 978 3 87134 789 4
.
.
.
.
Das Musik-Kreuzworträtsel im Dezember 2014
.
Der neue Musik-Rätselspaß !
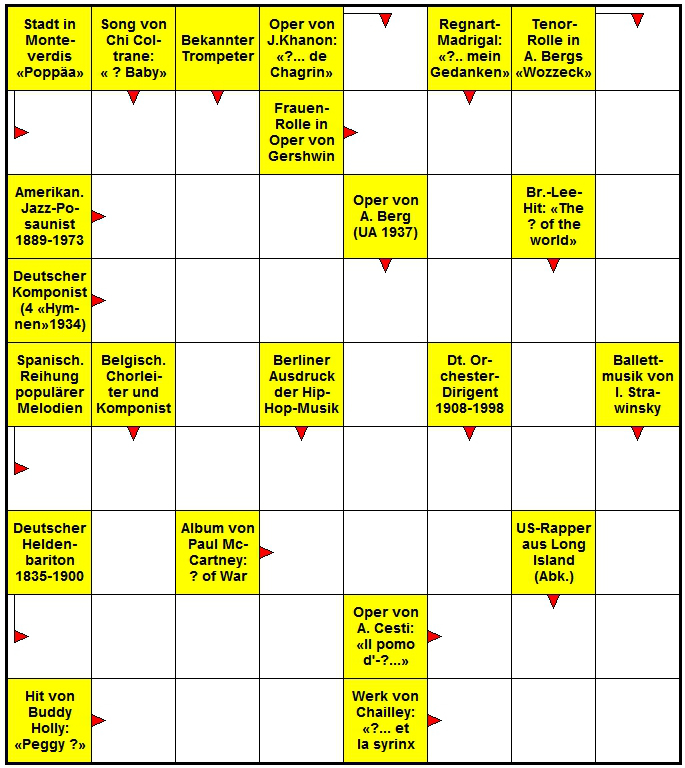
.
Copyright© 2014/12 by Walter Eigenmann
Rätsel ausdrucken (pdf)
Lösung: —>weiterlesen
.
.
.
Die Schach-Datenbank «Chessbase 13»
.
Schach auf Wolke 7 ?
Dr. Mario Ziegler
.
 29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?
29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?
Ich werde mich im Folgenden auf die Neuerungen von ChessBase 13 konzentrieren und daher die unzähligen nützlichen Funktionen, die bereits in früheren Versionen enthalten sind, übergehen. Dem Nutzer von ChessBase 12 wird der Einstieg in die aktuelle Version leicht fallen, da an der Menügestaltung kaum Änderungen vorgenommen wurden. Mitgeliefert wird in den günstigeren Programmpaketen die Datenbank «Big Database 2014» mit knapp 5,8 Millionen unkommentierten Partien (im Megapaket alternativ die «Mega Database» mit zusätzlich ca. 68000 kommentierten Partien). Das sollte hinsichtlich des Umfangs des Partiematerials keine Wünsche offen lassen, zumal aus ChessBase heraus ein Zugriff auf die noch umfangreichere Online-Datenbank von ChessBase möglich ist. Hier sei aber doch ein kleiner Kritikpunkt angebracht: Wieso endet eigentlich eine «Big Database 2014» mit Partien aus dem November 2013 (mit der ersten Weltmeisterschaft Anand-Carlsen)? Und wieso sind alle Datenbanktexte in der Big Database leer? Natürlich sind das Kleinigkeiten, aber andererseits wäre es ja sicher kein Problem gewesen, noch ein paar Tausend Partien aus 2014 aufzunehmen oder eben darauf zu achten, dass die Texte auch wirklich Texte sind und nicht nur aus Überschriften bestehen.
Nun aber zu den wirklich wichtigen Dingen. Hervorstechendes Merkmal der neuen Version ist die ChessBase-Cloud. Ein Verfahren, das bereits in vielen anderen Programmen umgesetzt wurde, hält damit auch ins Schach Einzug: Es wird möglich, Daten nicht nur lokal, sondern auch auf einem Server zu speichern. Bei der Installation des Programms werden drei leere Datenbanken angelegt: «Repertoire Weiß», «Repertoire Schwarz» sowie «Meine Partien». Darüberhinaus kann der Nutzer nach Belieben zusätzliche Datenbanken erstellen, solange die maximale Größe von 200 MB nicht überschritten wird.

Diese Cloud-Datenbanken befinden sich sowohl auf dem lokalen Computer als auch in der «Wolke». Das Programm prüft bei jeder Verbindung mit der ChessBase-Cloud, welche der beiden Datenbanken aktueller ist und synchronisiert selbständig die Versionen.
Die Vorteile dieser neuen Technik liegen auf der Hand. Von jedem beliebigen Computer kann man durch Aufruf der URL http://mygames.chessbase.com und Eingabe der Login-Daten auf die Cloud-Datenbanken zugreifen, auch wenn auf diesem Rechner kein ChessBase installiert ist. So kann man schnell und unkompliziert das eigene Repertoire durchsehen, Analysen studieren und bearbeiten oder trainieren. A propos Training: Für Trainer ist die Cloud ein nützliches Hilfsmittel, um den Schülern Material zur Verfügung zu stellen oder mit ihnen zu interagieren, ohne sich persönlich oder auf einem Server treffen zu müssen. Der Trainer kann Materialien vorbereiten, in die Cloud einstellen und den jeweiligen Schüler einladen, was diesem die Möglichkeit gibt, auf die Datenbank zuzugreifen.
 Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.
Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.
Neben der Cloud bietet das neue ChessBase verschiedene Detailveränderungen, die das Leben des Benutzers erleichtern. So muss man zur Kommentierung von Partien nicht mehr auf die rechte Maustaste zurückgreifen, da nun eine Leiste unter der Notation die wichtigsten Funktionen und Symbole bereitstellt. Nur am Rande sei die Frage gestellt, wieso nicht gleich alle Symbole, die ChessBase zur Kommentierung einer Partie anbietet, implementiert wurden.

Diese Leiste erleichtert die Eingabe deutlich. Für die im Screenshot dargestellte Variante samt Text und Symbolen benötigte ich mit der Leiste 5 Klicks, mit der alten Methode deren 9. Und auch eine zweite kleine Neuerung spart Zeit: Gibt man einen von der Partiefortsetzung abweichenden Zug ein, legt ChessBase nun sofort eine Variante an, statt wie früher ein Kontextmenü mit den Optionen «Neue Variante – Neue Hauptvariante – Überschreiben – Einfügen» zu öffnen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich dann nacharbeiten, wenn man ausnahmsweise wirklich die Partiefortsetzung überschreiben möchte.
Der obige Screenshot zeigt eine weitere Neuerung: Neben den Spielernamen werden nun die Bilder der Spieler angezeigt, und zwar die zeitlich am besten passenden aus der Spielerdatenbank. Klickt man die Fotos an, sieht man eine größere Version. Ein Klick auf die Spielernamen öffnet den Personalausweis, ein Klick auf den Turniernamen die Turniertabelle.
Ein nettes neues Feature ist die Möglichkeit, verschiedene Wertungszahlen zu speichern. Gerade die Unterteilung zwischen nationalen und internationalen Wertungszahlen halte ich für sehr sinnvoll, divergieren diese beiden Zahlen doch gerade bei Amateuren, die nicht regelmäßig Turniere mit Eloauswertung bestreiten, erheblich. Daneben kann man auch Blitz-, Schnellschach- und Fernschach-Wertungszahlen speichern.
Eine neue Analysemöglichkeit besteht darin, gezielt eine oder mehrere Positionen einer Partien vertieft bewerten zu lassen. Dazu werden Analyseaufträge angelegt, die das Programm abarbeitet. Dies ist sehr nützlich, um Schlüsselmomente der Partie auszuloten.
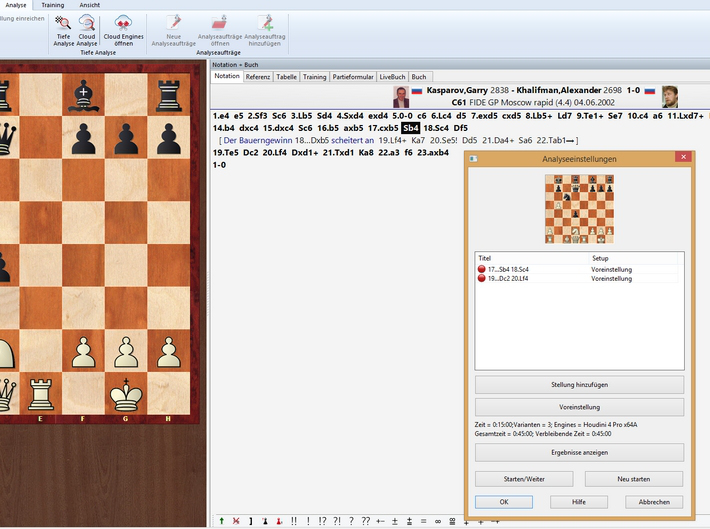
Zuletzt die technischen Mindestvoraussetzungen, wie sie der Hersteller selbst angibt:
Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM, DVD-ROM Laufwerk, Windows Media Player 9 und Internetverbindung (Aktivieren des Programms, Playchess.com, Let’s Check, Engine Cloud und Updates).

Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück der neuen Schachdatenbank ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg.
Fazit: Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück von ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg. Weitere Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion sind eher dem Bereich der Feinjustierung zuzuordnen; sie sind nützlich, jedoch nicht bahnbrechend. Um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen: Wer auf die Möglichkeiten der Cloud verzichten kann und bereits ChessBase 12 besitzt, für den stellt das neue ChessBase keinen Pflichtkauf dar. Für den Trainer oder Turnierspieler jedoch, der schnell auf wichtige Datenbanken zugreifen oder diese mit anderen teilen möchte, bietet ChessBase 13 durch die Cloud eine großartige Neuerung. ■
Chessbase GmbH: Chessbase 13 – Software-Schach-Datenbank, DVD, ISBN 978-3-86681-448-6
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
111 Chess Tacticals (44)
.
Schwarz am Zuge gewinnt
 Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. –
Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. –
Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■
.
.
.
.
.
Guillaume Connesson: «Lucifer», Cellokonzert (Jérôme Pernoo, Jean-Christophe Spinosi)
.
Infernalisches Klangspektakel
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 Schlägt man das Booklet zu dieser Neuveröffentlichung aus dem Hause Deutsche Grammophon auf, so ist dort über den 1970 in einem Vorort von Paris geborenen Komponisten Guillaume Connesson folgendes zu lesen: «Der 1970 geborene Guillaume Connesson ist zu jung, um sich jenem ideologischen und ästhetischen Diktat beugen zu müssen, das die vorangegangene Generation von Komponisten eingeengt hat. Seine Musik, immer wohlklingend und oft spektakulär hat eine Vielzahl von Einflüssen in sich aufgesogen. Seine ganze persönliche Welt ist das ‚Work in Progress’, welches aus jener Mischung von Pragmatismus und Naivität erwächst, die das Markenzeichen aller großen Schöpfer von Musik ist.»
Schlägt man das Booklet zu dieser Neuveröffentlichung aus dem Hause Deutsche Grammophon auf, so ist dort über den 1970 in einem Vorort von Paris geborenen Komponisten Guillaume Connesson folgendes zu lesen: «Der 1970 geborene Guillaume Connesson ist zu jung, um sich jenem ideologischen und ästhetischen Diktat beugen zu müssen, das die vorangegangene Generation von Komponisten eingeengt hat. Seine Musik, immer wohlklingend und oft spektakulär hat eine Vielzahl von Einflüssen in sich aufgesogen. Seine ganze persönliche Welt ist das ‚Work in Progress’, welches aus jener Mischung von Pragmatismus und Naivität erwächst, die das Markenzeichen aller großen Schöpfer von Musik ist.»
Obwohl man Elogen wie diese von Bertrand Dermontcourt nicht sonderlich lieben muss, so ist an diesen Worten schon etwas dran. Connesson, der heute eine Professur für Orchestration am Conservatoire National de Région d’Aubervilliers bekleidet, schöpft definitiv und vollkommen sorglos aus dem Vollen. Da beste Beispiel ist da das hier eingespielte Ballet en deux actes sur un livret du compositeur «Lucifer», das 2011 uraufgeführt wurde. Die enorm farbenreiche, geradezu glitzernde Partitur des «Lucifer» deckt stilistisch so ziemlich alles zwischen dem Sacre, Sandalenfilmmusik aus dem Hause Metro Goldwyn Mayer und groovigem Jazz ab. Ein buntes, wildes, ziemlich ungehemmtes Treiben, das in seiner gewissen Prinzipienlosigkeit rundum höchst unterhaltsam und darum auch – im Gegensatz zu so vielen, vielen Kompositionen der Moderne und Postmoderne – in jedem Falle massenkompatibel ist. Massenkompatibel sind übrigens auch die Thematik der Ballettmusik und auch das von der Deutschen Grammophon gestaltete Cover, das einen düsteren Wasserspeier an der Kathedrale Notre Dame in Paris zeigt. Frakturähnliche rote Buchstaben präsentieren den Namen «Lucifer». Es ist das Dunkle, Gothicmäßige, Gruselig-Abgründige, das hier mit Werk und Aufmachung bemüht, bedient und schlussendlich verkauft werden. Nicht umsonst wird das Konzert für Violoncello und Orchester, das ebenfalls auf der CD enthalten ist, verschwiegen. Die CD kommt also daher als böte sie eine Art Soundtrack für das Wave-Gothic-Festival Leipzig. Trifft die Phrase «Classic goes Pop» irgendwo zu, dann sicher hier. Das dürfte auch im Sinne Connessons sein, der mit seiner Musik (nicht nur) in Frankreich bestens ankommt und eine Reihe unterschiedlichster Preise, beispielsweise den vom Institut de France vergebenen Cardin-Preis (1998), den Nadia und Lili Boulanger-Preis (1999) oder – im Jahre 2006 – den Grand Prix Lycéen des Compositeurs erhalten hat. Guillaume Connesson hat von Beginn seiner Karriere an Elemente des Pop zu Themen seines Werkes gemacht hat, etwa in «Techno Parade», «Disco-Toccata» oder «Night Club». Warum also nicht auch hier?

Komponist Guillaume Connesson (links) und Dirigent Jean-Christophe Spinosi während der Aufnahmearbeiten zu “Lucifer”
Tritt man nun einen Schritt vom Marketing zurück und hört der Musik aufmerksam zu, dann präsentiert sich «Lucifer» als durchaus packende neue Musik, als eine neue Musik, die in der Lage ist, auch den der arrivierten «Klassik» nicht ganz so nahe stehenden Hörer zu fesseln. Das Werk, im Prinzip zwar eine Ballettmusik, aber laut Connesson gleichzeitig eine «große Symphonie», ist in sieben Abschnitte unterteilt, denen der Komponist einen Titel und jeweils einen kleinen Text voranstellt. Es wird – die Überraschung ist nicht groß – von «Le Couronnement du Porteur de Lumière» bis zum «Épilogue» der Fall Luzifers vom größten aller Engel zum verstoßenen König der Hölle «erzählt», allerdings verquickt mit Elementen der Prometheus-Sage. Es ist die Liebe zu einer Menschenfrau, die seine Verurteilung und seinen Fall herbeiführt. Im Épilogue tritt schließlich der Mensch «an sich» auf, der die Krone des Luzifer findet und sich – hier hat die Symbolik etwas unschön Gewolltes – von dieser dunklen Macht enorm fasziniert zeigt.
Zur Musik: Das Werk eröffnet mit der Krönungsszene Lucifers («Le Couronnement du Porteur de Lumière»). Musikalisch ist das zunächst schon ziemlich packend. Wilde Skalen in allen Instrumentengruppen, entfernt orientalische Klänge und starke Betonung des rhythmischen. Dann ein plötzlicher Stimmungswechsel. Streicherglissandi leiten einen nach Science Fiction klingen Abschnitt ein, eine liebliche Oboenmelodie schleicht sich ein, der Gesang wird von Celli ausgenommen. Das Orchester wird satter und baut einen Höhepunkt von düsterer Größe im üppigsten Cinemascope-Sound auf. Zu dieser Musik hätte Cecil B. DeMilles Moses problemlos das Rote Meer teilen können. Dann Rückkehr zum Bacchanal. Der zweite Satz «Le voyage de Lucifer» ist als Scherzo angelegt. Streicher, Holzbläser und der üppig bestückte Percussionsapparat rasen in wilder Jagd jazzig dahin. «La Recontre», die Begegnung Lucifers mit der Menschenfrau, sieht Connesson als das «Herz» des Werkes. Tatsächlich ist auch dies ein höchst hörenswertes Stück Musik. Geheimnisvoll tastend der Beginn, langsam etabliert sich – um Verdi zu zitieren – eine «melodie lunghe, lunghe, lunghe» in den Violinen. Der Satz gewinnt zusehends an Fülle, an Körper und entwickelt sich zu einer rauschhaft-orgiastischen Liebesmusik, die sich erneut auf eine wuchtige Metro-Goldwyn-Mayer Klimax hinwälzt, die nicht nur von fern an den frühen Mahler erinnert. Nach «La Recontre» ist es dann aber mit dem Einfallsreichtum vorbei. Sicher, auch die sich anschließenden Sätze «Le Procès», «La Chute», «L’Ailleurs» und «Épilogue» klingen gut, aber sie bringen nichts Neues. Immer und immer wieder rasende Skalen, Jazzrhythmen, Breitwandklänge. Hinzu kommt, dass der Eklektizismus überhand nimmt. Immer wieder fühlt man sich erinnert. Mal klingt Connesson nach Howard Shore (Le Procès) und mal nach Vaughan Williams’ «Sinfonia antartica» und dem «Sacre» (L’Ailleurs). Schließlich scheint der Épilogue des «Lucifer» klanglich und atmosphärisch fast den «Epilogue» der «London Symphony» (ebenfalls Vaughan Williams) imitieren zu wollen. Nach knapp 40 Minuten, die den Hörer angesichts des durchaus ansprechenden Klangspektakels wohl bei Laune halten, stellt man sich dennoch unweigerlich die Frage, ob das nun Musik ist, die über ihren knallbunten Eventcharakter hinaus etwas aussagt, etwas trägt oder ob sie das überhaupt will. Das etwas aufgepfropft wirkende «Programm» legt es zwar nahe, zurück bleibt aber der schale Geschmack einer eigentümlichen Leere.
Uneingeschränkt zu loben ist das atemberaubende Spiel des Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi, das sich mit Elan auf diese musikalische Spielwiese wirft und sich mit rechtem Gusto austobt, sodass die Funken nur so fliegen. Wenn Connessons «Lucifer» lediglich den Anspruch hätte, ein Werk sein zu wollen, das zeigen möchte, was an Klang und Virtuosität aus einem großen Orchester herausgekitzelt werden kann, dann wäre dieses als Plädoyer für die Möglichkeiten des Orchester bestens gelungen.

«Irrsinnige Spielfreude»: Solo-Cellist Jérôme Pernoo
Viel Klangzauber bietet auch das 2008 entstandene Cellokonzert in fünf Sätzen, die – so Connesson wiederum auf «zwei Akte» aufzuteilen sind. Auch hier finden sich im Beiheft allerlei Erklärungen dazu, wie das Werk zu verstehen sei und das, obwohl das Stück durchaus ohne Verstehenshinweise auskommt. Auch das Cellokonzert ist im Wesentlichen ein virtuoses Stück, das nicht nur den Cellisten, sondern auch das Orchester vor recht heikle Aufgaben stellt, und zwar nicht nur die nackte Spieltechnik betreffend, sondern ganz besonders, was die Vielfältigkeit und rasante Wechselhaftigkeit im Audruck angeht. Kaum sind die blockhaft-vehementen ersten Minuten des ersten Satzes «Gratinique» (hier sollen kalbende Eisberge inspirierend Pate gestanden haben) vorbei, schon gilt es eine zauberhaft klagende Atmosphäre im Mittelteil zu erschaffen. Das sich direkt anschließende «Vif» bringt Atemlosigkeit und unglaubliche Rasanz. Dann eine große «naturmagische» Musik im «Paradisiaque», in der das Cello zu einem großen Gesang anhebt, der nostalgischer, sentimentaler und bittersüßer kaum daher kommen könnte. Die «Cadence» fordert dem Solocellisten alles ab, was menschenmöglich ist, rausgeschmissen wird im letzten Satz «Orgiaque» mit Bacchanal-Stimmung, Jazz und Dixiland-Reminiszenzen.

Das Cellokonzert und die Balletmusik «Lucifer» von Guillaume Connesson sind packende, glitzernde, virtuose Musikstücke, deren spektakulärer Charakter jedoch nicht unbedingt einen lang anhaltenden Eindruck hinterlässt. Die Ausführung durch den Cellisten Jérôme Pernoo und dem unter Jean-Christophe Spinosi spielenden Orchestre Philharmonique de Monte ist tadellos.
Cellist Jérôme Pernoo leistet hier spielerische und gestalterische Schwerstarbeit und wird dieser ausufernden, mäandernden, ja schon bald überladenen Cellopartie mit einer schon fast irrsinnigen Spielfreude gerecht. Das Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi stehen dem in nichts nach.
Und doch stellt sich im Anschluss die Frage: Was bleibt? ■
Guillaume Connesson: Lucifer & Cellokonzert, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Jean-Christophe Spinosi, Jérôme Pernoo, Deutsche Grammophon 481 1166. 1, Audio-CD
.
.
.
.
Interview mit dem Schach-Autor J. Carlstedt («Die kleine Schachschule»)
.
Jonathan Carlstedt: «Die kleine Schachschule»
Thomas Binder
.
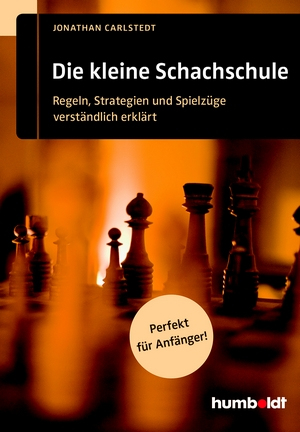 Der junge Hamburger Bundesliga-Spieler Jonathan Carlstedt gehört seit kurzer Zeit zu den Exponenten der Deutschen Schachszene. Neben dem eigenen Spiel arbeitet er als Geschäftsführer der Schachschule Hamburg, schreibt als Journalist und Online-Autor für verschiedene Medien und hat seit 2010 bereits mehrere Bücher vorgelegt. Dabei wendet er sich an die ganze Breite des Schachpublikums. Sind die Eröffnungsbücher sicher dem Experten vorbehalten, galten die beiden Werke unter dem Obertitel «Die große Schachschule» dem engagierten Turnier- und Vereinsspieler. Mit der «Kleinen Schachschule» wird das Spektrum der Zielgruppen nun gewissermaßen «nach unten» abgerundet, verkündet doch schon die Titelseite «Perfekt für Anfänger!»
Der junge Hamburger Bundesliga-Spieler Jonathan Carlstedt gehört seit kurzer Zeit zu den Exponenten der Deutschen Schachszene. Neben dem eigenen Spiel arbeitet er als Geschäftsführer der Schachschule Hamburg, schreibt als Journalist und Online-Autor für verschiedene Medien und hat seit 2010 bereits mehrere Bücher vorgelegt. Dabei wendet er sich an die ganze Breite des Schachpublikums. Sind die Eröffnungsbücher sicher dem Experten vorbehalten, galten die beiden Werke unter dem Obertitel «Die große Schachschule» dem engagierten Turnier- und Vereinsspieler. Mit der «Kleinen Schachschule» wird das Spektrum der Zielgruppen nun gewissermaßen «nach unten» abgerundet, verkündet doch schon die Titelseite «Perfekt für Anfänger!»
Carlstedts Werk reiht sich in die Tradition klassischer Schach-Lehrbücher für «Jedermann», wie sie seit mehr als 100 Jahren einen Urtyp der Schachliteratur darstellen. Kann man dieses Genre noch mit neuen Ideen bereichern?
Blicken wir zunächst auf die grobe Gliederung des Werkes: Wir haben vier wesentliche Abschnitte vor uns:
– Die Grundbegriffe und Regeln des Schachspiels werden auf ca. 40 Seiten erklärt
– Es folgen knapp 70 Seiten über Eröffnungen
– Das Mittelspiel wird auf ca. 60 Seiten abgehandelt
– Mit gut 40 Seiten ist das Endspielkapitel eher knapp bemessen
– Den Abschluss des Buches bildet ein kurzer Essay «Die Welt der Schachszene», (dem der Rezensent gerne etwas mehr Umfang und Tiefgang gewünscht hätte).
Das einführende Kapitel vermittelt das regeltechnische Rüstzeug jeder Schachpartie, leider noch nicht auf dem Stand der 2014 geänderten FIDE-Regeln (bei Stellungswiederholung und 50-Züge-Regel).
In den folgenden Hauptkapiteln hat es sich Carlstedt zur Aufgabe gemacht, dem «Anfänger» deutlich mehr zu vermitteln, als es vergleichbare Bücher tun. Exemplarisch dafür ist das Eröffnungskapitel. Nach Vermittlung der Grundstrategien (Figurenentwicklung, Königssicherheit) führt der Autor den Leser in einige wichtige Eröffnungssysteme ein. Dabei findet Jonathan Carlstedt das für einen Spieler auf Anfänger-Niveau passende Maß zum Verständnis der vorgestellten Eröffnungen. Bei jedem Zug wird dargestellt, inwiefern er seinen Beitrag zu den Grundzielen des Eröffnungsspiels leistet. Streiten könnte man allenfalls über das Mengenverhältnis (acht Seiten Königsgambit vs. fünf Seiten Sizilianisch) und über die Auswahl der Systeme. So fehlen etwa mit der Pirc-Verteidigung oder Russisch auch Eröffnungen, die einem Anfänger sehr wahrscheinlich recht bald begegnen werden.
Als ein Juwel unter vielen möchte ich hervorheben, wie der Autor die «fried liver attack» des Zweispringerspiels (freilich ohne sie beim Namen zu nennen) behandelt. Ich selbst habe schon viele Schach-Eleven ob der doppelten Bedrohung des Punktes f7 regelrecht verzweifeln sehen. Schade nur, dass in diesem Buch der betreffende Text im Abschnitt «Italienische Partie» versteckt ist.
Unter dem Oberbegriff «Mittelspiel» führt Carlstedt in die wichtigsten taktischen Manöver und strategischen Motive ein. Der Leser lernt Fesselungen, Gabeln, Spieße, Abzüge ebenso kennen wie grundlegendes Wissen über Bauernstrukturen und -schwächen. Auch die Eigenheiten der einzelnen Figuren und die Konsequenzen für ihren optimalen Einsatz werden besprochen. Ein (zu) kurzer Abschnitt über den Königsangriff beschließt das Mittelspiel-Kapitel.
Bei den Endspielen widmet Carlstedt den verschiedenen Aspekten der Bauernumwandlung (Opposition, Randbauer, Quadratregel) breiten Raum. Es folgen einige wichtige Stellungen zum Endspiel «Turm&Bauer gegen Turm». Das ist sicher eines der anspruchsvollsten Kapitel des Buches, und Jonathan Carlstedt präsentiert es so gekonnt, dass auch der «Anfänger» jederzeit folgen kann. Überraschend: Erst danach geht er auf die elementaren Matts mit den Schwerfiguren ein. Insgesamt hätte man dem Endspiel-Kapitel sogar etwas mehr Umfang gewünscht. Da bleiben einige Themen offen, die man auch der Zielgruppe dieses Buches zumuten kann. Andererseits wäre selbst ein Anfänger-Lehrbuch der Schach-Endspiele gut und gerne so stark wie die ganze vorliegende «Kleine Schachlehre» – so bietet sich das vielleicht für ein Nachfolgeprojekt an.
Das Buch im handlichen Taschenbuchformat ist auf hochwertigem Papier produziert und sorgfältig redigiert. Der Sprachstil des jungen Autors macht Freude, seine bereits enorme Erfahrung als Trainer ist auf jeder Seite zu verspüren.
Circa 200 Stellungsbilder unterstützen in perfekter Weise das Verständnis. Diese Diagramme wurden offenbar mit Chessbase-Software erstellt. Dabei nutzt Carlstedt die Möglichkeit der Verdeutlichung von Ideen und Plänen mit farbigen Pfeilen und Feldmarkierungen. Allerdings geht die visuelle Aussagekraft dieses Gestaltungsmittels beim Schwarz-Weiß-Druck fast völlig verloren und in einigen Fällen ist die Erkennbarkeit gerade dadurch sogar eingeschränkt.

Jonathan Carlstedt legt ein modernes «Anfänger-Lehrbuch» vor. Ansprechende Gestaltung und frischer Schreibstil tragen zum Erfolg des Werkes bei.
Bleibt die Frage, an welche Zielgruppe sich das Buch richtet. Carlstedt ist insofern konsequent, dass er keine spezielle Zielgruppe anspricht. Insbesondere fehlen jegliche spielerischen Elemente, wie man sie aus Kinder-Schach-Lehrbüchern kennt. Die Ansprache des Lesers orientiert sich am erwachsenen, allenfalls jugendlichen Schachschüler. So ist die Zielgruppe wohl nicht an Altersgruppen festzumachen, sondern am Einsteiger, der sich auf das anstrengende aber wunderbare Abenteuer einlassen will, das Schachspiel «von der Pike auf» zu erlernen. Wer das vorliegende Buch konzentriert durcharbeitet und das Gelernte umsetzt, wird schon nach wenigen eigenen Partien die ersten Früchte der Arbeit ernten.
Carlstedt schreibt im Vorwort: «Bücher schreiben macht Spaß». Wenn der Leser diesen Spaß des Autors nachempfindet, ist das Werk gelungen. Ich habe ihn nachempfunden! ■
Jonathan Carlstedt: Die kleine Schachschule – Regeln, Strategien und Spielzüge verständlich erklärt, Humboldt Verlag, 224 Seiten, ISBN 978-3-86910-209-2
.
.
.
.
Interview mit dem Schach-Autor Jonathan Carlstedt
«Der Schach-Sport ist – richtig verpackt – sehr kommunikativ»
.
Glarean Magazin: Herr Carlstedt, stellen Sie sich zunächst unserer Leserschaft kurz vor?
Jonathan Carlstedt: Ich bin 24 Jahre alt. Nachdem ich 2010 mein Abitur in Hamburg gemacht habe, begann ich selbstständig als Schachspieler/-Trainer/-Autor/-Journalist zu arbeiten. Inzwischen bin ich Internationaler Meister, trainiere ca. 25 Schüler, schreibe für den Deutschen Schachbund, bin Geschäftsführer des Hamburger Schachklubs und der Schachschule Hamburg, Organisator des VMCG-Schachfestivals und selber als Spieler auf diversen Turnieren und in der ersten Bundesliga aktiv. Außerdem verfasse ich regelmäßig Schachbücher und -Artikel.
GM: Was läuft in Deutschland bei der öffentlichen Darstellung des Schachs als Wettkampfsport falsch? Was kann/muss man besser machen um das Image des Schachsports aufzupolieren?
JC: Vermutlich muss man hier differenzieren. Wir haben zum einen die externen Umstände, bis zu einem gewissen Punkt passt Schach nicht in unsere Zeit. Schach ist ein stiller Sport, in dem nicht derjenige recht hat, der am lautesten schreit, sondern derjenige, der die besten schachlichen Argumente hat. Meine sehr und ganz persönliche Meinung ist, dass dieser Ansatz in unser Gesellschaft, die Kraft des Arguments über der Kraft der Lautstärke, immer weniger eine Rolle spielt und Schach als dessen Vertreter geringere Chancen als andere Sportarten hat, akzeptiert zu werden.
Gerade bin ich in Dresden, hier spielen 10 der stärksten Frauen des Landes ein Turnier mit einem Preisfond von 10’000 Euro in äußerst professioneller Atmosphäre. Nun ist die Frage: Wie können wir das Interesse der Medien und damit der Öffentlichkeit gewinnen. Anscheinend ist es möglich, das für einen Schach-WM-Kampf zu schaffen. «SPIEGEL Online» und «Zeit online» berichten ausführlich mit großartiger Berichterstattung. Um eine regelmäßige Darstellung wie andere «Mainstream»-Sportarten zu erreichen, müssen wir in gemeinsamer und vor allem koordinierter (etwas was gelegentlich fehlt) Anstrengung versuchen, ein Grundverständnis für unser Spiel bei der breiten Masse zu erzeugen. Dann haben wir die Chance, auch in der öffentlichen Wahrnehmung häufiger eine Rolle zu spielen.
Aber was ist das Image des Schachsport? Freaks ohne Anschluss? Sportart für Super-Intelligente? Schul-AG für Außenseiter? Wenn dem so ist, dann müssen wir etwas tun! Das geht nicht von heute auf morgen, denn die Diskussion wurde in der Schachszene bisher nicht geführt, ob wir nicht gut daran tun, eine Randsportart zu sein. Meine Meinung dazu ist klar: Unser Sport ist interessant, richtig verpackt sehr kommunikativ, und wenn Sie sich heute die Topspieler anschauen, haben wir intelligente, durchtrainierte Leistungssportler, die sich verkaufen können. Mit hochwertiger und beständiger Öffentlichkeitsarbeit können wir ins Bewusstsein der Bevölkerung treten. Konkret und kurzfristig müssen wir freundlicher zu Einsteigern werden, denn in den Vereinen ist das Bild in der Tat teilweise schmuddelig. Auch wenn ich vermutlich einige böse Mails bekommen werde, müssen frische Klamotten, Deo, gepflegtes Auftreten und Genuss von Alkohol nur zur späten Stunde ungeschriebenes Gesetz im Verein werden.
Zusammenfassend also: Wir sind unseres Glückes Schmied, konstante Öffentlichkeitsarbeit, die bereits geleistet wird, zusammen mit einem gemeinsamen Bewusstsein für deren Wichtigkeit sind die beiden Eckpfeiler uns in der breiten Öffentlichkeit zu etablieren.
GM: Sie sind Geschäftsführer der Schachschule Hamburg. Sie haben jetzt Gelegenheit ein wenig Werbung für dieses Projekt zu machen :-)
JC: Die Schachschule Hamburg bietet Schachinteressierten jeden Alters und jeder Spielstärke vom Anfänger bis zum Bundesligaspieler «offline»-Trainingsmöglichkeiten (wie man das glaube ich neudeutsch nennt) an. Dabei versuchen wir uns nach den Bedürfnissen und Wünschen der jeweiligen Interessenten zu richten und haben unser Trainingsangebot entsprechend breit aufgestellt. Jeder der also irgendwie an Schach interessiert ist, ist bei uns genau richtig! :-)
GM: Professionelle Schachschulen mit kommerzieller Ausrichtung scheinen sich in Deutschland wachsender Beliebtheit zu erfreuen. Wie schätzen Sie auf lange Sicht den Markt für solche Projekte ein? Wie sehen Sie diese Schulen im Spannungsfeld der «klassischen» Ausbildungswege junger Schachspieler wie Schulschach-AGs, Schachvereine und ggf. das Training der Verbandskader und schließlich den vielen neuen Spiel- und Trainingsansätzen im Internet?
JC: Die Schachschule Hamburg ist aus dem Hamburger Schachklub, dem größten Schachverein Deutschlands, entstanden und ein Teil dieses Schachklubs. Zwar verstehen wir uns als Unternehmen, müssen und wollen aber auch den Ideen eines gemeinnützigen Vereins wie dem Hamburger Schachklub genügen.
Der Markt für Schachschulen ist aus meiner Sicht sehr groß. Wir haben in Deutschland 90’000 eingetragene Schachspieler, davon alleine können Schachschulen nicht leben. Die Zahl derjenigen, die im Kindesalter oder wann auch immer die Grundregeln kennengelernt haben und grundsätzlich Interesse am Schachspiel bzw. -sport haben, ist ungleich größer. Wenn sich die «Schachszene» weiterhin diesen Umstand bewusst macht, ist der Markt noch lange nicht gesättigt. Übrigens eine Tendenz, die ich aus meiner selbstständigen Arbeit als Trainer untermauern kann. Allein in den vergangenen zwei Monaten musste ich sieben Anfragen von Schülern ablehnen, da ich keine Zeitkapazitäten mehr habe.
Für uns ist Schachschule und Schulschach kein Spannungsfeld, sondern die Grundlage für unsere Existenz. Unheimlich viele engagierte Trainer leisten an Schulen ehrenamtliche Arbeit, die die Basis dafür ist, dass Menschen wie ich und Institutionen wie die Schachschule wirtschaftlich arbeiten können. Ohne den Unterbau der dort geschaffen wird, kann es weiter in der Spitze bzw. für die Spitze keine Zukunft geben.
Auch das Internet ist, denke ich, förderlich für den Schachsport. Auf jeden Fall müssen wir uns nicht davor fürchten. Jene die ohnehin lieber in ihren eigen vier Wänden bleiben, haben das auch schon vor dem Aufkommen des Internets getan. Der Vorteil des Internets, aus Schachspieler-Sicht, ist, dass man schneller und unkomplizierter mit dem Schachsport in Berührung kommt. Unsere Aufgabe ist es, all jenen, die über das Internet zum Schachsport gekommen sind, Angebote zu unterbreiten, in den Verein zu kommen. Denn seien wir ehrlich: Bei einem Bierchen oder für Kinder und Jugendliche einer Cola in der realen Welt eine Partie Schach zu spielen, entspricht deutlich eher den menschlichen Bedürfnissen, als im eigenen Kämmerlein gegen anonyme Gegner zu spielen. Und auch wenn es einige nicht glauben, die meisten Schachspieler sind sogar extrem in Ordnung.
GM: Sie bieten auch Anfänger-Kurse für Erwachsene und Kurse für Senioren an. Wie werden diese Angebote angenommen?
JC: Im Grundsatz sind wir mit dem Zuwachs an Interessenten zufrieden. Trotzdem muss man einen Unterschied machen zwischen Erwachsenen, die im Berufsleben stehen und Senioren. So laufen die Seniorenkurse, die wir wöchentlich beispielsweise von 10 bis 12 Uhr anbieten, hervorragend. Berufstätige nach der Arbeit noch von 19 bis 21 Uhr für ein Schachtraining zu begeistern ist, wenn auch nicht unmöglich, doch schwierig. Deshalb gehen wir hier einen zweiten Weg: Wir bieten sogenannte Kompaktkurse an, Kurse also, die an einem Samstag gehalten werden und weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Kurse sehr gut geeignet sind, damit man seinen Partner mitnimmt, um anschließend gut gerüstet zu sein bei einem abendlichen Glas Rotwein auf dem Balkon eine Partie Schach zu spielen. Es ist nicht unser Ziel, jeden zu einem Großmeister zu machen.
Dieses Angebot wollen wir ausbauen, mit Eltern/Kind-Kursen und Trainings, die nicht bei uns, sondern in den Schulen vor Ort stattfinden. Wir haben hier noch einen weiten Weg zu gehen, sind aber überzeugt, dass dies der Richtige ist.
GM: Zu Ihrem neuesten Buch, der «Kleinen Schachschule». Zunächst war ich etwas verwirrt, nach zwei Büchern unter dem Label «Große Schachschule» jetzt auf die «Kleine Schachschule» zu treffen. Können Sie uns Ihre bisherigen Buchprojekte vorstellen und einen Blick auf die nächsten Pläne werfen?
JC: Da muss ich etwas weiter ausholen, aber da ich bisher schon ellenlang geantwortet habe, mögen mir die Leser das verzeihen :-)
Mein erstes Buch schrieb ich im zarten Alter von 19 Jahren, zeitgleich zur Lernphase meines Abiturs. «Die Englische Eröffnung» war der Titel und behandelt eine Schacheröffnung, die ich seit ich denken kann, spiele. Im Anschluss folgte «Die große Schachschule» Damals hatte ich eine Schachschule in Lüneburg und ich habe große Teile des Lehrplans meiner Schachschule in dieses Buch integriert, es folgte ein weiteres Eröffnungsbuch «Die Tarrasch-Verteidigung», ein Buch das aus meiner Sicht für die «Eingeweihten» eine Menge interessante neue Ideen beinhaltet. Anschließend schrieb ich «Die große Schachschule: Aus den Fehlern der Großmeister lernen». Hier habe ich 25 Partien analysiert, an vielen war ich selber beteiligt, wo eine Seite, vertreten durch einen Profispieler, einen schweren Fehler begeht. Mein Versuch war es, und ich hoffe er ist mir gelungen, diesen Fehlern auf den Grund zu gehen und «en passant» weniger erfahrenen Schachfreunden einen Einblick in die Schachszene zu geben.
Zu guter Letzt also «Die kleine Schachschule», auf die ich ebenfalls sehr stolz bin. Einerseits ist sie inhaltlich aus meiner Sicht gut geworden, außerdem hat mal wieder der Verlag hervorragende Arbeit geleistet, was Layout etc. angeht.
Zukünftige Projekte… Mein Plan war eigentlich weniger zu arbeiten :-) Derzeit gibt es einige Angebote Bücher zu schreiben. Meine Idee ist allerdings, einfach eins zu schreiben, ohne dass jemand davon weiß und es dann einem Verlag anzudrehen. Ich habe immer noch die sehr romantische Vorstellung mich einmal in ein Haus auf einer fernen Insel einzuschließen, dort zwei Monate an einem Buch zu schreiben, ohne von außen gestört zu werden. Vielleicht kennen Sie ja einen Verlag mit einem Haus auf einer karibischen Insel? ;-)
GM: Die «Kleine Schachschule» ist vom Typ her sicher mit klassischen Schachlehrbüchern zu vergleichen. Schach-Einführungen für Anfänger gibt es seit mehr als 100 Jahren. Sie erklären elementar die Regeln und geben kurze Abrisse zu Taktik-Motiven, strategischen Prinzipien, zur Eröffnungstheorie und Endspiellehre. Welche neuen Ideen haben Sie für diesen Lehrbuch-Typ eingebracht?
JC: In der «Kleinen Schachschule» geht es darum, kurz und bündig Interessenten am Schach unser Spiel näher zu bringen und ohne großes Hin und Her die Grundlagen zu bieten, um einfach mal eine Partie Schach zu spielen.
Meine neue Idee in dem Buch ist, früher auf grundlegende Strategien in den 3 Phasen Eröffnung Mittelspiel, Endspiel einzugehen. Meine Erfahrung aus den vielen Trainings und Lehrgängen mit Anfängern ist, dass man die Leute durchaus fordern kann und das Interesse am Schach auch und vor allem in den Strategien begründet ist. ■
.
.
.
.
Das klassische Glarean-Tangram (48)
.
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
Lösung: —>(weiterlesen…)
.
__________________________________
.
Das Tangram-Puzzle
 Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Schon in der uralten Kultur Chinas bedeutete das Quadrat die reinste Form einer Fläche, in sich vollkommen, und beim Tangram wird dieses in sich ruhende Quadrat nun aufgelöst in eine endlose Bewegung, wird es durch unablässige Veränderung zum Ausgangspunkt ungeahnter Gebilde, durch das Zusammenspiel seiner festen Elemente zum Quell des Neuen.
Die ersten Tangram-Bücher wurden zur Zeit des Ch’ing-Kaisers Chia Ch’ing (1796-1820) gedruckt, die früheste uns überlieferte Tangram-Publikation dort stammt aus dem Jahre 1813, doch das Grundprinzip des Spiels dürfte im asiatischen Raum schon lange vor Christi Geburt weit verbreitet gewesen sein. Eine frühe erste Veröffentlichung in Europa datiert aus dem Jahre 1805.
Inzwischen hat das Tangram einen wahren Siegeszug durch alle Kontinente angetreten, ist Gegenstand zahlreicher Bücher und Sammlungen geworden – und lädt unvermindert anregend und spannend ein zum Nachdenken, zum Knobeln, zum Sinnieren, ja vielleicht gar zum Philosophieren über die ewige Veränderung des ewig Gleichen…
Im «Glarean Magazin» finden sich regelmäßig interessante und berühmte Tangram-Aufgaben. Dabei wird das Lege-Puzzle erleichtert, wenn man sich aus Karton die sieben Grundelemente zurechtschneidet.
Sollten unter unseren Leserinnen und Lesern vielleicht sogar Tangram-«Erfinder» sein, so sind sie freundlich eingeladen, uns ihre neuen Figuren als Grafik-Datei zu senden! (we)
.
Ein Beispiel
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
.
.
Michel Bergmann: «Alles was war» (Erzählung)
.
«Ins Leben. Unbeschwert»
Günter Nawe
.
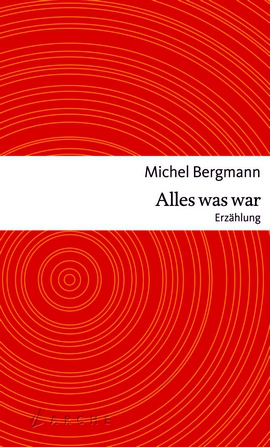 «Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.
«Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.
Von einem solchen Kind schreibt Michel Bergmann in seiner berührenden Erzählung «Alles was war». Es ist ein kleines großes Buch des Erinnerns – voller Trauer und voller Witz, melancholisch und heiter. Und er schreibt sicher von eigenem Erleben, denn dieser Michel Bergmann wurde 1945 als Kind jüdischer Eltern in einem Internierungslager geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Paris und Frankfurt/Main. Es waren seine Jahre als jüdisches Kind, als jüdischer Junge, die er in den 50er Jahren im Nachkriegsdeutschland verbrachte. In einem Land, das einerseits vom schrecklichen Geschehen während der Naziherrschaft und des Krieges traumatisiert war; andererseits aber auch noch längst nicht «entnazifiziert» war.
Bergmann ist bereits durch drei wunderbare Bücher literarisch auffällig geworden. Und das im besten Sinne. Mit seinen Romanen «Die Teilacher», «Machloikes» und «Herr Klee und Herr Feld» hat er von den Erlebnissen der Juden erzählt, die sich wieder in Frankfurt niedergelassen habe. Sie alle tragen schwer an dem Schicksal, das ihnen die Geschichte, das ihnen die Deutschen angetan haben.
Und nun also die Erzählung eines alten Mannes, der auf seine Kindheit zurückblickt. Er erinnert sich an die Schulzeit, daran, das er, den Ranzen auf dem Rücken, losrennt: «Ins Leben. Unbeschwert. Es ist sein Tag! Wie jeder Tag sein Tag ist!» Arzt soll er werden, stellt sich jedenfalls die Mutter vor, die mühsam wieder ein annähernd normales Leben zurückgefunden hat als Geschäftsfrau.
Dass das nicht einfach würde – alle wussten es, die den Weg des Jungen begleiteten. Erst aber einmal wird «gelebt». So stromert das Kind durch die Trümmergrundstücke. Er hat Freunde und später Freundinnen. Oft allerdings nur solange, bis herauskommt, dass er Jude ist. Freunde und Freude hat er in und mit der Familie, der Mischpacha, mit Freunden, den Chaverim. Er feiert unter etwas Weihnukka – eine Mischung aus Weihnachten und Chanukka. Er gerät in den einen und anderen Schlamassel. Voller Witz auch die Schilderung der Bar Mizwa, die der Junge trotz erster religiöser Zweifel über sich ergehen lassen muss.
In dreizehn wundervoll erzählten Kapiteln, teilweise im leicht jiddisch eingefärbten Deutsch, schreibt der alte Mann, hinter dem wir getrost Bergmann vermuten dürfen, sein kleine, seine exemplarische Geschichte, die für den Leser auch eine Art Geschichtsunterricht wird. Nicht dröge und keinesfalls belehrend, aber einfühlsam und bei aller Schwere leicht und mit Witz und einem gehörigen Schuss Melancholie. Und immer gegenwärtig in diesem jungen Leben sind die, die nicht mehr sind. Schließlich ist er «am Rande eines Massengrabs» aufgewachsen.
Der Junge wird älter. Er verliebt sich, wird betrogen, schafft gerade mal so das Abitur, genießt seine Freiheit und verachtet alles Angepasstheit und – auch sie gibt es wieder – die saturierte Bürgerlichkeit. Was aber steht hinter all dem? Kasches, Fragen, werden gestellt – und bleiben oft unbeantwortet. Die jüdisch-deutsche Problematik, die Geschichte der Juden in Deutschland sollte für den Ich-Erzähler später einmal von existenzieller Bedeutung werden.
Erst einmal aber wird er Volontär bei den «Frankfurter Rundschau». Auch kein Traumjob, aber… Hier lernt er den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer kennen. Dessen unermüdliches Engagement um den und im Auschwitz-Prozess ist beispielhaft gewesen. Mit großer Leidenschaft und großer Anteilnahme wird der junge Journalist.
Ein alter Mann erinnert sich. Auch daran, dass im Laufe der Jahre die Verbindung zur Mutter abgebrochen ist. Er erinnert sich an die Menschen, denen er in den Jahren seines Lebens begegnet ist. So trifft er bei der Beerdigung der Mutter einen alten Freund Marian wieder – und es war «wie am ersten Tag». Ihm wird er dieses kleine wundervolle Buch, diese auf ihrer Weise einzigartige Biografie widmen.

Die Geschichte einer jüdischen Kindheit im Deutschland der Nachkriegszeit – Michel Bergmann hat sie aufgeschrieben. Auch sie ein Kapitel deutscher Geschichte – wunderbar erzählt, heiter und witzig und voller Melancholie und Nachdenklichkeit. Ein kleines großes Buch, das traurig und zugleich glücklich macht.
Im letzte Kapitel, das bezeichnenderweise die Überschrift «Chaim – Leben» trägt, zitiert Michel Bergmann Søren Kierkegaard: «Das Leben kann nur nach rückwärts schauend verstanden, aber nur nach vorwärts schauend gelebt werden». In diesem Sinne hat Michel Bergmann dieses Buch geschrieben – und uns, seine Leser, auf wunderbare Weise beschenkt. ■
Michel Bergmann: Alles was war, Erzählung, Arche Verlag, ISBN 978-3-7160-2716-5
.
.
.
.
Das November-Streichholzrätsel im «Glarean Magazin»
.
Legen Sie eines der Streichhölzer so um, dass die Gleichung stimmt
.
Lösung: —>(more…)
.
.
Weitere Streichholz-Rätsel im Glarean Magazin
.
.
.
.
Drei Gedichte von Susanne Rasser
.
.
Richtungsweisend
Atem schöpfen, die Schultern
ausrichten. Den Kopf, den Blick
nicht senken.
Die schlechten Karten
wie Trümpfe auf den Tisch
legen. Abstoßen.
Aufstehen. Die Sohlen vom Boden
lösen, den Schritt
abfedern. Und dann,
immer den eigenen Füßen
nach, sie zeigen unverwandt
nach vorn.
.
.
.
Erstes Abendmahl
Nimm dir ein Herz,
gern auch meins,
fasse Fuß
im Mut.
Gib dem Zweifel
keinen Brösel
von dem Brot,
das ich buk,
das du nun
für uns brichst.
.
.
.
Bankrotterklärung, abgerissen
Kein Haus. Kein Baum. Kein Kind.
Keinem Staat und auch der Kirche nicht.
Null Dienstbarkeitsgefühl. Kaum Machtgelüste.
Zig Träume in den Sand der Welt gesetzt.
Mal da, mal dort, mal schwer vermittelbar.
Gelebt: geliebt. Gelacht. Genossen.
Manch‘ Scherbe in den Fuß getreten,
somit aus dem Weg geräumt.
.
.
.
.
_____________________________________
Geb. 1965, lebt als Autorin von Lyrik, Erzählungen und Drehbüchern in Rauris/A
.
.
.
.
Der neue Sudoku-Spass im «Glarean»
.
Die Sudoku-Rätsel-Puzzles im November 2014
.
.Copyright 2014 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin
.
Sudoku – die Regeln
Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in
3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.
Jede Zeile, jede Spalte und jeder Block soll alle
Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten.
In ein paar der Felder sind bereits Zahlen vorgegeben.
Bei einem Sudoku darf es nur eine mögliche Lösung geben,
und diese muss rein logisch gefunden werden können.
.
Auflösung —> (weiterlesen…)
.
.
Klaus Merz: «Unerwarteter Verlauf» (Gedichte)
.
Lyrik vom Feinsten
Susanne Rasser
.
 In wenigen Worten alles sagen, aufs Wesentliche konzentriert. Fokussiert. Unaufgeregt. Nah bei sich. Nah an den Menschen. Doch dabei immer auf jenen Abstand bedacht, der Freiraum bietet, der ein Miteinander erst möglich macht.
In wenigen Worten alles sagen, aufs Wesentliche konzentriert. Fokussiert. Unaufgeregt. Nah bei sich. Nah an den Menschen. Doch dabei immer auf jenen Abstand bedacht, der Freiraum bietet, der ein Miteinander erst möglich macht.
Dem Schweizer Autor Klaus Merz gelingt genau das. Seit vielen Jahren schon. Und er stellt es mit seinem Lyrikband «Unerwarteter Verlauf» erneut unter Beweis, dass er ein Meister der punktgenauen Schnörkellosigkeit ist.
Der aus dem schweizerische Aarau stammende und in Unterkulm lebende Lyriker und Prosaschriftsteller gehört zu den Längst-Etablierten, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Basler Lyrikpreis und den Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012). Zudem ehrt der Innsbrucker Haymon Verlag seinen Hausautor mit einer Werkausgabe, die seit 2011 im Halbjahresrhythmus erscheint und insgesamt sieben Bände umfassen soll.

Der Schweizer Autor Klaus Merz stellt es mit seinem Lyrikband «Unerwarteter Verlauf» erneut unter Beweis, dass er ein Meister der punktgenauen Schnörkellosigkeit ist.
Klaus Merz gehört zu den bedächtigen, sehr gesetzten Autoren. Das Laute, Aufgebauschte ist seine Sache nicht. Und weil das Sich-Vergewissern etwas mit Gewissen zu tun hat, schaut er sehr genau hin, sortiert mit Bedacht und setzt auf ein menschliches Maß.
Merz gewährt uns mit seiner Lyrik Einblick in eine Welt, die frei ist von Trubel, Kraftmeierei und Trendgeschrei:
Wir drücken die Stirn / ans Fensterglas und / spenden leise Applaus. ■
Klaus Merz: Unerwarteter Verlauf – Gedichte, mit Vignetten von Heinz Egger, 80 Seiten, Haymon Verlag, ISBN 978-3-7099-7093-5
.
____________________________
Geb. 1965, lebt als Autorin von Lyrik, Erzählungen und Drehbüchern in Rauris/A
.
.
.
.
.
.
.
.
Das Musik-Kreuzworträtsel im Oktober 2014
.
Der neue Musik-Rätselspaß !
.
Copyright© 2014/10 by Walter Eigenmann
Rätsel ausdrucken (pdf)
Lösung: —>weiterlesen
.
.
.
111 Chess Tacticals (43)
.
Weiß am Zuge gewinnt
 Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des modernen Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. –
Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des modernen Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. –
Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■
.
.
.
.
.
Das klassische Glarean-Tangram (47)
.
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
Lösung: —>(weiterlesen…)
.
__________________________________
.
Das Tangram-Puzzle
 Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Schon in der uralten Kultur Chinas bedeutete das Quadrat die reinste Form einer Fläche, in sich vollkommen, und beim Tangram wird dieses in sich ruhende Quadrat nun aufgelöst in eine endlose Bewegung, wird es durch unablässige Veränderung zum Ausgangspunkt ungeahnter Gebilde, durch das Zusammenspiel seiner festen Elemente zum Quell des Neuen.
Die ersten Tangram-Bücher wurden zur Zeit des Ch’ing-Kaisers Chia Ch’ing (1796-1820) gedruckt, die früheste uns überlieferte Tangram-Publikation dort stammt aus dem Jahre 1813, doch das Grundprinzip des Spiels dürfte im asiatischen Raum schon lange vor Christi Geburt weit verbreitet gewesen sein. Eine frühe erste Veröffentlichung in Europa datiert aus dem Jahre 1805.
Inzwischen hat das Tangram einen wahren Siegeszug durch alle Kontinente angetreten, ist Gegenstand zahlreicher Bücher und Sammlungen geworden – und lädt unvermindert anregend und spannend ein zum Nachdenken, zum Knobeln, zum Sinnieren, ja vielleicht gar zum Philosophieren über die ewige Veränderung des ewig Gleichen…
Im «Glarean Magazin» finden sich regelmäßig interessante und berühmte Tangram-Aufgaben. Dabei wird das Lege-Puzzle erleichtert, wenn man sich aus Karton die sieben Grundelemente zurechtschneidet.
Sollten unter unseren Leserinnen und Lesern vielleicht sogar Tangram-«Erfinder» sein, so sind sie freundlich eingeladen, uns ihre neuen Figuren als Grafik-Datei zu senden! (we)
.
Ein Beispiel
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
.
.
Der neue Sudoku-Spass im «Glarean»
.
Die Sudoku-Rätsel-Puzzles im August 2014
.Copyright 2014 by Walter Eigenmann / Glarean Magazin
.
Hier finden Sie die Sudoku-Regeln
Auflösung —> (weiterlesen…)
.
.
Eleni Torossi: «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» (Roman)
.
Sehnsucht nach griechischer Hühnersuppe
Günter Nawe
.
 Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.
Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.
Soviel zur Person, weil Eleni Torossi – wie man zu Recht vermuten darf – mit ihrem neuen Buch «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» einen autobiografischen Roman geschrieben hat. Damit erhält die Geschichte, die sie erzählt, ein hohes Maß an Authentizität. Denn sie ist die Tochter, die in Athen in Zeiten der Militärdiktatur aufwächst; deren Mutter, eine Hutmacherin, taub ist. Wie es sich lebt in diesen unruhigen Zeiten und warum beide Athen und eine Reise ins Ungewisse – nach Deutschland – antreten. Und wie es sich in Deutschland leben lässt.
Im Vordergrund ihrer Geschichte steht die Beziehung zwischen der tauben Mutter und der Tochter. Eine Beziehung, die sozusagen «wortlos» ist. Denn Eleni verständigt sich mit ihrer eleganten Mutter durch Gesten und Zeichen und mit Augen und Händen. Ein schwieriges Verfahren, das viel Geduld von beiden Seiten und große Vertrautheit miteinander erfordert. Und das dennoch weitestgehend gelingt. Auch wenn es Schwierigkeiten, immer wieder Verständigungsprobleme, Ängste und Schuldgefühle zu überwinden gilt – die Liebe zueinander widersteht allem. Es ist ein symbiotisch anmutendes Verhältnis, das Mutter und Tochter miteinander verbindet.

Der Roman «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» von Eleni Torossi erzählt über die außergewöhnliche Beziehung eines Kindes und einer jungen Frau zu ihrer tauben Mutter. Und erzählt von einer Reise ins Ungewisse in den 60iger Jahren – von Athen nach München. Doch er zeigt dem Leser – das Buch hat doch einige Schwächen – kaum überzeugend, «wie die Welt klingt». Tiefenschärfe und Nachhaltigkeit gehören nicht zu den Stärken dieses Romans.
Eleni Torossi erzählt diese Geschichte mit sehr viel Einfühlungsvermögen und sehr einem sehr persönlichen und psychologischen Feingefühl. Das allerdings ist nur die eine Erzählebene des Romans. Die andere behandelt das «historische» Geschehen. Spielt sich doch die Lebensgeschichte dieser beiden Frauen im Kontext der Zeit ab. Eleni erlebt den Widerstand gegen die politischen Verhältnisse in Athen, ist teilweise auch in diesen Widerstand eingebunden. Die Folge: Die als Hutmacherin erfolgreiche Mutter und ihre Tochter machen sich irgendwann auf die Reise ins Ungewisse – nach Deutschland, nach München.
Hier gibt es andere, gänzlich neue Probleme: Sprachkenntnisse, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis. Die Mutter arbeitet als Küchenhilfe, die Tochter beginnt ein Studium. Herausforderungen, mit denen in den 60-iger Jahre alle Gastarbeiter und Migranten zu tun hatten. Caruso, Freund des Hauses, hilft, wo er nur kann. Parallel dazu engagiert sich Eleni in einer linken Exilantengruppe, die sich dem Kampf gegen die griechische Diktatur verschrieben hat. Was die Integration in Deutschland nicht leichter macht. Beide, Mutter und Tochter, erfahren auf höchst unterschiedliche Weise, «wie die Welt klingt». Und das sind nicht immer harmonische Klänge.
Trotzdem führen Mutter und Tochter kein schlechtes Leben. Es öffnen sich neue Türen in dieses neue Leben, und bald sind sie – die Geschichte zieht sich bis in die 90-ger Jahre – wie man so sagt: integriert. Was aber bleibt, ist die Zerrissenheit zwischen alter und neuer Heimat, die stille Sehnsucht nach dem Zurück, die «Sehnsucht nach der griechischen Hühnersuppe».
Das ist alles sehr schön und interessant und von Eleni Torossi gut erzählt. Dennoch bleiben ihre Figuren seltsam blass. Vor allem die Tochter. So erfahren wir zwar von ihrer Mitgliedschaft in linken Gruppierungen sowohl in Athen als auch in München. Wenig aber von ihren eigentlichen Überzeugungen, von ihrer inneren Verfassung. Die politischen und sozialen Gegebenheiten für die Gastarbeiter in Deutschland werden recht einseitig-kritisch beleuchtet. Es fehlt die Tiefenschärfe. Und so überzeugt dieser Roman insgesamt nur bedingt, er lässt beim Leser Fragen offen und lässt Nachhaltigkeit vermissen. ■
Eleni Torossi: Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt, Verlag Langen Müller, ISBN 978-3-7844-3356-1
.
.
.
.
.
111 Chess Tacticals (42)
.
Schwarz am Zuge gewinnt
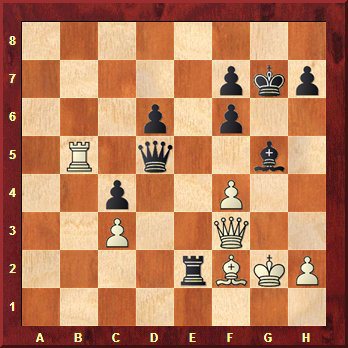 Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. –
Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. –
Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■
.
.
.
.
.
Jörg Schuster: «Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900»
.
Der Brief als artifizieller Schutzraum und schriftliche Selbststimulation
Dr. Karin Afshar
.
 1. Vorwort zu einer Besprechung
1. Vorwort zu einer Besprechung
Vor mir liegt eine Habilitationsschrift, ein Buch von 396 Seiten, ohne Literarturverzeichnis. «Kunstleben» heißt dieses Buch – der Untertitel lautet: Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes. Auf dem Einband: Rilke – schreibend.
Abgesehen davon, dass ich einen Vorteil habe (ich muss und werde nie eine Habil-Arbeit verfassen), habe ich ein Problem: ich kann das Thema und das Buch nicht auf einer Seite besprechen. Machen Sie sich auf ein längeres Verweilen-Müssen gefasst. Ferner hoffe ich, dass sowohl Jörg Schuster als auch der Wilhelm Fink Verlag Verständnis dafür haben, wenn ich die Rezension so gestalte, dass sie auch für Nicht-Wissenschaftler lesenswert und informativ wird. Deshalb werde ich meinen Text nicht als Literaturwissenschaftlerin oder auch nur annähernd als Germanistin verfassen, sondern als neugierige Leserin, die wissen will, was es mit dem Briefeschreiben um 1900 (zugegebenermaßen interessiert mich Rilke mehr als Hofmannsthal) auf sich hat.
Ich hoffe außerdem, dass auch jene meine Rezension lesen, die vielleicht niemals das Fachbuch – ein ausgezeichnetes Kompendium voller Details und Verknüpfungen – in die Hände bekommen.
Es geht also um Briefe, und um eine bestimmte Art von Briefen, die zu einem bestimmten Zweck und mit bestimmten Inhalten mit ganz bestimmten Mitteln geschrieben wurden. Die Aufgabe, dieses «bestimmt» zu beschreiben, hat sich Jörg Schuster gesetzt. Der Mann hat Neuere deutsche Literatur, Allgemeine Rhetorik und Philosophie studiert. Seine Dissertation hat er in Tübingen über die «Poetologie der Distanz – Die ‘klassische’ deutsche Elegie 1750-1800» verfasst. Das war 2001, 2012 legte er in Marburg, wo er an der Philipps-Universität als Wissenschaftlicher Mitarbeiter wirkte, seine Habilitationsschrift vor. Wie ich dem Netz entnehmen kann, lehrt er zur Zeit am Germanischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universtät in Münster.
2. Wer waren Hugo von Hofmansthal und Rainer Maria Rilke?
Sie lesen diese Rezension bestimmt deshalb, weil Sie einen der beiden Herren kennen? Bevor ich zu den Briefen komme, erlauben Sie mir, Ihnen einige Angaben zu Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke ins Gedächtnis zurückzurufen. Ersterer lebte von 1874 bis 1929, war österreichischer Schriftsteller, Dramatiker und Librettist. Er wird als der Repräsentant des fin de siècle und der Wiener Moderne schlechthin bezeichnet und hat – «Triumphpförtner» österreichischer Kunst – die Salzburger Festspiele (1918/1919) mitgegründet, die vielleicht nicht eine Gegenidee, so doch aber Entwurf zu einer Alternative zur Wiener Moderne sein wollte: klerikal, antidemokratisch, antiaufklärerisch.1)
Hugo von Hofmannsthal hatte bereits promoviert und habilitiert, als er um 1900 in eine persönliche Krise stürzte. Am 18. Oktober 1902 erschien Ein Brief («Chandos-Brief» – ein fiktiver Brief eines Lord Chandos, der seine Zweifel an den Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks niederschreibt) in der Berliner Literaturzeitschrift Der Tag. Der Chandos-Brief zeigt, aus welchen Gedanken heraus Hofmannsthal die Poetologie seiner Jugend ablegt, und markiert eine Zäsur in Hofmannsthals Kunstkonzept. Rückblickend erscheint ihm das bisherige Leben als bruchlose Einheit von Sprache, «Leben» und Ich. Nun aber kann das Leben nicht mehr durch Worte repräsentiert werden; es ist vielmehr direkt in den Dingen präsent… Neben lyrischen und theatralischen Werken ist eine umfangreiche Korrespondenz Hofmannsthals in Höhe von etwa 9’500 Briefen an nahezu 1’000 verschiedene Adressaten überliefert.
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) gilt als bedeutendster Lyriker Deutschlands. 1895 bestand er die Matura und begann Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie in Prag zu studieren, wechselte 1896 zur Rechtswissenschaft und studierte ab September 1896 in München weiter. Etwa von 1910 bis 1919 hatte Rilke eine ernste Schaffenskrise, der dann allerdings eine um so intensivere Schaffenszeit folgte. Er vollendete innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Duineser Elegien. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstanden auch die beiden Teile des Gedichtzyklus Sonette an Orpheus. Beide Dichtungen zählen zu den Höhepunkten in Rilkes Werk. Sein umfangreicher Briefwechsel – wird mit mehr als 10’000 Briefen angegeben – bildet einen wichtigen Teil seines Schaffens. Es wurden mittlerweile 70 Bände mit Rilke-Briefen herausgegeben. Allein eine Ausgabe von 2009 umfasst 1134 «Briefe an die Mutter», darin enthalten sind die Briefe aus der Kinder- und Jugendzeit. Es hat den Anschein, als hätte Rilke in seinen Briefen gelebt. Hofmannsthal wie Rilke waren «manische» Briefeschreiber.
3. Warum Briefe untersuchen?
Bevor ich weiter auf ausgewählte Themen eingehe, die Schuster in seiner Arbeit herausarbeitet, wende ich mich an Sie. – Schreiben Sie (noch) Briefe? – Würde ich gefragt werden, würde ich antworten: ich habe früher viel geschrieben, heute greife ich kaum noch zu Papier und Stift und schreibe einen Brief von 10 oder 12 Seiten. Meine heutigen Briefe beschränken sich auf in die Tastatur geschlagene Buchstaben in Mails, die ausgedruckt allerhöchstens die Länge einer halben DIN A 4-Seite erreichen.
Briefe sind ein Medium, das uns zur Verfügung steht, um zu Papier zu bringen, was an Gedanken mehr oder weniger geordnet in uns herumschwirrt. Briefe schreiben wir, weil und wenn unser Gegenüber abwesend ist. Der Gesprächspartner, mit dem wir uns im Dialog befinden, ist räumlich oder zeitlich von uns getrennt – wir möchten ihm etwas mitteilen. In diesem Wunsch, mitzuteilen, schreiben wir von uns, von dem, was uns zugestoßen ist, was wir gedacht, gefühlt und getan haben. Im Schreiben erwachen Empfindungskräfte – wir empfinden uns als uns, wir finden unsere Identität und – auch das ist möglich, unsere Individualität. Tagebuchschreiben und das Schreiben von Briefen haben diese identitätssteigernde Kraft.
Briefe zeugen vom Schreiber und seiner Autobiographie; sie entstehen nie in einem Vakuum. Manche Briefe sind als Liebesbriefe exklusiv, und zwei Menschen und deren Beziehung zueinander vorbehalten, andere sind Abbildungen der Alltäglichkeit, vielleicht Beschreibungen der Lebens- und Gedankenwelt, andere Briefe gehen über Schreiber und Leser hinaus und sind Abbilder der Zeit und Umstände, Abbilder der Problemlösungsfindungen dieser Menschen, noch andere sind Korrespondenzen zwischen Lehrer und Schüler, Ratgeber und Ratsuchender.
Und manchmal sind die Umstände, unter denen man schreibt, kritisch – dann sind die Briefe «Krisensymptome» (vgl. Angelika Ebrecht 2000) des Selbst wie auch der Zeitepoche.
Briefe können inspirieren, d.h. der Gedanke, jemandem darüber zu schreiben, woran man gerade arbeitet, kann neue Ideen freisetzen, zu Höhenflügen bringen. Je nach Briefpartner stachelt man sich gegenseitig an, oder zieht sich herunter.
Das Gros der Literaturwissenschaftler hat jedenfalls die Korrespondenzen von um 1900 als Spiegel von «Krisensymptomen» gelesen und bezeichnet: Als Ausdruck der Unsicherheit, die «das Bürgerliche» erfasst hatte. Die Modernisierungsprozesse sind eine nächste Interpretationssicht auf die Bedeutung der Briefe: Was machte die Urbanisierung, Industrialisierung, die Steigerung der Mobilität und die Beschleunigung mit den Menschen überhaupt? Jörg Schuster jedenfalls fragt in seinem Buch nach einer noch «anderen» Funktion der Briefe – nach der produktiven kulturpoetischen, und er hat sich zur Beantwortung seiner Frage der Briefwechsel jeweils von Hofmannsthal und Rilke angenommen.
Was findet er? – Analog zum Jugendstil in der Bildenden Kunst und Architektur findet er Briefe als Form der «Gebrauchskunst». Diese Art von Kunst reagiert auf anstehende Modernisierung. Inwieweit es sich um die Konstruktion einer Text- und Lebenswelt, die nur als ästhetische zu ertragen ist, handelt, ist Gegenstand von Schusters Buch. Er studiert und analysiert genauer hin, er nimmt «Versuche literarischer Kreisbildung» und Experimente «ästhetischer Erziehung» ebenso unter die Lupe wie die Ökonomie des Briefs und – im Kontext einer Kulturpoetik des (Innen-)Raums um 1900 – Konzepte des «epistolaren Interieurs». (Zugegeben, das habe ich dem Ankündigungstext entnommen.)
Das Buch ist, wie bereits gesagt, umfangreich. Ich greife deshalb nur einzelne Kapitel heraus und stelle Sie Ihnen genauer vor.
4. Hofmannsthals bitterer Briefwechsel mit Stefan George –
symbolisches Experiment am Vorübergehenden
Schuster beginnt mit einem Gedicht Hofmannsthals2) – George nach einem Treffen überbracht –, in dem es zunächst unverfänglich um eine poetische Standortbestimmung geht, bei der George vom Jüngeren die Rolle des Lehrers zugewiesen bekommt. Hofmannsthal ist 17, George 23 Jahre alt. Dem Gedicht ist ein Geschenk vorangegangen: George hat Hofmannsthal seinen ersten, im Vorjahr erschienenen Gedichtband Hymnen geschenkt und ihm vermutlich auch Einblick in seine Übersetzungen aus dem Französischen gegeben. Der Ältere erläutert dem Jüngeren das Pariser Vorbild einer «poésie pure», die mit der Tradition der Weltabbildung in der Literatur radikal gebrochen hat: das Gedicht ist nunmehr subtiles Gewebe von bildlichen Übergängen, von Klängen und rhythmischen Einheiten, ein autonomes Gebilde, das die Möglichkeiten der Sprache und nicht die Zwänge der Wirklichkeit offenbart. Hofmannsthal lernt schnell. Schon wenige Tage später, am 21. Dezember 1891, schickt er George dann sein Gedicht, das von Anspielungen auf die ausgetauschten und besprochenen Texte durchsetzt ist.
Das Gedicht ist eine klingende Antwort auf ein Vorübergehen, das steht fest, und es gleicht einem Gedicht Baudelaires «À une passante», das George übersetzt hatte. Was ist die Absicht Hofmannsthals? Meint er mit dem Vorübergehenden George, oder sich selbst? – Viele Andeutungen, über die sich zu lesen lohnt, und ein flüchtiges Erlebnis als Inspiration zur Kunst. – Interessanterweise gibt es dieses Gedicht in zwei Versionen. Eine in deutscher Schrift, mit großen Anfangsbuchstaben und Interpunktion auf Papier mit dem Wappen Hofmannsthals. Das andere in lateinischer Schrift, mit kleinen Anfangsbuchstaben, ohne Interpunktion. Diese Version zitiert Georges Schriftstil und dieses ist es, was Hofmannsthal ihm überreicht.
Gedicht an einen Vorübergehenden ist ein Widerspruch an sich, aber er wirkt. Hofmannsthal selbst gibt an, dass es ein persönliches Bekenntnis sei – er selbst sei der Vorübergehende, der Inspirierte. George allerdings fasst das Gedicht als Ausblick auf eine festere, dauerhaftere Zusammenarbeit auf – als ein Angebot zu Nähe. Es kommt zu einem Missverständnis, das die beiden Männer anschließend immer weiter bearbeiten. Jörg Schuster geht nun dem darauf folgenden Briefwechsel nach und findet «den Haken» in der Beziehung zwischen den beiden Männern und spannt einen Bogen zur Funktion des Briefes.
Auch der Briefwechsel hat den Charakter eines Gesprächs zwischen Meister (George) und Jünger (Hofmannsthal): der Meister ist in Besitz des Geheimnisses des mit der künstlerischen Produktion verbundenen Leidens (S. 49), das er nach und nach lüften wird, indem er Andeutungen macht. Die Briefe nun atmen die Sehnsucht nach poetischer Inspiration auf beiden Seiten, für George noch essentieller als für Hofmannsthal. Im Verlaufe des Briefwechsels kehrt George von der «verletzbaren Gewalt» (ein Bekenntnis, das er abgelegt hat) zu einem vornehmen Pathos der Distanz zurück, woraufhin Hofmannsthal ratlos nachfragt, was geschehen sei. Dazu verweigert George die weitere Kommunikation und bricht in ein Schweigen ab.
Hofmannsthal schreibt einen nächsten Brief an George: «Ich kann auch das lieben, was mich ärgert», bekennt er. George findet diesen Brief zu diplomatisch, zu glatt und neutral. Hofmannsthal halte sich bedeckt. Die Korrespondenz eskaliert, und mündet in Georges Androhung zum Duell. Wie nun rettet sich Hofmannsthal? – Er beruft sich auf seine Nerven («Verzeihen Sie meinen Nerven […] jede vergangene Unart»). Die Nerven erlauben dem reizbar-sensitiven Künstler alles. George hat allerdings mit der Androhung übertrieben, und versucht in der Folge abzuwiegeln. Dabei wirkt er beinahe «komisch» (S. 53), Hofmannsthal kann das nicht einordnen – der Bruch in der Beziehung ist nicht zu vermeiden.
Hofmannsthal und George ringen in ihrem Briefwechsel um Distanz und Nähe. Sie kennen sich aus Briefen, haben sich aber nur selten getroffen, in ihrer distanzierten Nähe sind Briefe ihr Medium zum Austausch von Lebenszeichen. – Nun ist George aber der, der die Regeln vorgibt. Der Jüngere entzieht sich, bleibt auf «orientalisch» (S. 55) und auf einschmeichelnde Art konsequent und virtuos. Hofmannsthal beherrscht schon hier die Kunst der «epistolaren insinuatio» (rhethorisches Mittel, das jemand verwendet, wenn er von vorneherein davon ausgeht, dass sein Zuhörer gegen ihn ist): er entzieht sich, macht sich klein, gibt vor, dem Gegner nicht gewachsen zu sein.
Alles in allem betrachtet, ist dieser Briefwechsel das Land, in dem die Krise (die je eigene der beiden und die ihrer Beziehung) in gegenseitigem Bekennen, Fordern, Ausweichen, Vereinnahmungsversuchen als Krisenbriefwechsel ausgetragen wird.
5. Die einsame Imagination, Lebensverdächtigung und ein
verfehlter Geburtstagsbrief – Der Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann
In den vorangehenden Kapiteln hat Schuster bereits eine «Brüchigkeit» in Hofmannsthals Briefen herausgearbeitet. Im Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann tritt eine neue Qualität hinzu.
Mit Beer-Hofmann verbindet Hofmannsthal «große menschliche Vertrautheit» (S. 118), die beiden kennen einander gut und treffen sich häufig. Auch sie sind junge Männer, als sie sich (um 1896/97) kennenlernen: Beer-Hofmann ist etwa 31 und Hofmannsthal 23 Jahre alt. Ihre Begegnungen haben für beide einen hohen Stellenwert, es gibt viele Gespäche über Machtverhältnisse und die Rollenverteilung. In diesem (im Vergleich zu dem mit George) Briefwechsel ist Hofmannsthal der Zudringlichere und Beer-Hofmann der Zurückhaltende. Ausgerechnet der Ästhet Hofmannsthal lässt sich hinreißen und schreibt «Hässliches, ja Ekelhaftes» (S. 119). Hofmannsthal sucht die Konfrontation und provoziert. «Epistolares Imponiergehabe», heißt es bei Schuster, lege er an den Tag. Er trifft auf einen, der sich nicht zwingen lässt: «Ich weiß, Sie nehmen es mit mir nicht genau; Briefe «schuldig sein» ist ja auch nur ein Bourgois-Begriff.» (S. 120). Doch Hofmannsthal nimmt es sehr genau, und ärgert sich. «Warum schreiben Sie mir nicht?» – Beer-Hofmann verweigert sich. Er will nicht als «Inspirationsmittel» für die poetische Produktion jüngerer Kollegen fungieren. Er identifiziert sich mit der Rolle des «Hemmschuhs». Hofmannsthal wiederum fühlt sich nicht geachtet genug. Es deprimiert ihn, dass die Beziehung sich nicht als ideale poetische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entwickelt bzw. gestaltet. Es gelingt ihm nicht, Beer-Hofmann aus dem Leben hinein in seine Briefwelt zu ziehen (S. 124), schreibt in einer Mischung aus Zudringlichkeit und Ich-Bezogenheit.
In einem Geburtstagsbrief (vom 6. Juli 1899) an Beer-Hofmann bricht – völlig deplaziert und verfehlt – die Erwartung aus Hofmannsthal heraus. Hier liegt ein Konflikt, so schreibt Schuster, zwischen dem Menschlichen (dem Leben) und der produktiven Fähigkeit (bzw. der Poesie) vor. Das Leben kann sich uns im Brief nur in Form von Schrift und Imagination nähern, wobei die Imagination eine emphatische ist. Einfühlung ist hier das Stichwort – paradoxerweise fühlt sich Hofmannsthal so sehr in Beer-Hofmann ein, dass er ihm mit seiner Kritik und den Vorwürfen zu nahe tritt und die Grenze des guten Anstands überschreitet. Beer-Hofmann antwortet lakonisch: «Lieber Hugo, Sie haben Recht, nur […] an einen Arzt oder Medikamente glaube ich bei diesen Dingen nicht.» – Bündiger, so Schuster, könne die eigene Resignation, aber auch das Zurückweisen der selbstbezogenen Zudringlichkeit Hofmannsthals nicht ausgedrückt werden (S. 126). Briefe – so sehen wir hier – können und werden im Sinne einer «Distanzmedizin» geschrieben (S. 181).
«Medizinbriefe» wie die an Beer-Hofmann sind einseitig – sie sind und bleiben Hofmannthals «Welt in der Welt». Anders als der Poet Hofmannsthal beherrscht der Briefschreiber Hofmannsthal etliches nicht: souveränes, prägnant-wirkungssicheres sprachliches Übertragen und Hervorrufen von Stimmungen. – Dass und wie es im Briefwechsel zu einer Wende kam, ist im Buch nachzulesen – die Auflösung auf Seite 147. In dieser Art, ausführlicher und noch mehr Hintergründe heranziehend, geht Schuster die Briefe durch, die er in größere und kleinere Kategorien zusammenfasst.
6. Rilkes transportable Welt und sein fein verteiltes Irgendwo-Sein
Wussten Sie, dass Rilke täglich durchschnittlich an die zehn Briefe schrieb? – Stellen Sie sich vor, Sie schrieben heutzutage täglich an 10 Personen aus Ihrem Bekanntenkreis 10 Seiten!? An manche dieser Personen zweimal pro Woche.
Rilke produziert in guten Zeiten Briefe «mit Dampf» – und vermerkt außerdem noch alle Daten rund um die Briefe. Ist er ein Maniker? Ist er nicht – schon einmal vorweggenommen. Hätte es damals facebook oder überhaupt das Internet gegeben – Rilke hätte es genutzt: um ein Netzwerk aufzubauen, um seine Werke vorzubereiten und sich selbst zu vermarkten. Er war ein Öffentlichkeitsarbeiter.
Wir erfahren, dass Rilke Wert auf das Aussehen seiner Briefe legte: Briefpapier wird von ihm speziell ausgewählt, er schreibt in einer besonderen Handschrift («th» und «y» schreibt er auf unverwechselbare Weise und lädt sie mit einer besonderen Bedeutung auf). Rilkes Briefe sind Gesamtkunstwerke, die gleichzeitig den Alltag poetisieren und entpragmatisieren – und die doch wieder nützlich werden. Im Kreis des literarischen Betriebs Fuß zu fassen, ist Rilkes Absicht. Die Briefe dienen ihm als Ersatz für noch nicht erlangten Erfolg vor größerem Publikum. Er schafft sich einen Kreis, in dem die Briefe einen Heimatersatz für ihn, den Ortlosen, bilden. Doch das «Irgendwo», das er sich damit verschafft (dazu mehr weiter unten), ist nicht der letzte Aspekt dieser Briefe.
Für Rilke ist der Brief nicht Medium der Intimität, sondern Vorzeigeobjekt. Das epistolare Subjekt Rilke – so Schuster – bildet eine Funktionsstelle ähnlich einer Durchgangsstation, eines Relais (S. 222). Rilkes Briefe sind nämlich öffentlich: sie dürfen und sollen von den Adressaten anderen im Bekanntenkreis gezeigt werden. Auch das «Subjekt des Empfängers» wird somit zur Funktion: er soll multiplizieren.
Rilke, der Vielschreiber, versteht die an einem Tag geschriebenen Briefe als eine Einheit – und als Werk an sich, das erlaubt, das Leben ätherisch und literalisiert zu «rezipieren und zu modellieren» (S. 224).
Ganz abgesehen davon macht Rilke das, was auch heute die Selfpublisher mit ihren selbstveröffentlichten Werken tun: Sie probieren Entwürfe und Vorarbeiten im Netz aus. Sie achten auf ihre Wirkung und Rückmeldung, nehmen Anregungen auf, ändern ab. – Vorab in den Briefen Rilkes öffentlich gemachte Textabschnitte finden sich in seinen literarischen Werken wieder. Rilke inszeniert den Schaffensprozeß in seinen Briefen.
7. Esoterik der Briefe und die Exoterik der Konversation
Dass Rilke zwischen einem Gespräch und einem Brief einen großen Unterschied macht, ist bereits mehrfach durchgeschimmert. Das Konkurrenzverhältnis der beiden «Medien» zueinander ist über Jahrzehnte sein Thema (S. 224): Dem Draußen des Gesprächs steht das einsame Drinnen des Briefs entgegen. Briefe zu schreiben, ist ein Sich-Sammeln. «Als ob Du bei mir eintreten könntest» ist der Titel eines Abschnitts (S. 249ff), in dem Schuster sich mit einem Brief Rilkes an Lou Andreas-Salomé und dem nachfolgenden Briefwechsel beschäftigt. Der Brief, um den es gehen wird, ist vom 13. Mai 1897. Es ist Rilkes erster Brief an die 10 Jahre ältere Frau, die später 30 Jahre lang erst seine Geliebte, dann Vertraute und «Beichtmutter» sein wird. Ohne Lou Andreas-Salomé wäre Rainer Maria Rilkes Leben anders verlaufen, heißt es. Er lernt sie in München, wo er studiert und Kontakte zur literarischen Szene sucht, im Mai 1897 eher zufällig kennen. Er ist 26 Jahre alt, Lou Andreas-Salomé bereits renommierte Autorin. Man kennt ihre Erzählungen und Romane, ihr Buch über Ibsen. Sie hat gerade einen Heiratsantrag von Nietzsche abgewiesen. Der erste Brief, den Rilke schreibt, verrät eine geradezu religiöse Verehrung und er verfolgt eine deutliche Absicht: er möchte ein exklusives Verhältnis zu ihr haben, schreibt sie persönlich und sehr höflich an, versichert ihr, dass es eine «Auszeichnung» sei, sie kennenzulernen – und möchte ihr imponieren (S. 249). Was Rilke dabei schon damals «beherrscht» ist, was man heute «name-dropping» nennt.
Rilke hatte die Dame am Vortag getroffen und möchte – enttäuscht von der mündlichen Kommunikation – seine Bewunderung auf dem brieflichen Weg ausdrücken. Der Brief, so Schusters Hypothese, stiftet somit eine Beziehung zu Lou Andreas-Salomé im Sinne «eines der Exoterik des gesellschaftlichen Gesprächs entgegengesetzten esoterischen Mediums» (S. 250).
In diesem Fall sehen wir den Brief als «Medium der Nähe und der Intimität», wobei er dem Gespräch, der vollständigeren Form der Kommunikation, unterlegen ist. Die bereits angedeutete Thematik «Gespräch vs. Brief» bleibt während der Korrespondenz und im Verlauf der Liebesbeziehung zu Lou Andreas-Salomé bestehen. Nach Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehung gilt jeder Brief, den er ihr schreibt, dem Wunsch nach dem Gespräch. Da dieses zwischen beiden schwierig ist, sehnt sich Rilke alsbald nach an einem Ort, nach einer Wohnung, an dem und in der er das nötige «setting» findet, den Ruheort, um die nötigen Briefe schreiben zu können. Überhaupt fehlt Rilke eine «Stube», also erbaut er sich eine («ein Stück Stube […], die ich mir damals erbaut habe» (S. 257) – er arrangiert sich ein Stück Wirklichkeit. Der Nachteil dieser Wirklichkeit besteht darin, dass es sich nicht um Lebenswirklichkeit handelt, sondern um das Hervorbringen von Schrift und Poesie. Der Verfasser der Schriften jedoch ist nicht mehr als eine «zerbrochene Schneckenschale». Das Briefeschreiben wird nicht nur zum Ausweg aus der Suche nach dem (Schreib-) Ort sondern auch aus Rilkes Dilemma. Im Laufe des Briefwechsels mit Lou Andreas-Salomé wird der Brief immer mehr der Ort der Ruhe, die Schreibsituation des Briefes verwirklicht seine Sehnsucht – und das ersehnte Gespräch damit schließlich überflüssig (S. 264). Wie es nun im Einzelnen mit Rilke und AS endete, kann dem Buch entnommen werden. Soviel an dieser Stelle. Zusammenfassend kann gesagt werden: auch wenn zwar im Falle dieses Briefwechsels ein «Ausschluss der Öffentlichkeit» vorliegt, ordnet Schuster den Brief bzw. den Briefwechsel in letzter Konsequenz doch eher dem «Zweck einer Stimulation» zu.
8. Lebenspraxis + Briefpoesie = die kleine Lebenshilfe?
Die vorangegangenen Seiten haben lediglich einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtwerk gezeigt. Es gibt ungleich mehr zu entdecken. Der ältere Hofmannsthal schreibt in seinen Briefen anders und über anderes, ebenso der ältere Rilke, der viele Briefe von männlichen wie weiblichen Lesern erhält und «Lehrbriefe» schreibt. Schuster analysiert etliche dieser Briefwechsel. Zu kurz gekommen in der Rezension ist der Lebens- und Schaffenshintergrund der Beteiligten, der Briefe zu Ratgebern werden lässt. Dieses und eine akribische Untersuchung der dichterischen Sprache habe ich links liegen gelassen.
Zu Anfang hatte sich Schuster die Frage gestellt, inwieweit die Briefkultur um 1900 symptomatisch für die kulturgeschichtliche Situation des fin de siècle und des frühen 20. Jahrhunderts ist. Was leisten Briefe dieser Zeit, was bringen sie auf kommunikativem Weg hervor? (S. 388)
Die Funktion der Briefe ist – alles in allem und zusammenfassend – dass sie dem Zweck dienen, Distanz zu schaffen und zu wahren. In dieser Distanz werden sie zu Repräsentanten des «Jugendstils» und damit – Gebrauchskunst (S. 389), mit der die Autoren die «artifizielle Innen-Einrichtung ihrer sozialen Welt» gestalten.
Hoffmannsthal arrangiert sich die Wirklichkeit, wie man einen Ausstellungsgegenstand hinstellt und arrangiert (S. 388), und Rilke verwebt sich, mittels seiner Briefe kontinuierlich in den Kokon einer Einrichtung.
Die Briefe fungieren als zugleich «private» wie auch höchst artifizielle Schutzräume, statt eines tatsächlichen Zusammenwirkens herrschen einsame Imagination und schriftliche Selbst-Stimulation vor, bei denen die Adressaten als Vorwand dienen (S. 392). Bei Rilke haben wir noch den Eindruck, wir könnten jederzeit eintreten, dennoch hält er eine tatsächliche Begegnung in der Schwebe.
Zwei Repräsentanten ihrer Zeit – und es bleibt mir nach der Lektüre die traurige Frage (sie wird hoffentlich erlaubt sein): Was wohl, wenn wir unsere heutigen Briefwechsel ähnlich akribisch unter die Lupe nähmen und eine Anamnese vornehmen würden, die Diagnose ergäbe? Für mich ganz persönlich nehme ich mit, dass ich in puncto Rilke die richtige, hier bereits angedeutete, Vermutung hatte. Leider konnte ich nicht auf all die anderen Fragen eingehen, die im Buch aufgeworfen und beantwortet werden. Leider, auch das bereits angedeutet, bin ich zu wenig Literaturwissenschaftlerin, um Schusters Werk für die Literaturwissenschaft würdigen zu können. Es sei dennoch ans Herz gelegt: wenn wir unsere Geschichte verstehen, verstehen wir auch die Gegenwart! ■
Jörg Schuster: Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes, 428 Seiten, Wilhelm Fink Verlag, ISBN 978-3770556021
.
1) Norbert Christian Wolf: Eine Triumphpforte österreicherischer Kunst – Hugo von Hofmannsthals Gründung der Salzburger Festspiele, Jung und Jung (Salzburg)
2) Herrn Stefan George
einem, der vorübergeht
du hast mich an dinge gemahnet
die heimlich in mir sind
du warst für die saiten der seele
der nächtige flüsternde wind
und wie das rätselhafte
das rufen der athmenden nacht
wenn draussen die wolken gleiten
und man aus dem traum erwacht
zu weicher blauer weite
die enge nähe schwillt
durch pappeln vor dem monde
ein leises zittern quillt
.
Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Das Musik-Kreuzworträtsel im August 2014
.
Der neue Musik-Rätselspaß !
.
Copyright© 2014/8 by Walter Eigenmann
Rätsel ausdrucken (pdf)
Lösung: —>weiterlesen
.
.
.
Anne Carson: «Decreation» (Gedichte – Oper – Essays)
.
«Die Liebe ist immer du»
Günter Nawe
.
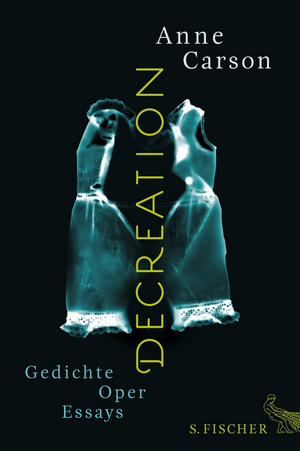 Den Titel ihres neuen Buches hat die kanadische Autorin Anne Carson von der französischen Philosophin Simone Weil übernommen. Für Weil – sie hat diesen Begriff geprägt –, von der sich die Carson stark beeinflusst sieht, bedeutet «décréation» einerseits Analyse der Selbstreflexion des Menschen und zugleich «Rückschöpfung», also eine «Ent-Schaffung»; anders: alles Erschaffene noch einmal ins Unerschaffene zu überführen.
Den Titel ihres neuen Buches hat die kanadische Autorin Anne Carson von der französischen Philosophin Simone Weil übernommen. Für Weil – sie hat diesen Begriff geprägt –, von der sich die Carson stark beeinflusst sieht, bedeutet «décréation» einerseits Analyse der Selbstreflexion des Menschen und zugleich «Rückschöpfung», also eine «Ent-Schaffung»; anders: alles Erschaffene noch einmal ins Unerschaffene zu überführen.
Aus diesem philosphisch-religiösen Gedankengut und in diesem Kontext der Simone Weil speist sich im Wesentlichen die Literatur der Anne Carson – vor allem, was das neue Buch «Décréation» betrifft. Es enthält Gedichte, Essays und ein Opernlibretto (nicht zu vergleichen mit einem herkömmlichen Libretto). Sehr unterschiedliche Spielarten der Literatur also, die jedoch bei Anne Carson in ihrem Innersten zusammenhängen. Auch der Lyrikerin geht es darum, eine Art «Rück-schöpfung» zu «inszenieren», indem sie ihre Vorstellung davon als Frage formuliert. Und dies Genre-übergreifend, sozusagen als Brückenschläge.
So in den Gedichten, die vor allem ihrer Mutter gewidmet sind. Sie ist «die Liebe meines Lebens». Mit ihr redet sie in ihren Versen: «Wenn ich mit meiner Muter spreche, mache ich es schön…». Von ihr hat die Dichterin gelernt: «Die letzte Lektion einer Mutter in einem Haus im letzten Licht / bringt den Ruin der Welt und den Handel zum Erliegen…». «Diese Stärke, Mutter: hervorgewühlt. Gehämmert, gekettet, / geschwärzt, gesprengt, heult, holt aus…».
Anne Carson, 1950 in Toronto geboren, ist im deutschen Sprachraum bisher durch die Bücher «Glas, Ironie und Gott» (Gedichte, 2000) und «Rot: Ein Roman in Versen» (2001) bekannt geworden Jetzt also «Décréation», und im Herbst wird der Band «Anthropologie des Wassers» erscheinen. Alle Bücher dieser Dichterin überzeugen durch die Klang- und Aussagekraft ihrer Poesie, durch die Intensität ihre Sprache, durch den Verzicht auf jegliches Pathos und die Bandbreite ihrer Themen. Großes Lob an dieser Stelle für Anja Utler, die «Decreation» aus dem Amerikanischen sehr feinfühlig ins Deutsche übersetzt hat. «Decreation» ist so eine weitere Möglichkeit, ein Versuch der Annäherung an eine der bedeutendsten Lyrikerinnen unserer Zeit.
Die lyrische Diktion dieser Autorin ist oft experimentell – auch von der formalen Struktur der Gedichte her. Ihr poetisches Credo: «Du kannst nie genug wissen, nie genug arbeiten, niemals die Infinitive und Partizipien auf genügend befremdliche Art verwenden, nie die Bewegung brüsk genug ausbremsen, nie den Geist schnell genug hinter dir lassen.» Das gilt – hervorragend umgesetzt – für die Verse, für ihre Essays und das Opernlibretto: zusammengefasst in diesem wunderschönen Band.
In dem kleinen Text «Jedes Abgehen ist ein Anfang» dekliniert Anne Carson zum Beispiel die verschiedenen Lesarten des Schlafs. Und bemüht dabei Aristoteles, Kant und Keats, um sich am Ende ausführlich Virginia Woolf zu widmen. Und so lesen wir «O zarter Salber stiller Mitternacht… Beschütz mich dann, dass nicht der Tag erneut / Aufs Kissen scheint, der mich so leiden ließ; …».

«Décréation» ist ein außergewöhnliches Buch einer außergewöhnlichen Dichterin. Klug, anregend und voller sublimer Erkenntnisse. Anne Carson gehört zweifellos zu den bedeutendsten zeitgenössischen Lyrikerinnen – und «Decreation» ist bis jetzt eines ihrer wichtigsten Werke.
Ihr großartiger Essay «Decreation – Wie Sappho, Marguerite Porete und Simone Weil Gott sagen» setzt die gelernte Gräzistin sich mit drei großen Frauen und ihren «spirituellen Erlebnissen» auseinander. Sappho, die die Liebe pries und diesen Lobpreis der Göttin Aphrodite weihte; Marguerite Porete hat über die Liebe Gottes geschrieben und wurde dafür 1310 als Ketzerin verbannt; Simone Weil, die «Erfinderin» des Begriffs der «décréation», Altphilologin und Philosophin hatte, wie die Carson schreibt, «ein Programm, mit dem sie ihr Selbst aus dem Weg schaffen wollte, um zu Gott zu gelangen. Um Liebe also geht es diesen drei Frauen, um Liebe auch geht es auch Anne Carson. Auch im Operntext, der ebenfalls den Titel «Decreation» trägt. So lässt sie Hephaistos singen: «Die Liebe ist immer du, / wenn sie frisch ist. / Wenn du da bist, wenn sie frisch ist, wenn sie frisch ist, wenn du da bist, / die Liebe ist immer, / immer / wenn du da bist.». Oder, wenn im 3. Teil des Librettos Simone die «Arie des Rückschöpfens» singt.
Und um «Erhabenes», einer Art Gedichtzyklus, in dem die Autorin in teilweise enigmatische «Versen» Kant eine Frage zu Monica Vitti stellen und Longinus von Antonioni träumen lässt.
Was aber ist dieses Erhabene, was ist die Seele und welcher Schlaf ist Befreiung vom Selbst? Zu erfahren vielleicht im Gespräch mit Gott, das wie Simone Weil auf andere Art auch Anne Carson führt. Es ist ein nahezu undurchdringliches Geflecht, das Anne Carson anbietet. Für den Leser aber, der sich lesend an die «Entflechtung» wagt, ein unendlicher Gewinn. ■
Anne Carson: Decreation – Gedichte, Oper, Essays, 250 Seiten, S. Fischer Verlag, ISBN 978-3-10-010243-0
.
.
.
.
.
Das klassische Glarean-Tangram (46)
.
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
Lösung: —>(weiterlesen…)
.
__________________________________
.
Das Tangram-Puzzle
 Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Das Tangram (auch Siebenschlau oder Weisheitsbrett genannt) ist ein altehrwürdiges chinesisches Geometrie-Spiel: Aus nur sieben Steinen eines Quadrates, nämlich fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm lassen sich die vielfältigsten Figuren (Pflanzen, Tiere, Menschen u.v.a.) legen, wobei immer alle sieben Steine verwendet werden müssen. Sie sollen sich berühren, dürfen sich aber nicht überlappen.
Schon in der uralten Kultur Chinas bedeutete das Quadrat die reinste Form einer Fläche, in sich vollkommen, und beim Tangram wird dieses in sich ruhende Quadrat nun aufgelöst in eine endlose Bewegung, wird es durch unablässige Veränderung zum Ausgangspunkt ungeahnter Gebilde, durch das Zusammenspiel seiner festen Elemente zum Quell des Neuen.
Die ersten Tangram-Bücher wurden zur Zeit des Ch’ing-Kaisers Chia Ch’ing (1796-1820) gedruckt, die früheste uns überlieferte Tangram-Publikation dort stammt aus dem Jahre 1813, doch das Grundprinzip des Spiels dürfte im asiatischen Raum schon lange vor Christi Geburt weit verbreitet gewesen sein. Eine frühe erste Veröffentlichung in Europa datiert aus dem Jahre 1805.
Inzwischen hat das Tangram einen wahren Siegeszug durch alle Kontinente angetreten, ist Gegenstand zahlreicher Bücher und Sammlungen geworden – und lädt unvermindert anregend und spannend ein zum Nachdenken, zum Knobeln, zum Sinnieren, ja vielleicht gar zum Philosophieren über die ewige Veränderung des ewig Gleichen…
Im «Glarean Magazin» finden sich regelmäßig interessante und berühmte Tangram-Aufgaben. Dabei wird das Lege-Puzzle erleichtert, wenn man sich aus Karton die sieben Grundelemente zurechtschneidet.
Sollten unter unseren Leserinnen und Lesern vielleicht sogar Tangram-«Erfinder» sein, so sind sie freundlich eingeladen, uns ihre neuen Figuren als Grafik-Datei zu senden! (we)
.
Ein Beispiel
Legen Sie mit den Tangram-Elementen die folgende Figur
.
.
.
Gerhard Josten: «Auf der Seidenstraße zur Quelle des Schachs»
.
Bereicherung des Diskurses über den Schach-Ursprung
Thomas Binder
.
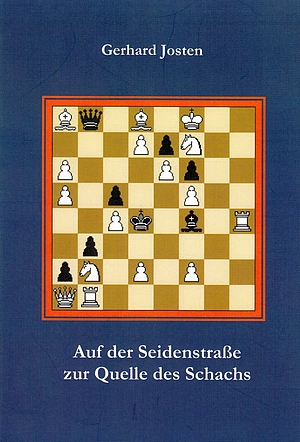 Die Frage nach dem Ursprung des königlichen Spiels gehört zu den ungelösten Problemen der Kulturgeschichte. Als sicher kann gelten, dass das Schachspiel aus südöstlicher Richtung zu uns gelangt ist. Alle weiteren Details bleiben bisher – und werden es möglicherweise immer bleiben – im Reiche der Mythen verborgen.
Die Frage nach dem Ursprung des königlichen Spiels gehört zu den ungelösten Problemen der Kulturgeschichte. Als sicher kann gelten, dass das Schachspiel aus südöstlicher Richtung zu uns gelangt ist. Alle weiteren Details bleiben bisher – und werden es möglicherweise immer bleiben – im Reiche der Mythen verborgen.
Gemeinhin wird der Ursprungsort in einem riesigen Gebiet vermutet, das mit «China, Indien oder Persien» zu umschreiben wäre. Oft wird sogar versucht, einen einzelnen Schöpfer des Spiels zu benennen. Selbst die berühmte Weizenkornlegende reiht sich in diese Überlegungen ein, ist doch die von Feld zu Feld verdoppelte Füllung des Schachbretts mit Weizenkörnern der Lohn für den «Erfinder des Schachspiels».
Zu den Forschern, die sich in jüngerer Zeit auf die Suche nach den Quellen des Schachs gemacht haben, zählt die Initiativgruppe Königstein. Von 1991 bis 2005 trafen sich namhafte internationale Schachhistoriker zu acht Konferenzen. Letztlich konnten auch sie keine schlüssige Antwort auf die eingangs gestellte Frage finden. Auf der Homepage http://www.schachquellen.de ist ihr Vermächtnis dokumentiert.
Eines der Mitglieder dieser Gruppe ist auch der deutsche Schachhistoriker, -komponist und -schriftsteller Gerhard Josten. Er legt nunmehr in Buchform seine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zum Thema vor.
In den Mittelpunkt der Überlegungen stellt er dabei die Seidenstraße – einen Oberbegriff für die Handelsrouten entlang derer schon um die Zeitenwende der Kontakt zwischen Europa und (Ost-)Asien seinen Anfang nahm. Dabei wurden nicht nur Handelsgüter ausgetauscht, sondern auch Wissen, Ideen, Techniken – sicher aber auch Geschichten, Kunst, Überzeugungen – und ganz gewiss auch Spiele und Spielideen.
In einem seiner einführenden Kapitel führt uns Josten in jene Zeit und räumt mit manchen falschen Vorstellungen über die Seidenstraße auf. So musste man keinesfalls den ganzen Weg vom Mittelmeer nach China auf sich nehmen, um von den Segnungen dieser Route zu profitieren. Vielmehr wurden Güter und Ideen über viele Zwischenstationen unter den Völkern weitergereicht, dabei immer wieder verändert und bereichert.
Den letztgenannten Prozess beschreibt Gerhard Josten nun für das Schachspiel, indem er verschiedene (Brett-)spiele ins Feld führt, die in den Ländern entlang der Seidenstraße und in deren weiterem Einflussgebiet verbreitet waren. Er wägt ab, welche Elemente dabei jeweils in das Schachspiel eingeflossen sind, wie sie sich zu einem Spiel vereinigten und ergänzten, das letztlich als Urform des Schachs angesehen werden kann. Hierfür verwendet er an zentraler Stelle und durchaus schlüssig den aus der Philosophie und Religionswissenschaft bekannten Begriff des Synkretismus.
Den Ort, an dem das Schachspiel entstanden sein könnte, bestimmt Josten im Kushanreich, welches innerhalb der Seidenstraße eine solch zentrale Position einnimmt, dass es sich als Schmelztiegel der Kulturen und ihrer Spiele offenbar anbietet.
Hat der Autor damit die Frage nach dem Ursprung des Schachs gelöst? Sicher nicht! Er bereichert aber den Diskurs um eine interessante Hypothese, die über den genannten Entstehungsort hinaus verschiedene neue Ideen einbringt. Ob sie dem Anspruch strenger Wissenschaft standhält, mag Ihr Rezensent nicht beurteilen. Das ist aber auch sekundär, solange keine eindeutig schlüssigeren Erklärungsansätze bekannt sind.
Die von Josten vorgelegte Arbeit ist eine in sich geschlossene Theorie – nicht besser und nicht schlechter als andere. Das Verdienst des Autors besteht darin, seine Ideen in eine auch dem Laien zugängliche Form gebracht und unsere Sinne für das nach wie vor ungelöste Problem geschärft zu haben.
Ob man seinen Gedankengängen in jedem Falle folgen möchte, bleibt dem Leser überlassen. An manchen Stellen konnte ich dies jedenfalls nicht bis ins letzte Detail tun – so als er zu einem unvollständig(!) gefundenen Satz von mehr als 4’000 Jahre alten Spielsteinen eine mögliche Anordnung auf einem 8×8-Brett ableitet, die natürlich der des heutigen Schachs sehr ähnlich ist.

Gerhard Josten bereichert mit seiner neuen Monographie die Forschung zum Ursprung des Schachs um eine interessante Hypothese. Seine Ideen werden schlüssig und gut lesbar vorgetragen, dabei passend illustriert. Die Kaufempfehlung für einschlägig interessierte Leser wird (trotz des recht hohen Preises) gerne ausgesprochen.
Jostens Buch ist angenehm lesbar geschrieben. Hier kommt ihm sein für einen Sachbuchautor überdurchschnittliches Schreibtalent zu Gute, welches ja schon in Romanen erprobt ist. Die Darstellung ist reich und zweckmäßig illustriert, überwiegend mit archäologischen Funden von Spielsteinen und –brettern sowie kartographischen Skizzen. Dabei gelingt Gerhard Josten auch der Spagat zwischen erfrischender Lesbarkeit und wissenschaftlicher Korrektheit im Umgang mit Quellen und Zitaten. Erstere stammen oft aus dem Internet. Der Autor hat, obwohl schon im achten Lebensjahrzehnt stehend, dieses Medium aktiv in seine Forschungsarbeit einbezogen. Zu den Zitaten ist anzumerken, dass englischsprachige in der Regel ohne Übersetzung stehen gelassen wurden.
Als Klammer des Buches dient der sogenannte Babson-Task – eine Aufgabe, die für Schachkomponisten lange Zeit ebenso unlösbar schien, wie für die Historiker die Frage nach den Quellen des Schachs. Auf dem Titelbild prangt (vielleicht nicht ganz zum Thema passend) die bisher beste Darstellung hierzu in einer Aufgabe des Russen Leonid Jarosch. Gegen Ende des Buches kommt Josten darauf zurück. Man mag den Zusammenhang zur Grundthematik etwas bemüht finden, als eine weitere Anregung zum Weiterforschen (z.B. im Internet) nimmt der Rezensent diesen Exkurs gerne auf.
Der Preis des Buches von knapp 30 Euro erscheint mir allerdings etwas zu hoch und wird ihm möglicherweise die verdiente Verbreitung unter Schachspielern, die gern etwas über den Brettrand hinausschauen, erschweren. ■
Gerhard Josten: Auf der Seidenstraße zur Quelle des Schachs, Diplomica Verlag Hamburg, 139 Seiten, ISBN 978-3842892194
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Das Musik-Kreuzworträtsel im Juli 2014
.
Der neue Musik-Rätselspaß !
.
 Copyright© 2014/7 by Walter Eigenmann
Copyright© 2014/7 by Walter Eigenmann
Rätsel ausdrucken (pdf)
Lösung: —>weiterlesen
.
.
.
Die besten Online-Schach-Portale
.
Virtuell Schach spielen – einfach, praktisch, gut
Walter Eigenmann
.
Seit es das World-Wide-Web 2.0 gibt, gibt’s auch internationale Server, die jedermann/-frau das virtuelle Gamen und Zocken am Computer ermöglichen – Internet-Seiten also, wo man sich in Minutenschnelle (mit Echt- oder Pseudo-Namen) anmeldet, um dann gegen zahllose andere Spieler/innen weltweit in allen möglichen und unmöglichen Spiele-Sparten antreten zu können.
.
Groß und mächtig: Chessbase & Co.
In Sachen Schach mischt seit vielen Jahren die Hamburger Software-Schmiede Chessbase («Fritz») ganz vorne in der Online-Szene mit, und in deren zahllosen virtuellen Turniersälen tummelt sich zu jeder Tages- und Nachtzeit tausendfach der Anfänger wie der Profi, der Patzer wie der Großmeister. Handling, Organisation und Funktionalität von «Schach.De» bzw. «PlayChess» genügen absolut professionellen Ansprüchen, was die enorme Beliebtheit dieses Schachservers begründet. Sogar ganze Vereine können hier ihre Mitgliedschaft zu Blitzturnieren einladen/anmelden, und regelmäßig gastieren internationale GM-Koriphäen mit Video-Theorieschulungen oder Simultan-Vorstellungen. Einen Nachteil für Gelegenheitsspieler hat aber Chessbase mit vielen anderen Anbietern gemeinsam: der Dienst ist kommerziell bzw. nur anfänglich kostenlos.
Ein weiterer, insbesondere im angelsächsischen Raum ebenfalls tausendfach frequentierter und seit Jahren bewährter Schachserver ist der Internet Chess Club (ICC). Auch hier ist das Spielangebot für Anfänger, Vereins- oder Meisterspieler gross, wenngleich für Teilnehmer mit ggf. rudimentären Englischkenntnissen das Handling vielleicht etwas anstrengend ist. Grösster Nachteil für den Amateur-Gelegenheitsspieler allerdings auch hier: Nur der erste Monat ist gratis, anschließend geht’s aufs Portemonnaie.
.
Kommerziell kontra nicht-kommerziell
Natürlich wäre das Internet nicht das weltumspannende Virtual Net, wenn sich gerade im Schach-Bereich nicht auch diverse interessante Server tummelten, die das Online-Schachspielen kostenlos frei Haus liefern. Wer hartnäckig recherchiert im Netz, entdeckt mit Sicherheit zahllose weitere Schach-Portale, kleinere oder ganz kleine, wo sich nach Herzenslust, in klein-intimem Rahmen mit der Compi-Maus die Schachfiguren rumschieben lassen. Sogar die gewaltige FIDE, der weltweite Dachverband aller organisierten Schachspieler, ist inzwischen auf den Geschmack gekommen und bietet das Online-Spiel ebenfalls an unter ihrer «Arena»-Seite (inkl. Rating-System…)
Seit bereits einiger Zeit wird nun der internationale Schachserver-«Markt» mit einer neuen Website aufgemischt, die es mir persönlich ganz besonders angetan hat, nämlich lichess.org.
.
Online-Schach am Beispiel «lichess»
Zu diesem Server fallen einem Stichworte ein, die jeden Online-Schächer in Verzückung versetzen: werbefrei, kostenlos, übersichtlich, vielfältig, verbreitet, computerfrei, lehrreich – dies alles sind unschlagbare Attribute, die auch den Autor dieser Zeilen zu einer Anmeldung bewogen… (Ok, ich geb’s zu, ich bin auch noch bei anderen Schachportalen Mitglied… ;-)
Für all jene, die (z.B. wie ich) momentan Schlechtwetter-Ferien haben, oder die – wegen Betriebsferien des Lokals – nicht an ihren Klubabend gehen können, oder die eher nachts als am Tag schachspielen möchten, oder die pensioniert sind und Zeit en masse haben, oder die aus irgendwelchen privaten oder medizinischen Handicap-Gründen nicht in einem regulären Schachverein mitmachen können, oder einfach überhaupt für alle, die schon immer mal Schach im Internet spielen wollten, aber sich noch nie trauten – für diese ist lichess.org mit Sicherheit eine der allerersten Adressen.
Das Anmelden gestaltet sich denkbar simpel (und funktioniert bei den meisten Schachservern ähnlich): Auf der Hauptseite 1. gewünschten Namen ( = Pseudonym) eingeben – 2. gewünschtes Passwort schreiben 3. Captcha-Abfrage ( = einfache Schachaufgabe) bestätigen – und schon kann’s losgehen. Oben stehen als Ausgangspunkte die Menüs «Spielen» (fürs Aufspüren/Einladen der Gegner), «Partien» (fürs Kiebitzen bei laufenden Games), «Training» (z.B. fürs Lösen von Schachaufgaben), «Turniere« (für die Teilnahme/Eröffnung neuer Blitz-Turniere), «Schachspieler» (für die Mitglieder-Recherche), «Mannschaften» (fürs Beitreten zu internationalen Spieler-Gruppierungen) und «Forum» (fürs Diskutieren über diverse Schach- und andere Themen mit Gleichgesinnten) zur Verfügung.
.
Kein Computereinsatz bitte!
Bereits bei der Registrierung wird einem deutlich klargemacht, dass die Zuhilfenahme von Schachcomputern bzw. -engines auf «lichess» grundsätzlich verboten ist. (Die meisten Schachserver setzen mittlerweile spezialisierte Software ein, die die Menschen-Partien auf typische «Computerzüge» hin analysieren, und die mit ihren Spezialalgorythmen äußerst effizient als Ermittler funktionieren). Es sei denn, man wolle nicht mit, sondern gegen die Bit-Virtuosen antreten – zurzeit ist das die bekannte Chess-Engine «Stockfish», deren Spielstärke man in 8 Schritten runterdrosseln kann (damit man als Mensch nicht schon in 15 Zügen unter die Räder kommt…)
Selbstverständlich lässt sich auch die Option «Mit einem Freund spielen» anklicken, sprich eine Rundum-Einladung mit gezielten Vorstellungen bezgl. Bedenkzeit und gegnerischer Spielstärke verschicken. Wer «nur zum Plausch» mitmachen, also seine Partien nicht werten lassen will, kann auch dies tun. Weiters kann man sich in einen der angebotenen «Autopairing-Pools» einspeisen und erhält dort schnell einen Gegner (gemäß selbstdefinierter Bedenkzeit) zugeteilt. Wie bei vielen anderen Portalen ist aber auch bei «lichess» das Mitmachen als Nur-Gast ohne Registrierung eine Option – für das gelegentliche Spielchen zwischendurch.
.
Schön – einfach – gut
Was gilt es im Zusammenhang mit «lichess» noch an Highlights zu erwähnen? Beispielsweise, dass sogar Anhänger der nach wie vor exotischen, seinerzeit von Bobby Fischer propagierten Spiel-Variante «Chess960» auf ihre Kosten kommen. Oder dass man seine Partien gleich im Anschluss nicht nur als PGN runterladen und damit sammeln, sondern vom Computer bzw. einer Schach-Engine sogar analysieren lassen kann – versehen mit allerlei Statistik sowie mit Zug-Kommentaren wie «Ungenauigkeiten», «Fehler» oder «Patzer» (sowohl im eigenen Spiel wie in jenem des Gegners…)
Alles in allem: «lichess» ist einfach nur empfehlenswert, eine wirkliche Alternative zu den großen kommerziellen Anbietern. Klein und schlicht, aber oho: Schönes Layout, einfaches Handling, viele Optionen, und praktisch jederzeit mit einem Spielerfeld von 1’000 bis 1’500 Teilnehmern aller Nationen und Levels verfügbar – was will das Herz des Online-Schach-Zockers mehr!?
Nur eines ist m.E. noch schöner als Schach am Compi: Die reale Partie in einem realen Verein am realen Brett gegen einen realen Menschen… ■
.
Meine persönliche Liste der 14 wichtigsten Online-Angebote
zum Schachspielen (keine Garantie auf Vollständigkeit)
– ChessCom: http://schach.chess.com/
– SchachOnline: http://www.schachonline.ch/
– ChessPoint: http://www.chesspoint.ch/portal/10-schach-online-spielen
– SchachArena: http://www.schacharena.de/
– FIDE-OnlineArena: http://arena.myfide.net
– PlayChess/Schach.De: http://www.schach.de/
– Free Internet Chess Server: http://www.freechess.org/
– LiChess: http://de.lichess.org/
– ChessMail: http://www.chessmail.de/
– RemoteChess: http://www.remoteschach.de/
– ChessNet: http://www.chess.net/
– GameKnot: http://gameknot.com/
– Caissa’sWeb: http://www.caissa.com/
– ShredderchessNet: http://www.shredderchess.net/
.
.
Internationale Literatur-Wettbewerbe 2014 (3)
.
Lyrik-Wettbewerb 2014 des «Literaturpodiums»
Das Portal «Literaturpodium» schreibt einmal mehr seinen jährlichen internationalen Lyrikwettbewerb aus. Eingesandt werden können unveröffentlichte Gedichte, die Themata sind frei wählbar. Die Beiträge sollen in deutscher Sprache verfasst sein. Dem Wettbewerb angeschlossen ist eine zusätzliche Spezialaufgabe, dessen Thema «Datenschutz» lautet. Einsende-Schluss ist am 1. September 2014, die weiteren Einzelheiten finden sich hier. ■
.
Grazer Jugend-Literatur-Wettbewerb 2015
Einen europaweiten Literaturwettbewerb für Jugendliche, die zwischen 1996 und 2006 geboren sind, schreibt die Grazer «Jugend-Literatur-Werkstatt» aus. Der Wettbewerb nimmt deutschsprachige Texte aus allen literarischen Sparten (Prosa, Lyrik, Tagebücher, Theaterstücke etc.) zum Thema «suchen» entgegen. Einsende-Schluss ist am 30. September 2014, weitere Details sind hier nachzulesen. ■
.
DeLiA-Literaturpreis 2015 für Liebesromane
Der Verein zur Förderung deutschsprachiger Liebesromanliteratur e.V. (DeLiA) offeriert wieder seinen DeLiA-Literaturpreis für den besten deutschsprachigen Liebesroman des Jahres. Teilnehmen können deutschsprachige Autor/inn/en mit einem unveröffentlichten Prosatext, der eine Liebesgeschichte zum Schwerpunkt hat; das Genre (Thriller, Fantasy, SF, Krimi, Historischer Roman, Jugendbuch etc.) ist dabei frei wählbar. Der Preis ist mit insgesamt 2’750 Euro dotiert. Einsende-Schluss ist am 31. Dezember 2014, die weiteren Details finden sich hier. ■
.
.
Weitere Literaturwettbewerbe im Glarean Magazin
.
.
111 Chess Tacticals (41)
.
Schwarz am Zuge gewinnt
 Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. –
Die Serie «111 Chess Tacticals» wendet sich an die Rätselfreunde unter den Schachspielern. Die faszinierende Welt der Schach-Taktik, wie sie sich in diesen 111 Miniaturen spiegelt, beinhaltet herrliche, meist frappante Kombinationen aus der Praxis des jüngsten Amateur- und Profischachs. Der Schwierigkeitsgrad variiert von Aufgabe zu Aufgabe, doch im allgemeinen kann ein Puzzle innerhalb von fünf Minuten von durchschnittlichen Vereinsamateuren gelöst werden. – Die Lösung erhalten Sie jeweils nach einem Mausklick auf das Diagramm, und die Varianten können dann online nachgespielt werden. Ausserdem lässt sich das ganze Puzzle als PGN-Datei downloaden. –
Viel Vergnügen beim Knobeln unserer «111 Chess Tacticals»! ■
.
.
.
.
.
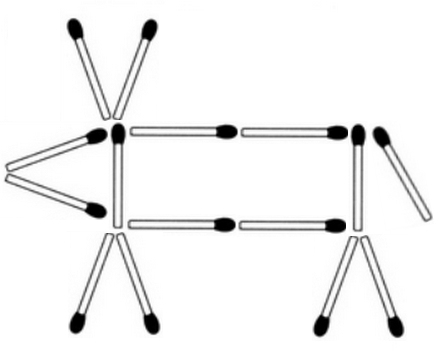

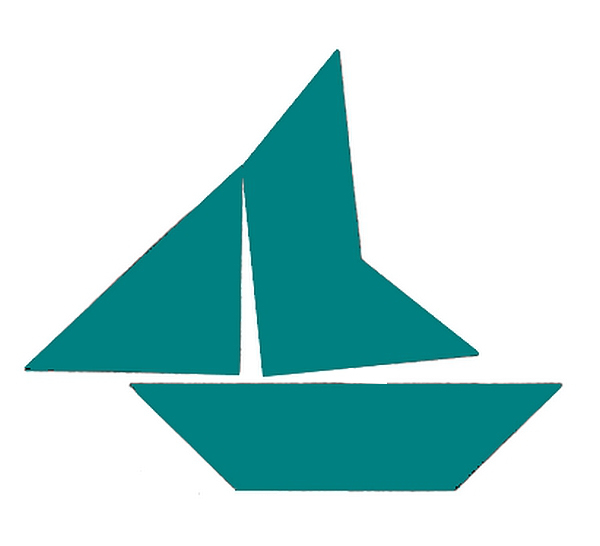
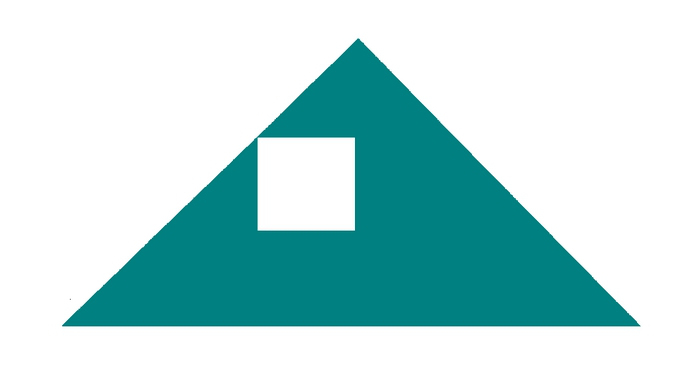

 .
.
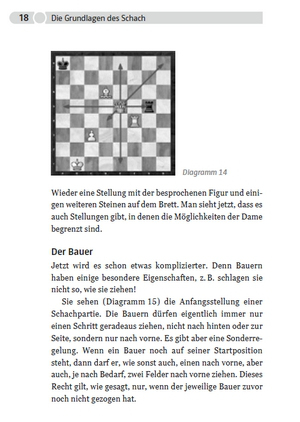
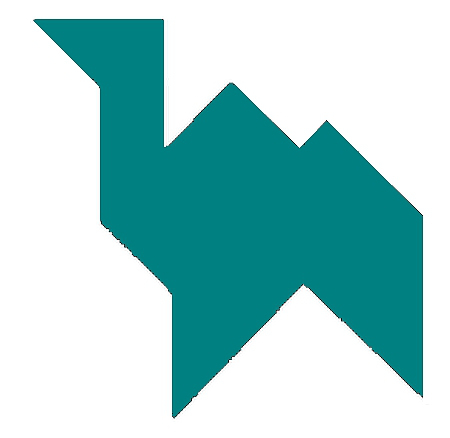






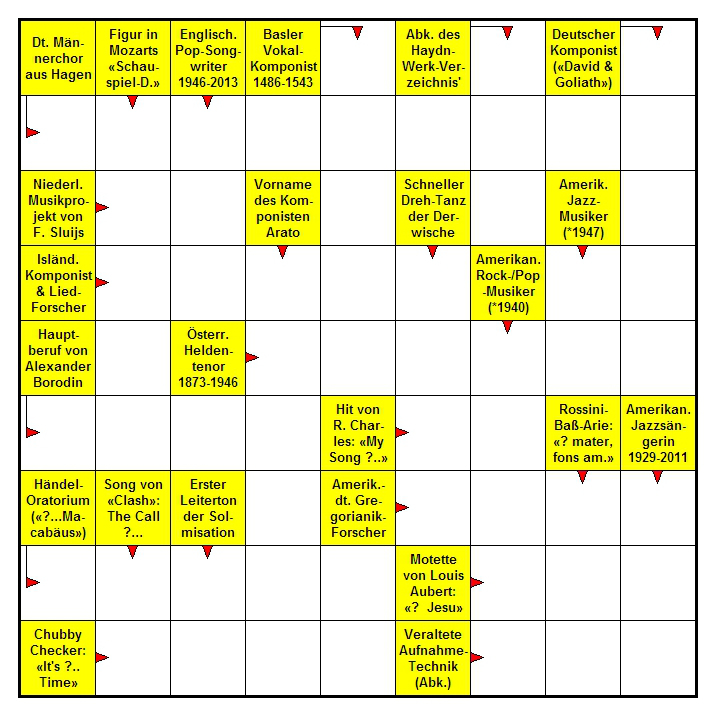

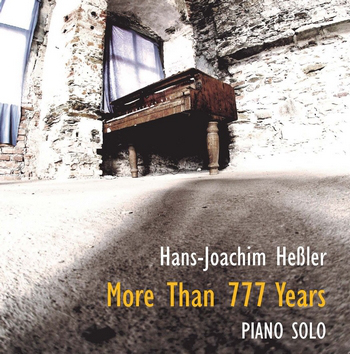





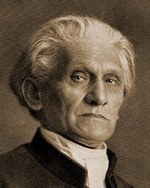
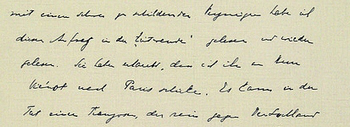
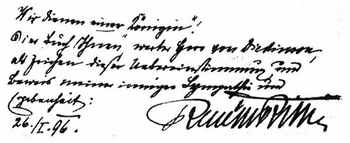






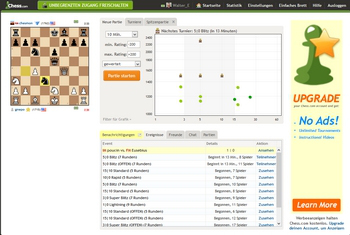
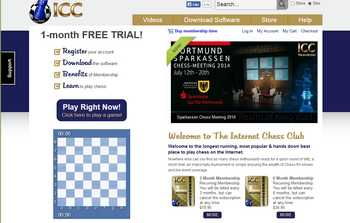

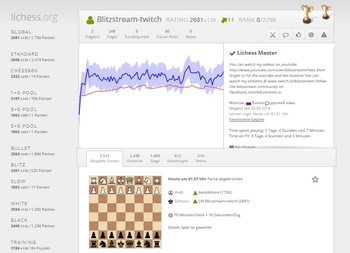





leave a comment