Franz Trachsel: Marsch-Impressionen im Parkhaus
.
Semper fidelis !
Franz Trachsel
.
Shopping-Center-Parkhäuser dürfen für sich beanspruchen, nach aussen umgebungskonform-freundlich aufzutreten, nach innen angesichts ihres grossen Parkplatzangebots aber die nüchtern-zweckmässige Wucht selber zu sein. Und dann erst die ausserhalb der Shopping-Zeiten darin herrschende Stille – empfunden heute, eines vorsommerlich frühen Montagvormittags, und angesichts des nur sehr spärlichen Eintreffens der Kundschaft.
Doch urplötzlich sieht sich, wer schon hier, vom Hauptzugang her von einem vollorchestrierten marschmusikkalischen Auftakt vereinnahmt! Und wer ausserdem auf dem schmalen Weg im Zweiradbereich abgestiegen, der kommt sich in eine kasernenhaft grosse, höchst belebte Blasmusikhalle hineingeraten vor.
Das alles aber keineswegs als aufdringliches Unterhaltungsgezeter dahertönend. Nein, was sich da vollentfaltet sehr wohl hören lässt, ist nichts Geringeres als eine amerikanische Marsch-Legende, nämlich John Philipp Sousas enorm beschwingter «Semper Fidelis». In voller Korpsstärke notabene – ein wirklich frappanter Tages- und Wochen-Start!
Und dann ist da die Erinnerung, diesen Marsch nicht nur in Konzerten, sondern in quasi welthistorischer Entfaltung miterlebt zu haben. Und zwar live anlässlich der Jubiläumsparade «200 Jahre USA» am 4. Juli 1976 auf der Pennsylvania-Avenue in Washington. Dieses Erlebnis dabei umso eindrücklicher, als Sousas «Semper Fidelis» nichts Geringeres ist als das stolz vertonte Siegel der US-Marine. Ja, und wem sonst, wenn nicht der Marine-Band wäre damals die Ehre zugekommen – vom Millionenpublikum besonders stürmisch applaudiert -, dem historischen Tag diesen unverkennbaren Stempel aufzudrücken! Das blendend weiss uniformierte Korps, ein makelloses Neunerkolonnen-Erscheinungsbild, der mitreissende Marschmusik-Takt: ein nationalhistorisches Aufkreuzen wie aus einem Guss!
Hier im Parking des örtlichen Shopping-Centers hingegen, 35 Jahre später: Sein Klang eine wahre Entschuldigung dafür im Gegensatz zu Washington, auch ohne das geringste Aufblitzen hochglänzend polierter Blasinstrumente festzustellen. Aber warum sollte denn den etagentragenden Parkhaus-Betonsäulen, den Auf- und Abfahrtsrampen, den Parkplatzschranken und dem massig alle sieben Etagen untereinander verbindenden Liftschacht nicht ausnahmsweise mal eine echte Klangreflektoren-Rolle zukommen! Aussergewöhnlich dabei halt dieser «Immer-Treu»-Marschauftritt vor allem deswegen, weil er ohne augenfällige Formation auskam. Nahm sich die Freiheit, statt sich mühsam um all die Begrenzungen, Kurven, Auf- und Abstiege herumzuwinden und sich in seine einzelnen Register aufzulösen und ganz eigene Weg ezu gehen. Ja selbst der Dirigent dürfte sich unter dem wuchtigen Etagenmauerwerk marschtrunken mit schwingendem Taktstock auf die sonnige Center-Dachterrasse verirrt haben. Und wenn dabei schrittsicher von jemandem begleitet, dann am ehesten noch vom Tambouren- und Flötenregister, derweil sich das Klarinetten-, das Saxaphon-, Trompeten-, Posaunen-, Pauken- und Bassregister (weil für den vom Dirigenten irgendwo mit seinem Stock in die Luft geschmetterten Takt hellhörig geworden), auf das übrige halbe Dutzend Etagen aufgeteilt haben mochten.
Und weil nun einmal John Philipp Sousas Klassiker des Tages die Aufwartung machte, dann gewiss nicht ohne sein – das Korps bekanntlich hinten dekorativ abschliessendes – Sousaphon-Register! Nicht auszudenken, dieses könnte – weil den Auftritt auch hier hinten abschliessend – im Zuge einer akuten Klangtrunkenheit etwa im Parterre-Zugang, also im Wagenwaschanlagen-Bereich in die gewaltig rotierenden Waschbürsten geraten sein. Deren schonungslos nässetrunkener Umlauf wäre vermutlich der kältesten Dusche ihres Musikerlebens gleichgekommen. Hätte man sich also den völlig aussergewöhnlichen Marsch-Auftritt durchaus im Beisein seines berühmten Komponisten vorstellen können, so doch keineswegs den Untergang einer ganzen Sousaphon-Equipe. So gesehen vielleicht nicht ganz unglücklich für ihn, diese Welt schon vor 80 Jahren verlassen zu haben.
Nun denn, plötzlich erwiesen sich auch meine Marschmusik-Minuten hier als gezählt. Augenblicke später benimmt sich in die eingetretene Stille hinein irgendwo im Parking eine forsch zuschlagende Autotür taktgenau wie ein Schlusssignal. Eine Soundanlage der Zehntausenderklasse in einem Coupé der Mittelklasse hatte wohl Raum- und Klangqualität bewiesen. Hier also ein hochkarätiges Bravourstück, was sich anderswo unter anderen Vorzeichen als polizeilich verbotene Belästigung erwiesen hätte. ■
.
________________________________
Franz Trachsel
Geb. 1933, langjähriger Lokal- und Kulturjournalist bei verschiedenen Printmedien, Kurzprosa in Zeitungen und Zeitschriften, lebt in Emmenbrücke/CH
.
.
.
Humoreske von Franz Trachsel
.
Hab Sonne im Rücken!
Franz Trachsel
.
Auf Rad- und Fußwegen als Stuntman aufzutreten ist nicht der spektakulärste Ort dafür und daher von anderer «Persönlichkeitsstruktur» als im angestammten Film. Anderer Natur daher auch der hier abgehandelte Auftritt, nämlich teils außerirdischer, teils aber vor Ort in Szene gesetzter. Eine Stuntrealität jedoch insofern, als der gewöhnliche Erdenbürger, vorausgesetzt er ist ein Radfahrer, als solcher gemeinsam mit keiner Geringeren als mit Frau Sonne am Himmel Regie führt und zwar in Gestalt eines aktivierten Schattens seiner selbst.
Schatten haben sowohl als Begriff wie auch real ein physikalisch misshelliges Dasein. Sie sind sozusagen Licht und Schatten zugleich. Das vor allem mit einem immens belebten Adria-, einem Balearen- oder Atlantic-City-Strand oder wo auch immer rund um den Erdball, mit schattenspendenden Palmen auf einer Wüstenoase, vor Augen. Selbst dem Radfahrer müssen Licht und Schatten, soweit in Stuntgestalt, nicht bloß als nichtsnutzige Begleiterscheinungen vorkommen. Zur richtigen Tageszeit – Schönwetter vorausgesetzt – am richtigen Ort in der einschlägigen Richtung unterwegs, erlebt er sie einer pfiffigen Himmelslaune, ja -gunst gleich. Und zwar mit Frau Sonne im Rücken. Sollte sich angesichts dessen in ihrem nach Milliarden von Jahren zählenden, höchst warmen Antlitz auch nur ein Hauch von Herzlichkeit regen, dann gewiss aus Freude darüber, aus knapp 150 Millionen Kilometern Entfernung an solch einem präzisen Erdbewohner-Phänomen maßgeblich beteiligt zu sein. Das umso mehr, als fast alles dafür spricht, dass wir die einzigen Lebewesen der Primatenspezies sind, die sich so in ihrem Licht-, Wärme- und Blickfeld tummeln.
Erstmals muss sich solcherlei Einvernehmen auf Mutter Erde – Strassen, ob von den Radfahrern gleich als solche wahrgenommen oder nicht – zur Zeit der meisten Fahrräder vor 200 Jahren eingestellt haben. Dies noch 150 Jahre bevor selbst im Fahrrad-Akkumulator mitgeführte Solar-, also von Frau Sonne gespiesene Energie den Fahrer bei Bedarf beim Pedalen zu unterstützen begann.
Schöne Tage zeichnen sich bekanntlich vielfach auch durch geradezu romantische Abende aus. Herbstabende zum Beispiel können eigentlichen Günstlingen gleich daherkommen. So die Stunden erfüllter irdischer Ansprüche Mr. Stunts: Ein vor allem fülliger Lichteinfall aus spiegelklarem Himmel. Fallen dessen abendlich milde Strahlen flachst denkbar und makellos linear zum West-Ost-Weg ein, sieht er die entscheidend wichtigen Voraussetzungen für seine stolzen Auftritte erfüllt.Etwas Musisches bis schattenhaft Strenges ist nun einmal dran und eine Prise Satire dazu. Musisch der Schattenwurf in Stunts-Gestalt selber, satirisch aber das Wie! Wem sonst nämlich wäre es beschieden, seinen Auftritt grundsätzlich nur bodenflach kopfvoran zu erbringen! Und welcher zum Zeitpunkt seiner Auftritte auf dem demselben Weg unterwegs befindliche Fußgänger nähme nicht Rücksicht auf solcherlei reichlich anders gelagerte Verkehrsteilnehmer! Als solche zeichnet sie nun einmal eine ureigene Signalwirkung aus, die ihresgleichen sucht. Je .länger die Schattengestalt, bei idealem Sonnenlicht-Einfall zwölf und mehr Meter, desto ansehnlicher der Abstand des in Wirklichkeit hinterher Pedalenden und zum Beispiel von Spaziergängern als umso schicklicher empfunden, ihm auf eine freie Fahrt auszuweichen. Wenn sich da nicht selbst Frau Sonne, ihrem abendlichen Untergang nahe, angesichts dessen nicht bisweilen aus ihrer schier universalen Ferne im Sinne eines «Hab Sonne im Herzen» ein diskretes Schmunzeln leisten würde! Aber wie sie sich rund um den Erdball und rund um die Uhr pausenlos irgenwo von neuem auf eine gute Nacht verabschiedet, so meldet sie sich unaufhaltsam stets auch irgendwo auf einen neuen Tag.
Ob dann durch unfreundliche Wolkenhüllen am Bestellen jeweiliger neuer Stunts gehindert, das ist hier Frage. Desgleichen auch ob solche irgendwo auf dem Erdball sich auch durch ihre gute mitteleuropäische Schlankheit auszeichnen. Und das unabhängig von ihrer bisweilen ansehnlich bodeneben dahinhuschenden Länge. So oder so, es lohnt sich als Radfahrer solche gleich am Morgen gemeinsam mit Frau Sonne wieder kreiieren zu gehen. Ihr Auftritt lässt sich zu früher Stunde nach ihrem Aufgang, ob gleich nun aus Osten dem Westen entgegen, diesmal erst recht sehen und erleben. Was, wenn die Frühe, der Einfallswinkel und dessen Linearität stimmen, den jungen Morgen an auffälliger Frische auszeichnet, zeichnet nämlich desgleichen auch seine Stunts aus. Und der mitverantwortliche Regisseur, der Radfahrer hätte (ob mit oder ohne vor ihm unterwegs befindliche Fußgänger) Grund, das bekannte Lied «Hab Sonne im Herzen» auf «Hab Sonne im Rücken» abgewandelt zu singen! Denkbar, dass er damit sogar ans Herz des Stuntmans zu rühren vermöchte! ■
________________________________
Franz Trachsel
Geb. 1933, langjähriger Lokal- und Kulturjournalist bei verschiedenen Printmedien, Kurzprosa in Zeitungen und Zeitschriften, lebt in Emmenbrücke/CH
.
.
.
.
.
.
.
Vier «Berg-Storys» von René Oberholzer
..
Der Berg
Kenia ist in Afrika. Der Kenianer ist in der Schweiz. Die Schweiz ist in der Schweiz. Der Kenianer kennt einen Appenzeller. Der Appenzeller schaut jeden Tag den Säntis an. Der Kenianer schaut jeden Tag den Appenzeller Gürtel an. Appenzell ist nicht das Heimatland des Kenianers. Appenzell ist das Heimatland des Säntis. Der Kenianer trägt ein Glöcklein an seinem Gürtel. Manchmal fährt er auf den Säntis und sagt den Touristen: «Der Säntis ist ein heiliger Berg.» Das sagt er auch dem Appenzeller. «Der Säntis ist ein hoher Berg», sagt der Appenzeller. Der Kenianer wird nie Appenzeller werden. Der Appenzeller wird nie Kenianer werden. Aber der Säntis könnte ein heiliger Berg werden.
.
Der Kompromiss
Ich bin ein taktiler Mensch. Wenn ich in die Berge gehe, fasse ich alle Blumen und Steine an. Die Berge machen mich euphorisch, dann fasse ich auch meine Frau die ganze Zeit an. Ich könnte sie beim Anblick des Säntis, des Kronbergs oder des Stockbergs ständig berühren. Meiner Frau ist das dann oft zu viel. Sie möchte dann einfach wandern und die Aussicht geniessen. Sie ist ein visueller Mensch. Irgendwie treffen wir uns beim Wandern wie auch im sonstigen Leben nie so richtig. Wir haben deshalb beschlossen, als Kompromiss die Wanderung wie auch das Leben auditiv in Angriff zu nehmen.
.
Die Überstunden
Neulich war ich dem Bergpolizisten begegnet. Mitten in der Wand stieg er mir hinterher und fragte mich im Seil, ob ich die Ruhezeiten in der Bergkarte eingetragen hätte. Ich verneinte, worauf er mir zu verstehen gab, dass ich jetzt zwei Stunden Schlaf nachholen müsse, bevor ich weiterklettern dürfe. Der Bergpolizist drängte mich an einen Felsvorsprung ab, und ich versuchte zwei Stunden im Stehen zu schlafen. Der Bergpolizist stand neben mir und rührte sich nicht von der Stelle. Zwei Stunden später hatte das Wetter umgeschlagen, ich durfte weiterklettern, der Polizist stieg ab und suchte einen weiteren Ruhezeitensünder am Berg. Völlig ausgeruht kam ich in der SAC-Hütte an. Der Polizist stürzte etwas später am Berg aus Unvorsichtigkeit ab. Weil an diesem Tag viele Kletterer am Berg unterwegs gewesen waren, hatte der Bergpolizist Überstunden schieben müssen.
.
Das Interview
Ich möchte die Geschichte eines Wanderes erzählen, der immer auf denselben Berg hinaufstieg. «Ich liebe diesen Berg», sagte der Mann einem Journalisten, «keiner ist so schön wie dieser.» Als er weiters gefragt wurde, warum er nicht auch noch auf andere Berge steige, sagte der Mann: «Ich bin schon seit 40 Jahren mit derselben Frau verheiratet. Verstehen Sie?» Der Journalist schaute den Mann lange an, sagte dann: «Ja, ich verstehe Sie.» Dann rief der Journalist seine Lebensgefährtin an und sagte: «Ich möchte mit Dir wieder einmal aufs Hörnli wandern.»
.
______________________
Geb. 1963 in St. Gallen/Schweiz, schreibt seit 1986 Lyrik, seit 1991 auch Prosa, lebt und arbeitet als Sekundarlehrer, Autor und Performer in Wil/Schweiz
.
.
.
Musik-Satire von Nils Günther
.
Der gemeine Orchesterdirigent
Nils Günther
.
Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer!
In unserer musikzoologischen Vortragsreihe «Die Unterwelt der Musik» wollen wir uns heute einer besonders verbreiteten, aber auch sehr interessanten und in weiten Teilen noch unerforschten Spezies zuwenden: dem gemeinen Orchesterdirigenten.
Zunächst sollten wir den Gegenstand unserer Betrachtungen einmal definieren, denn obwohl den gemeinen Orchesterdirigenten jeder kennt, ja wahrscheinlich viele von Ihnen selber den einen oder anderen davon im Plattenregal stehen hat, stellen wir uns mal ganz dumm und fragen: Was ist ein Dirigent?
Hierzu muss man in der Historie recht weit zurückgehen, eigentlich in die graue Vorzeit, an jenen Punkt, wo einer aus der Herde das Maul besonders weit aufriß und sich dadurch zum Leithammel machte. Dass dafür das Maulaufreißen allerdings nicht lange reichte, kann man sich vorstellen; Argumente allein hatten noch selten ewig Bestand. Daher war es nützlich, sich durchaus physischer Gewalt zu bedienen, etwa indem man einen großen Knüppel nahm und alles, was aufmüpfig war einfach niederschlug.
Aus eben dieser Figur des Leithammels entwickelten sich mehrere bis in die heutige Zeit existente Tätigkeiten, die alle mit Machtpositionen zu tun haben. Der Politiker, der Boxer, der Zahnarzt und der Dirigent: sie alle haben ihre Wurzeln im prähistorischen Knüppelschwinger, nur dass die Knüppel im Laufe der Evolution extrem verkümmert oder überhaupt zu rein geistigen geworden sind. Beim Dirigenten ist dieser letzte Rest des Knüppels aber in Form eines kleinen Stäbchens noch gut zu erkennen, auch wenn sich die Funktion seiner Keule ein wenig gewandelt hat. Sie wird nicht mehr zum direkten Prügeln benutzt, letzteres wird vielmehr bloß noch angedeutet; der Dirigent «gibt den Takt an», wie man sagt. (Ob er viel mehr tut, ist von der Wissenschaft noch nicht endgültig geklärt).
Diverse Sagen ranken sich um einige besonders heroische Dirigenten der Vergangenheit. So erzählt man sich heute noch voller Erschauern die Geschichte von Lully, der sich mit seinem (damals noch durchaus knüppelhaften) Stab den Fuß rammte und kurz darauf verschied. Ein Suizid der besonderen Art!
Doch diese heroischen Zeiten sind eigentlich vorbei, heute scheuen die meisten Dirigenten das Risiko, und kaum einer würde mehr selbst ein solches Opfer für die Kunst bringen. Nein, heute geht es dem Dirigenten in erster Linie darum, dem Komponisten zu zeigen, was eine Harke ist. Wedelnd steht der Dirigent an seinem Pult und fuchtelt alle ihm untergebenen Musiker in die Knie. Selbst bei Messen und anderen geistlichen Werken hat der Dirigent keine Skrupel, statt Andacht das blanke Stäbchen walten zu lassen. Das Werk hat vor dem Maestro zu erzittern, nicht etwa umgekehrt! Was man hört ist nicht Mozart oder Beethoven, sondern Bernstein oder Celibidache.
Der Dirigent muss nur die Auf- und Abwärtsbewegung des Stabes erlernen, nichts weiter. Zählen kann das Orchester allein, und zwar gut genug, um sich nicht durch das unrhythmische Gefuchtel aus der Ruhe bringen zu lassen. Gewiefte Dirigenten bringen es zustande, mit der freien Hand ebenfalls Bewegungen auszuführen. Solche Wunderknaben sind rar, und der tosende Applaus ist ihnen gewiss. Schließlich ist das so, als ob ein dressierter Affe gleichzeitig eine Banane isst und sich mit dem linken Fuß am Kopf kratzt. Vor solcherlei Launen der Natur hatte der Pöbel schon seit jeher Respekt. Zu Recht.
Der Weg zum Dirigentendasein führt also über mehrere Stationen. Zunächst muss man einiges an Feinmotorik mitbringen, um überhaupt ein Stäbchen koordiniert bewegen zu können. Nicht nur muss das Holzstück auf und ab bewegt, nein, es muss dabei auch fest genug gehalten werden, so dass es nicht versehentlich aus der Hand fällt. Einem angehenden Maestro werden in der ersten Probephase denn auch diverse Unfälle nicht erspart bleiben, von ausgestochenen Augen über tote Haustiere und zerstörte Porzellansammlungen bis hin zu unabsichtlich kastrierten Schulfreunden. Ist diese Klippe nach Jahren zermürbernden Trainings umschifft, muss sich der Dirigent einige feinere Eigenschaften antrainieren wie Arroganz, Geldgier, Oberflächlichkeit und Narzissmus. Manche haben darüber hinaus eine rudimentäre musikalische Grundausbildung, doch darauf kann man sich nicht verlassen.
In aller Regel muss man zufrieden sein, wenn der Dirigent weiß, in welche Richtung er zu blicken hat. (Für gewöhnlich hat er ja einen Handlanger, der sich Konzertmeister nennt. Dieser schüttelt dem Dirigenten immer wieder die Hand, damit der Maestro seine Position wieder richtig einnimmt, und auch, damit sich die um das Stäbchen gekrampfte Hand wieder etwas entspannen kann). Intelligentere Exemplare der Spezies sind zudem in der Lage, blitzschnell ihre Position durch eine Drehung um 180 Grad zu verändern, um sich gekonnt zum Publikum hin zu verbeugen. Einigen von ihnen gelingt es sogar, sich anschließend wieder mit katzenartiger Behendigkeit in die Ausgangslage zurück zu bewegen. Doch das ist angeborenes Genie, welches sich dem Normalsterblichen nur schwer erschließt.
Ein weiteres bedeutungsvolles Moment kommt hinzu: die Mimik. Sie ist die wahre Kunst des Dirigenten. So kann man es etwa bei Lorin Maazel beobachten, der mit seinem Blick unmissverständlich zu verstehen gibt, dass er nicht nur alle Musiker und das Publikum, sondern auch die Musik selbst abgrundtief verachtet und nur dort droben auf dem Podest steht, weil der Taxameter tickt und ihm den neuen Swimmingpool als sicher finanziert verspricht.
Der Dirigent ist in der glücklichen Lage, das meiste Geld zu verdienen und dafür am wenigsten tun zu müssen. Er muss in der Regel nur einen Auftakt schlagen, danach läuft die Sache quasi von selbst. Üben kann der Dirigent in seinem Sessel zu Hause mit einem feinen Glas Cognac in der einen Hand und der Partitur in der anderen. Lesen kann er sie größtenteils nicht, und so verbringt er die Zeit damit, die schwarzen Punkte mit einem Buntstift zu verbinden und sich von den entstehenden Bildern überraschen zu lassen.
Es ist natürlich nicht verkehrt, wenn der Dirigent den Schluss der Komposition nicht verpasst. Danach weiterzuschlagen wäre nicht von Vorteil. Denn der gebildete Dirigent weiß, dass der Schluss in 90 Prozent aller Fälle laut und immer von Stille gefolgt ist. Diese Stille muss schnell genug wahrgenommen werden, was schon schwieriger ist, da es zur verbindlichen Natur eines Dirigenten gehört, maximal zehn Prozent Hörfähigkeit zu besitzen. Aber der wahre Künstler hat es halt im Blut und wird blitzschnell reagieren, den Atem anhalten und erstarren, sich kurz darauf mit einem Nicken umdrehen und erleichtert sein, wenn tatsächlich geklatscht wird und er nicht doch einfach bei der Generalpause aufgehört hat. Aber da stehen die Chancen fity-fifty, da kennt die wahre Spielernatur gar nichts.
Ansonsten muss der Dirigent noch ein Autogramm geben können und einen Plattenvertrag unterschreiben, den Rest macht sein Assistent.
Derzeit wird die Dirigententätigkeit für sehr viele arbeitslose Fleischer und Polizisten interessant, doch nur wenige wagen einen solchen beruflichen Abstieg tatsächlich, viele werden wegen Überqualifikation auch gar nicht von den Orchestern angenommen. – Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen einen Einblick in die so faszinierende Welt des auf allen Kontinenten heimischen, aber immer noch rätselhaften gemeinen Orchesterdirigenten gegeben zu haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! ■
.
______________________
Geb. 1973 in Scherzingen/CH, Klavier- und Kompositions-Studium in Berlin und Winterthur, zahlreiche kompositorische Veröffentlichungen und Radio-Aufnahmen, lebt seit 1999 als Komponist in Berlin
.
.
Zum 100. Geburtsjahr von Astrid Lindgren
.
Drei Gedichte für Astrid
Humoreske
Christian Futscher
.

Astrid Lindgren mit der Pippi-Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson
.Astrid Lindgren hat schöne Bücher geschrieben. Unvergessen ist zum Beispiel «Pippi Langstrumpf», das auch verfilmt worden ist. Auch andere Bücher von Astrid Lindgren sind verfilmt worden, ich denke nur an die «Kinder von Bullerbü» und andere. Um auf Pippi Langstrumpf zurückzukommen: Ich glaube, es gibt wenige Mädchen in der gesamten Literatur, die so stark und gewitzt sind wie sie. Unvergessen auch ihr Pferd, ihr Affe und ihr Haus, die Villa Kunterbunt, von ihren Rechenkünsten ganz zu schweigen. Ich mache mir die Welt, wie es mir gefällt… oder heißt es: wie sie mir gefällt? Jedenfalls ist das wohl einer der schönsten Sätze der Weltliteratur, da fährt die Eisenbahn drüber!
Astrid Lindgren ist sehr alt geworden, das hat sie sich auch verdient. Ich glaube, man kann sogar sagen, sie ist unsterblich geworden durch das, was sie geschrieben hat. Hätte sie nicht geschrieben, sondern nur erzählt, ich meine, hätte sie ihre Phantasie und ihre Erfindungsgabe nur mündlich in den Dienst der Unterhaltung ihrer Kinder, Enkelinnen, Enkel oder Nichten und Neffen gestellt, wäre sie nicht unsterblich geworden. Aber was ist das schon, Unsterblichkeit? Wer kann denn wirklich garantieren, dass in sagen wir 500 Jahren noch ein Hahn nach Astrid Lindgren krähen wird? Ich muss jedoch sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass in 500 Jahren noch ein Hahn nach ihr krähen wird! Ja, ich bin sogar zuversichtlich, dass auch in 1000 Jahren noch etliche Hähne nach ihr krähen werden! Dank solcher Ausnahmetalente oder soll ich sagen: überragender Schriftstellerinnen wie ihr ist der Fortbestand der Literatur gesichert. Ich habe keine Angst vor einer Vernichtung der Erzählkunst, weil die Erzählkunst gehört zum Menschen wie der Busen zur Frau und das Glied zum Mann, um es drastisch und deutlich zu formulieren.

Michel aus Lönneberga alias Jan Ohlsson
Astrid Lindgren war eine Schwedin, sie wäre am 14. November 2007 hundert Jahre alt geworden. Ich bin noch nicht einmal 50, aber das tut nichts zur Sache. Wer jemals etwas von Astrid Lindgren gelesen hat, der weiß, dass sie eine große Schriftstellerin war und ist. Ihre Literatur lebt nach wie vor, sie erfreut sich bester Gesundheit.
Schon sehr viel Mist ist über Astrid Lindgren geschrieben worden, ich will ihr heute ein Gedicht widmen – ein sehr einfaches, wie es ihrer persönlichen Bescheidenheit entsprochen hätte, denn sie hat sich zeitlebens nie aufgeplustert wie so viele zweit- und drittklassige Autoren, die glauben, sie seien weiß Gott was und dabei sind sie nichts weiter als ein Fliegenschiss auf einem Kuhfladen oder Rossapfel. Es ist unglaublich, wie viele aufgeblasene Wichtigtuer, die keine Ahnung von nichts haben, sich Schriftsteller schimpfen! Astrid Lindgren war da anders, ganz anders, nicht zu vergleichen mit diesen Hohlköpfen, die glauben, sie seien was besseres als ein Furz im Wind oder ein geschmackloser Witz.
Hier jetzt aber das Gedicht für Astrid Lindgren, ein einfaches Gedicht ihr zu Ehren, und das geht so:
Astrid Lindgren
Astrid Lindgren
Astrid Lindgren
Astrid Lindgren
Der Titel des Gedichtes wäre nachzutragen, er lautet ganz einfach: «Astrid Lindgren».
Und ich will ihr noch ein zweites Gedicht schreiben, wieder ihr zu Ehren, eine kleine Spielerei, denn auch sie war verspielt, das sieht man an ihren verspielten Texten, wo Sprachspiele eine große Rolle spielen:
Astrid Lindkren
Arschtritt Lindcreme
Ast im Lindbrenn
Ast im Lindgrün
Ich schreibe ihren Namen
Wie es mir gefällt
Ich hoffe, die Gedichte hätten ihr gefallen! Die zweite Zeile in dem Gedicht ohne Titel ist übrigens in keiner Weise despektierlich gemeint, sondern übermütig, lebensfroh und pippifrech, um es so zu sagen! Und weil aller guten Dinge drei sind, hier noch ein drittes Gedicht für Astrid Lindgren, diesmal ein etwas anders gestricktes als die vorherigen, auch einfach gehalten, aber mit eindeutig mehr Tiefgang. Es drückt sich darin, mehr als in den vorigen beiden, das lyrische Ich aus, das empfindende, möchte ich hinzufügen, ja, ich möchte sogar in aller Bescheidenheit ergänzen: das tief empfindende! Der normale Prosafluss der normalen Alltagssprache ist verabschiedet worden, es heißt jetzt: Grüß Gott, Sprache des Gedichts, zur Lyrik gehörend, ergieße dich über uns armselige Stammler, Stotterer, Stümper…
Ich will Sie aber nicht länger auf die Folter spannen. Das dritte Gedicht für die von mir hoch geschätzte und verehrte Astrid Lindgren hat den Titel «Wie das Leben so spielt» und geht so:
Astrid Lingren wurde sehr alt
Sie starb mit 96
Ihr Bruder hieß Gunnar
Ihre Schwestern Stina und Ingegerd
Auch alle schon tot
Gunnar wurde 68 Jahre alt
Stina 91 und Ingegerd 81
(Wenn ich mich nicht verrechnet habe)
Ob die Schauspielerin
Die Pippi Langstrumpf gespielt hat
Noch lebt?
Schon möglich
Bzw. keine Ahnung
Astrid Lindgren hatte einen Sohn
Der hieß Lars, genannt Lasse
Der wurde nur 60
Sie hat ihn deutlich überlebt
Ach, ach, ach!
Ich hätte Astrid Lindgren gern kennen gelernt, aber das hat nicht sollen sein. Na ja.
Ich hoffe, mit diesem Essay und den drei Gedichten den einen oder anderen aufgerüttelt zu haben. So wie Astrid Lindgren immer alle aufgerüttelt hat, vor allem die Kinder. Mögen die Bücher von Astrid Lindgren noch in 10’000 Jahren die Herzen und Köpfe der Leserinnen und Leser erfreuen.
Danke für die Aufmerksamkeit.
.
.
Geb. 1960 in Feldkirch/A, Studium der Germanistik und Romanistik in Salzburg, Prosa- und Lyrik-Publikationen in Büchern und Zeitschriften, Träger verschiedener Literatur-Preise und -Stipendiate, lebt in Wien
.
.
.
.
.
.
.
Satire von Joschi Anzinger
.
Die Königin von Zasta
Eine Elegie
Joschi Anzinger
Es ist in dieser Geschichte von einem wunderschönen Land namens Autrischia die Rede, welches, am Rande des großen Sumpfes Konkursien gelegen, vom allmächtigen Geldfluss Euroinoco durchflossen wird. Dieser Fluss entzieht dem Kontinent Teuropa viele viele kleine Geldquellen und fließt schließlich nach wuchernden Zinsenkraftwerken und Börsenstromschnellen zu den Anlegerklippen. Zuletzt mündet der Eurinoco hinter den Aktienbergen und den Abkeschteichen in den Kapitalistischen Ozean.
In Autrischia leben viele fleißige Bürger und Handwerker, Bauern und Geschäftsleute, und alle kommen sie miteinander ganz gut zurecht. Nun trug es sich zu, dass durch geschickte Täuschung der Einwohner über Nacht das Land jäh von der hartherzigen Königin von Zasta eingenommen wurde. Sie ist gnadenlos berechnend in ihrem Handeln, sie ist äußerst korrupt, käuflich und bestechlich, und es eilt ihr der Ruf voraus, überall wo sie herrsche, rolle der Jubel.
Sie kam in ihrem goldenen Schiff über den Eurinoco nach Autrischia, um bis in die entlegensten Winkel des Landes zu walten. Kein Geschäft floriert nun mehr ohne ihr, kein Mensch tut einen Handgriff ohne Aussicht auf ihre Gunst, und jeder Mensch, der einmal ihre Nähe gespürt hat, will nicht nur für immer in ihrer Umgebung bleiben, sondern er möchte immer mehr von ihrer Zuneigung haben.
Die Königin von Zasta befehligt aber nicht alleine, sondern ihrem Tross folgen jede Menge Ritterfräuleins im Nadelstreif, und ein ganzes Heer von Spesenrittern reiten auf ihren Amtschimmeln einher, und unzählige Gaukler, Quacksalber und Zauberer, welche alle von Ihrer Majestät versorgt sein wollten, bilden ihr Gefolge. Gezüchtet werden die Amtsschimmel im Flippizanergestüt Schöntrum, wo sie auch zu Amtsschimmeln zugeritten und ausgebildet werden.
Jeder Bürger begehrt die Königin von Zasta und wünscht sich, auf Gedeih und Verderben, sie zur Gänze für sich zu beanspruchen. Besonders ergeben sind ihr die Zauberin Krampfadria und die hartherzige Prinzessin Hammaned. Eine Getreue ist auch Lady Von Nuttingham, die Gauklerin Promilla und die manchmal etwas indisponierte Frau von Huscher. Schier Tag und Nacht gepriesen wird die unwiderstehliche Königin von Zasta von der Spesenritterin Fräulein Po-Vor und der nach außen ehrwürdigen, aber zu den Untertanen geizigen Baronin von Trug und Lug.
Eines Tages befiehlt die Königin von Zasta ihrem Gefolge, die zwei großen Speicherseen Schillingsweiher und Groschenlora anzuzapfen und auszupumpen, um damit den Geldfluss Eurinoco zu speisen, damit der Kontinent Teuropa nicht austrockne.
Und siehe da, die Bewohner von Autrischia taten was ihnen befohlen, da sie befürchteten, die Königin von Zasta könnte es sich wieder anders überlegen und ihre unerschöpflichen Quellen erneut versiegen lassen. Sie schenkten ihre Speicherseen Schillingsweiher und Groschenlora der Königin von Zasta und bekamen ihr Wasser fortan aus dem Geldfluss Eurinoco.
Doch sein Wasser schmeckte vielen Menschen nicht wirklich und sie fanden plötzlich mit der ihnen zugewiesenen Ration nicht mehr das Auslangen. Dafür sicherten sich die zahlreichen Spesenritter die schönsten Uferzonen des Eurinoco und verbauten diese mit ihren monströsen Ministerienburgen. Da sind allen voran Spesenritter Von der Ädsch Bädsch mit seinem mächtigen Firlefanzministerium, nebst Spesenritter Von Klamm und Heimlich in seiner Burg, dem Veräußerungsministerium. Bei diesen beiden Spesenrittern laufen alle Fäden zusammen, und sie sind der Königin von Zasta in Treue ergeben. Unweit davon befindet sich die Burg Flausenstein des Spesenritters Van den Andern, zuständig für kulturelle Belange. Das Spesenritterfräulein Van Soll und Haben regiert von der Flaxenburg aus das Ungesundheitsministerium, und die Spesenritterin Van Palawa dirigiert das Einbildungsministerium. Die Spesenritterin Van der Bausch und Bogen herrscht in der Burg Justizewitz über alles was Recht ist, und in der Veteranenburg, von schwarzen Krähen beschützt und verteidigt, streichelt Spesenritter Van der Vorn und Hinten, Tag und Nacht seinen Zapfen.
Alle Bewohner sind von der Schönheit und Grazie der Königin von Zasta angetan, und es gilt als Zeichen von Macht, Stärke und Intelligenz, zu ihren Auserwählten zu gehören. Aber besonders dreist treiben es ihre Spesenritter. Wöchentlich treffen sie sich in der Burg Wahnsiedel im Penedrant zu ihren theatralischen Sitzungen und Zusammenkünften, um nebenbei ihre Taschen im burgeigenen Selbstbedienungsladen nach Herzenslust zu füllen.
In der Burg Wahnsiedel ist das Wort Sparen im Penedrant verpönt, und die Spesenritter reden mit gespaltener Zunge und schufen sich eine Eurokratie, in der es für Privilegierte eine Schande ist, mit den vorhandenen Reserven des Eurinoco sorgsam umzugehen. Jeder Spesenritter lebt auf großem Fuß und Sparen wird nur von den minder privilegierten Untertanen gefordert.
Viele Privilegierte, Angehörige des so genannten Geldadels, wurden auf Grund ihrer Abstammung in den Dunstkreis der Königin von Zasta hineingeboren. Für sie ist es nicht weiter schwierig, an den Rocksaum Ihrer Majestät, an das Goldene Kesch, heran zu kommen, welcher ewige Jugend, Klugheit und Schönheit verleiht, denn es hat sich über die Jahrhunderte der unsinnige Aberglaube zum Mythos gefestigt, dass Kesch zugleich fesch macht. Aber die meisten Untertanen müssen ohne üppige Gönnerschaft Ihrer Majestät ihr Leben meistern. Ihnen bleibt nur das Wissen, dass es die Königin von Zasta irgendwo gibt und dass sie zwar wunderschön sei, und jedem dem sie ihr Wohlwollen schenkt, ist er auch noch so einfältig und hässlich, Macht und Geltung, Ansehen und Ehre verleiht.
Doch sie ist auch gefährlich und berechnend, denn sie macht das Herz der Menschen steinhart, und wer mit ihr einmal ins Bett durfte, der ist zu jeder Tat bereit, selbst wenn es gilt, für Ihre Majestät über Leichen zu gehen. Sie ist mächtig und begehrt, weil sie Türen öffnet, die sonst niemand zu öffnen vermag, und sie macht aus Bettlern Regenten, welche in ihrem Namen herrschen.
Die Königin von Zasta macht aus Narren Führer und aus Herrschern Narren. Sie macht aus Damen Huren und sie macht aus Vätern Mörder, sie macht aus Menschen Tiere und aus Sehenden Blinde. Sie macht die Reichen im Grunde arm und sie macht die Guten schlecht, sie macht die Hässlichen schön und sie lässt die Unwissenden klug erscheinen. Sie macht die Ehrlichen falsch, die Aufrechten beugt sie, die Schwachen kauft sie und die Habgierigen verhungern neben ihrer gefüllten Schüssel.
Lang ist ihr Register und ungebrochen ist ihre Macht. Die Königin von Zasta beherrscht unsere Welt bis ans Ende aller Zeit. ■
___________________
 Joschi Anzinger
Joschi Anzinger
Geb. 1958 in Altlichtenberg/A, zahlreiche Publikationen von Dialekt-Lyrik und Kurzprosa in Anthologien, verschiedene Beiträge in Rundfunk und Fernsehen, Mitglied der Grazer AutorInnen Versammlung und der Österreichischen Dialekt-AutorInnen, lebt in Linz/A
.
.
.
.
Humoreske
.
Wienerli in kultureller Schräglage
Franz Trachsel
Jim hatte im Schulaufsatz ein Mittagessen zu beschreiben. Es hatte Wienerli*) gegeben. Weil an sich eine familiäre Angelegenheit, wollte auch Papa wissen, was dazu schließlich im Aufsatz stand.
«Aber Jimmy», hatte er einzuwenden, «wie kann man nur aus Wienerli ‘Wienerlein’ machen?!»
«Wenn schon schriftdeutsch, dann auch das längst fällige Wienerlein, nichts anderes als ein Zugeständnis an die Sprachkultur, Papa» gab sein Sohn fast schnippisch zu bedenken.
«Aber», fand Papa, «eine – sollte dem kulturell wirklich so sein – meines Erachtens am total falschen Objekt in Schräglage geratene Kultur. Dass Du dann nicht etwa gleich noch Wienerchen draus machst! Vor allem aber ist Dein Aufsatz, wo doch Dein Verhalten noch keineswegs vorbildlich ist, nicht etwa der Ort, Vorbehalte an unserer Tisch-, will sagen Esskultur anzubringen..!» –
Den Aufsatz zu beurteilen war letztlich aber auch hier dann die Sache des Lehrers. Dieser traute seinen Augen kaum:
«Weinerchen… Weinerchen… ich buchstabiere: W……..n für Wienerli – was soll das, Jim?»
«Ja, Vater war dann auch der Meinung, daran dass wir es mit Weinerchen statt mit Wienerli zu tun haben, müsse der Metzgermeister, weil er offenbar ein Problem hatte sie richtig anzuschreiben, in kulturelle Schräglage geraten und schuld sein!»
«Hmm, und dann erst..» der Lehrer plötzlich nachdenklich: «…all die Ihretwegen in kulturelle Rückenlage geratenen… Schweinerchen!»
*) Wienerli = Schweizer Schweinswürstchen
________________________________
Franz Trachsel
Geb. 1933, langjähriger Lokal- und Kulturjournalist bei verschiedenen Printmedien, Kurzprosa in Zeitungen und Zeitschriften, lebt in Emmenbrücke/CH





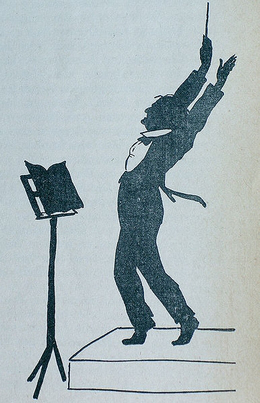


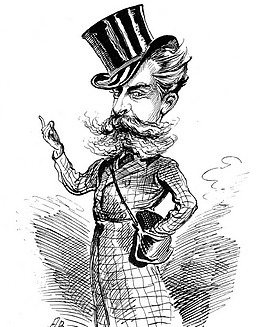








leave a comment