Das Zitat der Woche
.
Über die rechte Erziehung
Immanuel Kant
.
Unsern Schulen fehlet fast durchgängig etwas, was doch sehr die Bildung der Kinder zur Rechtschaffenheit befördern würde, nämlich ein Katechismus des Rechts. Er müßte Fälle enthalten, die populär wären, sich im gemeinen Leben zutragen, und bei denen immer die Frage ungesucht einträte: ob etwas recht sei oder nicht? Beispielsweise wenn jemand, der heute seinem Kreditor bezahlen soll, durch den Anblick eines Notleidenden gerührt wird, und ihm die Summe, die er schuldig ist, und nun bezahlen sollte, hingibt: ist das recht oder nicht? Nein! Es ist unrecht, denn ich muß frei sein, wenn ich Wohltaten tun will. Und, wenn ich das Geld dem Armen gebe, so tue ich ein verdienstliches Werk; bezahle ich aber meine Schuld, so tue ich ein schuldiges Werk. Ferner, ob wohl eine Notlüge erlaubt sei? Nein! es ist kein einziger Fall gedenkbar, in dem sie Entschuldigung verdiente, am wenigsten vor Kindern, die sonst jede Kleinigkeit für eine Not ansehen, und sich öfters Lügen erlauben würden.
Gäbe es nun ein solches Buch schon, so könnte man, mit vielem Nutzen, täglich eine Stunde dazu aussetzen, die Kinder das Recht der Menschen, diesen Augapfel Gottes auf Erden, kennen, und zu Herzen nehmen zu lehren. –Was die Verbindlichkeit zum Wohltun betrifft: so ist sie nur eine unvollkommene’ Verbindlichkeit. Man muß nicht sowohl das Herz der Kinder weich machen, daß es von dem Schicksale des andern affiziert werde, als vielmehr wacker. Es sei nicht voll Gefühl, sondern voll von der Idee der Pflicht. Viele Personen wurden in der Tat hartherzig, weil sie, da sie vorher mitleidig gewesen waren, sich oft betrogen sahen. Einem Kinde das Verdienstliche der Handlungen begreiflich machen zu wollen, ist umsonst. Geistliche fehlen sehr oft darin, daß sie die Werke des Wohltuns als etwas Verdienstliches vorstellen. Ohne daran zu denken, daß wir in Rücksicht auf Gott nie mehr, als unsere Schuldigkeit tun können, so ist es auch nur unsere Pflicht, dem Armen Gutes zu tun.
Denn die Ungleichheit des Wohlstandes der Menschen kommt doch nur von gelegentlichen Umständen her. Besitze ich also ein Vermögen, so habe ich es auch nur dem Ergreifen dieser Umstände, das entweder mir selbst oder meinem Vorgänger geglückt ist, zu danken, und die Rücksicht auf das Ganze bleibt doch immer dieselbe.
Der Neid wird erregt, wenn man ein Kind aufmerksam darauf macht, sich nach dem Werte anderer zu schätzen. Es soll sich vielmehr nach den Begriffen seiner Vernunft schätzen. Daher ist die Demut eigentlich nichts anders, als eine Vergleichung seines Wertes mit der moralischen Vollkommenheit. […]
Ob aber der Mensch nun von Natur moralisch gut oder böse ist? Keines von beiden, denn er ist von Natur gar kein moralisches Wesen; er wird dieses nur, wenn seine Vernunft sich bis zu den Begriffen der Pflicht und des Gesetzes erhebt. Man kann indessen sagen, daß er ursprünglich Anreize zu allen Lastern in sich habe, denn er hat Neigungen und Instinkte, die ihn anregen, ob ihn gleich die Vernunft zum Gegenteile treibt. Er kann daher nur moralisch gut werden durch Tugend, also aus Selbstzwang, ob er gleich ohne Anreize unschuldig sein kann.
Laster entspringen meistens daraus, daß der gesittete Zustand der Natur Gewalt tut, und unsre Bestimmung als Menschen ist doch, aus dem rohen Naturstande als Tier herauszutreten. Vollkommne Kunst wird wieder zur Natur.
Es beruht alles bei der Erziehung darauf, daß man überall die richtigen Gründe aufstelle, und den Kindern begreiflich und annehmlich mache. Sie müssen lernen, die Verabscheuung des Ekels und der Ungereimtheit an die Stelle der des Hasses zu setzen; innern Abscheu, statt des äußern vor Menschen und der göttlichen Strafen, Selbstschätzung und innere Würde, statt der Meinung der Menschen, – innern Wert der Handlung und des Tun, statt der Worte, und Gemütsbewegung, – Verstand, statt des Gefühles, – und Fröhlichkeit und Frömmigkeit bei guter Laune, statt der grämischen, schüchternen und finstern Andacht eintreten zu lassen. ■Aus Immanuel Kant, Über Pädagogik, in: Werke in 12 Bänden (W.Weischedel/Hg.), Suhrkamp Verlag 1968 (Bd. 12)
.
Themenverwandte Links
Kindererziehung – Erziehung-Kinder-Familie – Mittelalterliche Erziehung – Eltern unter Druck – Erziehungsdefizite nehmen zu – Kinder stark machen – Kindeswohl oder Ehegattenwohl – Bildungsferne – Warum Kinder sich langweilen sollten – Gender Mainstreaming – Wochenendvati – Ganzheitliche Entwicklung der Kinder – Autoritäre Erziehung&Alkohol
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von den Geschlechtern
Immanuel Kant
.
In alle Maschinen, durch die mit kleiner Kraft ebensoviel ausgerichtet werden soll als durch andere mit großer, muß Kunst gelegt sein. Daher kann man schon zum voraus annehmen: daß die Vorsorge der Natur in die Organisierung des weiblichen Teils mehr Kunst gelegt haben wird als in die des männlichen, weil sie den Mann mit größerer Kraft ausstattete als das Weib, um beide zur innigsten leiblichen Vereinigung, doch auch als vernünftige Wesen zu dem ihr am meisten angelegenen Zwecke, nämlich der Erhaltung der Art, zusammenzubringen, und überdem sie in jener Qualität (als vernünftige Tiere) mit gesellschaftlichen Neigungen versah, ihre Geschlechtsgemeinschaft in einer häuslichen Verbindung fortdauernd zu machen.
Zur Einheit und Unauflöslichkeit einer Verbindung ist das beliebige zusammentreten zweier Personen nicht hinreichend; ein Teil mußte dem andern unterworfen und wechselseitig einer dem andern irgendworin überlegen sein, um ihn beherrschen oder regieren zu können. Denn in der Gleichheit der Ansprüche zweier, die einander nicht entbehren können, bewirkt die Selbstliebe lauter Zank. Ein Teil muß im Fortgange der Kultur auf heterogene Art überlegen sein: der Mann dem Weibe durch sein körperliches Vermögen und seinen Mut, das Weib aber dem Manne durch ihre Naturgabe, sich der Neigung des Mannes zu ihr zu bemeistern: da hingegen im noch unzivilisierten Zustande die Überlegenheit bloß auf der Seite des letzteren ist. – Daher ist in der Anthropologie die weibliche Eigentümlichkeit mehr als die des männlichen Geschlechts ein Studium für den Philosophen. Im rohen Naturzustande kann man sie ebensowenig erkennen als die der Holzäpfel und Holzbirnen, deren Mannigfaltigkeit sich nur durch Pfropfen oder Inokulieren entdeckt, denn die Kultur bringt diese weiblichen Beschaffenheiten nicht hinein, sondern veranlaßt sie nur, sich zu entwickeln und unter begünstigenden Umständen kennbar zu machen.
Diese Weiblichkeiten heißen Schwächen. Man spaßt darüber; Toren treiben damit ihren Spott, Vernünftige aber sehen sehr gut, daß sie gerade die Hebezeuge sind, die Männlichkeit zu lenken und sie zu jener ihrer Absicht zu gebrauchen. Der Mann ist leicht zu erforschen, die Frau verrät ihr Geheimnis nicht, obgleich anderer ihres (wegen ihrer Redseligkeit) schlecht bei ihr verwahrt ist. Er liebt den Hausfrieden und unterwirft sich gern ihrem Regiment, um sich nur in seinen Geschäften nicht behindert zu sehen; sie scheut den Hauskrieg nicht, den sie mit der Zunge führt und zu welchem Beruf die Natur ihr Redseligkeit und affektvolle Beredtheit gab, die den Mann entwaffnet. Er fußt sich auf das Recht des Stärkeren, im Hause zu befehlen, weil er es gegen äußere Feinde schützen muß; sie auf das Recht des Schwächeren: vom männlichen Teil gegen Männer geschützt zu werden, und macht durch Tränen der Erbitterung den Mann wehrlos, indem sie ihm seine Ungroßmütigkeit vorrückt.
Im rohen Naturzustande ist das freilich anders. Das Weib ist da ein Haustier. Der Mann geht mit Waffen in der Hand voran, und das Weib folgt ihm mit dem Gepäck seines Hausrats beladen. Aber selbst da, wo eine barbarische bürgerliche Verfassung Vielweiberei gesetzlich macht, weiß das am meisten begünstigte Weib in ihrem Zwinger (Harem genannt) über den Mann die Herrschaft zu erringen, und dieser hat seine liebe Not, sich in dem Zank vieler um eine (welche ihn beherrschen soll) erträglicherweise Ruhe zu schaffen.
Aus Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Königsberg 1798
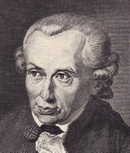






2 comments