Dominik Riedo und Karin Afshar – Ein literarisches E-Mail-Interview
.
Kairos – der richtige Zeitpunkt
oder
Kinski, Riedo, Schostakowitsch und … Kaffee
.
Dr. Karin Afshar
.
.

Dominik Riedo (* 28. Februar 1974 in Luzern/CH)
Ein Interview ist ein Gespräch, bei dem der eine Gesprächsteilnehmer den anderen zu einem zuvor festgelegten Thema befragt. Ziel eines Interviews ist die Erlangung von Information, entweder persönlicher oder sachlicher Art. Der Leser, der das Interview lesen wird, weiß bestenfalls hinterher mehr über den Befragten als er vorher wusste.
Ein Interview gelingt dann besonders gut, wenn sich der Befragende hinreichend über seinen Partner vorinformiert, sich ausdrucksstarke Fragen überlegt und sie in einen mehr oder weniger geordneten Zusammenhang bringt.
Der Befragte seinerseits muss während des Interviews eigentlich nichts weiter tun, als auf die Fragen so zu antworten, dass sowohl er als auch der Befragende mit den Antworten jeweils ihre Botschaft auf den Weg bringen.

Karin Afshar (* 1958 in der Eifel/D)
Es gibt etliche Fälle misslungener Interviews. Die meisten bekommen Leser oder Zuschauer oder Hörer nie zu sehen, aber hin und wieder macht eines in den Medien die Runde.
Ein echtes Skandal-Interview war eines mit Klaus Kinski, geführt mit einer jungen Reporterin, in einem Park (vielleicht Hamburg), im Beisein seiner Frau und einigen Fernsehleuten. Es ging um Kinskis damals gerade herausgekommenes Stück «Jesus Christus».
Nun war Kinski als «unmöglich», als enfant terrible bekannt, und was Interviews anging als störrisch verschrien. Ein Interview mit ihm also eine heikle Sache, die guter Vorbereitung bedurfte. Die junge Reporterin tappte gleich zu Beginn in ein erstes Fettnäpfchen, indem sie ihre Frage um das bedeutungsschwere Wort «ausgefallen» erweiterte. Das zweite Näpfchen stellte sich ihr in den Weg, als sie Kinski als «negativen Helden» bezeichnete, der sich nunmehr (überraschenderweise, ausgerechnet) des Neuen Testaments angenommen hätte… Kinski eskalierte sofort und ließ sich auch nicht mehr beruhigen. Der Rest des Interviews ist Geschichte.

Interview-Fettnäpfchen-Zerstörer Klaus Kinski (im legendären Park-Interview 1971)
Mein Gesprächspartner ist nicht Klaus Kinski (der ist auch inzwischen etliche Jahre tot), sondern ein lebender, kürzlich Geburtstag feiernder Schweizer Schriftsteller: Dominik Riedo. Als Nicht-Schweizerin und als Nur-noch-Sporadisch-Lesende kenne ich Herrn Riedo nicht. Eine Lücke, die ich schließe, indem ich im Netz recherchiere. Dominik Riedo studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in Zürich, Berlin und Luzern, von 2004 bis 2006 war er Lehrbeauftragter an der Universität Zürich, seit 1993 ist er Schriftsteller, Mitherausgeber von «Aufklärung und Kritik» (Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie), war 2010-2012 der Präsident des Deutschschweizer PEN-Zentrums und von 2007-2009 der Kulturminister der Schweiz. Er publiziert Bücher in verschiedenen Verlagen, betreibt eine Webseite und schreibt einen Blog, in dem er Aphorismen und Auszüge aus seinen Arbeiten einstellt. Ich lasse mir drei seiner neuesten Bücher (2014 erschienen) kommen.
Geplant ist ein E-Mail-Interview; diese Form von Interviews gewinnt immer mehr an Beliebtheit, folgt aber eben eigenen journalistischen Regeln, die man auch kennen sollte. Der größte Unterschied zu normalen Interviews ist der, dass die beiden Gesprächspartner nicht die Möglichkeit haben, eine gestellte Frage zu erweitern oder zu erörtern, sondern die Befragung und Beantwortung statischer sind und demzufolge strukturiert vorbereitet sein wollen. Zehn Fragen, so steht in den Leitlinien, die ich alsbald finde, sollten es in der Regel sein.
Ich schreibe Herrn Riedo eine erste Mail, um mich vorzustellen und um anzukündigen, dass demnächst meine Fragen kommen. Ich muss mich erst «warm laufen».
Frage: Was lesen Sie zurzeit? (Und ist es eher ein dickes oder dünnes Buch?)
Riedo: Proust und Lovecraft und Barnes.
Anlass zur Frage ist ein Zitat: «Literatur ist auf der einen Seite wie ein dickes Buch, auf der anderen wie ein dünnes. Im dicken, das im unmöglichen Idealfall ein Weltwälzer wäre, kann man sein ganzes Leben fortlesen, ohne aus dem Traum in die Realität niedersteigen zu müssen. Beim dünnen, das bis zu einem Wort, zu einem Zeichen nurmehr, zusammenschmelzen soll, wird durch das Gelesene eine plötzliche Einsicht in die Wirklichkeit bewirkt.»
Riedo: Man kann nicht sämtliche Literatur in einem Menschenleben lesen. Darum ist es vor allem wichtig, von elementaren Werken zumindest den Nukleus – also das, was ein bestimmtes Werk im Innersten zusammenhält, was es ausmacht und determiniert – zu verstehen; man sollte (selbst als unkreatives Wesen) zumindest begreifen, warum ein Autor ein solches Buch überhaupt schreiben wollte und konnte.
In einer späteren Mail, nachgefragt, wie es Proust jetzt «ginge»:
Riedo: Proust steckt fest. Der dritte Band ist zu zäh. Mal sehen, ob ich ihn durchgehe oder überwinde. Im Moment einiges andere auf dem Nachttisch.

Dominik Riedo: «Uns trägt das Angesungene» – edition taberna kritika
Ich lese derweil in «Uns trägt das Angesungene». Es ist ein rosa-/magentafarbenes A6-formatiges Taschenbuch mit Textschnipseln, mit Angedachtem, farbig im Text belassenen Korrekturanmerkungen und geschwärztem Text. Sieht interessant aus. Der Klappentext hebt an mit der Frage, ob Skizze auch Werk sein kann, so unfertig wie sie ist. Das Buch werde zur doppelten Allegorie, in dem es die (Un)Fertigkeit einer offengebliebenen Korrektur schamlos ausstelle. Ich stolpere über das erste von zwei Attributen, die man Riedos Arbeit zuweist.
Frage: Was meinen die Rezensenten und auch der Verlag mit der «schamlosen Ausstellung» des (Un)fertigen? Sollten «wir» – die Leser – uns für etwas schämen – und vor welchem Hintergrund sollen wir uns schämen? Lassen Sie alle Scham fallen, weil Sie nicht schreiben, wie es sich «gehört»?
Riedo: Wieso, wie «gehörte» es sich? Oder halt dies: Ich soll mich doch wirklich nicht schämen, das Unfertige zu zeigen: Denn wann ist etwas schon nicht «unfertig‘? Das mit den Leserinnen und Lesern ist eine verzwickte Sache: Eigentlich wäre nicht (fast) alles, was man als Wort-Mensch so schreibt, für deren Augen. Aber irgendwie muss man halt leben.
Ein zweites Attribut ist «verstörend»… Bin erstaunt, bin kaum verwirrt, wegen der Korrekturen nicht (kannte ich schon aus anderen Büchern), aufgrund der Inhalte nicht, muss schmunzeln (viele Ideen! Wenn er das alles zu Erzählungen machte!), bin wiedermal bestätigt: die Welt ist verrückt, so wie sie ist. Und nicht dazu angetan, wirklich heimisch in ihr zu sein.
Frage: Ist das mehr oder weniger auch das, was Sie trägt? – Was Sie hier «ansingen»? – Eine Welt in Auflösung?
Riedo: Die Welt ist ver-rückt: Wenn es nur in den Büchern wäre, fände ich das äußerst anstrebenswert. Aber die Realität … Es ist nicht zu sagen, was heute alles «geht». Eine Lösung wird kommen: Hoffen wir, es ist nicht eine endgültige. Auf dass man immer wieder dagegen ansingen darf. Und doch alle etwas Ungesungenes im Kopfherz tragen können.
Das mit dem Ansingen kenne ich. Dass es in Riedos Angesungenem viele Tote, Morde, Rachegedanken gibt… eben, so ist die Welt. Ver-Rückt. In meinem Alltag fallen mir just in dieser Zeit die kurzen, zusammengedampften Symphonien von Darius Milhaud zu. Der schrieb dergleichen Anfang des 20. Jahrhunderts, verkürzte mal eben eine (klassische Form) 90-minütige Symphonie in vier Sätzen auf acht Minuten. Ankündigung unserer heutigen Zeit-Not? Ein Kürzest-Werk, aber eben auch ein Werk.
Frage: «… Wie in einer musikalischen Struktur …» – haben Sie ein bestimmtes Stück vor Ohren gehabt?
Riedo: Einige; aber vor allem meins: do re mi do ni ki … Aber es sei gegengefragt: Wenn ein fremder Text in mir plötzlich Saiten zum Klingen bringt: Sind das von Geburt her eingezogene oder doch eher literarisch vorgebildete? Die Frage besteht: Gibt es Liebe zu einem Text ohne Vorkenntnisse (mal abgesehen davon, dass man das Alphabet erlernt hat und gewisses Weltwissen) und/oder «Drauf-hinauf-gehoben-Werden»?
Frage: Welche Musik hören Sie und was ist mit der Harmonielehre oder Tonkunst?
Riedo: Wie der Patient sagen würde: Ich bin ein Liebhaber der Tonkunst: Viele tanzen nach meiner Pfeife.
Kein Nachhaken meinerseits, aber zur Gegenfrage fällt mir vieles ein. Das Thema «Musik», über das ich gerne weiter gefragt hätte, bei dem ich dann auf Hindemith und von ihm weiter auf «das Werk» bzw. den Werksbegriff gekommen wäre, bleibt unvollendet. Ich suche noch ein wenig in der «Unterweisung im Tonsatz» – im Vorwort schreibt Hindemith Lehrreiches zum Werksbegriff bzw. über den Umgang der Jüngeren mit der Anwendung des ihnen zur Verfügung stehenden Musikwerkzeugs… Es hätte zu Riedos Interview mit Philippe Bischof gepasst:

Die Facebook-Community als Schriftsteller-Kollektiv: der Zwirbler-Roman
Anlässlich einer Tagung des Kulturministerium.ch hatte Riedo als Kulturminister der Schweiz mit Philippe Bischof, dem Leiter des Luzerner Kulturhauses Südpol ein Gespräch geführt. Riedo hatte gefragt, ob die Schriftsteller eventuell zu elitär geworden seien und ob Theater immer mit Schriftstellern zu tun haben bzw. immer von Schriftstellern geschrieben sein müsse.
Bischof bestätigte, dass dies im Moment (immerhin schon 5 Jahre her), tatsächlich immer weniger der Fall sei. Es gebe eine starke Tendenz dahin, dass der Autor nicht mehr der Schriftsteller allein sei, sondern die Schauspieler, der Regisseur, der Dramaturg zusammen etwas wie einen Kollektivautor bildeten, der auch die Leute draußen, das Publikum und seine Befindlichkeit und persönlichen Bedürfnisse einbeziehe und als dokumentarisches Theater diese authentisch aufnehme.
Von der Bühne und den Dramatikern, von der Musik hätte ich zu den Schriftstellern und den Büchern übergeleitet… Dank (preisgünstiger) E-Book-Publikationsmöglichkeit gibt es immer mehr Autoren und auch immer mehr zielgruppenorientiertes Schreiben. Da wird der Leser miteinbezogen, der Autor schreibt, was sein Leser sich von der Geschichte wünscht, ja, sogar mehrere Autoren schreiben kollektiv an einer Geschichte (z.B. der Zwirbler-Roman, der erste Facebook-Roman).
Frage: Sind diese eigentlich noch Schriftsteller zu nennen? Was ist ein Schriftsteller heute noch?
Riedo: Man könnte es über die Gewerkschaft definieren: Beim AdS («Autorinnen und Autoren der Schweiz») wird nur aufgenommen, wer bestimmte Minimalkriterien erfüllt. Andererseits ist «Schriftsteller» keine geschützte Bezeichnung, war es noch nie. Und das ist vielleicht auch gut so. Stichwort: «Offen für alles Kommende» … Der Untergang kommt früh genug …
Frage: Ist Schreiben ein Ausdruck seiner selbst, oder ist Schreiben als Erfüllung der Bedürfnisse anderer, besonders der Leser zu denken?
Riedo: Das geht durchaus Hand in Hand.

Dominik Riedo: «Die Schere im Kopf» – Offizin Verlag
«Die Schere im Kopf». Das Buch lässt mich nicht an sich heran, verärgert mich im Anlesen – und lässt mich «im Fenster der Nacht des Hierseins» – zurück, mit diesem «Herunterzählen» an Wörtern und Satzfetzen, bis hin zum letzten unverständlichen Wort. Ich bin alles andere als sicher, ob ich überhaupt verstehe, worum es geht. An manchen Stellen kann ich sogar vor Wut nicht weiterlesen.
Riedo: Auch ich war oft wütend angesichts des Textes. Aber er musste geschrieben werden. Und wäre es nur meinetwegen.
Frage: Provokation? Fishing for Widerspruch?
Riedo: Ne, nicht mehr … Das habe ich mit dem Kulturministerium hinter mir gelassen.
Fünf mal 24 Stunden hat der Erzähler in diesem Buch noch zu leben. Er liegt mit Krebs im Endstadium in einem Spitalbett und weiß, dass die Schmerzen trotz verabreichter Medikamente nicht mehr enden werden. Dennoch fürchtet er sich weniger vor dem elenden Ende, verspürt kaum Angst vor dem nahenden Tod, den er in seinem Überdruss willkommen heißt.
In aufeinanderfolgenden Bewusstseinsschüben beschreibt er nun sein abgelebtes Leben, zerreißt es rückblickend. Der Leser erfährt, dass der Erzähler früher einmal geglaubt hatte, das große Werk schreiben zu können, dass er zwar zwei Instrumente spielte, aber nicht ganz so musikalisch wie Mozart war. Er war Lehrer, einmal sogar Dozent an der Uni, arbeitete im Gefängnis (wo er feststellte, dass auch Verbrecher sich selbst beschwindeln) und hatte weitere Gelegenheitsjobs. Der Leser erfährt von den Frauen. 129 sollen es gewesen sein. Bei der Abrechnung überlegt der Sterbende, ob es ihm ein Trost wäre, wenn alle Menschen gleichzeitig mit ihm stürben. Fragmentarisch denkt er auch – an die Schweiz, an ihre unveränderbare Bürgerlichkeit und fasst zusammen, dass ihn auch das Reisen anwiderte, nachdem er alles bereist hatte.
Wie gesagt: das Buch widersetzt sich mir. Vielleicht wegen des Fragmentarischen, des «gestreamt» Vexierhaften – Vexierhaftes irritiert mich. Schostakovitsch und seine 15. Symphonie fallen mir ein. Sie beginnt mit dem Zitat aus Rossinis «Wilhelm Tell»-Ouvertüre. Das leichte, lockere Leben endet alsbald in Fragmenten und setzt sich mit dem Sterben auseinander. Es ist die letzte Symphonie des Russen, er ist schwerkrank und er komponiert unter stalinistischen Bedingungen, wandert dabei auf einem schmalen Grat zwischen ideologischer Vereinnahmung und künstlerischer Selbstverwirklichung, zwischen Leben und Tod. Ja, Schostakowitschs Musik evoziert Ähnliches wie die «Schere».
Die Schere im Kopf lege ich zur Seite. Sie schneidet meine Energie und meinen Elan ab. Auch die Antworten, die ich auf meine erste Mail bekomme, lege ich zur Seite. Jetzt spüre ich den Hauch des Proust-Effekts. Aufschieben, sage ich mir. Aufschieben, dann wird der rechte Augenblick kommen. Habe auch zur Zeit mit der Veröffentlichung der Aphorismen eines anderen jungen Mannes zu tun, fast gleicher Jahrgang, sogar ähnliche Gedanken.
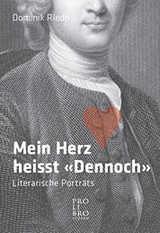
Dominik Riedo: «Mein Herz heisst ‘Dennoch’» – Pro Libro Verlag
Kurz vor Weihnachten schickt mir der Verlag pro libro aus Luzern das dritte Riedo-Buch: «Mein Herz heisst «’Dennoch’ – Literarische Porträts». Darin geht es um Schriftsteller und Denker, die anders als ihre Mitmenschen waren. Die Werke, die sie aus ihrer Andersartigkeit heraus geschrieben haben, werden heute bewundert. Den Erschaffenden aber machte das Anderssein zu schaffen. Sie haderten mit sich, mit der Welt, mit dem eigenen Werk. Riedo versammelt in diesem Buch literarische Porträts, die gewissermaßen den Finger auf die offene Wunde legen. Die Wunde ist die der Verdrängung des Haders der «Anderseienden» aus der heutigen Bewunderungsperspektive.
Sag ich doch! Mein Reden. Voller Vorfreude nehme ich das Buch in die Hand und vor die Augen. Riedo ist einer, der Einzelgänger zu mögen scheint. Seine Antworten zu sich selbst mögen da für ihn sprechen.
Frage: «Widerstand der Welt, den diese Denker und Schriftsteller erfuhren, aber auch Widerstand, den sie selbst der Welt entgegensetzten, der unbeirrbare Glauben der Porträtierten an das «Dennoch» – an die Keimzelle der unsterblichen Literatur.» Keimzelle? Unsterbliche Literatur?
Riedo: Unsterblich, denke ich, ist doch praktisch nichts. Die Keimzelle jedoch steckt in mir – und bringt ihre Triebe voran… Gegen den vorangegangenen Gegendruck …
Frage: Sind Sie ein lustig-melancholischer Mensch oder eher ein ernst-alberner? Oder ist die Frage zu persönlich?
Riedo: Beides wohl, wild durcheinander. Am ehesten ein melancholisch-heiterer.
Frage: Sie scheinen ein Faible für Einzelgänger zu haben oder sind Sie etwa selbst einer? Sehen Sie sich als einer?
Riedo: An der Party zu meinem 20. Geburtstag kamen 81 Gäste, an der zu meinem 40. Geburtstag noch 12 …
Und jetzt kommt die Kinski-Klippe, das Fettnäpfchen, in das ich treten könnte. Riedo war – wie bereits erwähnt – für zwei Jahre Schweizer Kulturminister – ein Zeitraum in seiner Biografie, den ich natürlich ansprechen muss.
Frage: Wie kam es überhaupt zu der Idee, Kulturminister werden zu wollen, sich als Kandidat zur Wahl (mittels Internet-Wahl aus 25 Kandidatinnen und Kandidaten) zu stellen?
Riedo: Weil ich, beim Sprung ins kalte Wasser, etwas lernen wollte.
Frage: Macht man das mal eben so? Haben Sie nicht genug zu tun gehabt?
Riedo: Ich mache eigentlich nichts «einfach so».
Frage: Wie haben Sie die 2 Jahre als Kulturminister verändert? Haben sie Sie verändert?
Riedo: Oh ja!
Meine zehn Fragen sind gestellt, und ich habe kein schlüssiges, rundum befriedigendes Bild. Ich habe gar nichts und muss erkennen, dass ich die falschen Fragen gestellt habe, und mir trotz allen Hin- und Herüberlegens kein Weg eingefallen ist, sie aufzubereiten. Riedo hat mich weite und inspirierte Denkwege zurücklegen lassen. Aber das Interview… wenn ich doch eine Tasse Kaffee mit ihm trinken könnte!
Es ergibt sich keine Gelegenheit. Im Gegenteil, ich entferne mich räumlich noch weiter von der Schweiz, fahre in den Norden, sitze in einem Bahnhofsrestaurant und – spreche mit Riedo.
Was trinken wir? Kaffee? Wie trinken Sie ihn? Mit Milch und ohne Zucker? – Der Kaffee kommt. Jetzt würde ich sie stellen – die wirklich wichtigen Fragen:
01. Wann können Sie am besten schreiben?
02. Wo kommen Ihnen so richtig gute Ideen?
03. Welche Stadt würden Sie gerne in nächster Zeit besuchen?
04. Haben Sie Freunde in Deutschland?
05. Welchen Film haben Sie kürzlich gesehen?
06. Haben Sie einen Lieblingsregisseur?
07. Trinken Sie lieber Kaffee oder lieber Tee? Eine Idee, warum das so ist?
08. Essen Sie gerne Fisch?
09. Welches ist Ihre derzeitige Lieblingsfarbe (hatte ich das nicht schon gefragt???)
10. Können Sie zeichnen?
Nichts mit Literaturwissenschaftlichem zu «Werk» und «Fragmentarismus», oder Lebensabrissen und Bewusstseinsströmen, genug des Zweifelns an der verrückten Welt, die uns dazu bringt, gegen sie anzuschreiben. Wozu? Um uns ein Denkmal zu setzen – oder uns am Leben zu erhalten? Wer dieses neue Interview liest, soll sich wohlfühlen und einen Menschen sehen, und sich darin wiederfinden – oder auch nicht. Etwas Riedo-haftes klingt in allen von uns… und sowohl ein Klaus Kinski als auch ein Dmitri Schostakowitsch waren als Künstler und als Menschen nicht einfach, noch unumstritten. Sie waren anders. Und dennoch!
Einen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Herr Riedo. ■
_________________________
Dies sind die Antworten, die mir Dominik Riedo auf meine obigen 10 Fragen gab:
01. Wenn mich an der Welt etwas stört, aber nicht in meinem Arbeitszimmer.
02. Beim Lesen.
03. Marsala. Ich werde März oder April dort sein.
04. Ja.
05. Verfilmungen von Philip K. Dick. Ich möchte einen Essay über ihn schreiben.
06. Orson Welles.
07. Kaffee. Weil ich als Kind bereits Mocca-Glacé über alles liebte. Aber warum das? Keine Ahnung.
08. Ich bin Vegetarier.
09. Schwarz.
10. Ich konnte es mal ganz gut und habe Freundinnen damit «beschenkt». Heute hab ich das etwas verloren.
.
Weitere Beiträge von Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Interview mit dem Schach-Autor J. Carlstedt («Die kleine Schachschule»)
.
Jonathan Carlstedt: «Die kleine Schachschule»
Thomas Binder
.
 Der junge Hamburger Bundesliga-Spieler Jonathan Carlstedt gehört seit kurzer Zeit zu den Exponenten der Deutschen Schachszene. Neben dem eigenen Spiel arbeitet er als Geschäftsführer der Schachschule Hamburg, schreibt als Journalist und Online-Autor für verschiedene Medien und hat seit 2010 bereits mehrere Bücher vorgelegt. Dabei wendet er sich an die ganze Breite des Schachpublikums. Sind die Eröffnungsbücher sicher dem Experten vorbehalten, galten die beiden Werke unter dem Obertitel «Die große Schachschule» dem engagierten Turnier- und Vereinsspieler. Mit der «Kleinen Schachschule» wird das Spektrum der Zielgruppen nun gewissermaßen «nach unten» abgerundet, verkündet doch schon die Titelseite «Perfekt für Anfänger!»
Der junge Hamburger Bundesliga-Spieler Jonathan Carlstedt gehört seit kurzer Zeit zu den Exponenten der Deutschen Schachszene. Neben dem eigenen Spiel arbeitet er als Geschäftsführer der Schachschule Hamburg, schreibt als Journalist und Online-Autor für verschiedene Medien und hat seit 2010 bereits mehrere Bücher vorgelegt. Dabei wendet er sich an die ganze Breite des Schachpublikums. Sind die Eröffnungsbücher sicher dem Experten vorbehalten, galten die beiden Werke unter dem Obertitel «Die große Schachschule» dem engagierten Turnier- und Vereinsspieler. Mit der «Kleinen Schachschule» wird das Spektrum der Zielgruppen nun gewissermaßen «nach unten» abgerundet, verkündet doch schon die Titelseite «Perfekt für Anfänger!»
Carlstedts Werk reiht sich in die Tradition klassischer Schach-Lehrbücher für «Jedermann», wie sie seit mehr als 100 Jahren einen Urtyp der Schachliteratur darstellen. Kann man dieses Genre noch mit neuen Ideen bereichern?
Blicken wir zunächst auf die grobe Gliederung des Werkes: Wir haben vier wesentliche Abschnitte vor uns:
– Die Grundbegriffe und Regeln des Schachspiels werden auf ca. 40 Seiten erklärt
– Es folgen knapp 70 Seiten über Eröffnungen
– Das Mittelspiel wird auf ca. 60 Seiten abgehandelt
– Mit gut 40 Seiten ist das Endspielkapitel eher knapp bemessen
– Den Abschluss des Buches bildet ein kurzer Essay «Die Welt der Schachszene», (dem der Rezensent gerne etwas mehr Umfang und Tiefgang gewünscht hätte).
Das einführende Kapitel vermittelt das regeltechnische Rüstzeug jeder Schachpartie, leider noch nicht auf dem Stand der 2014 geänderten FIDE-Regeln (bei Stellungswiederholung und 50-Züge-Regel).
In den folgenden Hauptkapiteln hat es sich Carlstedt zur Aufgabe gemacht, dem «Anfänger» deutlich mehr zu vermitteln, als es vergleichbare Bücher tun. Exemplarisch dafür ist das Eröffnungskapitel. Nach Vermittlung der Grundstrategien (Figurenentwicklung, Königssicherheit) führt der Autor den Leser in einige wichtige Eröffnungssysteme ein. Dabei findet Jonathan Carlstedt das für einen Spieler auf Anfänger-Niveau passende Maß zum Verständnis der vorgestellten Eröffnungen. Bei jedem Zug wird dargestellt, inwiefern er seinen Beitrag zu den Grundzielen des Eröffnungsspiels leistet. Streiten könnte man allenfalls über das Mengenverhältnis (acht Seiten Königsgambit vs. fünf Seiten Sizilianisch) und über die Auswahl der Systeme. So fehlen etwa mit der Pirc-Verteidigung oder Russisch auch Eröffnungen, die einem Anfänger sehr wahrscheinlich recht bald begegnen werden.
Als ein Juwel unter vielen möchte ich hervorheben, wie der Autor die «fried liver attack» des Zweispringerspiels (freilich ohne sie beim Namen zu nennen) behandelt. Ich selbst habe schon viele Schach-Eleven ob der doppelten Bedrohung des Punktes f7 regelrecht verzweifeln sehen. Schade nur, dass in diesem Buch der betreffende Text im Abschnitt «Italienische Partie» versteckt ist.
Unter dem Oberbegriff «Mittelspiel» führt Carlstedt in die wichtigsten taktischen Manöver und strategischen Motive ein. Der Leser lernt Fesselungen, Gabeln, Spieße, Abzüge ebenso kennen wie grundlegendes Wissen über Bauernstrukturen und -schwächen. Auch die Eigenheiten der einzelnen Figuren und die Konsequenzen für ihren optimalen Einsatz werden besprochen. Ein (zu) kurzer Abschnitt über den Königsangriff beschließt das Mittelspiel-Kapitel.
Bei den Endspielen widmet Carlstedt den verschiedenen Aspekten der Bauernumwandlung (Opposition, Randbauer, Quadratregel) breiten Raum. Es folgen einige wichtige Stellungen zum Endspiel «Turm&Bauer gegen Turm». Das ist sicher eines der anspruchsvollsten Kapitel des Buches, und Jonathan Carlstedt präsentiert es so gekonnt, dass auch der «Anfänger» jederzeit folgen kann. Überraschend: Erst danach geht er auf die elementaren Matts mit den Schwerfiguren ein. Insgesamt hätte man dem Endspiel-Kapitel sogar etwas mehr Umfang gewünscht. Da bleiben einige Themen offen, die man auch der Zielgruppe dieses Buches zumuten kann. Andererseits wäre selbst ein Anfänger-Lehrbuch der Schach-Endspiele gut und gerne so stark wie die ganze vorliegende «Kleine Schachlehre» – so bietet sich das vielleicht für ein Nachfolgeprojekt an.
Das Buch im handlichen Taschenbuchformat ist auf hochwertigem Papier produziert und sorgfältig redigiert. Der Sprachstil des jungen Autors macht Freude, seine bereits enorme Erfahrung als Trainer ist auf jeder Seite zu verspüren.
Circa 200 Stellungsbilder unterstützen in perfekter Weise das Verständnis. Diese Diagramme wurden offenbar mit Chessbase-Software erstellt. Dabei nutzt Carlstedt die Möglichkeit der Verdeutlichung von Ideen und Plänen mit farbigen Pfeilen und Feldmarkierungen. Allerdings geht die visuelle Aussagekraft dieses Gestaltungsmittels beim Schwarz-Weiß-Druck fast völlig verloren und in einigen Fällen ist die Erkennbarkeit gerade dadurch sogar eingeschränkt.

Jonathan Carlstedt legt ein modernes «Anfänger-Lehrbuch» vor. Ansprechende Gestaltung und frischer Schreibstil tragen zum Erfolg des Werkes bei.
Bleibt die Frage, an welche Zielgruppe sich das Buch richtet. Carlstedt ist insofern konsequent, dass er keine spezielle Zielgruppe anspricht. Insbesondere fehlen jegliche spielerischen Elemente, wie man sie aus Kinder-Schach-Lehrbüchern kennt. Die Ansprache des Lesers orientiert sich am erwachsenen, allenfalls jugendlichen Schachschüler. So ist die Zielgruppe wohl nicht an Altersgruppen festzumachen, sondern am Einsteiger, der sich auf das anstrengende aber wunderbare Abenteuer einlassen will, das Schachspiel «von der Pike auf» zu erlernen. Wer das vorliegende Buch konzentriert durcharbeitet und das Gelernte umsetzt, wird schon nach wenigen eigenen Partien die ersten Früchte der Arbeit ernten.
Carlstedt schreibt im Vorwort: «Bücher schreiben macht Spaß». Wenn der Leser diesen Spaß des Autors nachempfindet, ist das Werk gelungen. Ich habe ihn nachempfunden! ■
Jonathan Carlstedt: Die kleine Schachschule – Regeln, Strategien und Spielzüge verständlich erklärt, Humboldt Verlag, 224 Seiten, ISBN 978-3-86910-209-2
.
.
.
.
Interview mit dem Schach-Autor Jonathan Carlstedt
«Der Schach-Sport ist – richtig verpackt – sehr kommunikativ»
.
Glarean Magazin: Herr Carlstedt, stellen Sie sich zunächst unserer Leserschaft kurz vor?
Jonathan Carlstedt: Ich bin 24 Jahre alt. Nachdem ich 2010 mein Abitur in Hamburg gemacht habe, begann ich selbstständig als Schachspieler/-Trainer/-Autor/-Journalist zu arbeiten. Inzwischen bin ich Internationaler Meister, trainiere ca. 25 Schüler, schreibe für den Deutschen Schachbund, bin Geschäftsführer des Hamburger Schachklubs und der Schachschule Hamburg, Organisator des VMCG-Schachfestivals und selber als Spieler auf diversen Turnieren und in der ersten Bundesliga aktiv. Außerdem verfasse ich regelmäßig Schachbücher und -Artikel.
GM: Was läuft in Deutschland bei der öffentlichen Darstellung des Schachs als Wettkampfsport falsch? Was kann/muss man besser machen um das Image des Schachsports aufzupolieren?
JC: Vermutlich muss man hier differenzieren. Wir haben zum einen die externen Umstände, bis zu einem gewissen Punkt passt Schach nicht in unsere Zeit. Schach ist ein stiller Sport, in dem nicht derjenige recht hat, der am lautesten schreit, sondern derjenige, der die besten schachlichen Argumente hat. Meine sehr und ganz persönliche Meinung ist, dass dieser Ansatz in unser Gesellschaft, die Kraft des Arguments über der Kraft der Lautstärke, immer weniger eine Rolle spielt und Schach als dessen Vertreter geringere Chancen als andere Sportarten hat, akzeptiert zu werden.
Gerade bin ich in Dresden, hier spielen 10 der stärksten Frauen des Landes ein Turnier mit einem Preisfond von 10’000 Euro in äußerst professioneller Atmosphäre. Nun ist die Frage: Wie können wir das Interesse der Medien und damit der Öffentlichkeit gewinnen. Anscheinend ist es möglich, das für einen Schach-WM-Kampf zu schaffen. «SPIEGEL Online» und «Zeit online» berichten ausführlich mit großartiger Berichterstattung. Um eine regelmäßige Darstellung wie andere «Mainstream»-Sportarten zu erreichen, müssen wir in gemeinsamer und vor allem koordinierter (etwas was gelegentlich fehlt) Anstrengung versuchen, ein Grundverständnis für unser Spiel bei der breiten Masse zu erzeugen. Dann haben wir die Chance, auch in der öffentlichen Wahrnehmung häufiger eine Rolle zu spielen.
Aber was ist das Image des Schachsport? Freaks ohne Anschluss? Sportart für Super-Intelligente? Schul-AG für Außenseiter? Wenn dem so ist, dann müssen wir etwas tun! Das geht nicht von heute auf morgen, denn die Diskussion wurde in der Schachszene bisher nicht geführt, ob wir nicht gut daran tun, eine Randsportart zu sein. Meine Meinung dazu ist klar: Unser Sport ist interessant, richtig verpackt sehr kommunikativ, und wenn Sie sich heute die Topspieler anschauen, haben wir intelligente, durchtrainierte Leistungssportler, die sich verkaufen können. Mit hochwertiger und beständiger Öffentlichkeitsarbeit können wir ins Bewusstsein der Bevölkerung treten. Konkret und kurzfristig müssen wir freundlicher zu Einsteigern werden, denn in den Vereinen ist das Bild in der Tat teilweise schmuddelig. Auch wenn ich vermutlich einige böse Mails bekommen werde, müssen frische Klamotten, Deo, gepflegtes Auftreten und Genuss von Alkohol nur zur späten Stunde ungeschriebenes Gesetz im Verein werden.
Zusammenfassend also: Wir sind unseres Glückes Schmied, konstante Öffentlichkeitsarbeit, die bereits geleistet wird, zusammen mit einem gemeinsamen Bewusstsein für deren Wichtigkeit sind die beiden Eckpfeiler uns in der breiten Öffentlichkeit zu etablieren.
GM: Sie sind Geschäftsführer der Schachschule Hamburg. Sie haben jetzt Gelegenheit ein wenig Werbung für dieses Projekt zu machen :-)
JC: Die Schachschule Hamburg bietet Schachinteressierten jeden Alters und jeder Spielstärke vom Anfänger bis zum Bundesligaspieler «offline»-Trainingsmöglichkeiten (wie man das glaube ich neudeutsch nennt) an. Dabei versuchen wir uns nach den Bedürfnissen und Wünschen der jeweiligen Interessenten zu richten und haben unser Trainingsangebot entsprechend breit aufgestellt. Jeder der also irgendwie an Schach interessiert ist, ist bei uns genau richtig! :-)
GM: Professionelle Schachschulen mit kommerzieller Ausrichtung scheinen sich in Deutschland wachsender Beliebtheit zu erfreuen. Wie schätzen Sie auf lange Sicht den Markt für solche Projekte ein? Wie sehen Sie diese Schulen im Spannungsfeld der «klassischen» Ausbildungswege junger Schachspieler wie Schulschach-AGs, Schachvereine und ggf. das Training der Verbandskader und schließlich den vielen neuen Spiel- und Trainingsansätzen im Internet?
JC: Die Schachschule Hamburg ist aus dem Hamburger Schachklub, dem größten Schachverein Deutschlands, entstanden und ein Teil dieses Schachklubs. Zwar verstehen wir uns als Unternehmen, müssen und wollen aber auch den Ideen eines gemeinnützigen Vereins wie dem Hamburger Schachklub genügen.
Der Markt für Schachschulen ist aus meiner Sicht sehr groß. Wir haben in Deutschland 90’000 eingetragene Schachspieler, davon alleine können Schachschulen nicht leben. Die Zahl derjenigen, die im Kindesalter oder wann auch immer die Grundregeln kennengelernt haben und grundsätzlich Interesse am Schachspiel bzw. -sport haben, ist ungleich größer. Wenn sich die «Schachszene» weiterhin diesen Umstand bewusst macht, ist der Markt noch lange nicht gesättigt. Übrigens eine Tendenz, die ich aus meiner selbstständigen Arbeit als Trainer untermauern kann. Allein in den vergangenen zwei Monaten musste ich sieben Anfragen von Schülern ablehnen, da ich keine Zeitkapazitäten mehr habe.
Für uns ist Schachschule und Schulschach kein Spannungsfeld, sondern die Grundlage für unsere Existenz. Unheimlich viele engagierte Trainer leisten an Schulen ehrenamtliche Arbeit, die die Basis dafür ist, dass Menschen wie ich und Institutionen wie die Schachschule wirtschaftlich arbeiten können. Ohne den Unterbau der dort geschaffen wird, kann es weiter in der Spitze bzw. für die Spitze keine Zukunft geben.
Auch das Internet ist, denke ich, förderlich für den Schachsport. Auf jeden Fall müssen wir uns nicht davor fürchten. Jene die ohnehin lieber in ihren eigen vier Wänden bleiben, haben das auch schon vor dem Aufkommen des Internets getan. Der Vorteil des Internets, aus Schachspieler-Sicht, ist, dass man schneller und unkomplizierter mit dem Schachsport in Berührung kommt. Unsere Aufgabe ist es, all jenen, die über das Internet zum Schachsport gekommen sind, Angebote zu unterbreiten, in den Verein zu kommen. Denn seien wir ehrlich: Bei einem Bierchen oder für Kinder und Jugendliche einer Cola in der realen Welt eine Partie Schach zu spielen, entspricht deutlich eher den menschlichen Bedürfnissen, als im eigenen Kämmerlein gegen anonyme Gegner zu spielen. Und auch wenn es einige nicht glauben, die meisten Schachspieler sind sogar extrem in Ordnung.
GM: Sie bieten auch Anfänger-Kurse für Erwachsene und Kurse für Senioren an. Wie werden diese Angebote angenommen?
JC: Im Grundsatz sind wir mit dem Zuwachs an Interessenten zufrieden. Trotzdem muss man einen Unterschied machen zwischen Erwachsenen, die im Berufsleben stehen und Senioren. So laufen die Seniorenkurse, die wir wöchentlich beispielsweise von 10 bis 12 Uhr anbieten, hervorragend. Berufstätige nach der Arbeit noch von 19 bis 21 Uhr für ein Schachtraining zu begeistern ist, wenn auch nicht unmöglich, doch schwierig. Deshalb gehen wir hier einen zweiten Weg: Wir bieten sogenannte Kompaktkurse an, Kurse also, die an einem Samstag gehalten werden und weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Kurse sehr gut geeignet sind, damit man seinen Partner mitnimmt, um anschließend gut gerüstet zu sein bei einem abendlichen Glas Rotwein auf dem Balkon eine Partie Schach zu spielen. Es ist nicht unser Ziel, jeden zu einem Großmeister zu machen.
Dieses Angebot wollen wir ausbauen, mit Eltern/Kind-Kursen und Trainings, die nicht bei uns, sondern in den Schulen vor Ort stattfinden. Wir haben hier noch einen weiten Weg zu gehen, sind aber überzeugt, dass dies der Richtige ist.
GM: Zu Ihrem neuesten Buch, der «Kleinen Schachschule». Zunächst war ich etwas verwirrt, nach zwei Büchern unter dem Label «Große Schachschule» jetzt auf die «Kleine Schachschule» zu treffen. Können Sie uns Ihre bisherigen Buchprojekte vorstellen und einen Blick auf die nächsten Pläne werfen?
JC: Da muss ich etwas weiter ausholen, aber da ich bisher schon ellenlang geantwortet habe, mögen mir die Leser das verzeihen :-)
Mein erstes Buch schrieb ich im zarten Alter von 19 Jahren, zeitgleich zur Lernphase meines Abiturs. «Die Englische Eröffnung» war der Titel und behandelt eine Schacheröffnung, die ich seit ich denken kann, spiele. Im Anschluss folgte «Die große Schachschule» Damals hatte ich eine Schachschule in Lüneburg und ich habe große Teile des Lehrplans meiner Schachschule in dieses Buch integriert, es folgte ein weiteres Eröffnungsbuch «Die Tarrasch-Verteidigung», ein Buch das aus meiner Sicht für die «Eingeweihten» eine Menge interessante neue Ideen beinhaltet. Anschließend schrieb ich «Die große Schachschule: Aus den Fehlern der Großmeister lernen». Hier habe ich 25 Partien analysiert, an vielen war ich selber beteiligt, wo eine Seite, vertreten durch einen Profispieler, einen schweren Fehler begeht. Mein Versuch war es, und ich hoffe er ist mir gelungen, diesen Fehlern auf den Grund zu gehen und «en passant» weniger erfahrenen Schachfreunden einen Einblick in die Schachszene zu geben.
Zu guter Letzt also «Die kleine Schachschule», auf die ich ebenfalls sehr stolz bin. Einerseits ist sie inhaltlich aus meiner Sicht gut geworden, außerdem hat mal wieder der Verlag hervorragende Arbeit geleistet, was Layout etc. angeht.
Zukünftige Projekte… Mein Plan war eigentlich weniger zu arbeiten :-) Derzeit gibt es einige Angebote Bücher zu schreiben. Meine Idee ist allerdings, einfach eins zu schreiben, ohne dass jemand davon weiß und es dann einem Verlag anzudrehen. Ich habe immer noch die sehr romantische Vorstellung mich einmal in ein Haus auf einer fernen Insel einzuschließen, dort zwei Monate an einem Buch zu schreiben, ohne von außen gestört zu werden. Vielleicht kennen Sie ja einen Verlag mit einem Haus auf einer karibischen Insel? ;-)
GM: Die «Kleine Schachschule» ist vom Typ her sicher mit klassischen Schachlehrbüchern zu vergleichen. Schach-Einführungen für Anfänger gibt es seit mehr als 100 Jahren. Sie erklären elementar die Regeln und geben kurze Abrisse zu Taktik-Motiven, strategischen Prinzipien, zur Eröffnungstheorie und Endspiellehre. Welche neuen Ideen haben Sie für diesen Lehrbuch-Typ eingebracht?
JC: In der «Kleinen Schachschule» geht es darum, kurz und bündig Interessenten am Schach unser Spiel näher zu bringen und ohne großes Hin und Her die Grundlagen zu bieten, um einfach mal eine Partie Schach zu spielen.
Meine neue Idee in dem Buch ist, früher auf grundlegende Strategien in den 3 Phasen Eröffnung Mittelspiel, Endspiel einzugehen. Meine Erfahrung aus den vielen Trainings und Lehrgängen mit Anfängern ist, dass man die Leute durchaus fordern kann und das Interesse am Schach auch und vor allem in den Strategien begründet ist. ■
.
.
.
.
Interview mit dem Schach-Autor R. Ripperger («Gegenspiel»)
.
Reinhold Ripperger: «Gegenspiel»
Thomas Binder
.
 Repertoirebücher nehmen im Spektrum der Eröffnungsliteratur einen breiter werdenden Raum ein. Sie haben den unbestreitbaren Vorteil einer hohen Praxistauglichkeit. Autor und Leser können sich auf die für sie wirklich relevanten Systeme beschränken und in diese vertiefen. Während bei den reinen Eröffnungs-Nachschlagewerken inzwischen wohl elektronische Medien und Datenbanken konkurrenzlos sind, ist hier dem gedruckten Buch ein Platz weiterhin sicher. Der saarländische Schachtrainer Reinhold Ripperger hat nach «Anzugsvorteil» – einem Weißrepertoire für den e4-Spieler – nun mit «Gegenspiel» das Pendant für den Nachziehenden vorgelegt. Ein Repertoire für Weißspieler, die den Damenbauern bevorzugen, ist in Vorbereitung.
Repertoirebücher nehmen im Spektrum der Eröffnungsliteratur einen breiter werdenden Raum ein. Sie haben den unbestreitbaren Vorteil einer hohen Praxistauglichkeit. Autor und Leser können sich auf die für sie wirklich relevanten Systeme beschränken und in diese vertiefen. Während bei den reinen Eröffnungs-Nachschlagewerken inzwischen wohl elektronische Medien und Datenbanken konkurrenzlos sind, ist hier dem gedruckten Buch ein Platz weiterhin sicher. Der saarländische Schachtrainer Reinhold Ripperger hat nach «Anzugsvorteil» – einem Weißrepertoire für den e4-Spieler – nun mit «Gegenspiel» das Pendant für den Nachziehenden vorgelegt. Ein Repertoire für Weißspieler, die den Damenbauern bevorzugen, ist in Vorbereitung.

Reinhold Ripperger (Dipl. Sozialarbeiter) wurde 1954 in St. Ingbert/D geboren, wo er auch heute noch mit Ehefrau und Tochter lebt. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er aktiver Schachspieler. Er durchlief die Ausbildung des Deutschen Schachbundes und erhielt 1985 die Trainerlizenz.
Rippergers Schwarz-Vorschlag klingt auf den ersten Blick banal und schmalspurig: «Ziehen Sie 1… e6, egal was der Gegner eröffnet haben mag.» Dieses Vorgehen (wahlweise auch mit c6, d6, g6 oder anderen Zügen zelebriert) ist so selten gar nicht anzutreffen. Aber nicht immer ist es von Verständnis für die entstehenden Stellungen getragen. Man muss also bei der Repertoireplanung einen Schritt weiter gehen – und das tut Reinhold Ripperger.
Gegen 1. e4 landet man im Franzosen, wobei Ripperger auch in der Folge eine sinnvolle Auswahl anbietet – immer dort, wo Schwarz Gelegenheit hat, das Spiel zu bestimmen. Gegen 1. d4 fokussiert er sich streng auf den modernen Stonewall, bei dem Schwarz seine weiteren Bauern auf c6, d5 und f5 platziert, den Königsläufer aber im Gegensatz zum klassischen Stonewall auf d6. Die somit abgegrenzte Eröffnungswahl ist nicht nur von Ripperger selbst, sondern von mehreren namhaften Großmeistern erprobt und hat sich bewährt. Insbesondere verweist der Autor darauf, dass sich in beiden Eröffnungen ähnliche Motive ergeben und dem Spieler die Orientierung erleichtern. Bei der weiteren Variantenauswahl entscheidet sich Ripperger immer für offensive Abspiele, verspricht seinem Leser ein «Spiel auf Gewinn». Mit Schwarz wird also nicht ängstlich geklammert, sondern getreu dem Titel des Buches aktives Gegenspiel gesucht.
Angenehm fällt dabei auf, dass der Leser nicht mit ellenlangen und vielfach untergliederten Zugfolgen allein gelassen wird. In angemessenem Umfang werden der Sinn der einzelnen Züge und der dahinter stehende strategische Plan erläutert. Zwei bis drei Diagramme pro Seite lockern den Text auf und lassen es zu, die Ausführungen auch «vom Blatt» zu verfolgen. Nun hatte der Rezensent natürlich weder das Wissen noch die Zeit, jede einzelne Variante auf ihren schachlichen Gehalt zu prüfen. Stichproben haben aber das Vertrauen in Rippergers fundierte Analysen gestärkt. Dabei ist der Autor ein unabhängiger Geist, der vor der Autorität von Großmeistergenerationen und rechenstarken Computern nicht erschrickt, wenn es eigene Ideen zu vertreten gilt. Mit Blick auf das eigene Repertoire habe ich exemplarisch eine Variante geprüft: Nach 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 verfügt Weiß über die interessante Gambitfortsetzung 4. Ld2. Sie hat einen gewissen schachhistorischen Wert, stand u.a. 1950 im Kandidatenwettkampf zwischen Bronstein und Boleslawski auf der Tagesordnung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man damit selbst gestandene Französisch-Spieler aus dem Gleis ihrer Vorlieben werfen kann. Ripperger nun lässt seine Leser nicht im Regen stehen: Er empfiehlt sehr deutlich die Antwort 4… Sc6! Der Blick auf die Schach-Software «Fritz» bzw. in die «Mega Database» enthüllt dies als einen echten Geheimtipp: Die Datenbankstatistik zeigt, dass er gerade mal mit einer Häufigkeit von 4% in dieser Stellung gespielt wird und auch nach längerer Rechenzeit, weist «Fritz 13» den Zug erst als Nr. 4 oder 5 seiner Kandidatenzüge aus. Mit solchen Empfehlungen kann Reinhold Ripperger also auch dem gestandenen Spieler noch viele neue Ideen vermitteln.

Schach-Autor und -Trainer Reinhold Ripperger legt mit «Gegenspiel» ein praxistaugliches Schwarz-Repertoire mit Schwerpunkt «Französisch» vor. Die Stärke des Buches liegt in der Eigenständigkeit seiner Analysen und den angemessenen Erläuterungen zum strategischen Gehalt der empfohlenen Züge.
Gelungene Gestaltung und Typographie sorgen dafür, dass man das Buch jederzeit gern zur Hand nimmt. Der auf den ersten Blick vielleicht etwas hohe Preis ist durch den enormen Arbeits- und Analyseaufwand gerechtfertigt. Hier wird eine eigene Leistung des Autors verkauft, der wohl zu jeder Aussage des Buches stehen kann – keine schnell dahin geschriebene Computeranalyse. Einziger Kritikpunkt: ca. 35 Seiten mit insgesamt 100 Testaufgaben einschließlich Lösungen und Punktbewertung scheinen mir in einem Repertoirebuch entbehrlich. Abgefragt wird hier nicht schachliches Können, sondern «nur» das Erinnern der vorgestellten Varianten.
Alles in allem: Basierend auf der Empfehlung «Spiele immer 1… e6» legt Reinhold Ripperger ein praxistaugliches Schwarz-Repertoire vor. Neben einer gezielten Auswahl von Französisch-Varianten konzentriert er sich auf den Modernen Stonewall. Die Stärke des Buches liegt in der Eigenständigkeit seiner Analysen und den angemessenen Erläuterungen zum strategischen Gehalt der empfohlenen Züge. ■
Reinhold Ripperger: Gegenspiel – Ein dynamisches Repertoire für den Schwarzspieler, ChessCoach-Verlag, 272 Seiten, ISBN 3-981190-57-0
.
Leseproben
.
.
.
Interview mit dem Schach-Autor Reinhold Ripperger
«Eröffnungstheorie ist ein lebendiger Prozess»
.
Glarean Magazin: Herr Ripperger, in den letzten 2-3 Jahren steht Ihr Name immer wieder für interessante Neuveröffentlichungen auf dem Schachbuch-Markt. Den Menschen dahinter kennen sicher nur wenige. Möchten Sie sich bitte kurz den Glarean-Lesern vorstellen?
Reinhold Ripperger: Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, bin von Beruf Sozialarbeiter und lebe im Saarland.
GM: Als sehr aktiven Turnierspieler weist Sie schon die DWZ-Datenbank des deutschen Schachverbandes aus. Ihre Bücher lassen vermuten, dass Sie auch als Trainer Erfahrungen gesammelt haben?
RR: Ich bin seit über 30 Jahren Trainer und im Besitz der B-Lizenz. Als Spieler des SC Anderssen St. Ingbert und des SC Caissa Schwarzenbach habe ich in der Oberliga Südwest und in der 2. Bundesliga gespielt.
GM: Der Blick auf Ihre Homepage offenbart, dass es neben dem Schachspieler Ripperger noch einen auf ganz andere Art interessanten Menschen gibt – den Liedermacher. Erzählen Sie doch bitte ein wenig über diese Seite.
RR: Ich liebe gute Musik und bin ein glühender Fan von Reinhard Mey. Ich schreibe selbst hin und wieder ein Lied und veranstalte Liederabende, bei denen ich Keyboard spiele und neben eigenen Liedern auch Stücke von Hannes Wader, Reinhard Mey oder den Wise Guys singe. Im übrigen bin ich der Ansicht, dass Schach und Musik eng miteinander verwandt sind.
GM: Zurück zum Schachautor: Wenn ich nichts übersehen habe, liegen aus Ihrer Feder – zum Teil mit Co-Autoren – knapp 10 Bücher vor. Das Spektrum ist breit, der Schwerpunkt liegt aber bisher im Eröffnungsbereich. Wie schreibt man eigentlich heute in der Zeit der Datenbanken ein Eröffnungsbuch, das sich vom Durchschnitt abhebt? Wie ist das Verhältnis von eigener Erfahrung zur Vorgefassten Meinung anderer Autoren bzw. der Einschätzung der Computerprogramme?
RR: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich versuche in meinen Büchern, wie auch im Training, die Denkweise meiner Leser zu verändern. Ich lege großen Wert auf die Stellungsbeurteilung und das Schmieden eines sinnvollen Planes. Ich gehe auf die Feinheiten der Position ein und will so die strategischen und taktischen Fertigkeiten meiner Leser ausbilden. Die Computerprogramme sind wahnsinnig stark geworden, können aber einem Spieler keinen Plan erklären. Oft „sehen“ sie auch selbst keinen Plan. Selbstverständlich greife ich bei der Analyse einer Variante manchmal auch die Idee eines anderen Autors auf und versuche diese in meine Überlegungen einzubeziehen.
GM: Was muss heute ein gutes Eröffnungsbuch bieten, um einen Mehrwert gegenüber computergestützten Medien zu erreichen?
RR: Ich versuche dem Lernenden zu vermitteln, wie er sich ein vernünftiges Eröffnungsrepertoire zusammenstellt, seine ihm zur Verfügung stehende Zeit optimal nutzt. Ich versuche ihm wertvolle Ratschläge zu geben, welche psychologischen Einflüsse in einer Schachpartie zum Tragen kommen. Ein Fehler auf dem Brett entspringt einem Defizit im schachlichen Denken. Das versuche ich meinen Schülern klar zu machen.
GM: Einige Ihrer Bücher, darunter das aktuelle «Gegenspiel» verstehen sich als Repertoire-Empfehlung. Der Markt scheint gerade in diesem Bereich zu boomen. Ist das ein Trend «weg vom allgemeinen Eröffnungslexikon» hin zum «individuellen Rundum-Sorglos-Paket»?
RR: Wie ich schon sagte, kann ein Computer kein Eröffnungsrepertoire zusammenstellen. Außerdem ist die Eröffnungstheorie im modernen Schach ein lebendiger Prozess, der ständig im Fluss ist und von ehrgeizigen Spielern stetig beobachtet und weiterentwickelt wird.
GM: Leben Sie eigentlich das Konzept «… im ersten Zug immer e7-e6» auch selbst vor und wenn ja, mit welchen Erfahrungen?
RR: Ja, oft spiele ich selbst so. Das hat mir zum Beispiel in der Französischen Verteidigung eine Menge Erfahrung eingebracht. Natürlich muss ich hin und wieder von diesem meinen Gegnern bekannten Repertoire abweichen, um Vorbereitungen aus dem Weg zu gehen und mit der einen oder anderen Überraschung aufzuwarten.
GM: An «Gegenspiel» gefällt mir besonders, dass Sie den Leser nicht mit langen Varianten allein lassen, sondern die Idee einzelner Züge in kurzen und verständlichen Erklärungen erläutern.
RR: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich selbst sehr ungern endlos lange Varianten mit eingeschobenen Untervarianten nachspiele. Dann ist es doch selbstverständlich, dass ich das meinen Lesern ersparen möchte. Das soll aber nicht heißen, dass ich in meinen Büchern den Königsweg gefunden habe. Es gibt andere Konzepte, die bei anderen Schachspielern auf große Zustimmung stoßen und das ist auch in Ordnung.
GM: In den Katalogen finde ich ein Buch, das – nicht nur in Ihrem bisherigen Schaffen – aus dem Rahmen fällt. «Die große Schachparade 1», angekündigt als Streifzug durch die Turnierwelt vor 100 und mehr Jahren. Die Ziffer «1» weckt in mir die Erwartung, dass wir es hier mit einem auf Fortsetzung angelegten Projekt zu tun haben. Erzählen Sie uns bitte, worauf wir uns hier freuen dürfen.
RR: Die Schachparade ist kein klassisches Lehrbuch sondern mehr ein Lesebuch zum Thema Schach in unterschiedlichen Epochen und Ländern. Wir wollen den Lesern die Menschen hinter den Schachspielern näher bringen und interessante Details über Zeitgeist, politische und gesellschaftliche Hintergründe vermitteln. Das Buch ist sehr aufwendig gestaltet mit vielen Fotos und in Hardcover produziert ein echter Hingucker. Es werden nach und nach weitere Bände folgen.
GM: Sie veröffentlichen im Eigenverlag „ChessCoach“. Was hat Sie und Ihren Partner bewogen, einen eigenen Verlag aufzubauen?
RR: Ein eigener Verlag hat natürlich den Vorteil, dass man seine Vorstellungen eins zu eins umsetzen kann. Natürlich bringt es deutlich mehr Arbeit mit sich, das Buch nicht nur zu konzipieren, sondern auch am Markt zu platzieren, ein Vertriebsnetz aufzubauen und mit dem Buchhandel Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Dennoch stellt es auch eine interessante Erfahrung dar, auf diesem Sektor tätig zu sein. Der Verlag ChessCoach ist ständig auf der Suche nach neuen Autoren und interessanten Konzepten. Da ich auf Grund meiner Schwerbehinderung nicht mehr im Berufsleben stehe, kann ich für den Verlag mehr Zeit aufwenden und habe gleichzeitig eine interessante und sinnvolle Beschäftigung. Dennoch muss man es als Liebhaberei ansehen, da angesichts der geringen Auflage eines Schachbuchs die Kosten-Nutzen-Rechnung in den Hintergrund tritt und kaufmännischen Anforderungen nicht genügt.
GM: Welche aktuellen Projekte hat der ChessCoach-Verlag denn in der Pipeline?
RR: Im Verlag ChessCoach wird in Kürze das Buch «Anzugsvorteil II» erscheinen, ein Weißrepertoire für d4-Spieler. Außerdem stehen die Arbeiten an zwei schachhistorischen Werken kurz vor dem Abschluss: «Die Säulen des Schachs» sowie «London 1851». Zudem wird es ein Lehr- und Arbeitsbuch geben, «Die goldenen Regeln des Schachspiels». Besonders innovativ ist ein Projekt zum Thema Entscheidungen am Schachbrett. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Unterschied zwischen Fernschach und Nahschach. Hierzu konnten wir zwei international renommierte Großmeister gewinnen. ■
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Interview mit Rebecca Gablé («Der dunkle Thron»)
.
«Ich erzähle euch, wie es gewesen sein könnte»
Günter Nawe
.
Vor einigen Tagen veröffentlichte die deutsche Bestseller-Autorin Rebecca Gablé (Bürgerlicher Name: Ingrid Krane-Müschen) mit «Der dunkle Thron» ihren 13. «historischen Roman». Für das Glarean Magazin fragte Günter Nawe die erfolgreiche Schriftstellerin nach ihren literarischen Motivationen und nach den Gründen des Booms von Mittelalter und Renaissance in der modernen Literatur.
.
Glarean Magazin: Frau Gablé, vom berühmten Leopold Ranke stammt das Diktum, dass der Historiker aufzuzeigen habe, «wie es eigentlich gewesen» sei. Hat sich die Mediävistin und Schriftstellerin Rebecca Gablé diesen Satz zueigen gemacht?
Rebecca Gablé: Nein, denn dieser Anspruch ist unerfüllbar und überholt. Ganz gleich, wie gründlich wir schriftliche Quellen und archäologische Funde auswerten, kann das, was wir daraus ableiten, doch immer nur eine Rekonstruktion von Vergangenheit sein. Ein educated guess, wie die Briten sagen: eine Vermutung auf Grundlage der bekannten Indizien. Wie es «eigentlich gewesen» ist, können wir nicht erforschen und darum niemals wissen. So betrachtet, haben wir Schriftsteller es einfacher als die armen Wissenschaftler, denn wir sagen lediglich: «Ich erzähle euch, wie es gewesen sein könnte.» Nichts anderes hat übrigens auch Leopold Rankes Urgroßneffe Robert Graves getan: Er hat mit Kaiser Claudius einen Ich-Erzähler von scheinbar großer Zuverlässigkeit erdacht, der behauptet, er werde die Geschichte nun so erzählen, wie sie «eigentlich gewesen» sei, um dann ein abenteuerliches Konstrukt aus Intrigen und Mord zu spinnen, das zwar möglich, aber keinesfalls nachweisbar ist. Es kommt einem vor, als habe er mit einem Augenzwinkern in Richtung seines berühmten Vorfahren geschrieben.
GM: Sie haben sich vorwiegend und äußerst erfolgreich am englischen Mittelalter «abgearbeitet». In einem Interview haben Sie einmal gesagt: «Mein Herz gehört dem historischen Roman und dem englischen Mittelalter». Warum gerade diesem?
RG: Meine Vorliebe für das englische Mittelalter geht auf mein Literaturstudium zurück. Dort bin ich zum ersten Mal der englischen Dichtung des 8. bis 14. Jahrhunderts begegnet, die mich seither fasziniert und meine Fantasie anregt, weil sie so farbenprächtig, ausdrucksstark und in vieler Hinsicht auch sonderbar ist. All diese Werke – auch wenn sie religiöse oder sagenhafte Motive behandeln – erzählen etwas über ihre Verfasser und deren Zeit. Darum erschien es mir immer naheliegend, diese Literatur als Ausgangspunkt zu nehmen und mir die Lebenswelt der Dichter und ihrer Zeitgenossen vorzustellen. Von da war der Schritt nicht mehr weit, mich an einem historischen Roman zu versuchen, der, wie sich herausstellte, eine Literaturform ist, die mir besonders liegt.
GM: Mit dem neuen Roman «Der dunkle Thron» haben Sie allerdings das Mittelalter verlassen. Der vierte Teil der berühmten Waringham-Saga spielt bereits in der Renaissance, im 16. Jahrhundert. War das dem Interesse Ihrer Leserschaft geschuldet, die nach «Das Lächeln der Fortuna», «Die Hüter der Rose» und «Das Spiel der Könige» einfach wissen wollte, wie es weitergeht mit den Waringhams?
RG: Dem Interesse meiner Leserschaft und meinem. Ich wäre nicht in der Lage, mich zwei Jahre lang einem Thema zu widmen, das nicht in allererster Linie meine eigene Neugier weckt. Ich selber wollte wissen, wie es den Waringham – diesen wertekonservativen Spinnern, die immer noch Ritter sein wollen – in einer Epoche ergehen würde, die sich in vielerlei Hinsicht radikal vom Mittelalter unterscheidet.
GM: Im Mittelpunkt der Tetralogie steht das Geschlecht derer von Waringham. Mit dem Roman «Der dunkle Thron» haben Sie dieses Geschlecht in der mittlerweile sechsten Generation durch eine fast 200-jährige Geschichte begleitet und damit einen relativ langen Zeitraum der Geschichte abgeschritten. Wie hält das die Autorin durch, ohne den roten Faden zu verlieren?
RG: Mit Stammbäumen, sehr vielen Notizen und einem halbwegs zuverlässigen Gedächtnis.
GM: Die «Waringhams» sind ein fiktive Größe in Ihrem Roman. Sie erleben Abenteuer, Liebesgeschichten, Aufstieg und Fall. Dies alles eingebunden in den Fluß realer Geschichte. Wie viel in Ihren Romanen ist Fakt, wie viel Fiktion?
RG: Das ist schwierig zu bemessen, und wir sprachen ja eingangs schon über die Problematik historischer «Fakten». Dem historisch verbrieften Personal meiner Romane (das ja meist in der Überzahl ist), dichte ich keine Taten an, die sie nicht tatsächlich vollbracht haben, aber in dem Moment, da ich sie zu Romanfiguren mache, werden sie fiktionalisiert. Ich bemühe mich, ihre Charaktere so zu beschreiben, wie sie nach meiner Deutung wahrscheinlich waren, aber dessen ungeachtet werden sie zu Geschöpfen meiner Fantasie mit einer eigenen Ausdrucksweise und Körpersprache, mit Dialogen und Emotionen. Das gilt natürlich erst recht für die erfundenen Figuren, also zum Beispiel alle Waringham, obwohl ich auch dort immer mein Augenmerk darauf richte, ihre Lebensgeschichte so zu zeichnen, wie sie sich in der jeweiligen Epoche hätte zutragen können.
GM: Mit Nicholas Waringham, dem Protagonisten des neuen Romans, haben sie eine starke, eine faszinierende Figur geschaffen. Hat es eine vergleichbare Persönlichkeit in dieser Zeit gegeben – oder anders: Hätte es diesen Nicholas Waringham geben können?
RG: Es hätte Nicholas of Waringham in dem oben beschriebenen Sinne geben können, aber er hat kein historisches Vorbild.
GM: Historische Hauptfiguren in Ihrem Roman sind König Heinrich VIII., Anne Boleyn und seine anderen Frauen. Uns ist aufgefallen, dass Sie Heinrich VIII. nicht unbedingt mögen, die Frauen – vor allem Mary, seiner Tochter und späteren Königin, dafür Ihre – sagen wir einmal so – besondere Sympathie genießen. Haben wir richtig gelesen?
RG: Ich muss widersprechen: Die historische Hauptfigur dieses Romans ist allein die besagte Tochter, die spätere Königin Mary I. Ihr Vater Heinrich VIII. (den ich in der Tat fürchterlich finde), ihre Mutter und ihre fünf Stiefmütter sind natürlich wichtige Figuren, aber im Grunde nur in ihrer Beziehung zu Mary oder dem Protagonisten Nicholas of Waringham. Ich glaube, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass ich «besondere Sympathie» für Mary hege, dafür waren die Gräuel ihrer Regentschaft vielleicht einfach zu schrecklich. Aber es war mein Anliegen, diese in den Geschichtsbüchern so oft vernachlässigte Königin einmal zu entstauben, genauer zu betrachten und zu ergründen, warum sie wurde, wie sie war. Das ist es auch, was dieser Roman erzählt. Und je besser ich Mary kennen lernte, desto größer wurde meine Toleranz ihr gegenüber.
GM: Das ganze Romangeschehen spielt vor dem Hintergrund der geistigen, religiösen und politischen Umbrüche im 16. Jahrhundert. Und das nicht nur in England, das neben seinen Königen auch Persönlichkeiten wie Thomas Morus aufzuweisen hatte. Wir sprechen von der Reformation, die auch England erreicht, von der Loslösung Englands von dem Papst, von Heiratspolitik mit politischen Folgen. Hat die lange und intensive Beschäftigung mit dieser Zeit auch die Sichtweise der Autorin beeinflusst?
RG: Natürlich habe ich bei meiner Recherche viel Neues gelernt und bin Personen, Gedanken und Ereignisketten begegnet, von denen ich zuvor nur nebulöse Vorstellungen hatte. Aber meine Sichtweise hat sich nicht geändert. Ich wusste vorher schon, dass Religionen und Absolutheitsansprüche in Glaubensfragen das gefährlichste Konfliktpotenzial sind, das die Menschheit je ersonnen hat.
GM: Sie haben einmal gesagt, Ihr vordringliches Ziel sei zu unterhalten. Kann das gerade der historische Roman mit seiner Mischung aus Fakten und Fiktion leisten? Und ist darin das große Interesse Ihrer ständig wachsenden Leserschaft begründet? Auch weil – wir kommen noch einmal auf den Satz von Leopold Ranke zurück – es Ihnen so gelingt, am besten zu zeigen, «wie es eigentlich gewesen» ist?
RG: Ich glaube nicht, dass der historische Roman einen höheren Unterhaltungswert hat als andere Genres. Der anhaltende Erfolg ist eher der Mischung aus Unterhaltung und Wissensvermittlung geschuldet – «Infotainment», um mal ein besonders abscheuliches Wort zu bemühen, ist ja sehr in Mode. Viele Menschen interessieren sich für Geschichte und wollen wissen, wie die Welt früher war oder wie wir zu der Gesellschaft wurden, die wir heute sind, aber längst nicht alle haben die nötige Zeit oder Motivation, sich zur Beantwortung ihrer Fragen durch historische Fachliteratur zu quälen. Sie greifen lieber zu einem historischen Roman.
GM: Wie wir sehen, ist Ihnen das bestens gelungen zu unterhalten. «Der dunkle Thron» ist mittlerweile Ihr 13. Roman. Sie sind Bestseller-Autorin, gelten als «Königin des historischen Romans», sind in in Bücher-Charts prominent vertreten. Was kann jetzt noch kommen? Eine Fortsetzung der «Waringham-Saga» – oder etwas ganz anderes?
RG: Auf jeden Fall eine Rückkehr in mein geliebtes Mittelalter. Aber mehr wird noch nicht verraten… ■
.
.
.
.
Die Schachzeitschrift KARL feiert ihr 10-jähriges Bestehen
.
Vom Vereinsblatt zum internationalen Schachfeuilleton
Interview mit dem KARL-Herausgeber Harry Schaack
Thomas Binder
.
Mit KARL feiert heuer eines der profiliertesten Schach-Printmedien sein zehnjähriges Jubiläum. Ursprünglich nur für den lokalen Bereich konzipiert, mauserte sich dieses «Kulturelle Schachmagazin» während des vergangenen Dezenniums unter der Ägide seines Gründers, Herausgebers und Chefredakteurs Harry Schaack zu einer qualitätsvollen und vielbeachteten Schachzeitschrift weit über die BRD-Grenzen hinaus. KARL will nach eigenem Bekunden «in Berichten, Analysen, Essays und Porträts einen Blick werfen auf die kulturellen, historischen und gesellschaftlichen Aspekte des Schachs». Weniger die modernsten Eröffnungsvarianten als vielmehr die unübersehbar vielfältigen «außerschachlichen» Aspekte des Königlichen Spiels stehen also im Fokus der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift. «Glarean»-Mitarbeiter Thomas Binder hat dem KARL-Herausgeber einige Fragen zur Vergangenheit und Zukunft seines interessanten Magazins gestellt.
 Glarean Magazin: Glückwunsch Ihnen und dem KARL-Team zum zehnjährigen Jubiläum, Herr Schaack! Wie kam es seinerzeit zur Gründung einer Schachzeitung mit einem solch klaren Profil auf «Schach und Kultur»?
Glarean Magazin: Glückwunsch Ihnen und dem KARL-Team zum zehnjährigen Jubiläum, Herr Schaack! Wie kam es seinerzeit zur Gründung einer Schachzeitung mit einem solch klaren Profil auf «Schach und Kultur»?
Harry Schaack: KARL war ursprünglich die Vereinszeitung meines Klubs «Schachfreunde Schöneck», die ich seit den späten Neunzigern verantwortlich betreute. 2001 entschloss ich mich zusammen mit Johannes Fischer und Stefan Löffler die Zeitschrift unter gleichem Namen mit völlig neuem Konzept bundesweit zu vertreiben, die ersten Jahre noch mit einem Vereinsteil für Mitglieder. Nun erschien KARL in hoher Qualität mit Schwerpunkt-Konzept. Gründe für die Ausrichtung unseres Heftes waren zum einen natürlich unser generelles Interesse an Kultur, zum anderen war uns schon damals klar, dass im Zeitalter des Internets ein Printprodukt, das vorrangig über Turniere berichtet, stets der Aktualität hinterher hechelt.
Die erste Ausgabe «Tempo» erschien im Sommer 2001. Nach drei Heften schied Stefan Löffler aus, Johannes Fischer ist dagegen bis heute eng mit KARL verbunden und betreut mehrere Rubriken. Zunächst gab es einige Skepsis, ob das Schwerpunkt-Konzept dauerhaft tragen würde. Doch wir hatten schon zu Beginn eine lange Liste möglicher Themen erstellt, die nach nunmehr 41 Ausgaben noch nicht ausgereizt ist. Daher sehen wir optimistisch in die Zukunft.
GM: Können Sie sich – als der «Macher» des KARL – unseren Lesern kurz vorstellen? Sie haben ja im Schach sicher auch außerhalb der KARL-Redaktion Ihre Spuren hinterlassen?
HS: Ich habe Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Nach meinem Abschluss arbeitete ich einige Zeit als Grafiker in einer Werbeagentur, was mir aber offen gestanden nicht sehr zusagte. Ich suchte eher eine Tätigkeit im kulturellen Bereich. Dann ergab sich dank einer Anstoßfinanzierung die Chance, KARL zu machen. Heute bin ich selbstständig und – neben der KARL-Herausgabe – als Grafiker und Journalist tätig. Zudem war ich für die Chess Classics drei Jahre lang als Pressesprecher tätig.
Schach spiele ich seit über 20 Jahren bei den bereits erwähnten «Schachfreunden Schöneck» in der Nähe von Frankfurt, wo ich lange Zeit in der 2. Bundesliga gespielt habe. Ich bin FIDE-Meister, spiele aber in den letzten Jahren aus Zeitmangel nur noch selten (was ich bedaure).
GM: Und der Name KARL?
HS: Bundesweit gibt es unser Heft seit 2001, doch eigentlich gibt es KARL – wie bereits erwähnt – schon viel länger. Die Geburtsstunde geht auf das Jahr 1984 zurück, als mein Schach-Klub seine Mitglieder aufforderte, einen Namen für die neu gegründete Vereinszeitung zu finden. Die dritte Ausgabe trug dann den bis heute erhaltenen Namen – übrigens lange vor «Fritz». «Karl» verwies auf ein «typisches» Vereinsmitglied, wollte den «Brigittes» und «Emmas» ein männliches Pendant an die Seite stellen und ist auch als Akronym zu verstehen, abgeleitet aus Begriffen, mit denen sich der progressive Verein identifizierte. So war anfangs noch auf dem Cover zu lesen: «Zeitschrift für Kommunikation, Ansichten/Amazonen, Realitäten und Lorbeerkränze». Der Name ohne direkten Schachbezug sollte ein Hinweis darauf sein, dass die Redaktion kein «Durchschnittsblättchen» machen wollte und «durchaus auch für Nichtschachspieler» interessant sein sollte. Ein Credo, das bis heute Gültigkeit hat.
GM: Wir haben in den letzten Jahren manche Schachzeitungen kommen, aber auch gehen sehen. Vor allem jene, die sich auf die aktuelle Berichterstattung konzentrieren, konnten im Wettstreit mit den vielfältigen und tagesaktuellen Quellen im Internet nicht mithalten. Wie sehen Sie allgemein den Markt für Schachzeitungen, und wo positioniert sich Ihr Magazin?
HS: Das Internet ist der natürliche Feind aller Zeitschriften, die sich auf Aktualität konzentrieren. Wenn man eine Nachricht einen Monat später bringt als irgendeine Website, muss man dem Leser Zusatzleistungen bieten, Hintergrundinfos, Vorortberichte, aber das ist nicht immer einfach. In Deutschland gab es bis vor kurzem fast zehn regelmäßig erscheinende Zeitschriften. Dass nicht alle überleben würden, ist nicht verwunderlich, weil der Markt übersättigt war.
Der Trend geht – auch wenn mir das nicht gefällt – immer mehr in Richtung digitaler Zeitung. Das hat natürlich einige Vorteile für die User. Über ein IPad (oder ein ähnliches Gerät) kann man von überall auf der Welt bequem auf sein Archiv zugreifen, ohne kiloweise Papier mitzuschleppen. Jüngere Generationen sind mit diesen neuen Medien aufgewachsen, und das physische Buch wird unweigerlich immer mehr an Boden verlieren. In diesen neuen Medien liegen große Chancen, und in diesem Bereich wird sich auch KARL in Zukunft positionieren müssen.
GM: Wie entwickelt sich die Auflage der Zeitschrift? Sind Sie optimistisch, die «kritische Masse» für einen wirtschaftlich vertretbaren Betrieb des KARL halten zu können?
HS: Unsere Auflage ist seit einiger Zeit recht konstant. Die Abonnentenzahl steigt stetig leicht an, aber nicht mehr signifikant. Wirtschaftlich wichtig ist für uns der Verkauf älterer Hefte. Von Beginn an war dies ein Teil unseres Konzeptes. Da die Beiträge zu Schwerpunkten nicht der Aktualität geschuldet sind, sind sie auch noch Jahre später lesbar. Sie sind in dieser Hinsicht eher mit Fachbüchern als mit Zeitschriften vergleichbar.
Ich denke, dass unsere kulturelle Fokussierung ein Publikum anspricht, das sich dem Buch bzw. dem Papier verpflichtet fühlt. Deshalb habe ich im Moment keine Sorge und bin zuversichtlich, dass sich das Heft weiterhin «trägt». Zum anderen stand für mich nie der finanzielle Aspekt im Vordergrund. Es ist eher meine Leidenschaft, die das Heft stützt. Denn eigentlich ist mein Honorar angesichts des betriebenen Aufwandes nicht adäquat.
GM: KARL hat zu allen Themen immer außerordentlich kompetente Autoren aufzubieten. Sicher ist das mittlerweile ein Selbstläufer, weil man sich geehrt fühlt, für den KARL schreiben zu dürfen, oder?
HS: Das ist nicht ganz richtig. In Deutschland haben wir vielleicht einen ganz guten Ruf und können auf einen Autorenpool zurückgreifen. Doch wir arbeiten auch mit vielen nichtdeutschen Autoren zusammen. KARL erscheint in Deutsch und ist deshalb im Ausland vor allem durch meine Präsenz bekannt. Kontakte entstehen nicht selten durch meine zahlreichen Turnierbesuche im Ausland. Zudem weiß man oft nicht, wie zuverlässig ein Autor ist, wenn man das erste Mal mit ihm arbeitet. Ein Wagnis, das uns z.B. bei unserem Fischer-Heft sehr in Verlegenheit gebracht hat. Ein deutscher Autor, dessen Namen ich nicht nennen möchte, sagte uns kurz vor Redaktionsschluss einen zentralen Beitrag ab. Aber aus diesem Desaster haben wir gelernt.
GM: Auf Ihrer Homepage listen Sie ca. 160 «Mitarbeiter» auf (darunter auch einige leider bereits verstorbene). Wie ist diese Liste zu verstehen?
HS: Die Liste ist eine Gesamtdarstellung all unserer Mitarbeiter seit unserer ersten bundesweiten Ausgabe. Die große Menge ist auch ein Spiegelbild unseres Heft-Konzeptes, das immer wieder nach neuen Experten verlangt.
GM: Möchten Sie einige Autoren hervorheben, mit denen Sie besonders intensiv und produktiv zusammenarbeiten?
HS: Seit 2004 arbeite ich im schachhistorischen Bereich sehr intensiv mit Dr. Michael Negele zusammen, der mich auch in dankenswerter Weise immer wieder mit seiner Sammlung unterstützt. Er ist vermutlich unser fleißigster Autor. Eng arbeite ich auch mit Prof. Dr. Ernst Strouhal und Michael Ehn zusammen, die neben ihrer KARL-Kolumne zahlreiche weitere Artikel beigesteuert haben. In letzter Zeit ist Großmeister Mihail Marin öfter mit längeren schachspezifischen Beiträgen vertreten. Johannes Fischer ist freilich als Mann der ersten Stunde von Beginn an im Boot. Er betreut u.a. unsere Reihe «Porträts» und hat das Bild der Zeitschrift über die Jahre erheblich mitgeprägt. Schließlich sind natürlich unsere langjährigen Kolumnisten Prof. Dr. Christian Hesse und Wolfram Runkel zu nennen.
GM: Wie lange arbeiten Sie an einer KARL-Nummer von der Themenidee bis zu dem Tag, da es bei mir im Briefkasten liegt? Wer außer den Autoren ist daran noch beteiligt?
HS: Das ist schwer zu sagen, weil dies stark themenabhängig ist. Die Idee entsteht meist schon viele Monate vorher. Dann frage ich frühzeitig Autoren und Interviewpartner an, doch nicht alle können oder wollen tatsächlich einen Artikel schreiben, d.h. ich muss das Themenkonzept peu à peu anpassen. Mein eigener Aufwand richtet sich danach, wie viele Artikel ich selbst schreibe, und wie viele Reisen ich dafür unternehmen muss. Bei einem Schwerpunkt wie der WM in Bonn 2008 war ich z.B. der einzige Journalist, der die gesamte Spielzeit vor Ort war. Insofern kostet teilweise alleine die Recherche enorm viel Zeit.
Die heiße Schlussphase bis zur Fertigstellung eines Heftes beträgt etwa drei bis vier Wochen. Für die graphische Umsetzung des Heftes und die Auswahl der Beiträge bin ich alleine verantwortlich, wenngleich ich mich z.B. mit Johannes Fischer oft bespreche und auch seine Ideen einfließen. Außerdem gibt es noch zwei, drei Korrekturleser.
GM: Ich habe immer diejenigen Ausgaben als besonders interessant empfunden, in denen Sie ein Thema umfassend und aus sehr verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Stellvertretend seien Ausgaben wie «Schach und Politik», «Rivalen», «Zufall», «Schach und Musik» oder «Schönheit» genannt. In letzter Zeit verschiebt sich Ihr Schwerpunkt etwas zu Heften über eine einzelne Region oder ein Traditionsturnier. Zufall oder bewusste Themenverschiebung?
HS: Eine Themenverschiebung kann ich nicht erkennen. Die beiden Hefte, die sich mit einer Region beschäftigten, lagen nur dadurch direkt hintereinander, weil der Schachbund NRW sein Jubiläum feierte, das Heft 4/2010 über die Niederlande aber schon über ein Jahr im Voraus geplant war. Auch in der Vergangenheit gehörten Hefte über Regionen, Städte und Turniere zu unserer Themenpalette. Wenn wir die Möglichkeit haben, uns an aktuelle Ereignisse wie Jubiläen oder Ausstellungen anzuhängen, machen wir das. So ist unser letztes Heft über die Chess Classic deshalb entstanden, weil dieses nicht nur für Deutschland wichtige Traditionsturnier plötzlich zu Ende ging und ich als ehemaliger Pressesprecher mit dem Event verbunden war. Und da muss man schon einmal kurzfristige Themenänderungen vornehmen.
GM: Wie weit in die Zukunft reicht denn Ihr aktueller Themenkatalog? Können Sie uns mit ein paar Stichworten neugierig machen?
HS: Wir planen meist vier Hefte im Voraus. Für das Heft 1/2012 habe ich z.B. bereits einiges in die Wege geleitet und auch schon Interviews geführt. Bis zum Heft 2/2012 gibt es bereits konkrete Absprachen. Titel möchte ich nicht nennen, denn es wäre ungünstig, wenn andere Zeitschriften die gleichen Themen aufgreifen würden. So war ursprünglich für das Heft 3/2011 ein Kortschnoi-Schwerpunkt vorgesehen. Doch weil ihm auch die Zeitschrift SCHACH fast ein ganzes Heft gewidmet hat, haben wir davon abgesehen und uns stattdessen für seinen Antipoden Karpow entschieden, der ebenfalls einen runden Geburtstag hat.
GM: Unter den aktuell in der Schachszene diskutierten Problemen stehen (leider) die Betrugsmöglichkeiten mit elektronischen Hilfsmitteln im Blickpunkt. Aus meiner Sicht wäre dies ein ideales Feld für KARL, das Thema mit allen Aspekten (geschichtlich, technisch, rechtlich, Folgen und Lösungsansätze usw.) auszuleuchten. Sind Sie in der Spur?
HS: Sie haben vollkommen recht, Betrug ist ein reizvolles Thema und im Moment auch leider ein aktuelles Problem. Ich hatte Gelegenheit, mich in Bonn bei der Deutschen Meisterschaft als Augenzeuge direkt vor Ort über den «Fall Natsidis» zu informieren und mit Teilnehmern darüber zu sprechen. Der technische Fortschritt hat Möglichkeiten geschaffen, die Manipulation immer leichter machen. Gelingt es in Zukunft nicht, dies zu unterbinden, wird das Schach stark leiden.
«Betrug» war eines der Themen, die wir zu Beginn auf unserer Ideenliste für KARL-Schwerpunkte notiert hatten – das war 2001. Natürlich habe ich in Anbetracht der aktuellen Ereignisse über dieses Thema nachgedacht. Da wir aber einige Hefte im Voraus planen, müssen sich die Leser noch ein wenig gedulden. Doch ich bin sicher, dass uns das Thema noch eine ganze Weile begleiten wird.
GM: Im Vergleich zum hochwertigen Anspruch Ihrer Zeitschrift fällt das begleitende Internet-Angebot eher nüchtern und spartanisch aus. Damit sind Sie in der Schachzeitungs-Branche allerdings keineswegs allein. Reicht die Kraft nicht für eine umfassende Online-Präsenz oder spielt da auch die Angst mit, sich quasi eine Konkurrenz im eigenen Haus zu schaffen?
HS: Unsere Internet-Seite bedarf dringend einer Überarbeitung, das ist richtig. Dieses Problem haben wir leider allzu lange hinausgeschoben. Im Moment sind wir dabei, die Seite komplett neu zu gestalten. Dies dauert allerdings noch einige Zeit, weil mittlerweile doch schon ein enormer «Content» vorhanden ist. Wir bieten auf unserer Homepage zu jedem unserer Hefte gleich mehrere Leseproben. Mittlerweile sind in unserer «Kolumne», wo verschiedene Autoren aktuelle Publikationen rezensieren, über hundert Beiträge zu finden.
Wir hoffen, in naher Zukunft eine ansprechende Website präsentieren zu können. Angst vor Konkurrenz im eigenen Haus haben wir dagegen nicht. Unsere dort veröffentlichten Beiträge dienen unserer Eigenwerbung. Eine tägliche Berichterstattung über aktuelle Ereignisse streben wir dagegen nicht an.
GM: Was sind aus Ihrer Sicht die Highlights von zehn Jahren KARL-Geschichte? Denken Sie an ein besonders gelungenes Heft, einen sehr interessanten – vielleicht auch kontroversen – Artikel?

KARL-Macher H. Schaack (Hintergrund) in erlauchtem Kreise anlässlich des Keres-Festes 2006 in Tallin/Estland
HS: Ein ganz besonderes Highlight ist zweifellos bis heute das Keres-Heft (KARL 2/2004). Dabei wurden wir – Johannes Fischer und ich – vom Estnischen Fremdenverkehrsamt unglaublich unterstützt. Die besorgten uns nicht nur den Flug, sondern auch eine mehrtägige Estland-Rundreise in Begleitung. Wir hatten dadurch Kontakt zu allen wichtigen Gesprächspartnern, u.a. auch mit der Familie von Keres. Das war wundervoll und ist auch dem Engagement von Johannes Fischer zu verdanken, der im Vorfeld zahlreiche Institutionen anfragte. Zudem haben alle von uns angestrebten Artikel und Interviews geklappt, darunter die mit Spasski und Smyslow.
Aufgrund dieses Heftes lud man mich 2006 anlässlich des 90. Geburtstages des estnischen Nationalhelden zur großen Keres-Feier nach Tallinn ein. Ein unvergessliches Erlebnis, denn alle großen Spieler der Ära Keres waren versammelt: Karpow, Kortschnoi, Spasski, Awerbach, Taimanow, Gligoric, Unzicker, Schmid, Olafsson, u.v.m. Die Einladung enthielt auch Empfänge beim Präsidenten und ein Mittagessen mit dem Premierminister. Das war großartig. Ein anderes schönes Erlebnis war die Zusammenarbeit mit der Familie Unzicker für KARL 2/2007. Mit seiner Frau und den beiden Söhnen traf ich mich mehrfach in München zu mehrstündigen Interviews, die letztlich zu einer sehr persönlichen Biographie führten.
Auch zahlreiche Atelierbesuche bei diversen Künstlern, die sich mit Schach beschäftigten, sind mir in guter Erinnerung geblieben. Unter den vielen Ausgaben sind mir schachhistorisch vor allem die Lasker- und Nimzowitsch-Ausgaben (KARL 1/2008 + 4/2006) sowie die Hefte über den DSB und über Wien (1/2002 + 2/2009) in Erinnerung geblieben. Aber ich mag auch das Musik-Heft (KARL 4/2007), wo ich u.a. mit Portisch sprechen konnte, der in seiner Karriere nur ganz selten Interviews gegeben hat. Gleich zwei kuriose Artikel gibt es im Zufalls-Heft (KARL 2/2006): Einen von Strouhal über «Schach&Religion» und einen von Donninger über «Zufall&Computer». Das originellste Titelbild ist vermutlich jenes des Taktik-Heftes – ein Kugelfisch, den ich einer Anregung meiner Lebensgefährtin verdanke. Schließlich haben wir im aktuellen Heft (KARL 2/2011) mit unserem Preisrätsel, dass es meines Wissens so im Schachbereich noch nie gab, einen großen Erfolg gelandet, denn die Rückmeldung unserer Leser ist so groß wie nie.
GM: Herr Schaack, besten Dank für Ihre Ausführungen und weiterhin viel Erfolg mit KARL! ■
.
Leseprobe 1 (pdf) (Chrilly Donninger: Computerschach)
Leseprobe 2 (pdf) (Feuilleton: Café de la Régence)
Leseprobe 3 (pdf) (Wandler zwischen den Welten: Wolfgang Unzicker)
.
.
.
.
.
.
Interview mit der Claudius-Biographin Annelen Kranefuss
.
«Vorrang der Realität vor aller Kunst»
Günter Nawe
.
 Unlängst würdigte unser Magazin die kürzlich bei Hoffmann&Campe erschienene Claudius-Biographie der Kölner Germanistin Dr. Annelen Kranefuss: «Originell und unverwechselbar» – übrigens die erste Biographie seit über siebzig Jahren, die sich dieses Mannes (der als Journalist, als Dichter, als homme de lettres und als Redakteur des «Wandsbecker Bothen» Literaturgeschichte geschrieben hat) wieder umfassend annimmt. Günter Nawe unterhielt sich mit der Autorin über den Dichter Claudius, dessen wissenschaftliche Erforschung noch längst nicht am Ende sei. –
Unlängst würdigte unser Magazin die kürzlich bei Hoffmann&Campe erschienene Claudius-Biographie der Kölner Germanistin Dr. Annelen Kranefuss: «Originell und unverwechselbar» – übrigens die erste Biographie seit über siebzig Jahren, die sich dieses Mannes (der als Journalist, als Dichter, als homme de lettres und als Redakteur des «Wandsbecker Bothen» Literaturgeschichte geschrieben hat) wieder umfassend annimmt. Günter Nawe unterhielt sich mit der Autorin über den Dichter Claudius, dessen wissenschaftliche Erforschung noch längst nicht am Ende sei. –
Glarean Magazin: Frau Kranefuss, es gibt das berühmte Diktum Goethes über die Hauptaufgabe einer Biographie. War es auch für Sie Maßstab ihrer Arbeit?
Annelen Kranefuss: Ja. «Den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen» – das ist in der älteren Claudius-Biographik oft vernachlässigt worden. Damit hat man wesentliche Aspekte seines Schreibens und Lebens ausgeblendet. Die historischen Bedingungen (also auch die sozialen Besonderheiten des jeweiligen Lebensraums) waren nicht nur für sein Leben bestimmend, Claudius hat auch als Literat, als homme des lettres, wie er sich nannte, auf das Zeitgeschehen reagiert. Er hat ja als Journalist angefangen und auch nach dem Ende seiner Zeitungsarbeit in seinen Texten immer wieder auf Zeitereignisse und kulturelle Debatten reagiert, sehr oft indirekt, so dass es für die Nachwelt nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Er hat allerdings auch als Journalist versucht, die Dimensionen von Zeit und Zeitlosigkeit in Beziehung zu setzen und seinen Lesern zu vermitteln, dass es noch etwas anderes gibt als die Tagesaktualität.
GM: Seit der letzten größeren Claudius-Biographie sind rund 70 Jahre vergangen. Woher das Desinteresse der Germanistik an diesem «originellen und unverwechselbaren» Dichter?

Germanistin Kranefuss: «Mich spricht bei Claudius das Lakonische, seine Nüchternheit an, die gleichzeitige Herzlichkeit und Empathie, die Verbindung von Humor und Tiefgang, seine Mitmenschlichkeit und Weltbejahung ohne jede Verharmlosung.»
AK: Das Desinteresse ist nicht so groß, wie es scheint: In den letzten Jahrzehnten hat sich eine Reihe von Germanisten immer wieder intensiv mit dem Werk von Matthias Claudius befasst. Zugegeben: das ist nur eine Handvoll gemessen an der Fülle von populären und oft betulichen Claudius-Darstellungen und im Vergleich zu den kaum noch zu übersehenden Forschungen über andere Autoren, etwa Goethe oder Kafka. Hier geht es Claudius nicht anders als anderen «kleineren Poeten» der Literaturgeschichte. Es interessieren sich für ihn aber auch andere Disziplinen. Es gibt ausgezeichnete theologische Arbeiten über ihn; er hat einen Platz in der Geschichte von Theologie und Frömmigkeit – das heißt, man kann sich ihm im Grunde nur fächerübergreifend annähern. Was in der Forschung bis auf wenige Ausnahmen bisher zu kurz kam, ist ein seriöser biographischer Zugang, der über die älteren erbaulichen Schriften hinausgeht. Biographien galten in der Literaturwissenschaft ja lange als unseriös. Möglicherweise stand im Fall von Claudius auch das überlieferte Klischeebild des frommen Idyllikers und Familienvaters einem größeren Interesse im Wege.
GM: Was hat Sie letztlich bewogen, sich dieses Autors anzunehmen?
AK: Claudius hat mich seit meinem Studium immer wieder begleitet und beschäftigt. In seinen gelungenen Stücken (daneben gibt es durchaus auch Schwächeres) ist er einer der großen Meister unserer Sprache und der kleinen Form. Mich hat auch der dahinter zu spürende Mensch angesprochen, das Lakonische, seine Nüchternheit, die gleichzeitige Herzlichkeit und Empathie, die Verbindung von Humor und Tiefgang, seine Mitmenschlichkeit und Weltbejahung ohne jede Verharmlosung. Er hat unsere Hilflosigkeit angesichts des Todes erfahren und dargestellt. Und es hat mich gereizt, seiner «Mischung von Schöngeisterei und Religion», so beschreibt er die «Idiosynkrasie des Boten», nachzugehen. Das ist nicht zu verwechseln mit der Vorstellung von der ästhetischen Autonomie des Kunstwerks, wie sie die Klassiker zur gleichen Zeit entwickelten. Claudius beharrt auf dem Vorrang der Realität vor aller Kunst, was vielleicht erst heute, nach dem Ende des Zeitalters der Kunstreligion, wieder als künstlerische Möglichkeit neu gesehen werden kann.
GM: An einer Stelle schreiben Sie, dass in der «Verflechtung mit seinem Zeitalter … Claudius’ Eigenart sichtbar» wird. Welches war die «Eigenart» von Matthias Claudius?
AK: Ich habe sie u.a. mit dem Begriffspaar «Eigensinn und Geselligkeit» zu fassen gesucht. Er war weder im Leben noch im Schreiben der isolierte Außenseiter, als den ihn die Literaturwissenschaft lange geführt hat, er hatte Freunde, war gut vernetzt, aber er hat auch – im Dialog mit den Zeitgenossen – immer eine eigene Position zu behaupten gesucht und dem Zeitgeist auch widersprochen. Das wird deutlich, wenn man die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur als Goethezeit betrachtet, sondern den jeweils lokalen Besonderheiten nachgeht.
GM: Sie haben in diesem Buch einerseits mit Legenden aufgeräumt, andererseits von «Leerstellen» in der Claudius-Biographie gesprochen. Ist die Forschung über Claudius noch nicht am Ende?
AK: Mit Sicherheit nicht. Es lässt sich bestimmt noch eine Menge entdecken. Einerseits ganz positivistisch faktenbezogen. Ich denke, dass mit der wissenschaftlichen Edition der Briefe von und an Matthias Claudius, an der unter der Leitung von Professor Jörg-Ulrich Fechner in Bochum gearbeitet wird, noch das eine oder andere ans Licht kommen dürfte, manches wird mögicherweise auch in anderem Licht erscheinen. Ich musste mich noch weitgehend mit der unzulänglichen Briefausgabe von 1938 behelfen. Andererseits geht es ohnehin nicht in erster Linie darum, Lücken in der biographischen Überlieferung zu schließen, manche «weiße Flecken» werden bleiben. Vielmehr sind die Claudius-Texte selbst immer noch einmal genau zu lesen, genauer zu entziffern und im Kontext der Zeit zu deuten. Das habe ich versucht, aber damit kommt man nicht so schnell ans Ende. Das Genre Biographie eignet sich auch nicht als Container für alle Forschungsfragen und -ergebnisse. Schließlich sollte mein Buch nicht allzu dick werden. Und dann wird auch jeder Forscher, jede Epoche wieder andere Fragen an den Autor stellen und einen neuen Zugang finden.
GM: Mit der Ausgabe der «Sämtlichen Werke des Wandsbecker Bothen» hat Matthias Claudius ein einzigartiges Werk geschrieben. Wie ist dieses Werk zu klassifizieren, wo hat es seinen Platz in der Literaturgeschichte?
AK: Ich denke, das müsste aus meinen bisherigen Antworten schon hervorgehen.
GM: In Zusammenhang mit Claudius ist auch einmal von einem «sokratischen Schriftsteller» die Rede. Ist das eine weitere der vielen Facetten, die diese Autor hat?
AK: Das 18. Jahrhundert ist das «sokratische Jahrhundert» genannt worden. Die kirchliche Orthodoxie verdammte Sokrates als Heiden und sprach ihm jede Tugend ab, für die Aufklärer war er eine Symbolfigur im Kampf um Toleranz. In diesem Sinn ergreift auch Claudius Partei für Sokrates. Der Philosoph mit seinem «Ich weiß, dass ich nichts weiß» war auch für ihn ein Gewährsmann in seiner Wendung gegen Pedanterie und abstrakte Gelehrsamkeit. Seine Verehrung geht aber darüber hinaus. Der Sokrates, der in Athen vor Gericht stand und zum Tode verurteilt wurde, war ihm ein Vorbild innerer, religiös verstandener Freiheit.
GM: Was kann Matthias Claudius dem Leser von heute sagen? Kann er dem Leser von heute überhaupt noch etwas sagen?
AK: In vielem sind uns Claudius’ politische Ansichten, seine Lebensform heute fremd, gerade in dem, was z.B. das Bürgertum des 19. Jahrhunderts an ihm schätzte. Wir können die restaurativen Tendenzen seines Spätwerks nicht mehr nachvollziehen. Er ist weder der Dichter zeitloser Wahrheiten noch lässt er sich krampfhaft aktualisieren. Das ist aber auch gar nicht nötig – es gibt viele Züge, in denen wir uns zu diesem Menschen und Schriftsteller in Beziehung setzen, uns ihm annähern können, ohne uns identifizieren zu müssen. Er spricht auf anrührende und einfache Weise von den elementaren Gegebenheiten des Menschenlebens, von den Schönheiten der Natur, von der Vergänglichkeit und den ungelösten Fragen des Daseins und kann uns ermutigen, das zu suchen, was auch ihm wichtig war: «etwas Eigenes», das standhält.
GM: Einige wenige Menschen kennen bestenfalls die erste Strophe des berühmten «Der Mond ist aufgegangen…» und vielleicht noch den Schlussvers. Oder aber den Vers, von dem kaum einer weiß, dass «’s ist leider Krieg – und ich begehre / Nicht schuld daran zu sein!» von Claudius ist. Sollte dieser Dichter nicht wieder im Deutschunterricht von heute seinen Platz finden?
AK: Ich weiß nicht, ob er wirklich so ganz aus dem Deutschunterricht verschwunden ist. Das «Kriegslied» kommt, wie ich höre, durchaus vor. Und gerade hat mir jemand von einer Schulveranstaltung erzählt, bei der Claudius’ Gedicht «Die Sternseherin Lise» rezitiert wurde. Wichtig finde ich, dass die Schule beides vermittelt: die wunderbaren Texte und das Gefühl für die Zeit und die Person des Dichters. ■
.
.
.
Interview mit dem (Schach-)Schriftsteller Martin Weteschnik
.
«Systematisch lernen und regelmäßig üben!»
Thomas Binder
.
Vor zwei Wochen stellten wir hier den neuen Taktik-Band des Frankfurter Schach-Autoren Martin Weteschnik vor. Mit seinem «Schachtaktik–Jahrbuch 2011» setzt der FIDE-Meister eine Reihe erfolgreicher Schach-Publikationen aus seiner Feder fort. Nun denkt aber der bekannte Taktik-Theoretiker an die Beendigung seiner schachlichen Publikationsarbeit, um sich stattdessen «mit voller Kraft» aufs Romane-Schreiben konzentrieren zu können. «Glarean»-Mitarbeiter Thomas Binder stellte dem rührigen Schach-Pädagogen und Roman-Autoren einige Fragen zu seiner zurückliegenden Karriere und zu seinen Zukunftsvorstellungen.
Glarean Magazin: Als Turnierspieler ist es inzwischen recht ruhig um Sie geworden, dafür widmen Sie sich je länger desto mehr dem belletristischen Schreiben. Was waren denn so die wichtigsten Lebensstationen Ihrer (Schach-)Karriere?
Martin Weteschnik: Ich bin 1958 in Frankfurt am Main geboren und dort aufgewachsen. Nach dem Abitur begann ich Germanistik zu studieren und wollte Schriftsteller werden. Das Schreiben, so meinte ich damals, sei der einfachere Part, das «Worüber» weitaus schwieriger. Tatsächlich hatte ich bis dahin nicht eben viel erlebt, was einem künftigen Schriftsteller nicht gerade zu einem sensationell anspruchsvollen Blickfeld verhilft. Folglich sollte und wollte ich erst einmal die Welt kennenlernen! In Japan blieb ich etwas länger. Das Land und seine Kultur haben mich tatsächlich bis heute geprägt. Seither bemühe ich mich um eine Synthese zwischen östlichem und westlichem Denken.
In Amerika schließlich, wo ich fast fünf Jahre in San Francisco wohnte (eine verdammt schöne Stadt!), begann ich mich – nunmehr Mitte zwanzig – mit einem äußerst faszinierenden Spiel zu beschäftigen: mit Schach. Mehr als zwei Jahre verbrachte ich in Ungarn und lernte bei einem Profitrainer. Später unterrichtete ich selbst und schrieb mein erstes Schachbuch. Das «Lehrbuch der Schachtaktik» wurde mittlerweile in mehrere Sprachen übersetzt und erschien zudem bei ChessBase auf CD und DVD. Am erfolgreichsten ist es auf dem englischsprachigen Markt und gilt mittlerweile als Standardwerk im Bereich Taktik. Auf diese Weise gelangte ich also wieder zum Schreiben…
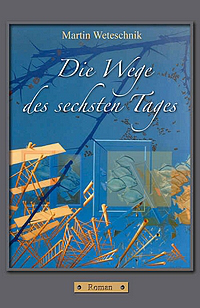
Weteschnik-Roman: «Einen Verlag zu finden ist ungleich schwieriger, als ein gutes Buch zu schreiben.»
Mit etwa 25 Jahren erlernte ich das Schachspiel in San Francisco im sogenannten Mechanics’ Institute. Nach einem Jahr schlug ich meinen ersten IM und den einen oder anderen ELO-Träger (damals ab 2200). Die Leute befragten mich anschließend, weshalb ich über die ersten Züge einer Hauptvariante eine Stunde lang nachgedacht hätte (ich kannte noch keine Eröffnungstheorie), oder warum ich den gleichen Fehler beginge wie Anderssen in einer seiner Matchpartien gegen Morphy. Oh natürlich! – Ich spielte also schon damals wie Anderssen… (leider hat es, wenn überhaupt, nur bezüglich der Fehler zu Anderssens Niveau gereicht).
Nach etwas über einem Jahr wurde mir praktisches Schach langweilig. Tatsache! Die anderen schienen immer nur dasselbe zu spielen, so jedenfalls kam es mir vor (mit dieser Vermutung hatte ich auch nicht ganz unrecht, zumindest was das blinde Nachspielen von Eröffnungstheorie anbelangt) – und selbst fiel mir auch nichts Weltbewegendes ein.
GM: Wie wurde denn aus dem «gelangweilten» Schach-Adepten ein FIDE-Meister?
MW: Aus irgendeinem Grund empfahl mir jemand, Capablancas Partien nachzuspielen (für manche nicht gerade der aufregendste Spielstil). Vielleicht lag es ja an Capablancas Bestreben, alle Figuren harmonisch einzusetzen und zusammenspielen zu lassen, jedenfalls half Capablancas Schachstil mir zu verstehen, wie Einfachheit und konsequentes Verfolgen einer Idee bei gleichzeitigem Bemühen um Harmonie (alle Kräfte wirken irgendwann zusammen) folgerichtig zu einem neuen und einzigartigen Ergebnis führen. So ein «magischer» Moment entsteht im Strategischen ähnlich wie Steinitz es einst bei der Taktik postulierte: dass Kombinationen keine Geniestreiche aus heiterem Himmel sondern das Ergebnis konkreter Positionen sind. Nun, das klingt ziemlich theoretisch. Mag mir im Schach das höhere Handwerkszeug – und möglicherweise auch die nötige Gedächtnisleistung – gefehlt haben, so behaupte ich aus meinen Erfahrungen heraus dennoch, dass selbst große Kreativität für jeden erfahrbar ist. Möglicherweise verdanke ich dem «Langeweiler» Capa den Zugang zu meinem Einfallsreichtum. Auch in anderen Bereichen (zum Beispiel beim Schreiben) werden mir die Ideen wohl nicht mehr ausgehen.
GM: Und wie ging’s dann in Europa weiter, in den angestammten Schachgefilden sozusagen?
MW: Meine «Schachkarriere» ist schnell erzählt. Aus Amerika kehrte ich nach Europa zurück, um dort Schach besser lernen und spielen zu können. Es blieb zumeist beim Lernen. Zwei Jahre trainierte ich mit Tibor Karolyi (dessen Schüler Peter Leko seinerzeit der jüngste Großmeister wurde). Fast ohne Vorkenntnisse war ich mit dem 70’000 Züge umfassenden, auswendig zu lernenden Eröffnungsrepertoire zumeist überfordert. Als «alter Mann» in der Dreißigern lernt sich eben nicht mehr so leicht, was heutzutage bereits Elfjährige mit ELO 2500 (allerdings auch erst nach Jahren intensivsten Trainings) beherrschen… Mir fehlten die praktischen Erfahrungen, um den gigantischen Stoff mit etwas Konkretem verknüpfen und ihn so im Gedächtnis speichern zu können.
Meist spielte ich damals geschlossene (IM-)Turniere. In meinem zu der Zeit einzig gespielten Open in Deutschland (Bad Vilbel 1995; verflucht aber auch, was könnte ich mir heute alles leisten, wenn es damals ausgewertet worden wäre…) erreichte ich den zweiten Platz. Später nahm ich an ein paar GM-Turnieren teil, und auf meinem «schachlichen» Höhepunkt (und letztem Turnier in Ungarn) fehlte mir nominell nur ein Titelträger, um die erste IM-Norm zu erspielen.
Ich muss dennoch zugeben, dass ich nie ein guter praktischer Spieler war. Viele recht peinliche Performances wären mir erspart geblieben, hätte ich aus gesundheitlichen o.ä. Gründen rechtzeitig aufgehört. Aber wir alle wissen ja: Der rechte Zeitpunkt, sich von jenen Dingen zu trennen, an denen wir hängen, ist nicht immer leicht abzupassen. Mein Freund und Trainer Tibor Karolyi sagte einmal zu mir, er kenne keinen (und er kennt eine Menge Leute), der das Schachspiel so sehr liebe wie ich. Sei’s drum, heute kann ich mir nichts Gewinnbringenderes, systematisch Erlernbareres und Tiefgreifenderes vorstellen als Tai Chi (Meditation in Bewegung), das ich wenig, dafür aber tagtäglich praktiziere. Schach war leider irgendwann nicht mehr mein Weg.
GM: Ihre Bücher haben nach meinem Eindruck einen großen Praxisbezug. Da liegt die Vermutung nahe, dass Sie auch als Trainer aktiv waren bzw. sind?
MW: Ja, ich habe Schach unterrichtet, Vorträge gehalten und auch einen Verein betreut. Allen Amateuren (und da meine ich durchaus Spieler bis 2400 ELO) kann ich empfehlen, wenigstens ein Mal in ihrem Schachleben mit einem gutem Trainer oder einem Profi zu trainieren (möglichst nicht in einer größeren Gruppe!). Durchschnittlich werden Spieler (bis etwa 1900) meiner Erfahrung nach innerhalb eines Jahres um 200 Ratingpunkte zulegen. Spieler (etwa wie die «ewigen FMs») werden möglicherweise feststellen, dass sie zu einseitig spielen. Gute Spieler lernen vielleicht weniger an technischen Dingen dazu, doch werden sie davon profitieren, dass ihnen ein erfahrener Trainer eine andere Perspektive aufzeigt. Natürlich nicht immer, aber immer öfters: Ich habe Leute mit einer Spielstärke von 2200 erlebt, die nach nur ein paar grundlegenden Stunden mit einem guten Trainer Titelträger einfach übers Brett schoben (push him over the board, meint Tibor Karolyi treffend, wenn er von der Waffe des Raumvorteils spricht).
Auch wenn meine schriftstellerische Arbeit das Trainieren anderer heute nicht mehr zulässt, möchte ich an dieser Stelle einen Tipp loswerden (auch wenn er allzu einfach klingen mag): Systematisch lernen und regelmäßig üben!
GM: Wie würden Sie die Zielgruppe Ihrer Schachbücher beschreiben?
MW: Das sind Spieler mit einer DWZ von 1200 – 2000.
GM: Wie findet man eigentlich bei der heutigen Fülle von Turnierpartien die «Rosinen im Kuchen», also die wirklich sehenswerten Kombinationen?
MW: Auf diese «Rosinen» im Kuchen wird man natürlich auch durch Quellen wie Internet und Zeitschriften aufmerksam. Man soll das Rad nicht immer neu erfinden; Eine brillante Kombination wird nicht schlechter, nur weil sie irgendwo mehrfach erscheint. Und ein Copyright gibt es weder auf das Finden noch (leider) auf das Kreieren von Taktik. Grundsätzlich bemühe ich mich natürlich, durch Eigenarbeit Neuem auf die Spur zu kommen. Dabei macht es die Fülle an Material eher einfacher, interessante Kombinationen aufzuspüren. In der Tat sollte man die guten Kombinationen bei den besseren Spielern suchen. Andererseits erstaunt es immer wieder, wie taktisch beschlagen auch schwächere Spieler sind. Das mag daran liegen, dass den meisten Turnierspielern im Amateurbereich viele Ideen bereits bekannt sind. Wenn einer die taktischen Motive kennt und ihren Aufbau versteht, kann jeder auch mal ganz große Taktik spielen… Also auf geht’s!
GM: Sind bei Ihren Taktik-Publikationen nachträglich viele interessante Partien «durch den Rost gefallen», weil sie sich bei nachträglicher Analyse als unkorrekt erwiesen?
MW: Natürlich lässt jeder ein Analyseprogramm im Hintergrund laufen. Unfehlbar ist keiner von uns. Man sollte sich dennoch auch auf sein Gefühl verlassen. Meist werden Kombinationen eher verworfen, weil mehrere Lösungswege dem Leser das Üben erschweren.
GM: Ich habe gelesen, dass Sie sich aus dem Schachbuchgeschäft zurückziehen wollen. Es wird also keine weiteren «Schachtaktik-Jahrbücher» mehr geben?
MW: Vermutlich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass mein Freund Heinz Brunthaler diese hübsche Reihe auch unter seinem Namen weiterführen kann.
GM: Zu Ihren Roman-Projekten: Auf welches Genre und welche inhaltlichen Schwerpunkte konzentrieren Sie sich dabei?
MW: Gerade habe ich einen Thriller mit historischer Schiene fertiggestellt und mich auf Verlagssuche begeben. Einen Verlag zu finden ist ungleich schwieriger, als ein gutes Buch zu schreiben… Da ich ein möglichst großes Publikum erreichen möchte, stehen Handlung und Spannung im Vordergrund. Allerdings konnte ich es mir nicht verkneifen (neben gründlicher Recherche), das Ganze auch mit etwas Gehalt zu unterlegen… Spannung mit Tiefgang soll auch meine künftigen Werke auszeichnen. Das nächste ist bereits in Planung und wird sich noch deutlicher auf das Thriller-Element konzentrieren. Während der jetzige Roman an den Schauplätzen Dresden, Genf, New Orleans und New York angesiedelt ist, spielt der nächste in Frankfurt, gleichwohl mit ein wenig internationalem Flair garniert. Irgendwann schreibe ich auch wieder ein Sachbuch (Mensch, Wissenschaft, Umwelt – sorry: keins über Schach). Mein unbescheidenes Ziel aber ist es, mit Romanen auch in Englisch verlegt zu werden und eines Tages ein Buch zu schreiben, das nicht nur inhaltlich, sondern zudem stilistisch über gute Unterhaltungsliteratur hinausgeht.
GM: Wird Ihr umfangreiches Wissen aus der Schachszene irgendwie in die Handlung einfließen?
MW: In wie weit das Thema Schach in meinen ersten Roman («Die Wege des sechsten Tages» / 2008) eingeflossen ist, kann man z.B. dem entspr. Medienecho entnehmen. Genauso wenig wie ich allerdings in reinem Lokalkolorit zu versinken gedenke, meide ich einseitig themenbezogenes Schreiben. Für den aktuellen Roman war zunächst kein Schachbezug vorgesehen. Allerdings drohte der historische Plot (des hauptsächlich in der Jetztzeit spielenden Thrillers) plötzlich in Paris zu versanden. In dem Roman geht es nebenbei um das Mausoleum Karl II. Zudem sollte die historische Schiene nach Amerika führen. Der Herzog von Braunschweig, Paris Mitte des 19. Jahrhunderts, Amerika… mmh… da war doch was? Richtig, die legendäre Schachpartie zwischen dem Amerikaner Paul Morphy und eben jenem Herzog (und dem Grafen dʼIsoard). Schach hilf! – Wie fantastisch sich das Ganze letztlich fügt, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten – auch nicht, was meine Recherchen zu dieser Partie und über den Grafen dʼIsoard ergeben haben… ■
.
.
.
.
.
Interview mit dem Fernschach-Großmeister Arno Nickel
.
Der Fernschachmeister als Schach-Forscher
Walter Eigenmann
.
Neueste Schach-Datenbanken wie die hier kürzlich besprochene «Corr Database 2011», aber weit mehr noch die modernen Schach-Rechenprogramme, beispielsweise die verbreiteten PC-Engines «Rybka», «Stockfish», «Shredder» oder «Fritz» u.v.a. mit ihrer mittlerweile extremen Spielstärke, die keinen internationalen Großmeister mehr fürchtet, lassen immer wieder neu und immer heftiger die Diskussion aufflammen, ob das Fernschach nicht inzwischen tot ist. Und nicht wenige der früher glühenden Verehrer des altehrwürdigen Korrespondenzschachs (Correspondence Chess) haben sich inzwischen enttäuscht davon zurückgezogen: «Ich will nicht gegen Maschinen spielen!»
Denn je länger desto mehr kann im Fernschach das Phänomen beobachten werden: Man rechnet nicht mehr, man lässt rechnen. Stunden-, ja tagelang «brütet» jetzt nicht mehr der FS-Spieler über den Partien, sondern Rybka&Co. wird mit den Stellungen gefüttert, wonach meist ein taktisch einwandfreier, ja oft sogar brillanter Zug resultiert – was aber in den Turnier-Resultaten nicht als Plagiat deklariert wird, sondern als persönlich-menschliche Eigenleistung auftaucht…
Über die Zukunft des internationalen Fernschachs, die Chancen und Gefahren der neuen Software-Generationen für das Fernschach, die spezifischen Anforderungen, die der Einbezug von Schachprogrammen für den ambitionierten FS-Spieler mit sich bringt, befragte das Glarean Magazin den internationalen Fernschach-Großmeister Arno Nickel (aktuell die Nummer 25 der Weltrangliste).
Der auch im Nahschach erfahrene Turnierspieler Nickel ist seit Jahrzehnten eine in der internationalen Correspondence-Chess-Szene sehr aktive und bekannte Persönlichkeit. Darüber hinaus gilt der 58-jährige Berliner Schach-Journalist, -Organisator, -Autor und –Verleger als versierter Kenner auch auf dem Gebiete der neuen Schach-Software. Für seine engagierte, kenntnisreiche und ebenso ausführliche wie informative Stellungnahme hier zum ganzen Themenkomplex «Modernes Fernschach» besten Dank! –
Glarean Magazin: Hand aufs Herz, nutzt der Top-25-Spieler Arno Nickel nicht auch wie viele andere Fernschach-Meister exzessiv die modernen Schach-Engines, als da sind: Rybka, Shredder, Fritz, Hiarcs u.a., oder auch die zahllosen starken Freeware-Programme wie beispielsweise Stockfish, Critter oder Houdini?
Arno Nickel: Eine nette Einstiegsfrage. Wenn nun noch definiert würde, was unter «exzessiv» (das Maß überschreitend, ausschweifend) zu verstehen ist, dann könnte ich darauf vielleicht besser antworten, aber ich versuche es gern auch so: Fernschach ist per se exzessiv, wenn wir mal von den Zeitbedingungen und den theoretisch unbegrenzten Hilfsmitteln ausgehen – oder auch von der idealistischen Zielvorstellung, eine perfekte Schachpartie zu spielen. Wäre man da nicht ein lausiger Fernschachspieler, wenn man nicht alle seine Ressourcen nutzte, um zum Erfolg zu kommen?
Andererseits gilt: Masse macht noch keine Klasse, das rein quantitative Maß der Engine-Nutzung sagt für sich genommen nicht viel aus. Es geht um das Wie der Nutzung und um das Wozu.
GM: Inwiefern hat der verbreitete Gebrauch von Schach-Software das Durchschnittsniveau des Fernschachs verändert?
AN: Die Veränderungen auf dem Durchschnittsniveau sind natürlich dramatisch, vermutlich noch gravierender als an der Fernschachspitze. Spieler, die früher – ohne Computer – einfache taktische Zusammenhänge nicht verstanden oder anfingen merkwürdig zu spielen, wenn ihr Buchwissen erschöpft war, spielen auf einmal mustergültige Partien, die auch ein Anand über weite Strecken kaum besser behandeln könnte. Ihr Pech ist nur, dass viele solcher – ich nenne sie mal: virtuellen – Schachpartien remis ausgehen, weil der Gegner den gleichen Sekundantenstab nutzt. Das kann auf die Dauer natürlich nicht befriedigen, weshalb auch «Durchschnittsspieler» früher oder später die Lust am Risiko wiederentdecken und eigene Wege suchen, vielleicht nicht in jeder Partie, aber doch hier und da, weil sie tief im Innern wissen, dass nur die eigene Leistung wirklich befriedigen kann.
In gewisser Weise hat die Nivellierung des allgemeinen Leistungsniveaus infolge elektronischer Sekundanten, die stärker sind als ihre menschlichen Arbeitgeber, zu einer Leistungsverzerrung geführt, da die natürlichen Unterschiede zwischen den Spielern nicht mehr ungefiltert zur Geltung kommen. Der stärkere Spieler muss sich zunehmend Gedanken machen, wie er vermeiden kann, dass der schwächere entscheidend von Engine-Leistungen profitieren kann – keine leichte, sondern eine höchst delikate Aufgabe. Welche Eröffnungen, welche Strategien soll man wählen, um einen nominell oder potentiell schwächeren Schachspieler zu überspielen? Das ist insbesondere für den Schwarz-Spieler eine ziemlich heikle Sache. Man kann nicht einfach wie im Nahschach die Stellung komplizieren, den Gegner in Zeitnot bringen und dergleichen, man muss tatsächlich schon eine strategische Auseinandersetzung anpeilen und darf den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. In der Tat enden wohl auch viel mehr Fernschachduelle zwischen zum Beispiel 2400ern und 2600ern remis als im Nahschach. Man kann versuchen, mittels Datenbanken ein Dossier seines Gegners zu erstellen, um seine Stärken und Schwächen auszuloten, aber wird dieses auch wirklich aktuell sein und zutreffen? Der Fernschachgegner ist schon aufgrund seiner unbekannten Ressourcen an Hilfsmitteln viel mehr eine «black box» als jeder Nahschachgegner. Das macht aber andererseits auch einen gewissen Reiz aus. Man wird gezwungen, die Messlatte höher zu legen und damit auch die Anforderungen an sich selbst zu erhöhen.
.
Kann man auch ohne Schach-Software noch FS-Großmeister werden?
.
GM: Ist eigentlich für einen ambitionierten FS-Spieler der Gedanke noch realistisch, im internationalen CC-Wettbewerb auch ohne Software Großmeister-Niveau erreichen zu können?
AN: Nein. Da sich das «Großmeister-Niveau» durch Software-Einfluss erheblich gesteigert hat, ist dies auf eine größere Partienzahl bezogen undenkbar. Auch im Fernschach ist niemand in der Lage, ohne Engines auf einem Elo-Durchschnittsniveau von 3000 oder mehr zu spielen. Das aber wäre etwa die geschätzte Leistungssteigerung, die man erhielte, wenn man 10 Fernschach-GMs ohne Engines gegen 10 Fernschach-GMs mit Engines spielen ließe. Nahezu überflüssig, zu erwähnen, dass auch Nahschach-Supergroßmeister ohne Engines, wenn sie es denn versuchten, im Fernschach chancenlos wären. Inzwischen werden ja sogar schon Nahschach-Profis gefragt, ob sie sich eröffnungsmäßig noch ausreichend ohne Computerhilfe vorbereiten können, ob sie sich gar trauen, «Neuerungen» aufs Brett zu bringen, die sie nicht zuvor «gefritzt» haben… Das heißt, der Einfluss der Schach-Software nimmt auch im Nahschach spürbar zu.
GM: Wo haben denn Rybka&Co. ihre grundsätzlichen bzw. strukturellen Schwächen? Im «strategischen» Bereich? Im Endspiel?
AN: Wenn man in Bezug auf Computer von strukturellen Schwächen oder strategischen Defiziten spricht, muss man sich über zwei Dinge im klaren sein:
1. Schachprogramme verfolgen keine «Strategien», sondern sie bewerten aus einer gegebenen Stellung zig Millionen von möglichen Folgestellungen, evaluieren sozusagen, wie das Spiel sich auf diese und jene Züge hin entwickeln und verzweigen könnte. Die Auswahl der am höchsten bewerteten Varianten mag als Simulation von «Strategie» erscheinen, was aber im Grunde eine optische Täuschung ist, denn diese «best move»-Evaluationen ergeben sich rein per Ausschlussverfahren gemessen an den Stellungen, die eben schlechter bewertet werden. Nicht das Programm verfolgt eine «Strategie», sondern der Mensch interpretiert die Programmvorschläge und ordnet sie mit seinem Schachwissen und -verständnis strategischen Kategorien zu, die mehr oder weniger zutreffend sein können.
Häufig ergeben Engine-Evaluationen in fast oder scheinbar gleichstehenden Stellungen ein etwas merkwürdiges Bild. Die Engine zeigt zum Beispiel im 5-Varianten-Modus fünf ziemlich gleich bewertete Varianten an, die aber völlig unterschiedlichen «Strategien» zu folgen scheinen (mal mit Damentausch, mal ohne, mal geschlossen, mal offen, mal agressiv, mal ruhig). Der Laie neigt in solchen Situationen zu dem ergötzlichen Kommentar: «Der weiß ja nicht, was er will!» Und die Pointe ist – der Laie hat Recht, aber er weiß nicht warum und kann daraus keinen Nutzen für sich ziehen! Korrekt wäre als erstes eine Interpretation etwa dergestalt: Das Programm sieht in der gegebenen Rechentiefe (und unter Berücksichtigung diverser Parameter) in den nächsten Zügen keine signifikante Veränderung des Stellungsgleichgewichts. Und nun ist eigentlich erstmal der Mensch gefragt, diesen Befund unter Berücksichtigung seiner eigenen Zugkandidaten zu analysieren. Stimmt der Befund auch dann noch bzw. bleibt es dabei, wenn man tiefer in die Varianten hineingeht? Oft entsteht hier das Problem einer weitläufigen Verzweigung, und da beginnt die eigentliche Fernschacharbeit…
2. Schachprogramme sind in ihren Berechnungen aber auch ohne «Strategie» meistens so genau, dass sie die Versuche von Menschen, strategische Ziele zu verfolgen und diese taktisch durchzusetzen, erstmal durchkreuzen bzw. deutlichen Widerspruch anmelden. Sie finden immer das berühmte «Haar in der Suppe». Menschen stehen daher, sofern sie das selbständige Denken nicht völlig aufgeben wollen, vor einem Bündel komlizierter Fragen, die es durch gründliche Erforschung der Stellung zu beantworten gilt, zum Beispiel:
a) Ist meine «Strategie» wirklich stellungsgemäß oder muss ich sie ändern? Muss ich sie grundlegend ändern oder nur modifizieren?
b) Treffen die Stellungsbewertungen der Engine(s) zu? Welche Aussagekraft haben sie? Sind Bewertungsunterschiede zwischen einzelnen Varianten relevant oder nicht?
c) Ist mein taktisches Vorgehen richtig?
d) Wie gut «versteht» das Schachprogramm die Stellung – wie gut verstehe ich selbst sie?
Das Analysieren mit Computer geschieht in Form eines Dialogverfahrens, gesteuert durch den Anwender, und die Qualität der Ergebnisse hängt sehr stark von der Qualität des Frage- und Antwortspiels ab. Der Mensch muss erkennen, welches sinnvolle und lohnenswerte Fragen sind, und dann die Antworten kritisch bewerten. Dabei ist ein hohes Maß an Objektivität gefordert. Vorurteile und Oberflächlichkeit schlagen letztlich gegen ihn selbst zurück. Die Ergebnisse werden um so besser sein, je gründlicher der Analytiker zunächst einmal versucht, die Stellung zu verstehen, anstatt sich vorschnell auf einen «besten Zug» zu orientieren.
Um nun auf die Frage nach «strukturellen» oder «strategischen» Schwächen von Engines zurückzukommen – das wäre ein großes Thema für sich. Für Programme ist es naturgemäß schwierig, die Bedeutung langfristiger Faktoren angemessen zu bewerten, also zum Beispiel die Auswirkungen einer Bauernstruktur im frühen Mittelspiel für ein Endspiel, das noch in weiter Ferne ist; ähnliches gilt für den Wert der Figuren für einen späeteren Übergang vom Mittelspiel zum Endspiel. Ein anderer Aspekt sind spezielle Stellungs- bzw. Endspieltypen. Man muss sich allerdings vor Verallgemeinerungen hüten. Wenn es auch vielleicht zutrifft, dass zum Beispiel Rybka 4 immer noch gewisse Defizite in der Einschätzung und Behandlung von Turmendspielen oder ungleichen Läuferendspielen aufweist, so heißt dies nicht, dass dies in jeder konkreten Stellung zu Buche schlägt, wie umgekehrt ein anderes Programm, nehmen wir zum Beispiel Shredder 12, das von vielen unter anderem wegen seiner Endspieltechnik geschätzt wird, in bestimmten Fällen auch mal gehörig danebenliegen kann.
In der Fernschachanalyse stößt man oft auf komplexe oder tiefliegende Zusammenhänge, die sich auch mit Engines und trotz großen Zeitaufwandes einer klaren und eindeutigen Durchdringung entziehen – sprich: das Schachspiel bleibt auch mit größtem Computereinsatz in vieler Hinsicht geheimnisvoll.
.
Die Programme als elektronische Sekundaten
.
GM: Worin besteht die Herausforderung an den Turnier-FS-Spieler hinsichtlich des effizienten Umgangs mit moderner Schach-Software?
AN: Bei «Schachsoftware» muss man natürlich unterscheiden zwischen den Engines, der Benutzeroberfläche, den Datenbanken und menschlichen Kommentierungen aller Art, die in die «Software» eingegangen sind. Auch die Hardware bestimmt das praktische Leistungspotential der Software. Generell versucht wohl jeder auf seine Weise, sein technisches Arsenal im Sinne eines Partieerfolges auszuschöpfen, was in Anbetracht der hohen Leistungsdichte eine zunehmend schwierige Aufgabe ist. Es bedarf eines vielfältigen ständigen Experimentierens, um herauszufinden, was «effizient» ist, denn dafür gibt es keinerlei Patentrezept, und die Herausforderung stellt sich mit jeder neuen Partie im Grunde genommen immer wieder neu und immer wieder etwas anders.
Als besonders gelungen erscheinen mir geglückte Versuche, menschliche Ideen mit Hilfe oder auch gegen den zeitweiligen Widerstand von Engines zu verwirklichen. Nehmen wir an, ein Spieler hat eine Opferidee, die ihn nicht loslässt, aber das Schachprogramm zeigt ihm erstmal nur die kalte Schulter. Nach langen Versuchen und Umstellungen findet der Spieler einen Weg, das Opfer doch zu rechtfertigen und die Engine zu «überzeugen», dass dies der einzige aussichtsreiche Gewinnversuch ist – ist das nicht ein äußerst reizvolles Szenario? Lehrreich und wertvoll sind aber auch Beispiele, wo der Mensch seine Stellungs- oder Partieeinschätzung als Ergebnis des Dialoges mit der Engine (seinem elektronischen Sekundanten!) grundlegend revidieren muss – das kann bis hin zu einer Widerlegung von Varianten bzw. Spielplänen gehen, die in der «Theorie» bislang als gesichert galten.
Der Fernschachspieler ist im Unterschied zum Nahschachspieler in viel stärkerem Maße beim Einsatz von Software (insb. Engines) der Wahrheit verpflichtet. Ein Eröffnungsbuch-Autor, der für den Nahschachspieler schreibt, was ja der Regelfall ist, lotet seine Varianten nicht in der Tiefe aus wie ein Fernschachspieler, der dies auf begrenztem Raum sehr wohl tut, wenn er auch nur einen kleinen Ausschnitt des Großen und Ganzen sieht, um das sich der Eröffnungsbuch-Autor kümmern muss. Was der Experte fürs Nahschach empfiehlt oder nicht, muss für den Fernschachbereich, wo bei jedem Zug in die Tiefe analysiert wird, nicht immer gelten und kann sich sogar als ziemlich fragwürdig erweisen, egal welch große Namen hinter den Empfehlungen stehen.
GM: Ist das moderne Fernschach zur reinen Materialschlacht verkommen, oder gibt es technisch-organisatorische Möglichkeiten, es wieder als kreativ-menschliche Leistung zu etablieren?
AN: Das Wort «Materialschlacht» weckt Assoziationen an den Ersten Weltkrieg, wo diese Bezeichnung zum erstenmal als gängiger Begriff aufgetaucht ist. Scheinbar verschwindet der Mensch völlig hinter den von ihm geführten Maschinen bis hin zu der Extremvorstellung, dass es die Maschinen bzw. heute eben die Computer selbst sind, die die Auseinandersetzung führen und entscheiden. Bezogen auf das Schach «hinkt» die Parallele aber in verschiedener Hinsicht: beim Schach wird abwechselnd gezogen und man kann zur Zeit immer nur einen Zug machen. Wenn der Zug erzwungen ist, spielt es keine Rolle, wie schwach oder stark die Maschinerie ist. Wenn der Spieler die Stellung nicht versteht und sich vollkommen der Maschinerie anvertraut, wird er gegen bessere Spieler regelmäßig scheitern, auch wenn diese nur über eine schwächere Ausstattung verfügen. Man kann heute allerdings davon ausgehen, dass zumindest auf Meisterniveau ein einigermaßen ausgeglichenes Niveau an Software- und Computerausstattung besteht, weshalb wirklich der intelligente Umgang mit beidem viel entscheidender geworden ist als die Ausstattung selbst. Die Ungleichgewichte in der Ausstattung, vor allem international gesehen, sind in den letzten Jahren immer geringer und jedenfalls unbedeutender geworden.
Nun mag es wohl Fernschachspieler geben, die ihre Rechner und ihre Software nicht effizient und vor allem nicht selbstkritisch genug einsetzen und dies so wahrnehmen, als hätten sie eine «Materialschlacht» verloren. Doch im Grunde ist dies eine bequeme Ausrede, sie geben die Verantwortung für ihre Züge an die Engines ab, statt gründlicher zu analysieren.
Man muss sich über einige weitere Dinge im klaren sein:
1.) Der Einsatz von Software, insb. von Engines, bedeutet absolut gesehen nicht eine Verringerung des menschlichen Zeit- und Arbeitsaufwandes, sondern dieser ist im Vergleich zu früher eher gleich geblieben. Er ist vermutlich etwas rationeller geworden, was für beide Seiten in einer Fernschachpartie gilt. Wer statt dessen Rechner einsetzt, um schnell und mit möglichst wenig eigenem Einsatz zum Erfolg zu gelangen, wird auf die Dauer nicht allzu weit kommen.
2.) Das moderne Fernschach ist durch einen wissenschaftlich-kreativen Stil geprägt. Diese Kombination ist kennzeichnender denn je. Man mag es bedauern, dass der kühne Gambit- oder Angriffsspieler heute vielleicht weniger auf seine Kosten kommt als früher, aber die Zeit lässt sich nun mal nicht zurückdrehen, so wenig wie sich ein Schachspieler der aufgeklärten Steinitz-Ära ins romantische Zeitalter zurückbeamen konnte.
3.) Um im Fernschach heutzutage zum Erfolg zu kommen, muss man Leistungen und Vorgaben («Eröffnungstheorie») aus dem Nahschachbereich kritischer denn je analysieren. Viele Erfolgsrezepte und -konzepte aus dem Nahschach überzeugen im Fernschach nicht, weil der strenge elektronische Sekundantenstab sich zu Recht unbeeindruckt von ihnen zeigt, nicht zuletzt auch weil Nahschachspieler insgeheim immer ein wenig auf die menschlichen Schwächen ihrer Gegner spekulieren, was aber im Fernschach selten funktioniert.
Wer im Fernschach gegen gute Gegner gewinnen will, muss sich heute meines Erachtens schon in der Eröffnung mehr eigene Gedanken denn je machen, denn der Erkenntnisfortschritt in den Hauptvarianten (das können auch Modevarianten sein, die dabei sind, alte Hauptvarianten zu verdrängen) hat grundsätzlich eine starke Remistendenz. Gute Fernschachspieler folgen nicht einfach blind irgendwelchen aktuellen Eröffnungszügen von Anand, Kramnik oder Carlsen, nur weil diese gewonnen oder remis gehalten haben, sondern loten durchaus viele kritische Stellungen von Vorgängervarianten bis zu einer gewissen Tiefe aus.
Kreativität ist also durchaus sehr gefragt im modernen Fernschach.
Ergänzend sei darauf verwiesen, dass Fernschachspieler, die ihr Hobby ohne Engine-Einfluss genießen wollen, also möglichst traditionell, sich in enginefreien Turnieren zusammenfinden können (und dies ja auch tun), wo man also unter Gleichgesinnten gemäß einem Ehrenkodex spielt. So etwas gibt es unter anderem beim BdF, dem Deutschen Fernschachbund; wie erfolgreich, das entzieht sich meiner Kenntnis. Eine andere Idee, ist die Popularisierung des Fischer-Schachs bzw. Chess960 im Fernschachbereich, die quasi dem «Overkill» im Eröffnungsbereich entgegenwirkt, allerdings die Engines nicht außen vor lässt.
.
Vermisst: Hochkarätige Turniere und FS-Sponsoring
.
GM: Gibt es bei dieser positiven Sicht des modernen Fernschachs denn überhaupt Probleme, die jetzt und in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen bzw. spielen könnten? Wie sehen die Wachstumszahlen im Mitgliederbereich aus?
AN: Letzteres vermag ich nicht genau zu sagen, es hat schon einen gewissen Mitgliederschwund im organisierten Fernschach als Folge der «Computerisierung» gegeben; das hat aber viel mit der Altersstruktur zu tun. Früher gab es viele Ältere im Fernschach, die einfach über mehr Zeit verfügten als Berufstätige oder Schüler/Studenten. Das geht bis hin zum Briefmarken- oder Postkartensammler, der einen ganz anderen Zugang zu seinem Fernschach-Hobby hatte als der ehrgeizige Turnierspieler. Interessanterweise gibt es heute viel mehr Fernschachspieler außerhalb der etablierten Verbände, weil nämlich das Internet unglaublich viele und attraktive Angebote bereithält, die auch genutzt werden. Wenn man die Fernschachserver bzw. -websites, auf denen gespielt wird, mitzählt, könnte man also vielleicht feststellen, dass heute allgemein mehr Fernschach gespielt wird als früher. Es wäre eine verdienstvolle Aufgabe, dies näher statistisch zu untersuchen. Nebenbei bemerkt, gehören ja auch alle diese Freizeit-Fernschachspieler zum Markt für Schachsoftware.
Die neuen alternativen Spielangebote im Internet kommen oft moderner daher als die traditionellen Verbände, die diese Spieler, darunter sicherlich viele junge, gar nicht erst erreichen.
Im Grunde interessiert mich das aber nur am Rande. Wesentlich mehr beschäftigen mich die Probleme im Spitzenfernschach, die ich wie folgt sehe:
1.) Es gibt zu wenig hochkarätige Turniere, wozu ich Turniere ab Kategorie 15 (Eloschnitt über 2600) zähle. Insbesondere sind die Fernschachweltmeisterschaften seit einigen Jahren wegen eines unattraktiven Qualifikationsmodus, der elo-stärkere Spieler von einer Beteiligung abhält, tendenziell unterklassig. Es handelt sich durchschnittlich um Kategorie 13-Turniere (Eloschnitt 2550-2575).
2.) Es gibt zu wenig Sponsoring im Fernschach. Dies ließe sich mit einem aktiveren Erscheinungsbild, insbesondere durch mehr hochkarätige Ereignisse, vermutlich etwas verbessern. Das Fernschach müsste meiner Ansicht nach auch bereiter sein, Quereinsteigern aus dem Nahschachbereich, also zum Beispiel Nahschach-Großmeistern, entsprechende Anreize zu bieten. Deren Bekanntheitsgrad könnte oft werbewirksam fürs Fernschach genutzt werden.
3.) Die Normenanforderungen für Fernschach-Titel waren bis vor kurzem allgemein zu niedrig angesichts der vermehrten Angebote, Normen erreichen zu können. Das hat in den letzten 10 Jahren zu einer Titelinflation geführt. Man ist dabei, dies nun wieder etwas zurückzufahren, aber mit welchem Erfolg muss sich noch zeigen. Rückwirkend geht das natürlich überhaupt nicht. Der Fernschachbund hat leider etwas zu starke Signale mit den Titeln als «Lockmittel» gegeben, – mit dem Ergebnis, dass er nun peinlicherweise hier und da öffentlich gefragt wird, wie es möglich ist, dass Spieler mit einem Nahschach-Niveau von deutlich unter 2000 (teilweise sogar um 1600) reihenweise internationale Titelträger werden, darunter sogar immer mehr Großmeister.
4.) Womit das Fernschach aber tatsächlich beeindrucken kann und muss, sind Partien, also schachliche Leistungen und deren angemessene Aufbereitung in Publikationen. Wie heißt es doch so schön? «An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!» So wäre es beispielsweise wünschenswert, dass die besten und interessantesten Partien von Fernschachspielern, ganz gleich, ob es sich um Titelträger handelt oder nicht, in Gestalt eines Fernschach-Informators regelmäßig vorgestellt würden. Frühere Versuche dieser Art sind als Printmedien nach einigen Jahren leider gescheitert. Es scheint nun an der Zeit, in diese Richtung neue – professionelle – Schritte zu unternehmen und dabei auch die Möglichkeiten des Internets bzw. der Computertechnologie zu nutzen. Ein besonderer Leckerbissen könnte in solchen Veröffentlichungen die Diskussion von konkreten Engine-Ergebnissen und -Anteilen sein, denn die Zeiten, in denen Fernschachspieler verschämt oder aus falscher Eitelkeit solche Aspekte in ihren Analysen und Kommentaren verschwiegen, sollten nun endgültig der Vergangenheit angehören. Der moderne Fernschachmeister hat mehr denn je Anteil an der Erforschung des Schachspiels – das gilt es zu erkennen, anzustreben und zu vermitteln..■
.
Nationale Fernschach-Verbände
Schweizer Fernschach-Vereinigung (SFSV)
Deutscher Fernschach-Bund (BdF)
Fernschach im Österreichischen Schachbund (ÖSB)
.
Internationale Fernschach-Verbände
International Correspondence Chess Federation (ICCF)
Internationaler E-Mail-Schachverbund (IECF)
.
.
.
.
Fernando Pessoa: «Genie und Wahnsinn»
.
«Sei vielfältig wie das Universum»
Günter Nawe
.
 Der Band «Genie und Wahnsinn – Schriften zu einer intellektuellen Biographie» bildet den Abschluss der grandiosen Werkausgabe von Fernando Pessoa (1888 bis 1935) im Zürcher Ammann Verlag. Er fasst annähernd alle Nachlassfragmente zusammen, die von der großen Schlüsselfigur des portugiesischen Modernismus zu Themen wie Genie, Wahnsinn, Degeneration oder Psychopathologie niedergeschrieben worden sind.
Der Band «Genie und Wahnsinn – Schriften zu einer intellektuellen Biographie» bildet den Abschluss der grandiosen Werkausgabe von Fernando Pessoa (1888 bis 1935) im Zürcher Ammann Verlag. Er fasst annähernd alle Nachlassfragmente zusammen, die von der großen Schlüsselfigur des portugiesischen Modernismus zu Themen wie Genie, Wahnsinn, Degeneration oder Psychopathologie niedergeschrieben worden sind.
Der junge Pessoa erweist sich darin als ein beachtlicher Kenner der geistigen Strömungen, die in Europa vor dem Ersten Weltkrieg im Umlauf waren und in der damaligen Zeit die intellektuelle Aufmerksamkeit beherrschten. Genannt seien stellvertretend Siegmund Freud, Max Nordau und Cesare Lombroso. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle so entstandenen Texte Frühschriften sind – aus der Zeit nach der Rückkehr Pessoas aus Afrika.
«Sei vielfältig wie das Universum» galt als Lebensdevise des Fernando Pessoa. Wie sehr er sich daran gehalten hat, zeigt sein Werk, das mit dem «Buch der Unruhe» des kurzsichtigen Hilfsbuchhalters Bernardo Soares, mit den Büchern seiner Heteronyme Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos und António Mora nicht nur diese Vielfalt dokumentiert, sondern zu den ganz großen Werken der Weltliteratur gehört.
Mit dem Band «Genie und Wahnsinn – Schriften zu einer intellektuellen Biographie» liegt also die «definitive, erweiterte Ausgabe der Werke Fernando Pessoas in neuer und überarbeiteter Übersetzung» vor, wie der Verlag zurecht feststellt. Und damit ein sehr schöner Abschluss einer hervorragenden Werkedition, für die der Ammann Verlag nicht genug zu loben ist.
«Verrücktwerden bedeutet, dass man zu leben beginnt». So befasst sich Pessoa im ersten Teil dieses Bandes mit den Gegebenheiten und Varianten von Wahnsinn und Genie, die sich nach seiner Auffassung gegenseitig bedingen. Es sind allerdings keine in sich geschlossenen Abhandlungen, sondern eher fragmentarische Texte. Es ist, wie der Herausgeber und Übersetzer Steffen Dix in seinem vorzüglichen Nachwort ausführt, eine Art der Selbstvergewisserung und der Selbstanalyse, der sich der Autor denkend und schreibend unterzieht. Diese Abhandlungen tragen aber wie auch die anderen Kapitel dieses Buchs dazu bei, das nachfolgende Werk des großen Schriftstellers etwas besser zu verstehen.
Das gilt auch für die literaturwissenschaftlich interessante «Fragestellung Shakespeare-Bacon», sowie die «Abhandlungen» zum Thema «Literatur und Psychiatrie» und «Über Kunst und Künstler». Spannend zu lesen auch die «Auszüge aus einigen Erzählfragmenten».
Damit also sind «wieder neue Masken Pessoas (…) ans Tageslicht befördert» worden. Werden es wirklich die letzten sein? Und was gibt die berühmte «Fundgrube», von der immer wieder einmal gesprochen wird, eventuell noch her? Wir dürfen gespannt sein. ■
Fernando Pessoa, Genie und Wahnsinn – Schriften zu einer intellektuelle Biographie, aus dem Portugiesischen und Englischen von Steffen Dix, Ammann Verlag Zürich, 442 Seiten, ISBN 978–3–250–10456-8
.
.
«Ich werde Verleger bleiben bis an die Bahre»
Interview mit Egon Ammann
.

Verleger Egon Ammann (1993)
Günter Nawe: Herr Ammann, mit dem Band «Genie und Wahnsinn» liegt jetzt – so die Verlagsmitteilung – «die definitive, erweiterte Ausgabe der Werke Fernando Pessoas» vor?
Egon Ammann: «Genie und Wahnsinn» ist ein weiterer Band in der Reihe von Ammanns Ausgabe der Werke von Fernando Pessoa. Die Texte, die in diesem Band versammelt sind, sind tatsächlich auf dem neuesten Stand der portugiesischen Quellentext-Forschung.
GN: Wirklich – oder ist in der berühmten «Truhe» noch etwas zu finden?
EA: Noch ist die Ausgabe nicht abgeschlossen, es fehlen wichtige Pfeiler von Pessoas Werk: Einmal die Gedichte, die er unter seinem Namen Fernando Pessoa geschrieben hat, also Texte, die er keinem seiner Heteronyme zugeordnet hat; eine Auswahl aus diesem orthonymen Pessoa wird in der Übersetzung von Inés Koebel 2013 bei S. Fischer erscheinen. Ein weiterer Band mit eher theoretischen Texten zum Modernismus, inspiriert von Marinetti, wird 2012, übersetzt von Steffen Dix unter den Titel «Sensationismus», der portugiesischen Variante des Modernismus, ebenfalls bei S. Fischer erscheinen.
GN: Diese «Schriften zu einer intellektuellen Biographie» sind so etwas wie «Fingerübungen» des damals noch jungen Pessoa. Welchen Stellenwert haben sie nach Ihrer Meinung innerhalb des Gesamtwerks?
EA: Die Schriften zu einer, wie wir das Buch im Untertitel genannt haben, «Intellektuellen Biographie» Fernando Pessoas sind wichtig, da er sich mit beiden Themata Genie und Wahnsinn, mit Degeneration und Psychopathologie bis zu seinem Lebensende befasst hat, auch wenn die meisten der in diesem Band versammelten Texte aus seiner frühen Schaffenszeit stammen, also um 1907 bis zum Beginn des ersten Weltkriegs. Sie bieten so tatsächlich Einblick in die Seelenstruktur des bedeutenden Portugiesen.
GN: Die Edition der Werke Fernando Pessoas ist so etwas wie ein «Schlusspunkt» in einer großen und erfolgreichen Reihe bedeutender Werkausgaben: Ossip Mandelstam, Antonio Machado, Fjodor Dostojewski und Ismail Kadare. Und damit auch ein «Schlusspunkt» für den Verleger Egon Ammann. Warum?
EA: Sie haben nicht unrecht, dass wir mit Fernando Pessoa so etwas wie einen Schlusspunkt unserer editorischen Arbeit setzen, doch, wie gesagt, es werden noch zwei, drei Bände folgen, nicht mehr mit dem Impressum des Ammann Verlags, aber bei S. Fischer. – Und ein endgültiger Schlusspunkt wird die Ausgabe Pessoas nicht sein. Wir hatten vor zwei, drei Jahren mit zwei wichtigen Werken begonnen, einer Neuübersetzung von Dantes «Göttlicher Komödie» durch Kurt Flasch. Dieses Werk wird 2011 im Herbst bei S. Fischer erscheinen, ich darf es als Verleger begleiten. Und dann ein großer Roman, von seiner literarischen Bedeutung her wie von seinem Umfang, ein Italiener mit Namen Stefano d’Arrigo, hierzulande eher unbekannt, der Titel seines großen Romans «Horcynus Orca», eine moderne Odyssee, wenn Sie so wollen, die während der Landung de Alliierten auf Sizilien spielt. Ein großartiger Meerroman, der zu den großen Romanwerken des vorigen Jahrhunderts zählt. Dieses Werk wird voraussichtlich 2013 ebenfalls bei S. Fischer erscheinen. Und danach dürfte, mit Seiner Hilfe, Schluss sein.

«Ein hervorragendes literarisches Programm» (Zurlauben-Preisverleihung 1993): Über 800 Bücher im mehrfach prämierten Ammann-Verlagsprogramm
GN: Sie haben einmal gesagt: «Ich bin mit Leib und Seele Verleger». Und Sie waren es schließlich dreißig Jahre lang – und sehr erfolgreich. Gilt diese Aussage heute nicht mehr?
EA: Doch, ich bin Verleger und werde Verleger bleiben bis an die Bahre – oder Grube. Das ist und war mein Beruf.
GN: Hat Ihr Rückzug als Verleger etwas mit den Entwicklungen in der Branche zu tun, mit den neuen technischen Gegebenheiten oder auch mit den Veränderungen innerhalb der Literatur?
EA: Der Rückzug, das heißt die Schließung von «Ammann», hat verschiedene Gründe, auf die wir reagiert haben. Einer davon ist die Tatsache, dass wir mit unserer Branche auf der Schwelle einer Revolution stehen. Gutenberg wird nicht abdanken, davon bin ich überzeugt, aber das Geschäft wird andere Wege gehen, sowohl im herstellenden wie im vertreibenden Buchhandel. Das digitale Zeitalter steht ante portas, und dem wollte ich mich nicht mehr stellen. Das sollen die Nachfolgenden, die Jungen bewältigen.
GN: In Ihrem herausragenden Verlagsprogramm gibt es – parallel zu den genannten großen Übersetzungen von Autoren der zeitgenössischen Moderne – eine Vielzahl prominenter Gegenwartsautoren. Ich nenne nur Julia Franck, Thomas Hürlimann, Navid Kermani, Katja Oskamp. Was geschieht mit diesen Autoren und ihren Büchern – und allen anderen rund 800 Titeln – in Zukunft?
EA: Diese Autorinnen und Autoren, die zum Teil bei Ammann debütiert oder bis zuletzt in unserem Haus veröffentlicht haben, haben inzwischen neue Verlagspartner gefunden, worüber wir sehr froh sind. Für einige wenige suchen wir noch Verlage, ich bin zuversichtlich, dass wir auch für sie früher oder später neue Heimaten finden werden. Es sind durchweg ernstzunehmende, gute Schriftsteller und Dichter, die werden ihren Weg gehen.
GN: Sie sind eine herausragende Persönlichkeit, nicht nur als Verleger. Sie haben ein Stück weit mit Ihrem Verlag die literarische Landschaft geprägt. Was macht Egon Ammann vor diesem Hintergrund in Zukunft? Bleiben Sie auf die eine und andere Weise der Literatur erhalten?
EA: Wie ich schon ausgeführt habe, werde ich die Werkausgabe von Pessoa weiterhin begleiten, auch den Dante und den d’Arrigo, aber dann werde ich das Alter erreicht haben, wo ich mich mit mir und meinem Abtreten beschäftigen muss. Auch das wird Arbeit sein. – Ein Kollege von mir, Friedrich Witz, der Begründer des Artemis Verlags, hat seine Biographie mit dem vielsagenden Titel «Ich wurde gelebt» überschrieben. Ganz so ist es bei mir nicht gewesen, ich konnte und habe gestaltet, ich habe gedient, ja, und dann kommt die stille Besinnung auf das, was gewesen ist, die Rechenschaft, das Beschäftigen mit dem Abgang. Eine Biographie jedoch wird es nicht geben, so wichtig ist die nicht und bin ich nicht. ■
.Links: Ein anarchistischer Bankier – Go Lisbon
.
Politik und Schach in der Ex-DDR (Interview)
.
«Nur eine Minderheit wusste vom Leistungssportbeschluss»
Interview mit dem DDR-Schach-Historiker Manuel Friedel
Thomas Binder
.
 Ende letzten Jahres publizierte der junge Historiker Manuel Friedel eine Bachelor-Arbeit an der Technischen Universität Chemnitz mit dem Titel «Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports» (das «Glarean Magazin» berichtete darüber). «Die Geschichte des Schachsports in der DDR ist nahezu komplett unerforscht», stellte dabei Friedel in dieser seiner Untersuchung fest, die für wichtige Teilbereiche einige wissenschaftliche Grundsteine für zukünftige Forschungsarbeit legte.
Ende letzten Jahres publizierte der junge Historiker Manuel Friedel eine Bachelor-Arbeit an der Technischen Universität Chemnitz mit dem Titel «Sport und Politik in der DDR am Beispiel des Schachsports» (das «Glarean Magazin» berichtete darüber). «Die Geschichte des Schachsports in der DDR ist nahezu komplett unerforscht», stellte dabei Friedel in dieser seiner Untersuchung fest, die für wichtige Teilbereiche einige wissenschaftliche Grundsteine für zukünftige Forschungsarbeit legte.
Um die Thematik etwas zu vertiefen, hat «Glarean»-Mitarbeiter Thomas Binder dem jungen DDR-Forscher ein paar Fragen zu seinem Buch und dessen Ergebnissen gestellt. –
.
Glarean Magazin: Herr Friedel, welchen Bezug haben Sie persönlich zum Schachspiel?
Manuel Friedel: Ich selbst bin ein Amateurschachspieler mit rund 1800 DWZ und spielte einige Jahre für den ESV Nickelhütte Aue in der Bezirksliga. Seit 2002 spiele ich allerdings nicht mehr im Verein, sondern nur noch gelegentlich einige Internetpartien. Ich verfolge aber nach wie vor gespannt das internationale Schachgeschehen. Ich habe mich auch schon immer für die Geschichte des Schachspiels interessiert.

Grundlagenforschung in Sachen DDR-Schach: Manuel Friedels Bachelor-Arbeit «Sport und Politik in der DDR»
GM: Wie kamen Sie eigentlich auf das Thema Ihrer Bachelor-Arbeit?
MF: Es kamen wohl mehrere Faktoren zusammen. Zum einen interessiere ich mich besonders für die Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, worauf ich auch meinen Studienschwerpunkt gelegt habe, und zum anderen interessiert mich, wie ich bereits erwähnt habe, die Geschichte des Schachspiels. Da kam mir irgendwann die Idee, meine Abschlussarbeit zum DDR-Schach zu schreiben.
Bei meinen ersten Recherchen zum DDR-Schach habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass es noch kein Buch zu diesem Thema gab. Das sah ich als Herausforderung an, weil ich «Pionierarbeit» leisten musste und mich auf keine Sekundärliteratur stützen konnte. Ich habe dann mit meinen beiden Dozenten, Prof. Kroll und Dr. Thoß gesprochen, ob sie die Arbeit betreuen würden. Sie stimmten beide sofort zu, worüber ich sehr froh war.
Allerdings bereitete mir der Mangel an Quellen einige Bauchschmerzen, weshalb ich zwischendurch überlegte, das Projekt abzubrechen. Aber meine Freunde haben mir immer wieder Mut gemacht, die Arbeit zu Ende zu führen.
GM: War es schwer, für dieses Thema offene Ohren an der Universität zu finden, oder stießen Sie auf Verständnis?
MF: Wie erwähnt willigten beide Dozenten sofort ein. Mir kam auch der Umstand zugute, dass Dr. Thoß sich sehr für die DDR und deren Sportgeschichte der Neuzeit interessiert. Er konnte mir deshalb auch sehr wertvolle Hinweise zu der Arbeit geben.
GM: Welche Quellen konnten Sie erschließen? Manches war ja wohl bisher nicht veröffentlicht?

Propaganda-Träger der sozialistischen Schach-Politik: Die ab 1953 einzige in der DDR herausgegebene Schachzeitschrift «Schach»
MF:Ich habe mir einige Akten des Bundesarchives in Berlin-Lichterfelde angesehen. Allerdings konnte ich nicht sonderlich viele neue Erkenntnisse gewinnen. Ich hatte mir von dem Archivbesuch mehr erhofft.
Ich habe mir dazu sämtliche Ausgaben der Zeitschrift «Schach» bis 1990 angesehen und einige Artikel aus dem «Neuen Deutschland» und noch ein paar kurze Artikel aus anderen Zeitschriften. Weiterhin führte ich zwei Zeitzeugen-Interviews mit GM Knaak und GM Uhlmann, die auch sehr hilfreich waren. Im Internet fand ich außerdem zwei Interviews mit Ernst Bönsch und Paul Werner Wagner, die ich ebenfalls mit in die Arbeit einfließen ließ. In einigen Büchern gab es hier und dort einen Absatz zum Schach in der DDR, aber es gab eben noch kein Überblickswerk zum DDR-Schach.
Meine Arbeit war deswegen wie ein Puzzle, weil es galt, viele kleine Bausteine zusammenzusetzen, um einen groben Überblick zu gewinnen.
GM: Sie fanden Kontakt zu wichtigen Zeitzeugen, die Hintergrundinformationen geben konnten ?
MF: Ja, die Interviews mit GM Uhlmann und GM Knaak gaben mir viele Hintergrundinformationen, ebenso die Interviews im Internet mit Paul Werner Wagner und Ernst Bönsch. Allerdings stellte sich schnell heraus und war auch nicht anders zu erwarten, dass diese vier Zeitzeugen einige widersprüchliche Auskünfte gaben; schließlich sind alle vier subjektiv durch ihre persönlichen Erfahrungen geprägt. Wie heißt es so schön: «Der Zeitzeuge ist der Feind des Historikers». Es galt also diese Aussagen zu hinterfragen und zu gewichten. Ähnlich subjektiv gefärbt war natürlich die Autobiografie von Manfred Ewald; Autobiografien neigen immer dazu, dass eigene Handeln im Nachhinein zu rechtfertigen und in ein besseres Licht zu rücken.

Vom Stasi-Häftling zum Präsidenten der Emanuel-Lasker-Gesellschaft: Kulturmanager und DDR-Schach-Zeitzeuge Paul Werner Wagner
GM: Woran liegt es wohl, dass es bislang keine umfassende Darstellung des DDR-Schachs gibt?
MF: Ich habe mich auch gefragt, warum zu diesem interessanten Thema noch keiner etwas geschrieben hat. Eine Antwort auf diese Frage weiß ich leider auch nicht.
GM: Gab es bisher erwähnenswertes Feedback auf Ihre Arbeit von Spielern oder Funktionären aus der Zeit des DDR-Schachs?
MF: Nein, bisher nicht.
GM: Ich wurde in letzter Zeit oft mit dem Gedanken konfrontiert, wonach das Schach in der DDR in hohem Ansehen gestanden haben müsste, weil es in der Sowjetunion hohe Achtung genoß. Haben Sie dieses Vorurteil auch erfahren?
MF: Ja – aber die DDR-Sportsführung hatte kein besonderes Interesse am Schach. Sie verteidigten sich immer wieder mit dem Argument, dass sie das Schachspiel bereits genug fördern würden, und dass nicht noch mehr Geld für diesen Sport – sofern er als Sport gesehen wurde – vorhanden wäre.
Ich habe vor wenigen Tagen (also erst nach dem Erscheinen meines Buches) ein neues Dokument (datiert vom 10.April 1987) aus dem Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde («Finanzielle Handlungsspielräume – Konsequenzen einer Gleichstellung des sogenannten ‘Sport II’ mit den besonders geförderten Sportarten») gefunden, in dem es u.a. heißt:
«Nicht zugestimmt werden kann […] der These, dass bei der Popularisierung des Schachsports durch die Massenmedien unzureichende Beiträge geleistet werden. Wie keine zweite Sportart in der DDR ist das Schach Gegenstand von Beiträgen im ND, in den Organen der Bezirksleitungen der SED, in der ‘Jungen Welt’, im ‘Sportecho’ und anderen Tageszeitungen […] Auch das Fernsehen und der Rundfunk leisten unter Beachtung der Spezifik der Darstellung dieser Sportart eine verantwortungsbewußte Arbeit […] Die DDR ist das Land, in dem die reichhaltigste Schachliteratur in der Welt produziert und der Bevölkerung angeboten wird»…
GM: Zentraler Punkt beim Rückblick auf 40 Jahre Schach in der DDR bleibt der unselige ‘Leistungssportbeschluss‘. Stimmt es eigentlich, dass diesen bisher niemand als Dokument gesehen hat, er nur mündlich vermittelt wurde?
MF: Wie ich leider erst nach Publikation meiner Arbeit herausgefunden habe, kann man den Beschluss, der auf das Jahr 1969 zurückgeht, in einigen Quellenpublikationen mittlerweile ansehen.
GM: Haben Sie bei Ihren Recherchen Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es unter den führenden Schachspielern der DDR Versuche des Widerstands gegen diesen Beschluss gegeben hat?
MF: Es gab insgesamt genügend Widerstand gegen diesen Beschluss. Aber in wie weit die DDR-Spitzenspieler Widerstand leisteten oder überhaupt leisten konnten, kann ich (noch) nicht genau sagen. Es gab auf alle Fälle aus dem Ausland genügend Versuche, die DDR in das internationale Schachgeschehen wieder zu integrieren.
GM: Im Rückblick überlagert die «Diskriminierung» der Schachspieler nach 1972 das Bild deutlich. Umgekehrt erscheinen die frühen Jahre als eine Blütezeit des DDR-Schachs auch im Spitzenbereich – mit der Olympiade in Leipzig 1960 als Höhepunkt. Hat also der Leistungssportbeschluss nicht nur die Wettkampfchancen der Spitzenspieler, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung völlig verändert?
MF: Nur eine Minderheit wusste von diesem Beschluss; er wurde schließlich nur mündlich verbreitet. GM Knaak sagte mir, dass er immer wieder gefragt wurde, warum denn die DDR nicht an der Olympiade teilnahm. Die Leute dachten, so sagte er mir, dass die DDR zu schlecht sei, um an dieser Olympiade teilzunehmen, obwohl man sich nicht für die Olympiade qualifizieren musste. Die Verwunderung über die Absenz der DDR war also schon da. Die Zeitschrift «Schach» hat versucht, um dieses Problem herumzuschreiben. Man kann also schon sagen, dass das Image des DDR-Schachs unter diesem Beschluss gelitten hat.
GM: Da sich Ihr Buch im Rahmen einer Bachelor-Arbeit in Umfang und Form an einigen Stellen beschränken musste, bleibt die Frage, ob das gesammelte Material vielleicht die Grundlage einer weiterführenden Darstellung sein könnte?
MF: Ich werde dieses Thema auf alle Fälle weiterverfolgen. Gerade was den «Leistunssportbeschluss» angeht, habe ich seit dem Erscheinen des Buches einige neue Erkenntnisse hinzugewonnen, auch wenn einiges noch im Dunkeln liegt und vielleicht auch liegen bleiben wird.
An der einen oder anderen Stelle kann man das Buch mit Sicherheit auch noch vertiefen. Wenn ich genügend neues Quellenmaterial gesammelt und ausgewertet habe, werde ich evtl. eine neue Auflage des Buches anstreben. ■
Weiterführende Links: Politisierung des DDR-Spitzensports
.
.
.
.
Interview mit dem Rybka-Programmierer Vasik Rajlich
.
Rybka 4 kommt mit neuer Suche, neuer Bewertung
und neuen Analyse-Funktionen
Dr. Peter Martan
.
we/Die Welt des Computerschachs hat schon seit langem ein allmächtiges Triumvirat, das da heißt: Rybka, Shredder, Fritz. Und für gewöhnlich pflegt dieses omnipräsente (und -potente) Trio alljährlich so gegen den Spätherbst hin mit neuen Versionen auf sich aufmerksam zu machen – das Weihnachtsgeschäft lässt grüßen.
Vor kurzem erschien nun bereits Fritz 12 (siehe hier), seit einigen Tagen ist auch Shredder 12 auf dem Markt (wir haben darüber berichtet) – doch wo bleibt Rybka 4 ?
Wo ist der absolute Generalissimus der Szene – jenes kleine blaue «Fischchen», das als gefräßiger Killer-Hai hinsichtlich Spielstärke jedes Engine-Turnier so dominant beherrscht wie kaum ein anderes Programm in der bisherigen Computerschach-Geschichte?
Das «Glarean Magazin» hielt die Spannung vor dem neuen Release nicht mehr länger aus, und Peter Martan gelangte mit ein paar ungeduldigen Fragen an den Rybka-Erfinder und -Chefdenker Vasik Rajlich.
Glarean Magazin: Was ist Ihre zurzeit wichtigste Arbeit an Rybka?
Vasik Rajlich: Ich befinde mich gerade im «Release-Modus»; da gibt es eine Menge kleinerer Dinge zu tun.
GM: Welche Innovationen können wir von Rybka 4 erwarten?
VR: Die Evaluation und die Suche sind neu gestaltet, beides habe ich letztes Jahr mehrfach geändert. Es werden zudem ein paar neue Analyse-Funktionen hinzukommen.
GM: Wann etwa dürfen wir Rybka 4 erwarten?
VR: Das ist noch offen…
GM: Wird es in der gleichen Weise verkauft bzw. vertrieben wie bisher?
VR: Ja, Convekta und ChessBase werden wieder die publizierenden Firmen sein.
GM: Gab es im Entwickler-Team etwelche Veränderungen?
VR: Die eigentliche Entwicklungsarbeit wird immer noch ausschließlich von mir gemacht. Aber wir haben ein tolles Team: Lukas Cimiotti hat beim «Clustering» sehr viel beigetragen, ebenso auch in Sachen Turnier-Vorbereitungen, und seine Mitarbeit im vergangenen Jahr war enorm. Unser «Book»-Team hat sich ein wenig verändert, wir haben nun zusätzlich Jiri Dufek ins Team geholt, aber Jeroen Noomen bleibt nach wie vor dabei. Nicht unerwähnt lassen will ich Felix Kling und seinen Bruder Christoph, welche für unsere Website verantwortlich sind. Weiters sind da noch Hans van der Zijden, der als PC-Operator auf Computer-Turnieren fungiert, meine Frau Iweta als die Verantwortliche für die Tests, Larry Kaufman für die Leitung der Mensch-vs-Maschine-Matches sowie der ganzen Parameter-Tunings, und schließlich Nick Carlin, der ebenfalls bei den «Book»-Arbeiten und Turnier-Vorbereitungen beteiligt ist.
GM: Wird es – früher oder später – eine öffentliche Cluster-Version von Rybka geben?
VR: Nein, jedenfalls nicht als Bestandteil der kommenden Rybka-4-Version. Aber wir haben Pläne, dies zusätzlich für den spezifischen Einsatz in Turnieren weiter zu entwickeln. Es wird gegenüber dem Bisherigen kleine Unterschiede geben, aber lassen Sie sich überraschen…
GM: Bereits im Rybka-Forum wurde mal danach gefragt, ob eine automatische «Backward Analysis» («Rückwärtsanalyse») im Multi-Varianten-Modus implentiert werden könnte, worauf geantwortet wurde, dass dies eine Frage des Interfaces, nicht der Engine sei. Aber würden Sie es als nützlich unterstützen, so etwas auch optional sogar im «normalen» Spiel-Modus, zumal für Cluster-Versionen, möglich zu machen?
VR: Der Output einer Cluster-Version ist ein schwieriges Thema, das noch einiges Nachdenken erfordert. Grundsätzlich könnte der «Cluster» sicher eine Art von Multi-PV-Analyse liefern, auch in seinem «Play»-Modus. Bisher haben wir aber überhaupt Cluster-Technik nur für Turniere angewandt, so dass dieses «Problem» noch nicht gelöst wurde.
GM: Wird Rybka 4 einen spezifischen «Finde-Gewinn-»Modus haben bzw. wird wieder eine zusätzliche «Winfinder»-Engine mitgeliefert?
VR: Die Entwicklung besonders «interessanter» Derivate (einschließlich «WinFinder»-Versionen) ist auf meiner To-Do-Liste, aber zurzeit noch nicht in Angriff genommen, ebenso wenig wie ein spezieller «Win-Finder»-Modus. Fest steht aber, dass Rybka 4 auch taktisch viel stärker als jetzt Rybka 3 sein wird.
GM: Wird die neue Engine auch die Option enthalten, den sog. «Nullmove» ein- oder ausschalten zu können?
VR: Dieses Feature ist wohl nicht so wichtig, dass es in die Parameter-Liste der Engine integriert werden müsste.
GM: Haben Sie schon News betreffend «Shared Analysis» und «Persistent Hash»?
VR: Noch nicht, bisher sind diesbezüglich nur ein paar Bugfixes zu melden. Das sind aber weitere Themen, die wohl noch eine ganze Menge Arbeit machen werden… ■
.
___________________________________
.
Interview in english:
GM: What is your main work to be done with Rybka right now?
VR: Right now I am in «release mode», there are a ton of little things to do now.
GM: What innovations may we expect from Rybka 4?
VR: The eval and search are revamped, I changed it completely three times last year. There will also be a few new analysis features.
GM: When approximately may we expect Rybka 4?
VR: This is still TBD.
GM: Will it be sold and distributed in the same ways as formerly?
VR: Yes, Convekta and ChessBase will be the publishers.
GM: Has there been any change in the team of developers?
VR: The development work is still done only by me, but we have a great team. Lukas Cimiotti has helped tremendously with the clustering and with tournament preparations, his contribution over the past year has been enormous. Our book team has changed a bit, we have added Jiri Dufek, while Jeroen Noomen remains involved. We will give more details later. I also should mention Felix Kling and his brother Christoph for their work on our web site, Hans van der Zijden as the Rybka operator, my wife Iweta for testing, Larry Kaufman for man-vs-machine matches and parameter tuning, and Nick Carlin for book work and tournament preparations.
GM: Will we have a public Rybka cluster-version sooner or later?
VR: This won’t be a part of the Rybka 4 release, but we do have plans for this in addition to competing in tournaments. It will be something a little different, you’ll have to stay tuned.
GM: Maybe you remember me asking you once at Rybka forum about multi-variant-mode of analysis. My special wish of automatic backward analysis in mv- mode was answered by you then as a matter of GUI, which it is, of course. But would you support it as useful, even sometimes in normal game mode, especially as for cluster version?
VR: Can you say what you mean by “backward analysis”?
GM: I just meant the feature of some GUIs to step back automatically in the game analyzed.
VR: The output of our cluster is a tricky issue which needs some thinking. Outputting a single PV is a poor fit to how the cluster searches. In principle, the cluster could provide a sort of multi-pv analysis even in its more efficient “game-play” mode. So far we have only used the cluster for competitions, so this issue has not been resolved.
GM: Will the “find win” mode be new too in Rybka 4 or will even a new WinFinder come up again?
VR: Making more interesting versions (including some WinFinders) is on my to-do list, but I haven’t touched it since Rybka 3. Ditto for “find win” mode – it could be improved, but so far hasn’t been. Rybka herself is much stronger tactically now than Rybka 3.
GM: Or do you think nullmove to be switched off as an option of the engine would also be a feature worth adding?
VR: This feature probably doesn’t have enough value to add to the parameter list.
GM: Any news to be expected as for shared analysis and persistent hash?
VR: Not yet, so far there are only some bug fixes. This is another topic which will eventually get a lot of work.
.
.
.
.
Interview mit dem Schach-Programmierer Stefan Meyer-Kahlen
.
Computerschach: «Wir stehen erst am Anfang des Weges»
Dr. Peter Martan
.
Viermaliger Weltmeister bei den Mikro-Schachcomputern, zwei Mal Sieger einer Computerschach-Weltmeisterschaft, fünf Mal Gewinner der Computer-Blitzschach-WM, und Erster bei der Chess960-WM in Mainz – dies der eindrückliche Palmarès des deutschen Schachprogrammes Shredder seit dem Jahre 1996. Vater dieser erfolgreichen Schach-Engine, welche im Kreise der Computerschach-Experten einen seit langem hervorragenden Ruf genießt, ist der Düsseldorfer Software-Entwickler Stefan Meyer-Kahlen.

Stefan Meyer-Kahlen wurde 1968 in Düsseldorf geboren, studierte Informatik in Passau und ist seit 1996 hauptberuflich Programmierer. Er ist verheiratet und hat drei Töchter.
In einigen Wochen will der bekannte Profi-Programmierer, der seit 1993 an Shredder arbeitet, die zwölfte Version seines Programmes veröffentlichen. Aus diesem Anlass stellte ihm der Wiener Computerschach-Kenner Dr. Peter Martan im Auftrag des «Glarean Magazins» einige Fragen zum Stand der aktuellen Shredder-Dinge, aber auch zur Zukunft überhaupt der Schachprogrammierung.
Glarean Magazin: An der kürzlich beendeten Computer-Schach-Weltmeisterschaft in Pamplona hat Ihr Shredder-12-Prototyp den Titel zwar in allen drei Bewerben knapp verfehlt, aber nur die seit längerem absolute Nummer Eins im Computerschach, die Engine Rybka, war noch erfolgreicher. Wann darf man Shredder 12 erwarten, und wird er auch in den einschlägigen Ranglisten wieder härtester Konkurrent von Rybka werden?
Stefan Meyer-Kahlen: Shredder-12 erscheint Ende Juli. Die neue Engine ist deutlich verbessert und wird in den diversen Ranglisten sicher einen großen Sprung nach vorne machen. Meines Erachtens aber mindestens genauso wichtig am neuen Shredder 12 sind die Elostufen, bei denen man die Spielstärke in Elo einstellen kann, mit der Shredder spielen soll. Das hat im alten Shredder schon ganz gut geklappt, aber ich habe hier sehr viel Arbeit investiert und denke, dass es nun noch viel besser funktioniert. Shredder macht nun auch die typischen Fehler, die ein menschlicher Spieler mit der eingestellten Spielstärke macht. Shredder berechnet nun auch die Spielstärke des Benutzers besser und passt sich auf Wunsch automatisch an diese Spielstärke an. Das ist für den normalen Nutzer sicher sehr viel wichtiger als die letzten paar Elos.
Pamplona lief für Shredder wirklich nicht so schlecht, aber ich würde natürlich gerne auch mal wieder eine WM gewinnen. Ich gebe nicht auf und werde es beim nächsten Mal wieder probieren. Mit den Partien von Shredder in Pamplona bin ich aber sehr zufrieden.
GM: In den Anfangszeiten des Computerschachs war es unmöglich, Schach-Engines unterschiedlichster Plattformen automatisiert gegeneinander spielen zu lassen – bis Sie damals das sog. UCI-Protokoll vorstellten, welches inzwischen von fast jedem namhaften Schachprogramm unterstützt wird und damit zum Standard avancierte. Wie sehen Sie in der Erinnerung und in der Zukunft die UCI-Geschichte?

Wird der neue Shredder dem amtierenden Weltmeister Rybka (links: Programmierer Vas Rajlich) die Stirn bieten können?- Hier eine Partie von der WM 2009 (Weiß: Rybka – Schwarz: Shredder-X): 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 Bb4 5. Bg5 Nbd7 6. cxd5 exd5 7. e3 c5 8. Bd3 Qa5 9. Qc2 c4 10. Bf5 O-O 11. O-O Re8 12. Nd2 g6 13. Bh3 Bxc3 14. Qxc3 Qxc3 15. bxc3 Kg7 16. Rfb1 b6 17. g3 h6 18. Bf4 g5 19. Bd6 Nf8 20. Bg2 Ng6 21. a4 Bd7 22. Bb4 Bf5 23. Rb2 h5 24. a5 b5 25. a6 h4 26. Nb1 Bd7 27. Ra5 h3 28. Bf3 Ne7 29. Bd6 Rac8 30. Kf1 Kg6 31. Na3 Nc6 32. Raxb5 Re6 33. Bc5 Nd8 34. Rb8 Rxa6 35. Rxc8 Bxc8 36. Rb8 Bg4 37. Bxg4 Nc6 38. Rh8 Nxg4 39. Rxh3 Nd8 40. Be7 Ne6 41. Rh8 Nf6 42. Rb8 Ne4 43. f3 Nxc3 44. Ke1 f5 45. Kd2 Na4 46. Nc2 Rb6 47. Rxb6 Nxb6 48. Bc5 Kf6 49. Bxb6 axb6 50. Kc3 Ke7 51. e4 fxe4 52. fxe4 dxe4 53. d5 Ng7 54. Kxc4 Nf5 55. g4 Nh4 56. Kd4 Nf3+ 57. Kxe4 Nxh2 unentschieden
MK: Die erste Version für Chessbase war 5.32, ein Mittelding zwischen 5 und 6, welche Version die erste mit UCI war, weiß ich gar nicht mehr so genau, ich denke 4 oder 5. Ohne Rudolf Huber, mit dem ich UCI ja zusammen «erfunden» habe, und mich hier zu sehr selbst zu loben, denke ich schon, dass UCI eine sinnvolle Sache war, die das Computerschach weiter gebracht hat. Wir hatten damals allerdings keine Visionen oder langfristige Pläne für UCI, wir waren nur mit dem existierenden Standard Winboard sehr unzufrieden und waren der Meinung, dass es Zeit für etwas Neues, viel Besseres sei. Da ich in Shredder ja die GUI und die Engine selber programmiere, hab ich es dann direkt in beides eingebaut und so eine Art Referenz-Implementierung geschaffen.
Dass sich UCI durchgesetzt hat und so erfolgreich ist, freut mich natürlich schon. Die Entwicklung von UCI ist noch nicht am Ende. Wir haben es ja damals extra so angelegt, dass man es ohne Probleme erweitern kann und dabei immer noch kompatibel zu älteren Engines oder GUIs ist.
GM: Prof. Ingo Althöfers Idee vom «Dreihirn» hat Shredder als eines der interessantesten Features seiner GUI aufgegriffen. Ist eine Art Triple Brain ein Ansatz, die alte Frage nach Strategie und Taktik zu beantworten? Eine Engine, die hochselektiv in die Tiefe und eine zweite, die an der Basis des Suchbaumes sozusagen mehr in die Breite rechnet, von einer «Master Engine» oder wahlweise auch dem Bediener kontrolliert in der Entscheidung, was in der entsprechenden Stellung wesentlicher für die Bewertung ist?
MK: In der Schachprogrammierung gibt es wie in fast allen Bereichen Trends. Zurzeit ist der Trend, dass man sehr selektiv rechnet und aggressiv pruned. Das wird auch in der parallelen Version so gemacht. Sicher gibt es aber einige, die diesem Trend mehr und andere, die diesem Trend weniger folgen.
Cluster kommen so langsam in Mode und es ist richtig, dass man da andere Sachen machen kann, als in der normalen Version. Ob man dort aber weniger selektiv rechnen soll oder nicht ist unklar. Eine Möglichkeit, auf einem Cluster zu rechnen, ist sicher eine Art 3-Hirn oder aber ein Mehrhirn. Man kann auch mehrere Programme oder ein Programm mit unterschiedlichen Einstellungen an verschiedenen Stellungen rechnen lassen. Wenn man viele Prozessoren hat ist es schwer, ein klassisches Schachprogramm darauf effektiv laufen zu lassen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem sich mehrere Prozessoren nicht mehr lohnen, dann muss man nach anderen Wegen suchen, die vorhandene Rechenpower zu nutzen. Hier ist sicher viel möglich und wir stehen erst am Anfang des Weges.

Aufgrund seiner teils exklusiven Features sowie seiner Stabilität sehr geschätzt: Das Interface von Shredder 11
GM: Eine weitere Neuerung kam ab Shredder 10 mit den «Shredder-Bases». Darin werden zu den gespeicherten Endspielstellungen nicht wie in den «Nalimov- Datenbanken» Zugzahlen zum Gewinn oder Remis gespeichert, sondern nur Bewertungen. Das macht den Zugriff während der Partie schneller und bei kurzen Bedenkzeiten besser nutzbar. Wird es die kompletten 6- Steiner, die es von Nalimov gibt, als Shredderbases geben und was kann man sich davon für den Partie-Erfolg erwarten?
MK: Ja, es wird die kompletten 6-Steiner als Shredderbases geben. Wir haben eine Beta-Version sogar schon fertig, die für alle 6-Steiner ca. 40 GB braucht. Leider gab es noch kleinere Probleme, und anderer Projekte hatten Priorität, so dass wir die 6-Steiner etwas zurückgestellt haben, sie werden aber bald definitiv kommen.
Was das alles an Spielstärke bringt, ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt hatte ich schon erwartet, dass die 5-Steiner als Shredderbases mehr bringen. Man hat dort schließlich sehr schnellen Zugriff auf den perfekten Wert für alle Stellungen mit 5 oder weniger Figuren.
Meine Einstellung zurzeit ist, dass die Endspiel-Datenbanken für das praktische Spiel sicher nicht schaden, und irgendwann wird es sicher was bringen. Wenn die 6-Steiner nicht helfen, dann vielleicht die 7-Steiner. Wenn die nicht, dann die 8-Steiner… Spätestens bei 32 ist Schluss, und die bringen garantiert was…
GM: Wie weit wird die Computertechnik und die Wissenschaft in nächster Zeit fortschreiten bezüglich der Berechenbarkeit des Schachspiels?

Im Mai 1997 schlug die Super-Machine Deep Blue den amtierenden Weltmeister, das russische Schach-Genie Garry Kasparow, in einem Match mit 3,5:2,5. Seitdem ist der Computer in ständigem Vormarsch, und inzwischen haben (auch gegen simple PC-Software) nur noch wenige Spitzen-Großmeister eine Chance.
MK: Das Schachspiel wird in absehbarer Zeit sicher nicht gelöst werden, dafür ist es einfach zu komplex. Es wurde schon oft vorhergesagt, dass die Engines irgend wann nicht mehr weiter kommen, oder dass dem Schachspiel der Remistod droht. Wenn man sich die letzten zwei, drei Jahre anschaut, dann geht es so schnell voran wie schon lange nicht mehr. Dabei wurden die Programme nicht nur besser, weil die Rechner viel schneller und massiver parallel wurden, sondern auch die Algorithmen wurden ganz eindeutig verbessert. Wenn man sich die auch noch vorhandenen klaren Schwächen der Programme ansieht, dann wird auch klar, dass es noch sehr viel Raum für weitere Verbesserungen gibt.
Ich bin also sehr zuversichtlich, dass es mit dem Computerschach noch eine ganze Weile voran geht.
GM: Wohin geht die «Artificial Intelligence» Ihrer Meinung nach überhaupt, was sind die Speerspitzen heute, nachdem im Schach kaum ein menschlicher Spieler unter üblichen Turnierbedingungen gegen die Maschine mehr echte Gewinnchancen hat? Und wird Shredder sprachgesteuert werden (wie z.B. beim IBM-Projekt Jeopardy), völlig ohne Brettansicht, ohne Tastatur und Maus bedienbar?
MK: Mit KI oder künstlicher Intelligenz ist es so eine Sache. Wenn man sich anschaut, auf welche Art Programme Schach und Dame spielen, dann ist das sicher nicht intelligent. Wenn man sich nur das Ergebnis anschaut, also dass z.B. ein Schachprogramm stärker als alle Menschen Schach spielen kann, dann hat das sicher etwas von Intelligenz. Es ist also eine Frage der Definition.
 Bei Ankündigungen von großen Firmen muss man immer aufpassen, nicht auf Marketing-Aktionen reinzufallen. Gerade bei IBM hab ich noch gut im Kopf, was Deep Blue alles Gutes für die Menschheit tun sollte, nachdem er das Schach drangegeben hat. Eine Maschine, die Jeopardy spielt, wäre aber sicher nicht schlecht.
Bei Ankündigungen von großen Firmen muss man immer aufpassen, nicht auf Marketing-Aktionen reinzufallen. Gerade bei IBM hab ich noch gut im Kopf, was Deep Blue alles Gutes für die Menschheit tun sollte, nachdem er das Schach drangegeben hat. Eine Maschine, die Jeopardy spielt, wäre aber sicher nicht schlecht.
Ein Shredder, der nur mit Sprachsteuerung gesteuert wird, ist heute schon möglich. Für ein Schachprogramm gibt es ja nicht so viele Sachen, die es verstehen muss. ■
.
.
.
.
Themenverwandte Links
Mythos Maschinenbeherrschung – Thinking Machine – Schach in den USA – Schachcomputer – 3 D Schach – Computer schlägt Go-Profi – Chip-Blog – Schwatt und Weiß
Polit-Krimi von Thomas Brändle: «Das Geheimnis von Montreux»
.
Tödliche Schweizer Politik
Walter Eigenmann
.
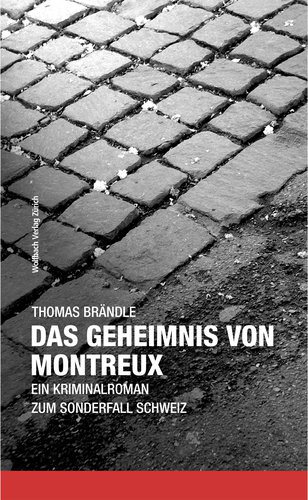 Was wäre, wenn damals auf den Schweizer Bundesrat Christoph Blocher, also auf einen der seit Menschengedenken einflussreichsten Politiker Helvetiens, ein tödlicher Mordanschlag verübt worden wäre? –
Was wäre, wenn damals auf den Schweizer Bundesrat Christoph Blocher, also auf einen der seit Menschengedenken einflussreichsten Politiker Helvetiens, ein tödlicher Mordanschlag verübt worden wäre? –
Hoppla! Darf man sowas wirklich fragen? Ja, überhaupt nur denken? In der Schweiz? In der Innerschweiz??
Doch genau dies tut der Zuger Schriftsteller Thomas Brändle. In seinem Kriminalroman «Das Geheimnis von Montreux».
Die Geschichte des Brändle-Roman-Erstlings entspinnt sich um ein skandalöses Verbrechen: Im SwimmingPool seiner Villa wird der Schweiz prominentester Volksvertreter ermordet aufgefunden. Natürlich heißt im Roman das Opfer nicht Blocher (sondern Landolt) und nicht Christoph (sondern Christian) mit Vornamen. Doch im dritten Kapitel liest’s sich völlig unzweideutig (Zitat):
«Landolt war damals noch der Inhaber eines global agierenden Konzerns in der Kunststoffbranche und bereits wichtiges Mitglied des Nationalrates, der grossen neben der kleinen Kammer, dem Ständerat. Landolt führte in der öffentlichen Wahrnehmung quasi im Alleingang einen politischen Feldzug gegen das gesellschaftliche, mediale und wirtschaftliche, auch das politische Establishment der Schweiz, das sich im Vorfeld geschlossen für den Beitritt ausgesprochen hatte. Und das Volk liebte ihn dafür, denn noch einige Monate vor der entscheidenden Abstimmung wurden die Gegner in den Medien flächendeckend als nationalistische Ewiggestrige der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Gegnerschaft, das war schon damals ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung. Sie hatte aber kaum bedeutende Exponenten auf ihrer Seite, sondern machte nur die sprichwörtliche Faust im Sack. Landolt avancierte in dieser Situation zum Volkstribun. Der schwerreiche Grossindustrielle glänzte durch seine scharfzüngige Rhetorik, einen entwaffnenden Schalk und sein für einen Politiker ungewohnt bodenständiges Auftreten. Er liess kein Schwingfest, keine Parteiversammlung, keinen Auftritt in einer Gemeindeturnhalle, keine Möglichkeit aus, um sich unter das Volk zu mischen, mit deftigen Sprüchen auf die ‘Classe politique’ zu schimpfen und mit einer einfachen, direkten Sprache zu zeigen: Ich bin einer von euch. Er war Mitglied der SVP, einer kleinen Partei, die bis anhin kaum 5% Wähleranteil auf sich vereinen konnte, der Partei der Landwirte und kleinen Gewerbeunternehmer, die erst während des Zweiten Weltkriegs, also fast hundert Jahre nach der Staatsgründung, eines der sieben Regierungsmitglieder stellen konnte. Die Parteigänger waren stolz auf ihren Multimillionär, der immer offener ihre Bewegung, wie sich die Partei selber bezeichnet, finanzierte, die ebenso immer offensichtlicher in vielen Themen auch Landolts ganz persönliche Meinung als ihre eigene übernahm. Landolt erweckte die verschlafene Partei zu einer politischen Kraft, die sich bei fast jeder Abstimmung gegen alle anderen Parteien des Landes stellte. Mit jeder gewonnenen Abstimmung legte sie ein bis zwei Prozente Wähleranteil zu…»

Bankier-Leiche an helvetisch historischer Stätte: Rettet der Geist von Morgarten die Schweizer vor dem neoliberalen Sozial-Darwinismus?
Das Landolt-Attentat wird in der Folge der Story zum Ausgangs- und Angelpunkt zugleich von nicht nur schweizerischen, sondern internationalen, ja global vernetzten Machenschaften, Illegalitäten und Korruptionen, von mysteriösen Polit-Szenarien mit schier monströser Tragweite, welche zuweilen, konsequent zuende gedacht, den Leser beängstigen müssten. Denn selbstverständlich bleibt der hohe Magistrat nicht das einzige Mordopfer in diesem Krimi: Wenig später findet man die Leiche einer weiteren Schweizer Symbolfigur, nämlich des Präsidenten der Nationalbank – ausgerechnet an für Eidgenossen heiliger Stätte: dem Morgarten-Denkmal am Ägerisee. Dem armen Teufel hatte man flüssiges Gold in den Rachen geleert… Und es geht weiter, das Meucheln – das Geheimnis von Montreux aus uralter Zeit fordert plötzlich neuzeitlichen Tribut.
Mitten in all diese mörderischen Troubles um viel «Geld und Macht», aber auch viel «Gut und Geist» hineingestellt findet sich die attraktive Journalistin Franziska Fischer, deren Recherchen sie tief in die helvetische Vergangenheit (bis zur «Helvetischen Republik» nach der französischen Invasion durch Napoleons Truppen im Jahre 1798) und weit in die Zukunft (bis zum Crash des Währungssystems im Jahre 2011 aufgrund skrupelloser Mafia-Banken-Attacken…) führen. Ihr zur Seite steht der «frei-sinnige» Nationalrat Marco Keller, ein direkter Nachfahre des berühmten freiheitlich-«liberal»-vaterländischen Polit-Dichters Gottfried Keller, der u.a. Mitte des vorletzten Jahrhunderts die Gründung der Zürcher Kantonalbank als Staatsbank anregte mit den Worten: «Wir brauchen diese Staatsbank, um den Wucher zu bekämpfen, den Privatbanken heilsame Konkurrenz entgegenzustellen und den mittleren und kleineren Gewerbestand vor der Ausbeutung durch die in erster Linie auf eigenen Nutzen bedachten Privatbanken zu schützen.»

Politiker, Bäcker, Schriftsteller: Thomas Brändle
Der 1969 in Liestal geborene, seit langem im innerschweizerischen Zug als selbstständiger Konditorei-Inhaber lebende, im kantonalen Parlament als FDP-Mitglied politisierende und bislang v.a. als humoristischer Belletristiker hervorgetretene Autor Thomas Brändle hat mit «Das Geheimnis von Montreux» nicht nur über den «Sonderfall Schweiz» einen Roman geschrieben, sondern selber einen «Roman-Sonderfall» geschaffen. Denn Buenos Aires, Rom, Montreux, Washington, Moskau: das sind nicht Schauplätze, wie man sie von Innerschweizer Schriftstellern gewohnt ist; ebensowenig geläufig sind einem bei zentral-helvetischen Autoren Themata wie Polit-Morde, Finanz-Verschwörungen oder Regierungs-Korruption. Vollends «unmöglich» für einen Zuger Schriftsteller, notabene einen dezidiert «bürgerlichen» Regionalpolitiker schließlich scheint derart Unerhörtes wie Kritik am «Finanzplatz Schweiz», an der zivilen Verfilzung von Parlament und Großindustrie, an grundsätzlich Kapitalistischem wie der «Freien Marktwirtschaft» oder an institutionalen Grundfesten wie der Börsenkotierung zu sein. Denn Autor Brändle lässt so ziemlich nichts aus, was Herrn und Frau Schweizer eigentlich (und eigentlich brennend) interessieren müsste an den (durchaus momentanen) Geschicken des Landes. Nur dass es hier als globale Verflechtung daherkommt, deren Schicksalshaftigkeit man so gerade eben und gottseidank noch die hehren Staatstugenden eines Gottfried Keller entgegenzuhalten vermag – denn sonst…

Geistiger Wegbereiter eines volkssouveränen Liberalismus’ und eines progressiven Schweizer Grundgesetzes: «Martin-Salander»-Dichter Gottfried Keller (1819-1890)
Brändle breitet auf 240 Buchseiten eine ganze Menge historischer «Aufklärung», aber auch politischer Aufklärung aus, zahllose (schweizer-)geschichtliche Exkurse garnieren den Krimi, bis hin zur Philosophie- und Sozialhistorik, und ein zumeist geistesgeschichtliches Prominenten-Zitat über jedem Kapitel untermauert quasi die jeweilige «Moral der G’schicht». Dies alles kommt dabei in einer erstaunlich rasanten Sprache daher, Brändle schreibt kurz, knackig, routiniert. Die teils üppigen Theorie-Einschübe werden geschickt durch schnelle Wechsel von Zeit und Ort gesplittet, was die literarischen Handlungsstränge zwar simultanisiert und dadurch verkompliziert, aber die Spannung durchaus raffiniert hält.

Wer über den viel- (und im eigenen Land gern-)zitierten politischen «Sonderfall Schweiz» mehr erfahren will, als er im üblichen eidgenössischen Blätterwald je vorgesetzt erhält, der kann nun auch einfach den Innerschweizer Krimi “Das Geheimnis von Montreux” lesen…
Wer also über den viel- (und im eigenen Land gern-)zitierten politischen «Sonderfall Schweiz» mehr erfahren will, als er im üblichen eidgenössischen Blätterwald – gerade zu Zeiten und inmitten eines krisengeschüttelten Europa – je vorgesetzt erhält, der kann nun auch einfach einen Innerschweizer Krimi lesen…
Thomas Brändle, Das Geheimnis von Montreux, Ein Kriminalroman zum Sonderfall Schweiz, Wolfbach Verlag, 240 Seiten, ISBN 978-3-9523334-1-9
.
.
Interview mit Thomas Brändle
.
Glarean Magazin: Bis jetzt kannte man den Schriftsteller Thomas Brändle vornehmlich als erfolgreichen Humoristen, beispielsweise in «Noch ein Stück, bitte!» und «Einen Augenblick bitte!». Warum nun dieser unverhoffte Schwenk ins dramatische, ja buchstäblich todernste «Fach» des Polit-Thrillers?
Thomas Brändle: Tatsächlich bevorzuge ich das Humoristisch-Hintergründige. Dass ich nun einen Politkrimi geschrieben habe (der im wahrsten Sinne des Wortes auch seine komischen «Seiten» hat), hat natürlich mit meinem politischen Mandat zu tun. Nach einigen Jahren Recherche habe ich ihn 2007 geschrieben und im September 2008 veröffentlicht. Am 15. September 2008 crashte die Bank Lehman Brothers – der Anfang der aktuellen Weltwirtschaftskrise. Ich bin selber verblüfft, wie schnell schon vieles eingetroffen ist, was ich im Buch vorweggenommen habe. Sogar die Schweizer Boulevardzeitung «Blick» schrieb darüber. So wie’s aussieht, könnte noch einiges mehr aus dem Politthriller Realität werden.
GM: Ihren Protagonisten Marco Keller charakterisieren Sie im Buch u.a. so: «Er hält es in den vorgegebenen Leitplanken kaum aus und kann nicht verstehen, wie seine Partei, die FDP, zunehmend das eigene Staatsgebilde demontiert, sich immer auf Sachzwänge, die Globalisierung und eine vermeintlich ökonomische Logik berufend.» Spricht hier auch der real politisierende Autor, dem die eigene Fraktion bei einer Parlamentsrede gar mal das Mikrofon abstellen ließ?
TB: 2002 wurde ich ins Parlament des Kantons Zug gewählt. Ende 2004 erschien mein erster kritischer Leserbrief zu unserer Wirtschafts- und Finanzordnung. Damals begann meine Odyssee durch die Schweizer Geschichte und auch das Zweifeln an der Seriosität der Wirtschaftswissenschaften. Da ist viel Ideologie dabei. Inzwischen darf ich im Parlament auch wieder ausreden. Meine «Aktien» sind durch die Krise gestiegen… Und ja, die FDP ist leider von einer staatstragenden, visionären Volkspartei zur Klientelpartei mutiert. Das kritisiert mein Protagonist Marco Keller.
GM: Über jedem Ihrer Buch-Kapitel prangt ein Aphorismus eines zumeist großen Dichters oder Denkers, und der wirtschaftsethische Standpunkt des Autors bleibt zu keinem Zeitpunkt verborgen. Der Krimi auch als moralischer Appell? Haben Schriftsteller eine soziale Aufgabe?
TB: Persönlich lese ich am liebsten Autoren, die mich aufregen, anregen und unterhalten – und natürlich zum Lachen bringen. Ich möchte mir mit Lesen nicht nur die Zeit vertreiben, sondern davon eben auch bereichert werden. Ich finde schon, dass Schriftsteller eine sehr wichtige Aufgabe hätten. Wie es Dürrenmatt gesagt hat, haben Schriftsteller die Position der Rebellion zu beziehen, in jeder Gesellschaft, die denkbar ist. Wir schnell werden bloße Behauptungen zu Wahrheiten, die sich in unseren «gesunden» Menschenverstand einschleichen und dort alles lahm legen! Dann wehren wir uns natürlich, wenn plötzlich einer fragt, ob denn die Erde auch wirklich flach ist. Wir dürfen (trotzdem) «nie damit aufhören, Fragen zu stellen» (Albert Einstein).
GM: Wie einflussreich sind wirtschaftliche «Geheimbünde» wie die von Ihnen geschilderte, in Montreux gegründete «Mont Pèlerin Society» oder «Denkfabriken» wie «Avenir Swiss» wirklich?
TB: Offenbar sind sie sehr einflussreich. Deren Interessen und Ansichten sind eben nicht geheim. Sie werden durch Bildungsinstitute, Medien und Politik gelehrt und verbreitet. Die von ihnen propagierte Wirtschaftsdoktrin hat, wenn auch selten in der reinen Lehre, innert 30 Jahren den Status eines global akzeptierten «Naturgesetzes» erreicht. Im Anhang meines Romans findet die interessierte Leserschaft «andere» wissenschaftliche Literatur. Es gibt wenig Geheimes, nur der Fokus ist oft etwas beschränkt…
GM: Nach H. Ch. Binswangers Arbeit «Die Wachstumsspirale», welche Sie im Buch zitieren, zerstört unser neoliberales Kreditsystem wichtige ökologische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Strukturen. Wie sähe die kurze Skizzierung eines besseren politischen Gegenentwurfs aus?
TB: Binswanger plädiert unbedingt dafür, dass wir unser 500 Jahre altes Finanzsystem reformieren, wie es in der Schweiz nach 1848 schon einmal getan wurde. Und zwar recht erfolgreich. Nur die Notenbank darf Geld herstellen und die Kantonal- und Genossenschaftsbanken haben die gesellschaftliche Verantwortung, dass es für sozial nützliche Projekte zur Verfügung steht: für die Infrastruktur, die wertschöpfenden Menschen, die Familien und jene Unternehmungen, die sinnvolles Produzieren und damit Nutzen stiften. Geld darf sich nur durch reale Wertschöpfung vermehren, nicht durch sich selber. Einen konkreten Vorschlag habe ich aktuell bei der «Fachkommission Wirtschaftspolitik» der FDP Schweiz eingereicht. Wirtschaftswissenschaftler wie Hans Christoph Binswanger, Heinrich Bortis und andere haben mir dabei geholfen.
GM: Gottfried Keller ist in Ihrem Krimi eine Art imaginärer Rufer aus der Vergangenheit. Was, glauben Sie, würde er seinen Schweizern zurufen angesichts der heutigen Misere in Staat und Gesellschaft?
TB: Der IT-Unternehmer Ivo Muri hat in seinem Buch «Kleptokratisches Manifest» ein fiktives Interview zwischen Gottfried Keller und einer heutigen Wirtschaftsstudentin veröffentlicht. Herrlich genial!
In der Realität würde Keller sich heute wohl sehr wundern, dass wir im Gegensatz zu Bereichen wie Technik, Bildung und Wissenschaft geistig, politisch und moralisch so klägliche Fortschritte gemacht haben. Bestimmt würde er sich auch ärgern, dass ausgerechnet die Schweizer so geldhörig geworden sind. Die Schweiz hätte der Welt gerade heute aufgrund ihrer staatspolitischen Erfahrungen so viel zu geben.
GM: Glauben Sie, dass Bücher die Welt verändern?
TB: Ja, manche haben das ja auch getan. Das geschriebene Wort hat schon seine Kraft – wenn es gelesen wird. Wenn die Menschen es endlich überdrüssig sind, nur als Konsumenten, Arbeitnehmer, Steuerzahler und einfältige Unterhaltungssuchende gesehen zu werden, möchten sie vielleicht auch wieder geistig etwas herausgefordert werden; lustbetont, humorvoll, spannungsgeladen. ■
.
Probeseiten
.
.
Interview mit dem Komponisten Fabian Müller
.
Neue Musik?
Der Zürcher Fabian Müller, studierter Konzert-Cellist, passionierter CH-Volksmusik-Forscher und früher vieljähriger Begleiter der Tessiner Sängerin «La Lupa», zählt mittlerweile zu den erfolgreichreichsten und vielseitigsten Schweizer Komponisten der jüngeren Generation. Da er sich, wie er sich selbst charakterisiert, «nie irgendwelchen Schulen oder Glaubens-Sätzen verpflichtet fühlt», und «intellektuell entworfene Konzepte, denen die Musik folgen soll», nicht sein Ausgangspunkt beim Komponieren sind, schlieβt sein bisheriges Oeuvre modernistische Elemente ebenso ein wie traditionelle. Seine Werke «schöpfen ganz aus der intuitiven Freiheit» (Müller).
Im Frühjahr 2001 nahm David Zinman zusammen mit dem Philharmonia Orchestra London eine CD mit Werken von Fabian Müller auf. Eine Produktion, die sich für das weitere Schaffen des jungen Zürcher Komponisten als sehr fruchtbar erweisen sollte.
Die Kunsthistorikerin, Autorin und Kulturjournalistin Margaret Jardas führte vor einiger Zeit mit Fabian Müller ein Gespräch, das wir hier (mit freundlicher Genehmigung des Komponisten) auszugsweise wiedergeben.
Margaret Jardas: Ihre Werke knüpfen irgendwie an die Klangwelt des Impressionismus an. Bei neuer Musik erwarte ich eigentlich ganz andere Klänge. Komponisten, die sich auf die eine oder andere Art von der Avantgarde abgewendet haben, schreiben mehr oder weniger tonale Musik. Ist das nicht ein Schritt zurück? Darf man da überhaupt von neuer Musik sprechen?
Fabian Müller: Was genau heiβt «neu»? Man muss sich heutzutage genau überlegen, was dieses Wort bedeutet, was denn überhaupt «neu» sein kann. Inhaltlich hat sich über die Jahrhunderte nicht viel geändert. Es geht immer noch um Liebe, Schmerz und Tod, um die Palette von Gefühlen und Erfahrungen, die in der Kunst allgemein und speziell eben auch in der Musik zum Ausdruck kommen. Deshalb ist die Frage nach Neuem vor allem die Frage nach neuen Ausdrucksmitteln. Das ist eine Frage des Stils, und im Hinblick auf den Stil gab es natürlich eine beachtliche Entwicklung in den vergangenen Jahrhunderten. Ich verstehe die Entwicklungen der Musikgeschichte als ständige Erweiterung der klanglichen Möglichkeiten.
Was herkömmliche Instrumente unseres Orchesters betrifft, muss man sagen, dass diese Entwicklung inzwischen abgeschlossen ist. Auf der Geige gibt es keinen relevanten neuen Klang zu entdecken, der nicht bereits vor Jahrzehnten verwendet wurde. Ein Komponist, der heute meint, seine Musik sei neu, weil sein Stück für Geige solo auf den «normalen» Geigenklang verzichtet und aus lauter Spezialeffekten besteht, der ist entweder naiv oder macht sich etwas vor. Es gibt keinen Klang auf diesen Instrumenten, der nicht bereits in den 50er- und 60er-Jahren ausgelotet wurde. Wer also für diese Instrumente komponiert, schreibt hinsichtlich der «Materialfrage» nicht eigentlich «neue» Musik.
Man muss sich deshalb ernsthaft fragen, wessen Musik denn heute «neu» ist: Diejenige, welche die Erwartungshaltung der Avantgarde-Kreise erfüllt, oder jene, die diese – wie auch immer – durchbricht und etwas anderes versucht.
«Ich glaube, der Einsatz des Geräusches zur Herstellung wird zunehmen, bis wir zu einer Musik gelangen, die mit Hilfe elektronischer Instrumente produziert wird, die uns sämtliche Klänge, die das Gehör wahrnehmen kann, zur Verfügung stellen wird. – Bis ich sterbe, wird es Geräusche geben. Und diese werden meinen Tod überdauern. Man braucht keine Angst um die Zukunft der Musik zu haben.»
John Cage, Komponist von «433»
Dabei ist es sicher nicht interessant, Stile aus der Vergangenheit zu kopieren. Ich glaube viel mehr, dass die jüngere Generation sich einfach die Freiheit herausnimmt zu schreiben, was sie will, und eine meiner Meinung nach gesunde Rücksichtslosigkeit an den Tag legt gegenüber den Avantgarde-Kreisen, die genau zu wissen scheinen, wie es gegenwärtig klingen muss. Wenn man Leute aus diesen Kreisen etwas genauer ausfragt, was sie denn bei neuer Musik für Hörerwartungen haben, stellt sich heraus, dass es sich um stilistische und klangliche Elemente handelt, die keineswegs neu sind und vor 40 Jahren noch Provokation waren, heute aber längst der Vergangenheit angehören.
Ich gehöre auf keinen Fall zu denen, die die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte für einen Irrweg halten. Es gibt viele Komponisten und Komponistinnen dieser Zeit, die groβartige Musik geschrieben haben oder immer noch schreiben und die ich sehr schätze. Das 20. Jahrhundert hat der Kunstmusik eine ungeheure Befreiung gebracht. Diese Freiheit unverkrampft und undogmatisch zu nützen, und alles bisher musikalisch Entdeckte zu einer persönlichen Synthese zu bringen, das ist meiner Meinung nach die momentane Herausforderung für Komponierende.
MJ: Sie glauben also an eine Zukunft der Kunstmusik. Was kann denn Ihrer Meinung nach noch «neu» sein?
FM: Wer heute noch nach neuen Klängen sucht, muss diese ehrlicherweise in der Elektronik suchen oder nach neuen akustischen Instrumenten-Erfindungen Ausschau halten.
 Als offizielles Geburtsdatum der elektronischen Musik gilt der 26. Mai 1953. Auf dem vom Nordwest-Deutschen Rundfunk organisierten Kölner «Neuen Musikfest» 1953 wurden vier erste Stücke von Robert Beyer und Herbert Eimert (Bild) vorgestellt. Werner Meyer-Eppler zur Definition: «Musik ist nicht schon dann ‘elektronisch’ zu nennen, wenn sie sich elektronischer Hilfsmittel bedient, da es hierzu keineswegs genügt, die bereits vorhandene Tonwelt oder gar eine bestehende Musik ins Elektro-Akustische zu übertragen.»
Als offizielles Geburtsdatum der elektronischen Musik gilt der 26. Mai 1953. Auf dem vom Nordwest-Deutschen Rundfunk organisierten Kölner «Neuen Musikfest» 1953 wurden vier erste Stücke von Robert Beyer und Herbert Eimert (Bild) vorgestellt. Werner Meyer-Eppler zur Definition: «Musik ist nicht schon dann ‘elektronisch’ zu nennen, wenn sie sich elektronischer Hilfsmittel bedient, da es hierzu keineswegs genügt, die bereits vorhandene Tonwelt oder gar eine bestehende Musik ins Elektro-Akustische zu übertragen.»
Im gleichen Jahr stellte Karlheinz Stockhausen seine «Studie I» fertig, die nur aus Sinustönen zusammengesetzt war und als das erste realisierte Stück auch den theoretischen Intentionen der elektronischen Musik entsprach.
Mit einem Orchester in klanglicher Hinsicht «neue» Musik zu schreiben ist kaum möglich. Aber vergessen wir nicht: Klangmaterialien und musikalische Formen sind die – man könnte sagen – «materielle» Seite der Musik. Durch alles was in den letzten 600 Jahren musikalisch entdeckt und entwickelt wurde, hat der heutige Musikschaffende eine noch nie dagewesene Palette von Möglichkeiten. Die Frage ist: Hat er auch die Freiheit sie zu benützen? Und da gehen die Meinungen sehr auseinander.
Viele Anhänger der avantgardistischen Ästhetik halten ausschlieβlich das Verwenden der letzten Entwicklungen oder zumindest derjenigen der Nachkriegsavantgarde für legitim und hoffen auf eine Weiterentwicklung. Das Verwenden von beispielsweise tonalen Bezügen gilt in gewissen Kreisen geradezu als Verrat. Dieses Denken sollte man meiner Meinung nach nun am Beginn eines neuen Jahrhunderts hinter sich lassen, weil es – bei aller plausiblen Begründung – ganz einfach unfrei und dogmatisch ist. Eine schlechte Voraussetzung, um zu wirklich «neuen» Resultaten zu kommen.
Es kann heute nicht mehr um «tonal» oder «atonal» gehen. Meiner Meinung nach ist es heute eine Befreiung und auch eine Chance, wenn man sich vom Denken, die Musikgeschichte als geradliniges Kontinuum zu betrachten löst, wo Epoche auf Epoche folgt, entweder als Weiterentwicklung des Vorhandenen oder als Reaktion darauf. Es ist ja eine unbesteitbare Realität, dass im heutigen Konzertangebot sämtliche Epochen in einer noch nie dagewesenen Weise gleichzeitig präsent sind, und dementsprechend auch in unserem Bewusstsein. Man sollte versuchen, die Musikgeschichte als ständige Erweiterung der klanglichen Möglichkeiten zu sehen.
Wenn man die bis heute entwickelten musikalischen Mittel als Ganzes sieht und sich die Freiheit nimmt, sie auch als Ganzes zu verwenden, stehen wir eher an einem Beginn als an einem Ende. Die Schwierigkeit ist heute, in dieser immensen Palette von Möglichkeiten einen persönlichen Weg zu finden.
MJ: Haben Sie ihn gefunden?
FM: Auf irgendeinem Weg bin ich, weiβ aber nicht wohin er führt. Ich habe ein sehr nebelhaftes Gefühl davon, wie es in Zukunft weitergehen könnte. Wenn Sie mich aber fragen, warum ich heute so komponiere und nicht anders, dann ist meine einzige ehrliche Antwort darauf: weil ich nicht anders kann. Alle ästhetischen und philosophischen Begründungen folgen erst nachher. Es war mir immer ein Anliegen, das zu schreiben, was ich wirklich innerlich wahrnehme, ohne jegliche Konzessionen an heutige Hörerwartungen. Wenn ich das Bedürfnis habe, etwas aufzuschreiben und es stellt sich heraus, dass es zum Beispiel Anklänge an Mahler hat, dann hat das damit zu tun, dass ich Mahlers Musik eben sehr liebe und seit meiner Jugend so oft gehört habe, dass sie längst in mir verinnerlicht ist.

Natürlich könnte ich das Wahrgenommene nun so verfremden, dass es avantgardistisch daherkommt. Doch warum? Die Beweggründe dafür wären mir suspekt. Natürlich spreche ich hier nur von subtilen Anklängen, die sich von selbst einstellen und nicht von längeren Passagen oder gar Stilkopie. Mit Stilkopien kann ich gar nichts anfangen. Auβerdem ist für mich die Klangwelt des Symphonie-Orchesters noch immer das Gröβte – für Elektronik konnte ich mich nie so richtig begeistern, sie war mir immer etwas zu kalt – also werde ich wohl weiterhin für die herkömmlichen Instrumente schreiben. Natürlich träume ich davon – wie es wahrscheinlich jeder Komponist tut – Klänge, die bisherigen und neue dazu, eines Tages auf noch nie dagewesene Art zu verwenden… daran arbeite ich.
Gewisse Synthesen von verschiedenen Stilmitteln einiger heutiger Komponisten können durchaus als «neu» bezeichnet werden, weil Musik noch nie in dieser Form erklungen ist. Dieses «Neue» ist zur Zeit in Europa vor allem in den nordischen oder baltischen Staaten zu finden.
MJ: Am Anfang haben Sie unterschieden zwischen Inhalt und musikalischem Material – wir haben bis jetzt hauptsächlich über das musikalische Material gesprochen. Gibt es auch «Neues», was den Inhalt betrifft?
FM: Darüber möchte ich gerne etwas sagen, nämlich über das Bedürfnis eines Komponisten, überhaupt etwas zu schreiben, überhaupt diese undefinierbaren Dinge und Empfindungen, die ihn nicht loslassen, in Musik auszudrücken. Es gibt diese ewige Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, die Sehnsucht nach vollkommenem Glück, vollkommener Liebe, Ekstase, Schönheit.
«Die Musik der meisten Komponisten, die ich für groβ halte, erzählt von der Freude an diesen wunderbaren Dingen, für die es sich zu leben lohnt – und gleichzeitig schwingt darin eine Melancholie mit – die Trauer darüber, dass man diese Dinge eben nie ganz erreicht. Solche Musik kann uns ergreifen, erschüttern, verzaubern. Sie entspringt einem Niemandsland irgendwo zwischen der Sehnsucht selbst und dem, was man herbeisehnt. Das beste Beispiel im 20. Jahrhundert für das, was ich meine, ist die Musik von Olivier Messiaen. Seine Musik ist für mich zukunftsweisend.» (Fabian Müller)
Dem rein intellektuellen Umgang mit Klang in den letzten Jahrzehnten ist diese transzendente Dimension der Musik etwas abhanden gekommen. Es ist wohl die Aufgabe der jüngeren und nächsten Generationen, der Kunstmusik diese Dimension wieder zurückzugewinnen. Meiner Meinung nach hat nur eine Musik dauerhaften Wert, die den Menschen als Ganzes anzusprechen vermag. Weder losgelöster intellektueller Kitzel noch Gefühlsschwärmerei ohne Logik befriedigt auf die Dauer. Über die «wissenschaftliche» Analysierbarkeit eines Werkes freuen sich allenfalls die Musikwissenschafter und Kritiker und oft auch nur deswegen, weil ihnen ein anderer Zugang zur Musik verwehrt bleibt. Der Begriff «Musikwissenschaft» birgt in sich sowieso schon ein Paradoxon. Denn das, was Musik wirklich ausmacht, beginnt dort, wo der Wissenschaft die Türen verschlossen bleiben. Konnte jemals jemand erklären, warum einen beispielsweise das Thema des 2. Satzes im Doppelkonzert von Brahms aus den Socken hebt? Und dies auch beim x-ten Anhören? Natürlich lässt sich viel über die Spannungsverhältnisse der Intervalle im Verlauf dieser Melodie sagen und es wird irgendwie offensichtlich, warum es sich um eine «gute» Melodie handelt. Aber hat jemals jemand durch solche – wissenschaftlichen – Erkenntnisse die Fähigkeit erlangt, eine ähnlich gute Melodie zu schreiben?
Musik ist wie das Leben, sie lässt sich nicht erklären, und ein einzelnes Werk ist wie ein Mensch: Lange analytische Werkeinführungstexte sind wie anatomische Beschreibungen und wecken in mir den Verdacht, dass ich im Konzert eine klingende Leiche zu hören bekomme.

«Komponier-Gartenhäuschen» in Zürich, genius loci von F. Müller.
MJ: Wenn Sie vorhin von dieser Sehnsucht nach dem Unerreichbaren gesprochen haben, ist das nicht eigentlich der Zeitgeist der Romantik?
FM: Vieles was heute tonal klingt oder tonale Anklänge hat, wird als «Neoromantik» bezeichnet. Das geht manchmal auch meiner Musik so, und mir persönlich auf den Wecker… «Neoromantisch» ist ein so unscharfer Begriff – und wenn ich bedenke, dass oft schon ein paar Dreiklänge oder ein Melodiefetzen ausreichen, um Musik als neoromantisch zu betiteln, dann kommt mir das irgendwie lächerlich vor. Sicher, ich bin wohl ein «romantischer» Mensch, wenn «Romantik» eben diese Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, Transzendenten meint, aber warum dann «neo»? Ist denn Sehnsucht bloβ die Empfindung einer Stilepoche? Ganz sicher nicht! Vielmehr ist dieses Gefühl ja etwas von dem, was den Menschen überhaupt ausmacht. Und das, was den Menschen ausmacht – das ist ja doch ewiges Thema jedwelcher Kunst. Romantik als menschlichen Ausdruck hat es immer gegeben, und wird es immer geben, weil die Sehnsucht immer da ist. Der Zeitgeist bestimmt eigentlich nur, auf welche Weise sich dieses Sehnen ausdrückt… ■
.
.
.


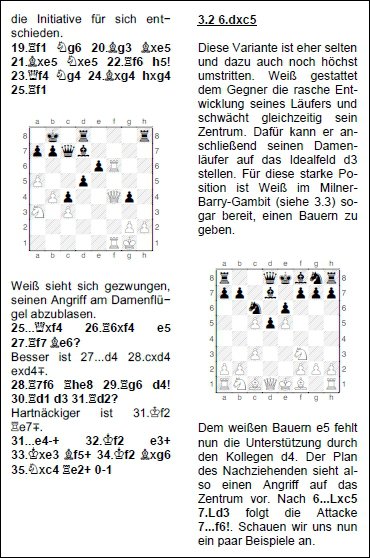
















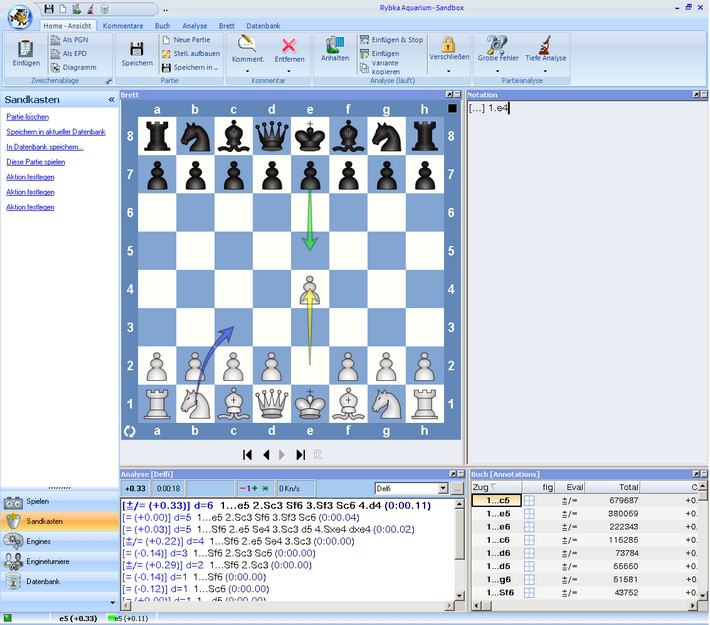
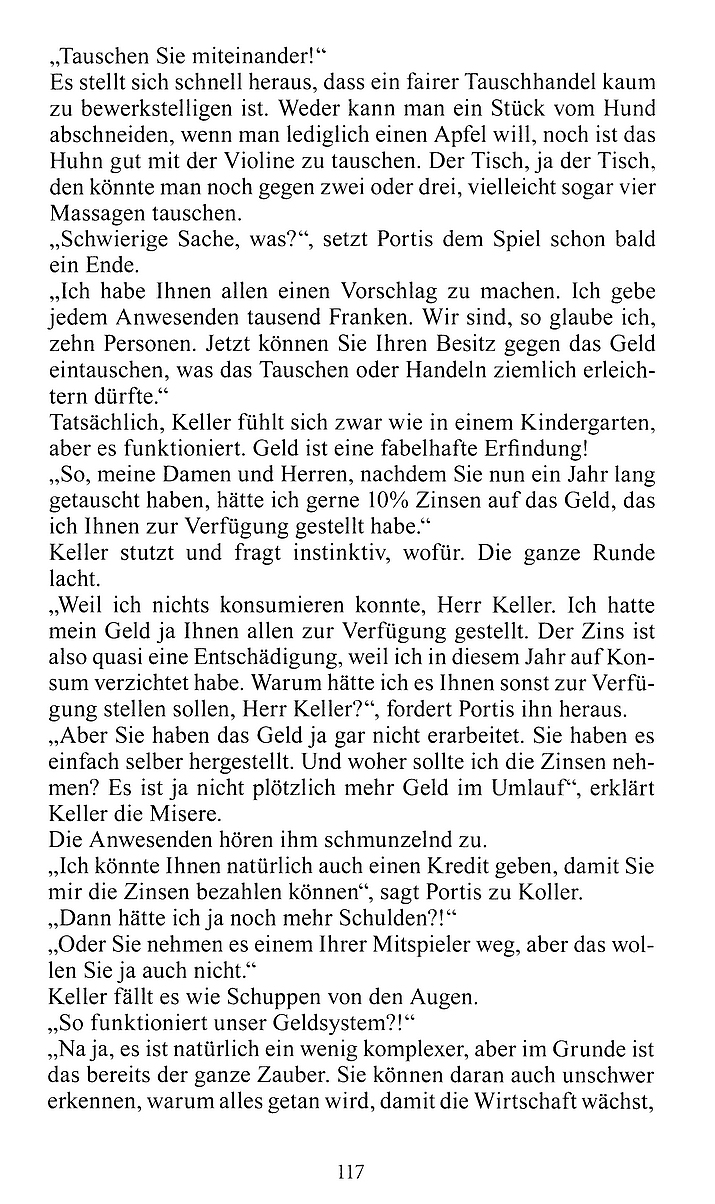
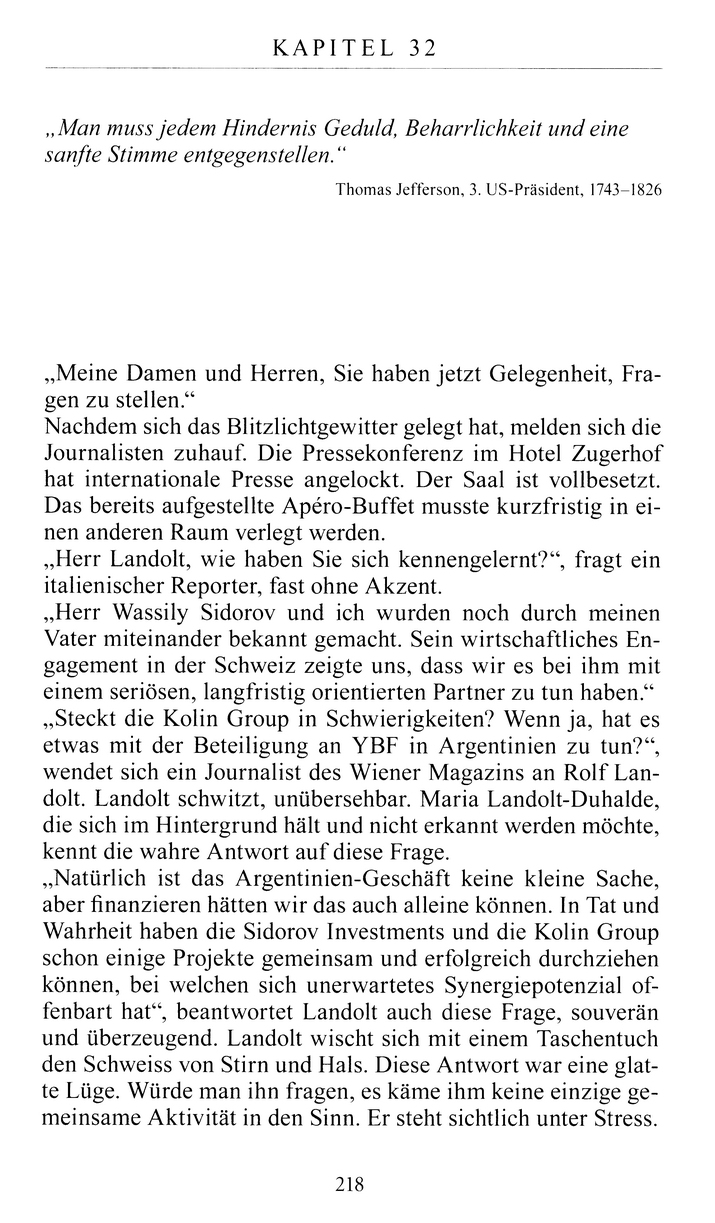







1 comment