Shahriar Mandanipur: «Eine iranische Liebesgeschichte zensieren»
.
Was man sieht, ist nicht das, was es ist
Dr. Karin Afshar
.
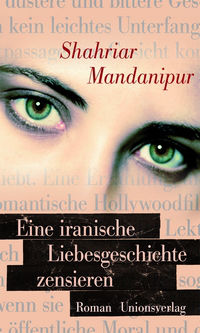 Sie wollen endlich einmal eine Liebesgeschichte von einem Iraner lesen, die gut ausgeht? Shariar Mandanipur verspricht Ihnen dies – in seinem neuesten Roman «Eine iranische Liebesgeschichte zensieren» – zumindest, und kündigt dann noch gleich in der Einleitung an, dass seine Heldin in wenigen Minuten sterben wird. Wie kann das eine glückliche Liebesgeschichte sein?
Sie wollen endlich einmal eine Liebesgeschichte von einem Iraner lesen, die gut ausgeht? Shariar Mandanipur verspricht Ihnen dies – in seinem neuesten Roman «Eine iranische Liebesgeschichte zensieren» – zumindest, und kündigt dann noch gleich in der Einleitung an, dass seine Heldin in wenigen Minuten sterben wird. Wie kann das eine glückliche Liebesgeschichte sein?
Aber wenn Sie an dieser Stelle angelangt sind, haben Sie nun schon einmal angefangen zu lesen und befinden sich bereits mitten in einem ausgelegten Netz, aus dem Sie nur herauskommen, wenn Sie weiterlesen – wenn überhaupt je wieder.
Shahriar Mandanipur ist 1957 in Schiras geboren; man ist sich überein, dass er nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch der modernste unter den iranischen Autoren ist. (Modern, werden Sie bald merken, geht dabei oft mit Schwerlesbarkeit einher.) Auf dem Klappentext lesen Sie, dass der Autor Politikwissenschaften studierte und im iranisch-irakischen Krieg, der vom September 1980 bis zum August 1988 dauerte, Soldat war. Für seine Werke bekam er zahlreiche Preise, darunter den Mehregan Award und den Golden Tablet Award. Wegen der Zensur konnte er zwischen 1992 und 1997 im Iran nichts veröffentlichen und verließ 2006 den Iran. Zur Zeit ist er Gastdozent in Harvard, in Cambridge lebend. Noch mehr Autobiografisches können Sie dem Buch entnehmen.
«Eine iranische Liebesgeschichte zensieren» wurde aus dem Persischen von Sara Khalili ins Englische übersetzt. Autor und Übersetzerin haben gemeinsam daran gearbeitet, die subtile, manchmal heitere Doppelbödig- und stete Symbolhaftigkeit der persischen Sprache zu übertragen. Die deutsche Übersetzung von Ursula Ballin beruht auf der englischen. Sie werden sich trotzdem wünschen, Sie könnten gut genug Persisch, um das Original zu lesen!
Sie heißt Sara, und der junge Mann, um den es hier – Alter ego Mandanipurs? – geht, Dara. Das ist eine geniale Namenwahl. Wenn Sie Iraner kennen, fragen Sie sie, was es damit auf sich hat. Anspielungen, Hinweise – intertextuelle Bezüge auf klassische persische wie auch klassische und moderne westliche Literatur, auf Filme, auf Geschehnisse – finden sich allerorten. Dem Zensor, der «mit viel Einfühlungsvermögen seine Arbeit machen muss, um unmoralische Schriftsteller, welche die iranische Jugend zu verderben drohen, zu entlarven», hat Mandanipur den Namen Porfirij Petrowitsch gegeben. Was – Sie kennen ihn nicht? Und ausgerechnet in Sadegh Hedayats Roman «Die blinde Eule» findet Sara den ersten Liebesbrief von Dara.
Sie bedienen sich Saint-Exupérys «Kleinen Prinzen» ebenso wie Garcia Lorcas. Dara markiert Buchstaben mit Punkten, aus denen Sara nun Briefe dechiffriert. So kommunizieren sie eine Weile, ohne dass sie sich kennen, und so beginnt ihre Liebesgeschichte.
Shahriar Mandanipur ist ein gewiefter Ich-Erzähler, der Sie an der Entwicklung der Geschichte und an seinen Gedanken zu deren Konstruktion teilhaben lässt, eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte erzählend. Sie erfahren viel über das tägliche Leben der Menschen, ihre Nöte und ihren erfindungsreichen Umgang mit auftretenden Problemen, über Reaktionen auf politische Ereignisse und deren Hintergründe.
Um es gleich vorweg zu nehmen: der Ton ist locker, luftig, respektlos, wie ihn nur Menschen haben können, die vor nicht mehr viel Angst haben. Doch was einfach aussieht, ist nicht selten das Ergebnis durchlebten Leids. Auf den ersten Seiten werden Sie öfter herzhaft lachen. Hier bekommen die Iraner ebenso wie die Amerikaner (in Geographie nicht so gut bewandert) ihr Fett weg. Doch täuschen Sie sich nicht: das Buch ist weder eine Liebesgeschichte noch eine belanglose, zufällige Aneinanderreihung beiläufig geschilderter Ereignisse und Hinweise.
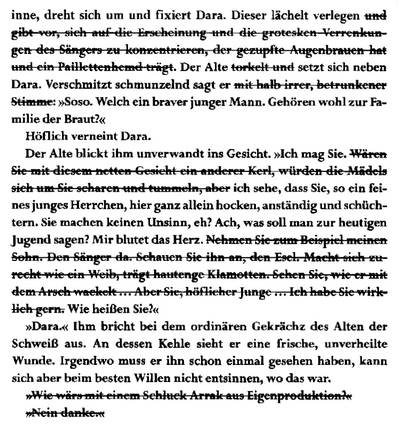
«Der Zensor sitzt bereits im Kopf des Autors, und was dann folgt, ist der Parcours durch eine Welt, in der man nicht glauben darf, was man sieht und liest und nicht sehen darf, was ist, und in der der Spagat zwischen Innen und Außen schier schizophren macht.»
Mandanipur hat 320 Seiten mit Buchstaben gefüllt, die eigentliche Geschichte aber steht zwischen den Zeilen. Es geht eben um Zensur, und Sie werden am Ende des Buches eine Ahnung davon haben, wie Sie werden – sollten Sie jemals unter eine Diktatur geraten – zu schreiben haben.
Widersprüche durchziehen das Buch, wie sie die persische Seele durchziehen. Das macht ihre Anziehungskraft aus, auch wenn sie Leid bedeuten. Denn Leid gehört zum Leben, und dass es nicht immer verbittert geschildert werden muss oder nihilistisch (was aufs Gleiche hinauskommen könnte), zeigt Mandanipur. Sprachverliebt und sprachgewaltig ist er. Es sind nicht nur die vielen Bezüge und die Verschachtelungen, die Ihnen das Lesen schwer machen könnten, sondern auch die Kaskaden von Sätzen und Bildern. Orientierung wird Ihnen durch das Schriftbild zuteil: es gibt fett gedruckte Textstellen, normal gedruckte und durchgestrichene. Setzen Sie sich nicht gleich hin und schreiben einen Brief an den Verlag, weil das Buch suggeriert, es sei zensiert und dann irrtümlicherweise doch mit den zensierten Passagen abgedruckt worden.
Der Zensor allerdings sitzt bereits im Kopf des Autors, und was dann folgt, ist der Parcours durch eine Welt, in der man nicht glauben darf, was man sieht und liest und nicht sehen darf, was ist, und in der der Spagat zwischen Innen und Außen schier schizophren macht.
Wenn Sie von der Kultur Persiens – das es ja nicht mehr in dieser Form und mit dieser Bezeichnung gibt – fasziniert sind und den Menschen, die auf dem Staatsgebiet des heutigen Iran leben, nahe stehen, werden Sie kennen und bestätigen, was Mandanipur schreibt. Wenn Sie das alles erst kennenlernen und verstehen wollen, haben Sie eine große Aufgabe vor sich. Es ist eine Geschichte der Menschheit, von Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. ■
Shahriar Mandanipur (Übersetzung: U. Ballin), Eine iranische Liebesgeschichte zensieren, Roman, Unionsverlag, 320 Seiten, ISBN 3-293-00415-6
.
Leseproben
.
.
.
.
.
.

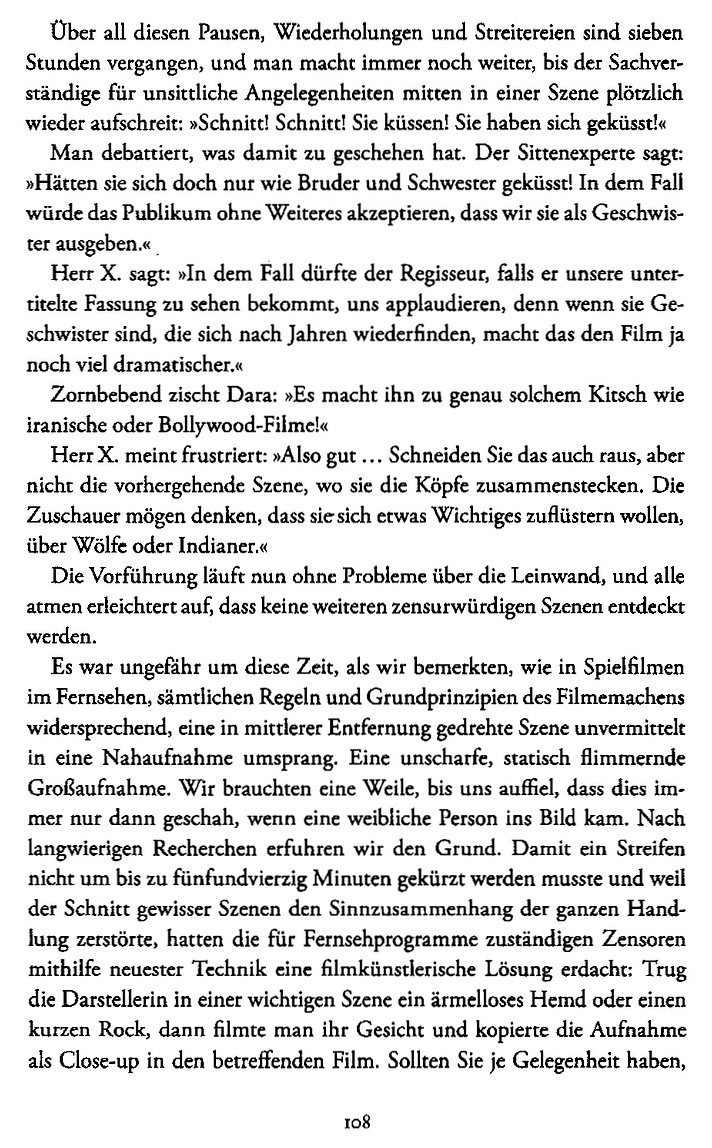
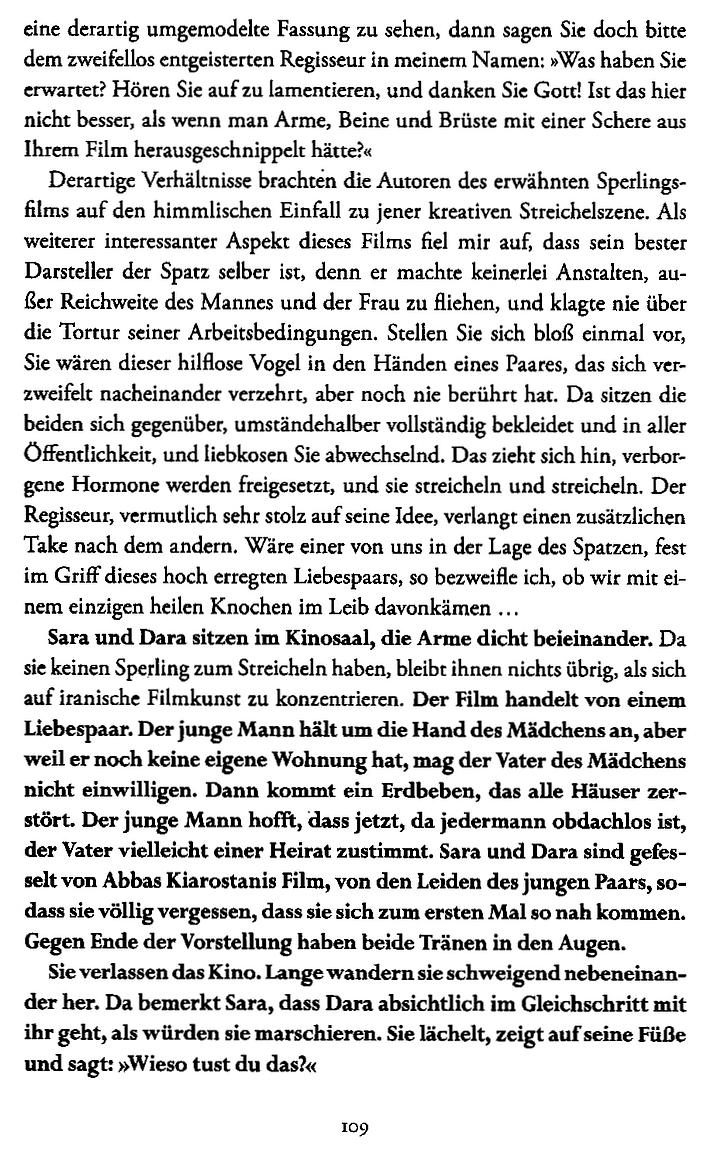





leave a comment