Martin Walker: «Schwarze Diamanten»
.
Spannend und unterhaltsam, doch thematisch zu viel des Guten
Isabelle Klein
.
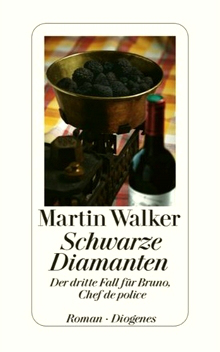 Im beschaulichen Saint Denis ist im Dezember jede Menge zu tun für Bruno, den Chef de police: Das lokale Sägewerk schließt, Menschen verlieren ihre Jobs, nicht zuletzt wegen des Sohnes des Besitzers Guillaume Pons, der sich an die Spitze der Écolos gestellt hat. Vater und Sohn sind zutiefst verfeindet. Guillaume ist kürzlich, nach vielen Jahren Auslandsaufenthalt in Asien, wo er scheinbar äußerst erfolgreich war, in seine Heimat zurückgekehrt. Er eröffnet die Auberge des Verts und will Bürgermeister werden – sehr zum Verdruss Brunos…
Im beschaulichen Saint Denis ist im Dezember jede Menge zu tun für Bruno, den Chef de police: Das lokale Sägewerk schließt, Menschen verlieren ihre Jobs, nicht zuletzt wegen des Sohnes des Besitzers Guillaume Pons, der sich an die Spitze der Écolos gestellt hat. Vater und Sohn sind zutiefst verfeindet. Guillaume ist kürzlich, nach vielen Jahren Auslandsaufenthalt in Asien, wo er scheinbar äußerst erfolgreich war, in seine Heimat zurückgekehrt. Er eröffnet die Auberge des Verts und will Bürgermeister werden – sehr zum Verdruss Brunos…
Doch nicht genug: Bruno, geschäftstüchtiger Trüffelzüchter, verkauft zu Saisonbeginn die «schwarzen Diamanten» auf dem Markt in Sainte Alvère, als ihn sein Freund Hercule auf Ungereimtheiten hinweist: die teuren Trüffeln wurden anscheinend mit minderwertigen Chinatrüffeln gestreckt und überteuert an Pariser Hotels verkauft. Bruno nimmt sich der Sache an…
Schließlich kommt es auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt, den der Chef de police in seiner Funktion als Weihnachtsmann beehrt, auch noch zu einem Überfall auf den allseits geschätzten vietnamesischen Restaurant- und Weihnachtsmarktstand-Besitzer Nimh. Bruno ermittelt und sticht in ein Wespennest aus Intrigen. Und als Bruno und der Baron sich auf die Schnepfenjagd begeben, finden sie Hercule brutal ermordet…
Martin Walker nimmt sich in diesem seinem dritten «Bruno»-Fall einiges vor: Bandenkrieg der Vietnamesen und Chinesen, Organisiertes Verbrechen, verbunden mit dem Kolonialkrieg in Vietnam und dem Algerienkrieg, jede Menge Stoff also – meines Erachtens etwas zu viel, denn durch die Trüffelthematik, gewürzt mit oben genannten Bezügen, ist dieser Krimi thematisch überfrachtet. Dadurch, dass letztlich alle Ereignisse zusammenhängen, wirkt dieser Fall zu konstruiert, es geht zulasten der Stringenz und der Spannung: Der Mord an Hercule geschieht «so nebenbei» und geht angesichts aller anderen «Probleme» unter, wird am Ende auch mit wagen Vermutungen abgespeist.
Statt den Fall glaubhaft und durchdacht in den Mittelpunkt zu stellen, wird zu sehr auf anders abgezielt: auf das «Multitalent», den «Allrounder» Bruno. Alle seine unzähligen Vorzüge zu nennen ist unmöglich: Bruno ist nicht nur Polizist, Koch, Selbstversorger, Tennis- und Rugbylehrer, sondern auch ambitionierter Trüffelzüchter, Jäger, Kinderretter, Feuerwehr- und Weihnachtsmann. Und er ist immer und überall zur Stelle: Er besorgt Jobs, rettet mal so nebenbei ein Kind aus der Jauchegrube, wird mal schnell zum Feuerwehrmann, rettet dabei weitere Kinder. Bruno ist zum Gutmenschen hochstilisiert, ist positiv völlig überzeichnet, wirkt dadurch unglaubhaft. Überhaupt ist mir die Schwarz-Weiß-Malerei, die der Autor hier betreibt, zu flach: Böse sind nur böse und Gute nur gut. Wo bleiben Einblicke in das Seelenleben und die Entwicklung/Hintergründe/Motive, die die Bösen so böse werden lassen? Den Charakteren fehlt es insgesamt an Tiefe – sie bleiben alle sehr oberflächlich beschrieben. Dafür erhalten wir jede Menge Einblick in Brunos Seelen- bzw Liebesleben: Isabelle, Pamela, eine alleinerziehende Mutter…

Bei aller Kritik an Martin Walkers neuem Krimi «Schwarze Diamanten» mit seiner thematischen Überfrachtung und seiner psychologischen Schwarz-Weiss-Malerei: Das Buch unterhält durchaus bestens, ist prima geeignet beispielsweise als Strandlektüre - ein echter Wohlfühlkrimi!
Bei aller Kritik ist aber doch zu sagen: das Buch unterhält durchaus bestens, ist prima geeignet beispielsweise als Strandlektüre – ein echter Wohlfühlkrimi. Er enthält viel stimmige Darstellung der Atmosphäre mittels dichtem Beschreibungsstil; man bekommt regelrecht Lust, dem Departement Dordogne, dem Périgord einen Besuch abzustatten, dabei gut zu essen – natürlich mit Trüffeln und Wein… Und wenn der Folgeband die angesprochenen Fehler vermeidet: Konstruiert-gesuchte Handlung, überfrachtete Themata, Oberflächliche Figuren-Entwicklungen, teils psychologische Unglaubwürdigkeit, dann darf man sicher erwartungsvoll dem vierten «Fall» des Walkerschen Polizeichefs Bruno entgegensehen. Ich jedenfalls werde ihn bestimmt lesen. ■
Martin Walker, Schwarze Diamanten (Black Diamond), Kriminalroman, 348 Seiten, Diogenes Verlag, ISBN 978-3257067828
.
.
.
.
.
.
.
Helena Marten: «Die Kaffeemeisterin»
.
Eine unmögliche Liebe
Isabelle Klein
.
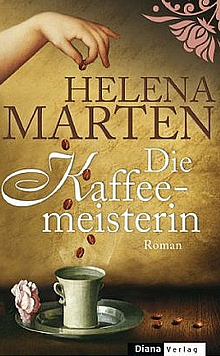 Ein ansprechend gestaltetes Cover und der verheißungsvolle Titel «Die Kaffeemeisterin» ließen mich beim Stöbern in der Buchhandlung aufmerksam werden. – Frankfurt 1732: Nach dem Tod ihres Mannes hat es die junge Johanna Berger nicht leicht das Kaffehaus «Coffeemühle» erfolgreich weiterzuführen, machen ihr doch allerlei Intrigen und Misstrauen gegenüber dem «teuflischen Getränk» Kaffee, das «süchtig macht», das Leben schwer. Doch die gewitzte Johanna lässt sich nicht unterkriegen, hat sie es doch Adam auf dem Totenbett versprochen. So mausert sie sich zu einer fähigen Geschäftsfrau, die Frankfurts ersten Damensalon aufmacht. Denn: warum soll der verführerische Genuss Frauen verwehrt bleiben?! Doch am Tag der Eröffnung schlägt Intimfeind Hoffmann erneut zu, es kommt zum Eklat. Die «Bergerin» steht unvermittelt vor dem Nichts. Es beginnt eine abenteuerliche Reise, die sie über Venedig schließlich bis ins exotische Istanbul, in den Harem des Sultans führt. Zurück lässt Johanna allerding ihre zwei Stiefkinder und auch ihre knospende Bekanntschaft mit dem jüdischen Musiker Gabriel Stern, der ihre große, aber unerfüllbare Liebe zu werden scheint …
Ein ansprechend gestaltetes Cover und der verheißungsvolle Titel «Die Kaffeemeisterin» ließen mich beim Stöbern in der Buchhandlung aufmerksam werden. – Frankfurt 1732: Nach dem Tod ihres Mannes hat es die junge Johanna Berger nicht leicht das Kaffehaus «Coffeemühle» erfolgreich weiterzuführen, machen ihr doch allerlei Intrigen und Misstrauen gegenüber dem «teuflischen Getränk» Kaffee, das «süchtig macht», das Leben schwer. Doch die gewitzte Johanna lässt sich nicht unterkriegen, hat sie es doch Adam auf dem Totenbett versprochen. So mausert sie sich zu einer fähigen Geschäftsfrau, die Frankfurts ersten Damensalon aufmacht. Denn: warum soll der verführerische Genuss Frauen verwehrt bleiben?! Doch am Tag der Eröffnung schlägt Intimfeind Hoffmann erneut zu, es kommt zum Eklat. Die «Bergerin» steht unvermittelt vor dem Nichts. Es beginnt eine abenteuerliche Reise, die sie über Venedig schließlich bis ins exotische Istanbul, in den Harem des Sultans führt. Zurück lässt Johanna allerding ihre zwei Stiefkinder und auch ihre knospende Bekanntschaft mit dem jüdischen Musiker Gabriel Stern, der ihre große, aber unerfüllbare Liebe zu werden scheint …
Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich, nach der «Porzellanmalerin», um das zweite Werk des Autorenduos Helena Marten. Gemäß Verlagsangaben besteht dies aus Autorinnen, die beide in der Verlagsbranche arbeiten. Eines ist dieser Roman sicherlich: eine unterhaltsame Lektüre, gepaart mit einer problematischen Liebesgeschichte, vor historischer Kulisse mit exotischen Schauplätzen. Er liest sich leicht, die Sprache ist sehr eingängig und einfach, bildhaft, teils auch banal (mit sehr vielen Ausrufesätzen). Da wird beispielsweise geplumpst, geschmissen oder losgelegt. Oder schon mal der Schwester des Sultans das Wort «Hallo» in den Mund gelegt. Wer drückte sich zur damaligen Zeit wohl so aus?! Von vgaloppierenden Hunden» ganz zu schweigen…
Sollte ein historischer Roman nicht mehr aufweisen?! Nämlich einen gewissen «Mehrwert» – ich möchte Neues erfahren. Doch außer rudimentären Kenntnissen über die Kaffeezubereitung wird hier nichts geboten. Zudem möchte ich in die Geschichte hineingezogen, an Schauplätze versetzt werden, die dicht beschrieben sind. Stattdessen ist Lokalkolorit Mangelware: Johannas Venedig wird zwar bildhaft beschrieben, doch nicht atmosphärisch ausgearbeitet. Auch Istanbul bleibt bloßer Handlungshintergrund für einen kurzen Ausflug in den Harem. Diesbezüglich hat das Autorenduo jede Menge Potenzial verschenkt: Johanna hastet innerhalb nicht einmal eines Jahres (und 100 Seiten) von Frankfurt über Venedig nach Istanbul und via Neapel wieder zurück. Wie glaubhaft ist es solches anno 1733? Eine anstrengende Reise innerhalb dieser Zeitspanne zu bewältigen, nebenbei noch zur Kaffeemeisterin des Sultans aufzusteigen und zwei neue Sprachen zu erlernen?

Schlecht ist Helena Martens neuer Roman «Die Kaffeemeisterin» keineswegs. Nur leider historisch sehr schwammig bis fragwürdig. Ein Historischer Roman sollte vor allem authentisch und korrekt sein. Ich bevorzuge pralle «Sittengemälde» a la Rebecca Gable, wo sich überzeugende und fein gezeichnete Gestalten glaubhaft verhalten und entsprechend handeln. Und wo ich quasi nebenbei jede Menge Neues aus alter Zeit erfahre. Dies alles fehlt bei Helena Marten – schade.
Dieser historische Roman ist also vor allem eines: Anachronistisch mit seiner Hauptfigur Johanna, die über Giovanna zu Yuhanissa mutiert. Sie wird als «stark und faszinierend» beschrieben, ist aber erstaunlich naiv. Sie reist alleine nach Venedig – wie das bitte zu einer Zeit, in welcher Frauen alleine nicht mal das Haus verließen?! Oder: Sie besucht einen jüdischen Musiker zu Hause und gibt zur Begrüßung die Hand.
Die Protagonistin, eigentlich eine sympathische Figur, ist leider schablonenhaft ausgearbeitet. Sie meistert jede Situation, aber überzeugt weder als historische Gestalt noch als Mensch wirklich, sie bleibt vorhersehbar und seltsam blutleer, außerdem naiv in ihren Gedankengängen wie in ihren Verhaltensweisen. Die Beziehung zu dem «faszinierenden, großäugigen und sensiblen» Musiker Gabriel bleibt weitestgehend «auf der Strecke». Dennoch erkennen beide vom ersten Augenblick an die gegenseitige Anziehung und können einander nicht vergessen…
Aber bei aller Kritik: Schlecht ist dieser Roman keineswegs. Nur leider historisch sehr schwammig bis fragwürdig. Zudem fehlt im dritten Teil, als Johanna wieder in Frankfurt/Main ankommt, der rote Faden; Hier reihen sich mehr oder weniger Ereignisse, und alles endet recht vorhersehbar.
Ein historischer Roman sollte vor allem authentisch und historisch korrekt sein. Ich bevorzuge pralle «Sittengemälde» a la Rebecca Gable, wo sich überzeugende und fein gezeichnete Gestalten glaubhaft verhalten und entsprechend handeln. Und wo ich außerdem, quasi nebenbei, jede Menge Neues aus alter Zeit erfahre. ■
Helena Marten, Die Kaffeemeisterin, 512 Seiten, Diana Verlag, ISBN 3453290607
.
.
.
Gisa Pauly: «Die Hebamme von Sylt»
.
Interessantes Sujet – schlecht realisiert
Isabelle Klein
.
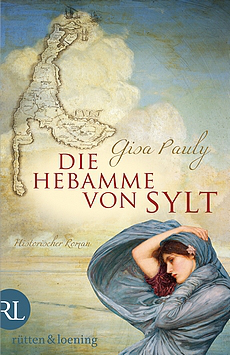 In einer stürmischen Sommernacht des Jahres 1872 werden im Haus der Sylter Hebamme Geesche zwei Kinder geboren, deren künftiges Leben nicht unterschiedlicher verlaufen könnte: Hanna und Elisa. Und 16 Jahre später hat sich so einiges im Leben der Protagonisten anders entwickelt als geplant: Geesches Verlobter hat sich das Leben genommen, und der Leser erfährt recht schnell, dass auf dem Gewissen der Hebamme ein furchtbares Geheimnis lastet, das mit der Geburt der beiden Mädchen verbunden ist. Der Bau der Inselbahn bringt den Tourismus nach Sylt, und sowohl Geesche als auch Hanna profitieren davon. Die Hebamme beherbergt den Hamburger Arzt Leonard Nissen, der ihr Avancen macht. Doch auch Marius Rodenberg, der uneheliche Sohn eines Grafen, kehrt beruflich auf die Insel zurück und umwirbt sie erneut. Pünktlich zur Sommerfrische treffen schließlich wieder Graf von Zederlitz samt Frau und Tochter Elisa zum jährlichen Aufenthalt auf der Insel ein. Sehr zur Freude Hannas, die sich als Elisas Mädchen für alles ein Zubrot verdient. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf durch Hannas intrigantes Wesen, durch Elisas unbekümmerte Verliebtheit in Hannas Stiefbruder Ebbo – und durch das 16 Jahre zurückliegende große Geheimnis. Doch damit nicht genug: Sogar die Königin Rumäniens stattet der aufstrebenden Insel einen Besuch ab, zu guter Letzt sorgt ein schwarz gekleideter, unheimlicher Fremder für Aufruhr und mysteriöse Verwicklungen; erst wird der Initiator des Inselbahnbaus, ein Dr. Pollacsek beraubt – und dann wird ein Mann ermordet…
In einer stürmischen Sommernacht des Jahres 1872 werden im Haus der Sylter Hebamme Geesche zwei Kinder geboren, deren künftiges Leben nicht unterschiedlicher verlaufen könnte: Hanna und Elisa. Und 16 Jahre später hat sich so einiges im Leben der Protagonisten anders entwickelt als geplant: Geesches Verlobter hat sich das Leben genommen, und der Leser erfährt recht schnell, dass auf dem Gewissen der Hebamme ein furchtbares Geheimnis lastet, das mit der Geburt der beiden Mädchen verbunden ist. Der Bau der Inselbahn bringt den Tourismus nach Sylt, und sowohl Geesche als auch Hanna profitieren davon. Die Hebamme beherbergt den Hamburger Arzt Leonard Nissen, der ihr Avancen macht. Doch auch Marius Rodenberg, der uneheliche Sohn eines Grafen, kehrt beruflich auf die Insel zurück und umwirbt sie erneut. Pünktlich zur Sommerfrische treffen schließlich wieder Graf von Zederlitz samt Frau und Tochter Elisa zum jährlichen Aufenthalt auf der Insel ein. Sehr zur Freude Hannas, die sich als Elisas Mädchen für alles ein Zubrot verdient. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf durch Hannas intrigantes Wesen, durch Elisas unbekümmerte Verliebtheit in Hannas Stiefbruder Ebbo – und durch das 16 Jahre zurückliegende große Geheimnis. Doch damit nicht genug: Sogar die Königin Rumäniens stattet der aufstrebenden Insel einen Besuch ab, zu guter Letzt sorgt ein schwarz gekleideter, unheimlicher Fremder für Aufruhr und mysteriöse Verwicklungen; erst wird der Initiator des Inselbahnbaus, ein Dr. Pollacsek beraubt – und dann wird ein Mann ermordet…

Obschon Gisa Paulys Roman «Die Hebamme von Sylt» durchaus interessant den Schwerpunkt auf die Darstellung von Sylt während dessen touristischer Pionierzeit legt, ist von einer Lektüre abzuraten, denn wer Wert legt auf einen gut geschriebenen, flüssig erzählten, menschlich überzeugenden, spannungsreich konzipierten historischen Roman mit lebendigen Charakteren und unvorhersehbaren «Geheimnissen», der geht beim neuen «Pauly» leider leer aus.
Soweit der Inhalt von Gisa Paulys historischem Roman «Die Hebamme von Sylt» – doch noch selten ist mir derart schwer gefallen, den Inhalt eines Buches zusammenzufassen. Es gibt hier einfach zu viele unverbundene Handlungsstränge, selbst die erklärte Hauptfigur des Romans, die Hebamme Geesche bleibt nur eine Protagonistin unter vielen. Demgegenüber wird das angekündigte «Geheimnis» jedem Leser von Beginn an ersichtlich, ist lediglich plakative Werbung auf dem Cover. Wie gesagt: Die Handlung wird durch ständige überflüssige Details und viel zu ausführliche Beschreibungen permanent «unterbrochen». Lange Satzkonstrukte und gleichzeitig eine eher simple Sprache lassen das Lesen zu einer belletristischen Durstrecke geraden. Wenn ich ausführlichste Beschreibungen von Gebäuden und Handlungsschauplätzen möchte, lese ich einen Reiseführer, aber zuallerletzt einen historischen Roman. Durch exzessive Hintergrundinformierung und detaillierteste Beschreibung kleinster Handlungsabläufe wie sämtlicher mitwirkenden Personen kann sich die Geschichte Geesches nicht wirklich entfalten; hier wäre eine Fokussierung bzw. Straffung des fast 500-seitigen Textes wichtig gewesen.
Auch die anderen Protagonisten neben der Hebamme bleiben blass, noch schlimmer: eindimensional gezeichnet. Pauly betreibt hier eine extreme Schwarz-Weiß-Malerei. Hanna z.B. ist durchwegs unangenehm und verkommen; Geesche viel zu festgefahren. Das sind keine «echten» Menschen, sondern Schemata. Dazu trägt wesentlich bei, dass die Autorin weitestgehend auf ein «Innenleben» ihrer Figuren verzichtete; Der Leser erfährt praktisch nichts über deren Ängste, Sorgen, Gefühle. Besonders abstrus empfand ich aber das letzte Viertel des buches: Erst passiert hunderte von Seiten beinahe nichts, was das Geschehen hin auf das «tödliche Geheimnis» vorantriebe – und dann auf einmal verschiedenste Tote. Ein absolut hanebüchenes Buch-Ende, ein finaler, aber aufgesetzter Showdown – unglaubwürdig.
Obschon also Gisa Paulys Roman «Die Hebamme von Sylt» durchaus interessant den Schwerpunkt auf die Darstellung von Sylt während dessen touristischer Pionierzeit legt, ist von einer Lektüre abzuraten, denn wer Wert legt auf einen gut geschriebenen, flüssig erzählten, menschlich überzeugenden, spannungsreich konzipierten historischen Roman mit lebendigen Charakteren und unvorhersehbaren «Geheimnissen», der geht beim neuen «Pauly» leider leer aus. ▀
Gisa Pauly, Die Hebamme von Sylt, Roman, 495 Seiten, Rütten&Loening (Aufbau Verlag), ISBN 978-3352008023
.
.
.
.
Rebecca Stott: «Die Korallendiebin»
.
Zwischen Homologie und Transformation
Isabelle Klein
.
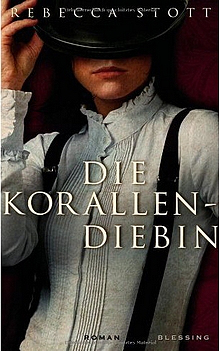 Bereits auf den ersten Blick ist dieses Buch etwas Besonderes; das zeigt sich visuell zunächst an dem wunderschön gestalteten und sehr treffend gewählten Vorsatzblatt, dann an den Abbildungen, die immer wieder in den Text eingeschoben werden. Aber auch erzählerisch hält dieser Roman, was der Klappentext verspricht. Dies ist einer Autorin zu verdanken, deren wissenschaftlicher Hintergrund den ganzen Roman hindurch präsent ist. Rebecca Stott, Jahrgang 1964, ist Professorin für Englische Literatur sowie für Creative Writing an der University of East Anglia. Mit «Die Korallendiebin» liegt nun ihr zweiter Roman vor.
Bereits auf den ersten Blick ist dieses Buch etwas Besonderes; das zeigt sich visuell zunächst an dem wunderschön gestalteten und sehr treffend gewählten Vorsatzblatt, dann an den Abbildungen, die immer wieder in den Text eingeschoben werden. Aber auch erzählerisch hält dieser Roman, was der Klappentext verspricht. Dies ist einer Autorin zu verdanken, deren wissenschaftlicher Hintergrund den ganzen Roman hindurch präsent ist. Rebecca Stott, Jahrgang 1964, ist Professorin für Englische Literatur sowie für Creative Writing an der University of East Anglia. Mit «Die Korallendiebin» liegt nun ihr zweiter Roman vor.
Er erstellt einen Katalog über das gesamte Tierreich, eine Beschreibung sämtlicher Arten der Welt. Kein Wunder, dass er überlastet ist. (…) Das muss man sich mal vorstellen – alle Arten dieser Erde werden dort vertreten sein.‘ Was für ein faszinierender Gedanke, meinen Namen unter anderen auf der Titelseite eines dieser Bände zu lesen! (S. 138)
Juli 1815: Napoleon ist auf dem Weg in die Verbannung, das Zeitalter der Restauration beginnt: der 21jährige Anatomiestudent Daniel Connor reist von Edinburgh nach Paris. Im Handgebäck hat er seltene Fossilien und ein Empfehlungsschreiben für den berühmten Baron Georges Cuvier. Er will Cuvier bei dem äußerst ehrgeizigen Projekt als Forschungsassistent zur Seite stehen.
Kurz vor dem Ziel wird eine faszinierende Unbekannte, samt ihrer kleinen Tochter, zu seiner Reisebegleitung. Mit fatalen Folgen, entpuppt sie sich doch als «die Korallendiebin», die sowohl die wertvollen Fossilien als auch Empfehlungsschreiben und private Notizbücher des aufstrebenden Akademikers entwendet. Zurück bleibt ein am Boden zerstörter Daniel, der Hilfe bei Surete-Chef Jagot (angelehnt an die historische Gestalt Vidocqs) sucht. Denn Lucienne Bernard ist Teil eines gesuchten Diebespaares, mit dem Jagot noch eine Rechnung offen hat.
Während Paris den unbedarften Jungen aus der Provinz langsam in seinen Bann zieht, wird die immer wieder auftauchende Lucienne, zu seiner Obsession. Ein undurchschaubares Verwirrspiel beginnt. Dadurch wird eine Entwicklung in Gang gesetzt, die der junge Forscher in seinen kühnsten Träumen nicht erwartet hätte und ihn auf vollkommen neue Pfade führt.
Es gibt einen Hunger, der sich nie stillen lässt. Je mehr man isst, desto mehr will man haben. 1814 in Paris konnte ich nie genug von ihr bekommen, der Diebin, der Korallensammlerin, der Frau, die wusste oder zu wissen meinte, wie die Zeit begann. Ich wurde nie satt von ihr. Ich hätte alles für sie riskiert. (S. 263)
«Die Korallendiebin» vermag von Beginn an eines meisterhaft: den ahnungslosen Leser mit einer unheimlichen Sogkraft in das Paris des beginnenden 19. Jahrhunderts hineinzuziehen. Stott lässt ein Seine-Stadt der Kontraste vor dem Auge des Lesers auferstehen, ein Paris, das noch durch den Geist und die Eroberungen Bonapartes geprägt ist, das vor dem Hintergrund der Revolution unsagbare Grausamkeiten erdulden musste und nun der Restauration, nach dem verloren Krieg mit England, entgegensieht. Die wunderbaren Kunstschätze, die Napoleon auf seinen diversen Feldzügen erbeutet hat, bilden den Ausgangspunkt der unvergleichlichen «Museenpracht» und lassen es zum kulturellen und wissenschaftlichen Zentrum Europas werden. Bis ins Kleinste hat die Autorin diese Stadt in all ihren Facetten und Widersprüchlichkeiten nachgezeichnet. Ein Roman, der mich vor allem durch seinen Lokalkolorit und die damit atmosphärische Dichte in seinen Bann gezogen hat.
‚Sind Sie eine Schülerin des Transformisten Lamarcks?‘
‚Ich war es. Lamarck hat in fast allem recht. Die Arten sind nichts Unveränderliches. Alles ist im Fluss. Die Tiere, die Menschen, die Berge – selbst Kleinigkeiten, Haut, Haare, alles erneuert sich unablässig. Bedenken Sie, woher wir kamen –aus dem Meer, primitive Geschöpfe ohne Augen oder Herz oder Hirn-, und bedenken Sie, was aus uns noch werden kann. Finden Sie das nicht aufregend?‘ (S. 14)
Hinzu kommt der äußerst spannende und kurzweilige wissenschaftliche Diskurs zwischen Transformisten und Homologisten. Wie entstanden die Arten? Was für heute durch Charles Darwins Werk «Über die Entstehung der Arten» Allgemeingut geworden ist, war damals ein höchst ketzerischer Gedankengang. Obwohl bereits Philosophen der Antike wie z.B. Aristoteles Gedanken über die Transformation in den Raum stellten, ist man im Abendland auch 1815 noch tief von religiösen Vorstellungen geprägt. Lamarck und seine Anhänger mit ihrer Entwicklungshypothese wurden als Avantgarde von führenden Wissenschaftlern wie Cuvier belächelt und diskreditiert.
Der große Pluspunkt, der dieses belletristische Werk von der Masse abhebt, ist seine wunderbare Sprache. Anspruchsvoll wird der Leser an diversen Stellen zum Mitdenken und vor allem Nachdenken angeregt. Sehr detaillierte Beschreibungen, ein ungeheure Bildhaftigkeit sowie Lebendigkeit und geistreiche Dialoge machen das Ganze zu einem Leseerlebnis der besonderen Art.

Rebecca Stotts «Die Korallendiebin» ist brillant und lehrreich geschrieben, Fakt und Fiktion sind gekonnt verwoben. Intelligente Unterhaltung auf hohem Niveau!
Neben diesen Vorzügen der Thematik und der atmosphärischen Dichte ist auch Kritik anzumelden: Dies «wunderbare Liebesgeschichte», die der Klappentext verspricht, ist für mich eine «zweischneidige» Sache. So wird für den jungen Daniel die rund 20 Jahre ältere Lucienne doch sehr schnell zu einer «Obsession», die sein Leben für kurze Zeit komplett umkrempelt. (Insofern wieder eine interessante Beziehung zweier grundlegend verschiedener Charaktere, die hauptsächlich auf Faszination durch die Andersartigkeit beruht.) Daniels Lucienne ist dabei zwar eine äußerst interessante Figur, eine «femme exceptionelle», doch auch im Frankreich der Libertinage, in einer Zeit der Freidenker und Avantgardisten erscheint vieles aus ihrer Biografie doch reichlich anachronistisch, vor allem durch die Häufung ihrer ungewöhnlichen Erlebnisse und Reisen. Außerdem erscheint Daniel über weite Passagen denn doch zu zaghaft gezeichnet, um zu überzeugen; Die Spannung leidet dadurch, v.a. im ersten Drittel. Dafür überschlagen sich dann einige Ereignisse gegen Ende hin – hier wäre ein konstanter Spannungsbogen von Vorteil gewesen. Doch alles in allem: Brillant geschrieben, zudem psychologisch durchdacht und ausgefeilt – intelligente Unterhaltung. ▀
Rebecca Stott, Die Korallendiebin (Originaltitel: The Coral Thief), Roman, 352 Seiten, Karl Blessing Verlag, ISBN 978-3896673398
.
.
.










leave a comment