Alice Sara Ott: Chopin – «Complete Waltzes»
.
Pianistik voller wunderbarer Leichtigkeit
Jan Bechtel
.
 Im Jahre 1810 wird in Polen ein Mann geboren, der bis heute als einer der bedeutendsten und wegweisendsten Pianisten und Komponisten des 19. Jahrhunderts angesehen wird: Frédéric François Chopin (eigentlich: Fryderyk Franciszek Waltyr Chopin; polnisch auch Fryderyk Franciszek Waltyr Szopen).
Im Jahre 1810 wird in Polen ein Mann geboren, der bis heute als einer der bedeutendsten und wegweisendsten Pianisten und Komponisten des 19. Jahrhunderts angesehen wird: Frédéric François Chopin (eigentlich: Fryderyk Franciszek Waltyr Chopin; polnisch auch Fryderyk Franciszek Waltyr Szopen).
Sein Geburtsdatum ist nicht genau belegt, und so weiß man heute nicht mehr, ob Chopin, wie in seiner Taufurkunde vermerkt ist, am 22. Februar 1810 oder erst am 1. März 1810 (wie er es selber angab) geboren wurde. Sein Geburtsort ist Zelazowa-Wola (Herzogtum Warschau); mit sechs Jahren erhält der Junge den ersten Klavierunterricht, da man seine außerordentliche Begabung erkannt hatte. Sein Lehrer wird der böhmische Violinist und Komponist Wojciech Adalbert Zwyny, der den jungen Chopin von 1816 bis 1822 unterrichtet. Ab 1822 (bis 1829) nimmt er am Konservatorium bei Joseph Elsner zusätzlich Unterricht in Musiktheorie.
Schon früh wird er ein Liebling der Salons und reißt die polnischen Aristokraten immer wieder zu Begeisterungstürmen hin. 1831 übersiedelt er dann endgültig von Polen nach Paris (von 1829 und 1831 war er ständig zwischen Warschau, Wien und Paris hin und her gependelt). Auch in Paris wird er schnell zum Liebling des dortigen Publikums in den Salons der Stadt. Der Konzertsaal ist nie wirklich Chopins Terrain gewesen, und er steht jedes Mal vor einem Auftritt «Höllenqualen» aus, weil ihn die «anonyme Menge» des Publikums zutiefst irritiert und ihm «die Luft zum Atmen nahm». In den feinen Salons, in denen nur wenige Betuchte und Aristokraten verkehren, fühlt sich Chopin viel freier und kann seine ganze Virtuosität frei entfalten.
Sein Privatleben ist eigentlich eher ruhig, von Krankheit gezeichnet. Einzig das Verhältnis zu George Sand, einer berühmten französischen Schriftstellerin, bringt ein bisschen «Aufregung» in Chopins Leben. Es ist insgesamt die längste Beziehung, die Chopin zu Lebzeiten eingegangen ist. Warum es zum Bruch zwischen Chopin und Sand kam, ist bis heute nicht ganz geklärt.
Im Verlauf des Jahres 1847 verschlechtert sich Chopins Gesundheitszustand rapide, und 1848 gibt er sein letztes öffentliches Konzert im Hause Pleyel. Am 17. Okotber 1849 stirbt Frédéric Chopin mit nur 39 Jahren in seiner Wohnung am Place Vendôme in Paris. Todesursache ist vermutlich die ihn schon länger quälende Mukoviszidose. Er wird auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris beigesetzt. Sein Herz wird auf eigenen Wunsch nach Warschau gesandt und dort in der Heiligkreuz-Kirche beigesetzt. Heute wird Frédéric Chopin als der polnische Nationalkomponist angesehen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts war Chopin, ähnlich wie Franz Liszt, Vorbild für einige der bedeutendsten Pianisten-Komponisten, unter ihnen etwas Sergej Rachmaninow und Alexander Skrjabin, die Chopin zu einigen ihrer Kompositionen anregte.
Chopin schuf seine Walzer für Klavier in den Jahren zwischen 1827 und 1846/47. Seine «Valses» haben in engerer Bedeutung nichts mit dem Wiener Walzer eines Johann Strauß (Sohn) und anderer Walzer-Komponisten zu tun. Sie sind im besten Sinne Salonmusik (einzig die Walzer op. 70 haben ein wenig von dem typischen «Tanzwalzer»-Charme, wenn auch nur sehr rudimentär). Chopins erster Walzer ist der Walzer As-Dur KK Iva Nr. 13 von 1827 (KK = Krystyna Kobylanska. Thematisches-biographisches Werkverzeichnis). In der Folge schreibt Chopin noch weitere Walzer, unter ihnen die berühmt gewordenen Walzer Es-Dur op.18 (Grande Valse brillante, 1831), Des-Dur op.64 Nr. 1 («Minutenwalzer», 1846/47) und op. post. 69 Nr.1 («Abschiedswalzer», 1835). Die Walzer op.64, die nur einige Jahre vor seinen Tod (1846/47) entstanden, sind der letzte Beitrag Chopins zur Gattung des Walzers für Klavier.
Anlässlich des aktuellen 200-Jahr-Jubiläums Chopins hat die DGG ein Album mit sämtlichen Walzern des Komponisten mit der jungen deutsch-japanischen Pianistin Alice Sara Ott herausgegeben. Alice Sara Ott wird 1988 in München als Tochter eine deutschen Vaters und einer japanischen Mutter geboren. Schon früh entdeckt sie die Liebe zum Klavier und wird bald, zunächst gegen den Willen der Mutter, zur Konzertpianistin ausgebildet. Seitdem hat sie einige Auszeichnungen und Stipendien erhalten. Sie hat einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon Gesellschaft (DG). Die Aufnahme der Walzer Chopins ist ihre zweite für das «Gelblabel», nachdem sie zuvor die «Etudes pour l‘ execution transcendante» von Franz Liszt eingespielt hatte.
Alice Sara Ott ging es, nach eigenem Bekunden, bei der Aufnahme der Walzer nicht darum, eine besonders introvertierte und intellektuelle Einspielung der Werke vorzulegen, sondern den «Duft» der Werke nachzuspüren. Sie sieht in jedem Walzer ein für sich abgeschlossenes Werk und arbeitet dessen «Eigenheiten» akribisch heraus. Dabei gelingt es Ott allerdings, eine wunderbare Leichtigkeit zu erzeugen und die «Stimmung» der einzelnen Stücke sehr schon einzufangen. Es geht ihr, wie man aus jedem Ton hört, nicht um eine eitle Selbstdarstellung. Alice Sara Ott steckt mit ihrer Spielfreude sogar regelrecht an und man könnte die knapp 60 Minuten lange CD immer und immer wieder hören. Sicher kann man jetzt einwenden, dass es schon eine Reihe namhafter Einspielungen dieser Walzer mit etablierten Pianisten gibt, und es mag die Frage laut werden, ob bei einer solch hochkarätigen Auswahl eine Neueinspielung der Werke nötig war. Dazu kann ich persönlich nur sagen: Es ist sicher richtig, dass es viele hervorragende Aufnahmen der Walzer gibt, u. a. von Vladimir Ashkenasy, dessen Gesamteinspielung der Chopin-Werke für Klavier solo ja eine absolute Referenz darstellt. Dennoch bietet Alice Sara Otts Interpretation eine gelungene Alternative zu den etablierten Aufnahmen. Wer Chopin einmal betont jugendlich-frisch und aus einem anderen «Blickwinkel» erleben möchte, der ist bei dieser japanisch-deutschen Künstlerin genau richtig.
Die Tempi sind manchmal vielleicht etwas sehr forsch, aber niemals zu schnell. Otts Spiel ist wunderbar transparent und macht einfach Lust auf mehr. Wenn man ihr zuhört, dann werden die Schwierigkeiten, die diese Musik u. a. interpretatorisch mit sich bringt, in die Bedeutungslosigkeit verbannt. Ihr leichter, perlender Anschlag passt wunderbar zu diesen Walzern. Für mich, der ich selbst auch – wenngleich sozusagen nur für den Hausgebrauch – Pianist bin, ist diese Neueinspielung der Walzer eine absolute Bereicherung und Entdeckung. Ich kann nur jedem Liebhaber von klassischer Musik bzw. Klaviermusik raten, sich diese Aufnahme zuzulegen und sich selbst ein «Bild» zu machen. Sie ist in jedem Fall eine willkommene Ergänzung der etablierten Einspielungen und muss sich hinter diesen keinesfalls verstecken! ■
Alice Sara Ott: Chopin, Complete Waltzes, Deutsche Grammophon Gesellschaft
.
.
.
Rafael Kubelik / Berliner Philharmoniker: Die Schumann-Sinfonien
.
Packende und klangschöne Orchester-Romantik
Jan Bechtel
.
 Chopin und Schumann könnten in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag feiern, und zudem gedenkt heuer die Musikwelt Gustav Mahlers 150. Todestag. Pünktlich hierzu lassen es sich die großen Labels nicht nehmen einige «Schätze» aus ihren Archiven wieder frisch aufzulegen oder ihnen zumindest ein neues «Layout» zu geben. So hat nun die Deutsche Grammophon Gesellschaft (DGG) eine Aufnahme der vier Symphonien Robert Schumanns mit Rafael Kubelik am Pult der Berliner Philharmoniker in ihrer Reihe «The Originals» wieder neu herausgegeben. Die kürzlich auf zwei CDs wiederveröffentlichte Einspielung erschien ursprünglich auf drei einzelnen LPs in den Jahren 1963/64. Dabei befanden sich die Symphonien Nr. 1 und 4, die Symphonie Nr. 3 und die «Manfred»-Ouvertüre sowie die Symphonie Nr. 2 und die Ouvertüre zu «Genoveva» auf einer LP. (Die Aufnahme der 3. Symphonie und der «Manfred»-Ouvertüre wurde im Jahr 1965 mit dem Grand Prix des Discophiles ausgezeichnet.)
Chopin und Schumann könnten in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag feiern, und zudem gedenkt heuer die Musikwelt Gustav Mahlers 150. Todestag. Pünktlich hierzu lassen es sich die großen Labels nicht nehmen einige «Schätze» aus ihren Archiven wieder frisch aufzulegen oder ihnen zumindest ein neues «Layout» zu geben. So hat nun die Deutsche Grammophon Gesellschaft (DGG) eine Aufnahme der vier Symphonien Robert Schumanns mit Rafael Kubelik am Pult der Berliner Philharmoniker in ihrer Reihe «The Originals» wieder neu herausgegeben. Die kürzlich auf zwei CDs wiederveröffentlichte Einspielung erschien ursprünglich auf drei einzelnen LPs in den Jahren 1963/64. Dabei befanden sich die Symphonien Nr. 1 und 4, die Symphonie Nr. 3 und die «Manfred»-Ouvertüre sowie die Symphonie Nr. 2 und die Ouvertüre zu «Genoveva» auf einer LP. (Die Aufnahme der 3. Symphonie und der «Manfred»-Ouvertüre wurde im Jahr 1965 mit dem Grand Prix des Discophiles ausgezeichnet.)
Der Dirigent der vorliegenden Aufnahmen ist Rafael Kubelik, ein Schweizer Komponist und Dirigent tschechischer Herkunft. Er wurde am 29. Juni 1914 in Bychory (Schloss Horskyfeld)/Tschechische Republik geboren, als Sohn des berühmten Geigers Jan Kubelik. Rafael Kubelik war v.a. bekannt für herausragende Interpretationen der Werke von Komponisten seiner Heimat, u.a. Janacek und Dvorak. Auch das Orchester-Oeuvre Gustav Mahlers stand im Fokus seines dirigentischen Schaffens. Seine bedeutendste Anstellung war die des Chefdirigenten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (1961–79, als Nachfolger von Eugen Jochum, der das Orchester 1949 gegründet hatte). Von 1955 bis 1958 war er Chief Administrator des Royal Opera House Covent Garden London.
1948 verließ er die Tschechische Republik und ging in die USA (1973 nahm er die Schweizer Staatsbürgerschaft an). Erst 1990 kehrte er auf Einladung des damaligen tschech. Präsidenten Vaclav Havel in seine Heimat zurück. 1984 zog er sich von der Musikbühne zurück, um sich dem Komponieren zu widmen. Am 11. August 1996 starb Kubelik mit 82 Jahren in Kastanienbaum (Schweiz), bestattet wurde er auf dem Vyscherader Friedhof in Prag.
Kubelik war berühmt und geschätzt dafür, dass er die Partituren der dirigierten Werke perfekt kannte. Und auch sein kollegialer Umgang mit den Orchestermusikern trug ihm große Zuneigung ein.
Dass Kubelik sich intensiv mit den Werken auseinandersetzte, die er aufführte, zeigen auch seine Aufnahmen der vier Symphonien Schumanns, die er Mitte der 1960er Jahre mit Karajans «Berlinern» einspielte. Schumanns Werke hatten zuvor zwar nie großen Raum in seinen Konzerten eingenommen, dennoch kannte und liebte Kubelik die Symphonien Schumanns. (Die Aufnahmesitzungen fanden übrigens in den Jahren 1963/64 in der Berliner Jesus-Christus-Kirche im Stadtteil Dalem statt, die ein sehr berühmter Aufnahme-Ort geworden war; zahlreiche großartige Einspielungen entstanden in dem Sakralbau, u.a. machte Herbert von Karajan hier einige seiner ganz großen Aufnahmen.)
Mit den Berliner Philharmonikern, die erstmals 1957 bei den Salzburger Festspielen mit Kubelik zusammengearbeitet hatten, verband den Dirigenten schon nach kurzer Zeit ein besonders vertrautes Verhältnis. Die hier besprochene Einspielung gibt ein beredtes Zeugnis davon. Kubelik und den «Berlinern» gelang ein Interpretationsansatz, der Schumanns Musik wundervoll Rechnung trägt. Er wählt einen sehr «sanften» Zugang, was Schumanns Musik gut bekommt, und dokumentiert dadurch eindringlich, welche Qualitäten Schumann als Symphoniker hatte (und dass die Behauptung mitnichten stimmt, er habe «keine Ahnung» von Instrumentierung/Orchestrierung gehabt – ein «Argument», das sich hartnäckig auch im 19. Jahrhundert hielt). Wie schon u.a. George Szell und Wolfgang Sawallisch schuf Kubelik damit einen Schumann-Zyklus, der beweist, dass Schumanns Musik auch nicht sperrig und schwülstig klingen muss. Kubeliks Tempi sind durchaus straff, aber niemals gehetzt, und auch das andere Extrem, das Dahinschleppen gerade der langsamen Sätze, vermeidet Kubelik.

Kubelik als Interpret tschechischer Musik: Smetanas «Moldau» in der Prager Philharmonie 1990 (Klangbeispiel: Youtube)
Die 1. Symphonie macht ihrem Namen («Frühlingssymphonie») bei Kubelik alle Ehre. Sie kommt gleichsam als ein frischer Frühlingshauch daher, die langsame Einleitung ist kräftig herausgearbeitet, und der Übergang zum Hauptteil ist einfach großartig gelungen. Das Larghetto erinnert mich an einen lauen Frühlingsabend, wenn ein leises Lüftchen weht und eine gelassene, lockere Stimmung herrscht. Das Scherzo wiederum ist ein sehr prägnantes, zupackendes Stück, und Kubelik geht es entsprechend energisch und markig an, das Finale schließlich trumpft wieder absolut «majestätisch» auf. Mit seinen Schlussakkorden endet eine überzeugende Einspielung dieser Symphonie.
Schumanns C-Dur Symphonie op.61 ist ja ein eher selten gespieltes Werk. Das «Juwel» des ganzen Opus ist zweifelsohne sein langsamer Satz. Und Kubelik macht gerade aus diesem Satz etwas ganz Besonderes, etwas Ergreifendes, das niemanden kalt lässt. Den ganzen Schmerz, den Schumann in dieses Stück hineingeschrieben zu haben scheint, lässt Kubelik deutlich werden, indem er beinahe «hymnisch» ausdirigiert. Und obwohl er weniger Zeit als etwas George Szell für den Satz benötigt, geht kein Detail verloren. Ich persönlich habe diesen Satz selten so ergreifend interpretiert gehört wie hier unter Kubelik.
Auch Schumanns Dritte, die sog. «Rheinische» liegt hier in einer wirklich grandiosen Aufnahme vor; möglicherweise darf man sogar von einer Referenzaufnahme sprechen. Die beiden Ecksätze werden majestätisch musiziert; es soll wohl der Besuch des Kölner Doms darstellt werden, und in der Tat kann man regelrecht die Ausmaße dieses sakralen Prachtbaus erahnen (wenngleich es sich hier, wie stets bei Schumann, nicht um eigentliche Programmmusik handelt). Beisternd zupackend musizieren Kubelik und die «Berliner» aber auch in den Innensätzen.
Die 4. Symphonie (d-moll) schließlich, das symphonische Gipfelwerk Schumanns: sie braucht einen sehr speziellen Interpretationsansatz, da bekanntlich ihre Sätze ohne Unterbrechung ineinander übergehen. Das Werk muss absolut «organisch» klingen, ohne hörbare Brüche, mit dezidiert fließenden Übergängen. Die langsame Einleitung zum ersten Satz nimmt Kubelik kraftvoll und energisch, der Hauptteil des Satzes schreitet betont beherzt voran, um schließlich im Scherzo bei Kubeliks Leseart in einen regelrechten Vulkanausbruch zu münden. Auch hier hat der Hörer beim Vergleichen anderer Einspielungen ein ganz besonderes Aha-Erlebnis.
Die Berliner Philharmoniker folgen Kubelik präzise durch die Werke, realisieren seine Intentionen – und stellten damit einmal mehr ihren hohen Rang in der Musikwelt unter Beweis. Alles in allem eine höchst gelungene Aufnahme der Symphonien Schumanns, die in keiner gutsortierten CD-Sammlung fehlen sollte – eine willkommene Wiederveröffentlichung einer besonders wertvollen Einspielung. ■
Rafael Kubelik, Berliner Philharmoniker, Robert Schumann, Symphonien Nr. 1-4 & Ouvertüren «Genoveva» und «Manfred», 2 CDs, Deutsche Grammophon Gesellschaft
Inhalt
CD 1
Symphonie Nr. 1 B-Dur op. 38 «Frühlingssymphonie»
Symphonie Nr. 2 C-Dur op. 61
Ouvertüre zu «Genoveva»
CD 2
Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 «Rheinische»
Symphonie Nr. 4 d-Moll op. 120 (Fassung von 1851)
«Manfred»-Ouvertüre op. 115
_______________________________
Geb. 1984 in Hann.-Münden/D, Ausbildung zum Rechtsanwalts-Fachangestellten, vielfältige musikalische Aktivitäten, lebt in Witzenhausen/D
.
.
.
.

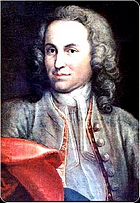













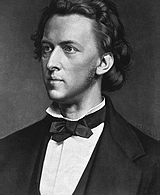













leave a comment