H.Sarkowicz & A.Mentzer: «Schriftsteller im Nationalsozialismus»
.
Kompakte und präzise Darstellung eines heiklen Themas
Jan Neidhardt
.
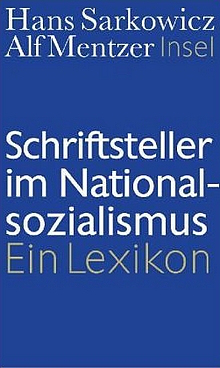 Wer sich mit der deutschen Literatur zur Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, wird wahrscheinlich zunächst an die Schriftsteller denken, die als Emigranten Deutschland verlassen haben – meist gezwungenermaßen, wie Bertolt Brecht oder die Mann-Brüder, um nur zwei bekannte Namen zu nennen. Andererseits gab es auch noch eine Menge Schriftsteller, die nicht unbedingt mit dem Naziregime konform gingen, trotzdem in Deutschland blieben und teilweise auch weiter veröffentlichten – Stichwort «Innere Emigration», landläufig zum Beispiel verbunden mit Namen wie Erich Kästner oder Ricarda Huch.
Wer sich mit der deutschen Literatur zur Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, wird wahrscheinlich zunächst an die Schriftsteller denken, die als Emigranten Deutschland verlassen haben – meist gezwungenermaßen, wie Bertolt Brecht oder die Mann-Brüder, um nur zwei bekannte Namen zu nennen. Andererseits gab es auch noch eine Menge Schriftsteller, die nicht unbedingt mit dem Naziregime konform gingen, trotzdem in Deutschland blieben und teilweise auch weiter veröffentlichten – Stichwort «Innere Emigration», landläufig zum Beispiel verbunden mit Namen wie Erich Kästner oder Ricarda Huch.
Um den weiten Bogen zum umschreiben, den das neue Lexikon «Schriftsteller im Nationalsozialismus» der beiden Autoren Hans Sarkowicz und Alf Metzner spannt, muss man zur Literatur jener Zeit die damals mengenmäßig weit überwiegenden systemkonformen Literaten mit hinzuzählen. Ein Bereich, dem sich die Literaturwissenschaft v.a. auch im populären Bereich eher ungern widmet. Schriftsteller wie Hans Grimm, Will Vesper oder Heinrich Anacker stehen in der Schmuddelecke jener Blut-und-Boden-Literatur, die heutzutage höchstens noch zeitgeschichtlich von Interesse sein kann.
Das Lexikon widmet sich in einer Gesamtschau einer Übersicht zu vielen der Autoren, die in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus erscheinen durften. Literaturgeschichtlich ist die Zeit sehr spannend und erstaunlich vielschichtig, das wird bei der Lektüre des Lexikons schnell klar. Es sei noch einmal betont: Nicht alles, was zwischen 1933 und 45 in Deutschland in Druck ging, war Nazi-Literatur. Teilweise durften selbst jüdische Autoren bis 1938 (natürlich unter erheblichen Schwierigkeiten) weiterhin veröffentlichen. Autoren der Nachkriegszeit haben damals ihre ersten Schreibversuche gemacht, zum Beispiel Marie Luise Kaschnitz, Wolfgang Koeppen, Max Frisch.
Sarkowcz und Mentzer, die sich in ihrem Band mit einem sehr breiten Spektrum an Literatur beschäftigen, fällen keine Pauschalurteile, sondern stellen in alphabetischer Reihenfolge Gegner des NS-Regimes und berüchtigte Nazi-Literaten nebeneinander. Über diese Art der Zusammenstellung von 155 so unterschiedlichen Biographien lässt sich sicher streiten. Aber ich finde die Idee gelungen, wenn man etwas über die Lebensumstände jener Zeit nicht nur unter schriftstellerischen Gesichtspunkten erfahren möchte.
Nebeneinandergestellt ohne Wertung zeigen sich oft Parallelen in den Entwicklungen, die geschichtlich bestimmt sind. Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs und die darauf folgende Phase der Weimarer Republik spielen fast immer eine Rolle, andererseits die persönlich Suche nach einer Sinngebung, die sich im künstlerisch-literarischen Schaffen niederschlägt. Spannend ist es, anhand dieses Buches besonders die gefeierten Nazidichter einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Viele von ihnen, so zeigt sich, waren Konjunkturritter, die literarisch sonst kaum eine Chance gehabt hätten, größere Aufmerksamkeit zu erzielen. An ihrem Beispiel wird aber auch das Kompetenzgerangel im kulturellen Sektor des sog. Dritten Reiches deutlich, ebenso die Tatsache, das ein gefeierter Schriftsteller schnell unter die Räder kommen konnte, wenn er es sich mit einer der verschiedenen Schaltstellen der Macht verscherzt hatte.

«Schriftsteller im Nationalsozialismus» von Sarkowicz & Mentzer ist ein interessantes Projekt, indem es die Schriftsteller aus der Zeit des Nationalsozialismus in einem biographisch orientierten Lexikon verzeichnet. Gut geeignet für alle, die sich eine Übersicht verschaffen möchten, und für alle, die auch nach weiterführenden Informationen zu bestimmten Personen suchen.
Einen weiteren Punkt zeigt das Lexikon sehr gut auf, nämlich dass die Wirkung der Literatur jener Zeit nicht Punkt 1945 schlagartig aufhörte, sondern dass die Denkweise, die hier angestoßen wurde, weiter wirkte. Mehr noch, nicht nur die vermittelten Denkweisen wirkten weiter, auch Schriftsteller dieser Zeit waren «danach» weiter im Geschäft, wie zum Beispiel Hans Baumann, der Erfinder des berüchtigten Liedes «Es klappern die morschen Knochen», der nach dem Krieg als «Geläuterter» zahlreiche (und teils bis heute beliebte) Kinderbücher schrieb. Und schließlich blieben auch viele Bücher, die in jener Zeit verfasst wurden, auch besonders die vermeintlich unpolitischen, weiterhin erfolgreich, wurden teils in entschärften Versionen noch Jahre lang neu aufgelegt. Ein Thema also, dem man sich in seiner Komplexität sehr lange widmen kann.
Den Autoren ist hier ein wirkliches Kunststück gelungen: die Literatur von 1933 bis 1945 kompakt und präzise darzustellen. Der lexikalische Hauptteil enthält 155 Biographien, durchaus auch erzählerisch ausgestaltet und nicht bloße Aneinanderreihung von Eckdaten. Es gibt ein Werkverzeichnis (meist in Auswahl) und Hinweise zur Sekundärliteratur. Das Lexikon ist natürlich als Nachschlagewerk gedacht und auch geeignet, andererseits passt es auch hervorragend zum Querlesen und Schmökern. Viele Namen mit unglaublich spannendem und dabei zeittypischem Lebenslauf sagen uns heute nichts mehr, sind aber wichtig für das literarische Gesamtbild jener Zeit. Gewiss, bei 155 Autoren bleibt letztlich die Auswahl eine subjektive, das stellen Sarkowicz und Metzner auch gar nicht in Abrede. – Herausgekommen ist ein Buch, das man sicher schon als Standardwerk bezeichnen kann, das sich aber auch für jeden Literatur- und zeitgeschichtlich Interessierten abseits des wissenschaftlichen Kontextes eignet. ▀
Hans Sarkowicz, Alf Metzner: Schriftsteller im Nationalsozialismus – Ein Lexikon, Erweiterte Neuauflage, Insel Verlag, 676 Seiten, ISBN 978-3-458-17504-9
.
.
Klaus Seybold: «Poetik der prophetischen Literatur im Alten Testament»
.
Sprachanalyse der biblischen Prophetien
Jan Neidhardt
.
 Die Propheten des Alten Testaments waren vielfach anders, als man sie sich in unserer Zeit vorstellt. Heute betrachtet man sie oft als Vorankündiger zukünftiger Ereignisse oder reduziert sie überhaupt auf Messias-Ausrufer. Hinzu kommt, dass die Bibel einen bestimmten Kanon an namentlich bekannten Propheten versammelt, jenen der sogenannten Schriftpropheten.
Die Propheten des Alten Testaments waren vielfach anders, als man sie sich in unserer Zeit vorstellt. Heute betrachtet man sie oft als Vorankündiger zukünftiger Ereignisse oder reduziert sie überhaupt auf Messias-Ausrufer. Hinzu kommt, dass die Bibel einen bestimmten Kanon an namentlich bekannten Propheten versammelt, jenen der sogenannten Schriftpropheten.
Im alten Israel war aber das Prophetentum weitaus vielfältiger: Ein Prophet war ein Mensch, der mit Gott in Verbindung stand, ein Medium, durch das Gott den Menschen seinen Willen kundtat. Das geschah in verschiedenen gesellschaftlichen Formen: Es gab Hofpropheten, Prophetenschulen und Wanderprediger, Angesehene oder auch Deklassierte, die als Propheten in Erscheinung traten.
Die Schriftpropheten, um die es im neuen Buch «Poetik der prophetischen Literatur im Alten Testament» von Klaus Seybold geht, sind für die Identität des jüdischen Volkes von besonderer Bedeutung, da sie geschichtliche Krisen des alten Israel markieren, insbesondere die Zeiten der Bedrohung durch Assyrer und Babylonier.
Propheten müssen großen Eindruck auf die Menschen gemacht haben. Als ihr wichtigstes Medium kann die Sprache gelten; Gott teilt sich durch das Wort mit. Nach Zenger zählt unter anderem zum Merkmal des Propheten, erstens in schockierenden, ja obszönen Bildern zu sprechen, und zweitens die rhythmisch-poetische Sprache, die kunstvollen Gedichte und Liedformen in ihren Reden.

Klaus Seybolds «Poetik der prophetischen Literatur im Alten Testament» ist ein nicht nur für Theologen bzw. Alttestamentler interessantes Buch, das die besondere Sprache der Propheten wissenschaftlich analysiert und dadurch auch die literarische Ästhetik, die sich mit ihren Aussagen verbindet, verstehen hilft.
Dies ist auch das zentrale Thema in dem Band des ehemaligen Dekans der Basler Theologischen Fakultät Ludwig Seybold. In seinem umfangreichen Kompendium werden über hundert Texte aus den Prophetenbüchern analysiert und rhetorische Stilmittel wie spezifische Eigenarten der behandelten Propheten herausgearbeitet.
Seybolds Untersuchung ist eher für den wissenschaftlich-theologischen Zusammenhang geschrieben, durchaus aber geignet auch für theologische Laien, die sich für das Prophetentum besonders interessieren. Das Buch liefert zusätzlich eine gute Einführung in die Prophetengeschichte und den aktuellen Forschungsstand. Im Anhang befindet sich ein Begriffsregister, das einen raschen Zugriff auf die gesuchten Informationen ermöglicht, und schließlich enthält es noch ein Verzeichnis der relevanten Bibelstellen zur eigenen Recherche.
Das Buch ist für jene ein Gewinn, die sich mit den Propheten nicht nur auf theologischer, sondern v.a. auch auf sprach- und literaturwissenschaftlicher Ebene auseinandersetzen möchten. Es wird helfen, die aus heutiger Sicht teils schwer verständlichen Prophetenworte zu erhellen. Das Buch schafft ein Bewusstsein für diesen, oft auch das ästhetische Empfinden besonders ansprechenden, dichterischen Aspekt der Bibel. ■
Klaus Seybold: Poetik und Literatur im Alten Testament, Kohlhammer Verlag, 348 Seiten, ISBN 978-3-17-021549-8
.
.
Martin Tamcke: «Tolstojs Religion»
.
Suche nach einem gültigen Lebensentwurf
Jan Neidhardt
.
 Lew Nikolajewitsch Tolstoj (1828-1910) zählt zu den bekanntesten russischen Schriftstellern und zu den größten Autoren der Weltliteratur überhaupt. Der Sohn einer russischen Adelsfamilie war dem Realismus verpflichtet und beschäftigte sich in seinem Werk insbesondere mit dem Gegenstand des Sinns des menschlichen Daseins.
Lew Nikolajewitsch Tolstoj (1828-1910) zählt zu den bekanntesten russischen Schriftstellern und zu den größten Autoren der Weltliteratur überhaupt. Der Sohn einer russischen Adelsfamilie war dem Realismus verpflichtet und beschäftigte sich in seinem Werk insbesondere mit dem Gegenstand des Sinns des menschlichen Daseins.
In «Tolstojs Religion» stellt sich der Theologe Martin Tamcke einer Annäherung an ein für Tolstoj lebensbeherrschendes Thema: der Spiritualität und dem «richtigen Leben». Tolstoj war von der Absicht getrieben einen für ihn gültigen moralischen Lebensentwurf zu entwickeln, der auf Basis seiner Religiosität bestehen sollte. Zentral war für ihn hierbei die Suche nach der Begegnung mit Gott. Ein Mensch, der sich derart intensiv wie Tolstoj auf die Suche nach dem Schöpfer begibt, wird auch an der Auseinandersetzung mit den offiziellen Vertretern der Kirche (besonders im Russland der damaligen Zeit) nicht vorbeikommen.
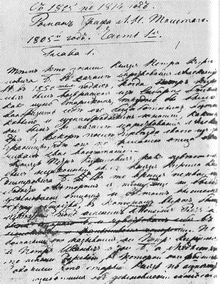
Literarisch leidenschaftliche Suche nach den menschlichen Grundwerten: Erste Manuskript-Seite von «Krieg und Frieden»
Das Buch macht sehr gut deutlich, wie Tolstoj letztlich hier keine Antworten fand. Die Auseinandersetzung war immer stärker von Kritik geprägt und führte schließlich zu seiner Exkommunizierung durch die orthodoxe Kirche. Auch Tolstoj selbst wurde durch seine Suche nach einem Lebensentwurf immer wieder vor persönliche Schwierigkeiten gestellt. So stellte er fest, dass ein gültiger Lebensentwurf immer im Verlauf eines bereits gelebten Lebens entsteht, welches meist den moralischen Ansprüchen nicht genügen kann.
Martin Tamcke schildert diese Schwierigkeiten sehr anschaulich und gut nachvollziehbar. Details oder eine Chronologie der Lebensgeschichte Lew Tolstojs spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle, es werden bestimmte Aspekte des Lebens und Werks des Autors beleuchtet, und das Buch setzt beim Leser schon gewisse Grundkenntnisse voraus. Tolstoj erscheint hier nicht unbedingt in einem ganz neuen Licht, doch Leben und Lebensbetrachtung werden in Hinblick auf das Religiöse gut erfahrbar.

«Tolstojs Religion» von Martin Tamcke ist eine gelungene Auseinandersetzung mit Tolstojs Suche nach dem «richtigen Leben», insbesondere im Hinblick auf sein religiöses Fragen. Tolstoj wird als Mensch mit sehr menschlichen Problemen gezeigt - eine interessante Ergänzung zu den originalen Werken des großen russischen Schriftstellers.
Was ich persönlich zudem spannend fand, sind die Entwicklungen in der russisch-orthodoxen Kirche und die Macht der Zensur im 19. bis frühen 20. Jahrhundert. Martin Tamckes Anspruch, Tolstoj «nicht zu einer Autorität für alternative religiöse Konzepte zu küren […], sondern ihn vor den gleichen menschlichen Grundfragen zu sehen, die sich vielen von uns auch heute stellen», wird in diesem Buch sehr gut eingelöst, da der Bezug auch zum heutigen Leben hergestellt werden kann, insbesondere hinsichtlich der vielen Möglichkeiten, die sich uns heute zu bieten scheinen. Das Buch erlaubt Vergleiche anzustellen, und es regt an Dinge zu hinterfragen… ■
Martin Tamcke: Tolstojs Religion – Eine spirituelle Biographie, Insel / Suhrkamp Verlag, 154 Seiten, ISBN 978-3458174837
.
.
J. Klinger & G.Wolf (Hg.): «Gedächtnis und kultureller Wandel»
.
Annäherung an den Zusammenhang
zwischen Erinnerung und Literatur
Jan Neidhardt
.
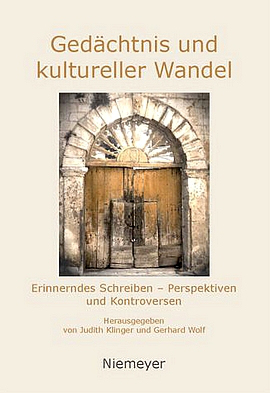 Im Zuge stetig wachsender Erkenntnisse im Bereich der Neurophysiologie spielt der Erinnerungsdiskurs in den Kulturwissenschaften eine immer wichtigere Rolle. Im Herbst 2007 fand der Deutsche Germanistentag in Marburg unter dem Titel «Natur, Kultur. Universalität und Vielfalt in Sprache, Literatur und Bildung» statt. Darin ging es vor allem um die neuen Herausforderungen, die sich für die Germanistik aus den enormen Fortschritten im Bereich der Neurophysiologie, Kognitionspsychologie und in verwandten wissenschaftlichen Bereichen ergeben.
Im Zuge stetig wachsender Erkenntnisse im Bereich der Neurophysiologie spielt der Erinnerungsdiskurs in den Kulturwissenschaften eine immer wichtigere Rolle. Im Herbst 2007 fand der Deutsche Germanistentag in Marburg unter dem Titel «Natur, Kultur. Universalität und Vielfalt in Sprache, Literatur und Bildung» statt. Darin ging es vor allem um die neuen Herausforderungen, die sich für die Germanistik aus den enormen Fortschritten im Bereich der Neurophysiologie, Kognitionspsychologie und in verwandten wissenschaftlichen Bereichen ergeben.
Dem Erinnerungs- bzw. dem Gedächtnisdiskurs kommt in diesem Zusammenhang wachsende Bedeutung zu. Die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes, Judith Klinger und Gerhard Wolf, haben hier 18 Aufsätze zusammengetragen, die eine Auswahl aus den insgesamt etwa 40 eingereichten Beiträgen darstellen. Die Texte basieren auf Vorträgen, die auf dem Germanistentag gehalten wurden.
Sie beleuchten das Thema sowohl aus der diachronen Perspektive – durch die «Analyse der Entstehung von kollektiven Gedächtnissen und narrativen Ordnungen am Beginn der frühen Neuzeit und um 1800», als auch aus der synchronen – im Rahmen verschiedener Vergleiche von modernen Werken.
Anhand verschiedener Autoren (überwiegend des 20. Jahrhunderts) wird in den Beiträgen eine Annäherung an den Zusammenhang zwischen Erinnerung und literarischem Schaffen versucht.
Erörtert werden sowohl die Perspektiven als auch die Kontroversen der Erinnerungsforschung. Welche Rolle spielen beispielsweise methodische Ansatzpunkte aus der Sozialpsychologie? Und inwiefern ließen diese Annahmen sich kritisch hinterfragen? Erinnert der Mensch sich in der Moderne genau so wie der Mensch vor 200 Jahren? Und was bedeutet das für die Literaturwissenschaft? Man vergleiche nur mal Goethes «Wahlverwandtschaften» mit einem zeitgenössischen Werk.

Die Themen Werksetzung und Niveaulosigkeit schon in der Romantik diskutiert: Friedrich Schlegel («Gespräch über die Poesie»)
Wie wird Erinnerung literarisch verarbeitet? Wie beschreibt beispielsweise Dieter Bohlen in seiner Autobiographie «Nichts als die Wahrheit» sein Leben? Und werden Bekenntnisse a la Bohlen eigentlich erst seit der Moderne, dem «Zeitalter der Bücher», als niveaulose Publikationen empfunden? Gab es so etwas früher überhaupt schon? Ein Blick in die deutsche Kulturgeschichte zeigt, dass dieses Phänomen nichts Neues ist, denn bereits in der Romantik ging Friedrich Schlegel in seinem «Gespräch über die Poesie» auf die Themen Werksetzung und Niveaulosigkeit ein. In seinem Aufsatz «Mich kennen die Leute – Erinnerungsarbeit bei Rainald Goetz und Dieter Bohlen», geht der Autor Ulrich Breuer im Zuge eines Vergleichs der Werke «Nichts als die Wahrheit» (Bohlen) und «Abfall für alle» (Goetz) auf den Unterschied zwischen Autobiographie und autobiographischem Schreiben ein.
Doch nicht nur die jüngste und/oder triviale Literatur ist Thema. Klaus Schenk nähert sich dem Thema «Erinnerndes Schreiben – Zur Autobiographik der siebziger Jahre und ihren didaktischen Konsequenzen» an, indem er das Konzept der Autofiktionalität an Texten von Elias Canetti, Thomas Bernhard und Christa Wolf erläutert.
Weitere Themen sind «Erinnertes und sich erinnerndes Ich» (Jürgen Joachimsthaler), «Mythos und Ruhm – Zur Funktion zweier Konzepte des kulturellen Gedächtnisses in Gedichten um 1800» (Dirk Werle) u.v.m. Mehrere Beiträge sind dem wichtigen Thema «Bewältigung des Nicht-Bewältigbaren» gewidmet. Darin geht es u.a. um die «Erinnerungsliteratur von Tanja Dückers, Günter Grass und Uwe Timm» – ein interessanter Beitrag von Michael Braun, der sich auch den «Enkeln» widmet, die den Krieg nicht selbst erlebt haben und «jetzt […] anfangen zu fragen». Auch Günter Grass, dessen Geständnis, Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein, für erbitterte Debatten gesorgt hat, wird hier im Zusammenhang mit dem «Verschweigen» thematisiert.
Jan Süselbeck schreibt über «Das Nachzittern des Grauens. Metonymien und Erinnerungen der Shoah in Texten Arno Schmidts und Thomas Bernhards» und bezieht verschiedene interdisziplinäre Ansätze (v.a. aus dem Bereich der Neurobiologie) in seine Analysen mit ein.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass den Herausgebern und Autoren mit diesem Sammelband ein ausgesprochen interessanter und bereichernder Beitrag zur aktuellen kulturwissenschaftlichen Diskussion um Gedächtnis und Erinnerung gelungen ist. Die Aufsätze machen Lust auf die tiefergehende Lektüre der besprochenen Werke. ■
Judith Klinger / Gerhard Wolf (Hg.), Gedächtnis und kultureller Wandel – Erinnerndes Schreiben: Perspektiven und Kontroversen, De Gruyter Verlag, 280 Seiten, ISBN 978-3110230970
.
Inhalt
Vorwort SEKTIONSSITZUNG A (PLENARVORTRAG): GEDÄCHTNIS UND KULTURELLER WANDEL Günter Oesterle: Kontroversen und Perspektiven in der Erinnerungs- und Gedächtnisforschung SEKTIONSSITZUNG B: IDENTITÄT UND NARRATIVITÄT – SUBJEKTBILDUNG IM ERINNERN Klaus Schenk: Erinnerndes Schreiben. Zur Autobiographik der siebziger Jahre und ihren didaktischen Konsequenzen Jürgen Joachimsthaler: Die memoriale Differenz. Erinnertes und sich erinnerndes Ich IDENTITÄT UND NARRATIVITÄT – INDIVIDUELLE UND KOLLEKTIVE GEDÄCHTNISPRODUKTION Eva Kormann: Bruchstücke großer und kleiner Konfessionen. Vom gelegentlichen Widerspruch zwischen individuellem, familiärem und kulturellem Gedächtnis: Grass, Timm und Wilkomirski Nils Plath: Zu Brechts kalifornischen Musterhäusern. Betrachtungen zum Weiterlesen im Arbeitsjournal, 1942–1947 Ulrich Breuer: „Mich kennen die Leute“. Erinnerungsarbeit bei Rainald Goetz und Dieter Bohlen BEWÄLTIGUNG DES NICHT BEWÄLTIGBAREN Michael Braun: Die Wahrheit der Geschichte(n). Zur Erinnerungsliteratur von Tanja Dückers, Günter Grass, Uwe Timm Jan Süselbeck: Das Nachzittern des Grauens. Metonymien und Erinnerung der Shoah in Texten Arno Schmidts und Thomas Bernhards VI Inhalt Hannes Fricke: Wer darf sich wann, warum und woran erinnern – und wer darf von seinen Erinnerungen erzählen? Über Binjamin Wilkomirski, Günter Grass, die Macht der Moralisierung und die Opfer-Täter-Dichotomie im Zusammenhang der Debatte um neurobiologische Ansätze in den Geisteswissenschaften SEKTIONSSITZUNG C: AUSLÖSCHUNG UND VERLEBENDIGUNG Timo Günther: Den Toten eine Stimme geben? Konzepte der Erinnerung bei Botho Strauß; mit einem Ausblick auf Robert Harrison Michael Ostheimer: „Monumentale Verhältnislosigkeit“. Traumatische Aspekte im neuen deutschen Familienroman ÄSTHETISIERUNG UND TRADITIONSBILDUNG –MEMORIA UND ERFAHRUNG Ralf Schlechtweg-Jahn: Natur- und Kulturbilder zwischen Epochenbruch und Umbesetzung Benedikt Jeßing: Doppelte Buchführung und literarisches Erzählen in der frühen Neuzeit Dirk Werle: Mythos und Ruhm. Zur Funktion zweier Konzepte des kulturellen Gedächtnisses in Gedichten um 1800 (Hölderlin, Goethe, Schiller) Axel Dunker: Das ‚Gedächtnis des Körpers‘ gebiert Ungeheuer. Das Golem-Motiv als Gedächtnis-Metapher SEKTIONSSITZUNG D: NATURALISIERUNG UND FIKTIONALISIERUNG Daniel Weidner: Zweierlei Orte der Erinnerung. Mnemonische Poetik in Uwe Johnsons Jahrestage Uwe C. Steiner: Dinge als Gedächtnis und Dinge als zweite Natur in der frühen kritischen Theorie Jens Birkmeyer: Das Gedächtnis der Emotionen. Alexander Kluges Chronik der Gefühle als verborgene Erinnerungstheorie Namenregister Sachregister
.
___________________________
Geb. 1979 in Wilhelmshaven/D, Biologie- und Politik-Studium in Oldenburg, zurzeit Studium der Vergleichenden Kulturwissenschaft, Theologie, Medienwissenschaften und Geschichte in Regensburg, Verfasser eines Sachbuches, Rezensent des ostbayerischen Online-Kulturmagazins Kultur-Ostbayern
.
.
.





 Sprache ist nie neutral und kann nicht wirklich objektiv gebraucht werden. Man kann das, was man wie sagt, aktiv auswählen. Aussagen über Wirklichkeits- und Wertvorstellungen schwingen dabei immer mit. Diskriminierung geschieht nicht nur über Schimpfwörter oder offene Ausgrenzung, Diskriminierung entsteht im sprachlichen und im sozialen Kontext.
Sprache ist nie neutral und kann nicht wirklich objektiv gebraucht werden. Man kann das, was man wie sagt, aktiv auswählen. Aussagen über Wirklichkeits- und Wertvorstellungen schwingen dabei immer mit. Diskriminierung geschieht nicht nur über Schimpfwörter oder offene Ausgrenzung, Diskriminierung entsteht im sprachlichen und im sozialen Kontext.






leave a comment