Dominik Riedo und Karin Afshar – Ein literarisches E-Mail-Interview
.
Kairos – der richtige Zeitpunkt
oder
Kinski, Riedo, Schostakowitsch und … Kaffee
.
Dr. Karin Afshar
.
.

Dominik Riedo (* 28. Februar 1974 in Luzern/CH)
Ein Interview ist ein Gespräch, bei dem der eine Gesprächsteilnehmer den anderen zu einem zuvor festgelegten Thema befragt. Ziel eines Interviews ist die Erlangung von Information, entweder persönlicher oder sachlicher Art. Der Leser, der das Interview lesen wird, weiß bestenfalls hinterher mehr über den Befragten als er vorher wusste.
Ein Interview gelingt dann besonders gut, wenn sich der Befragende hinreichend über seinen Partner vorinformiert, sich ausdrucksstarke Fragen überlegt und sie in einen mehr oder weniger geordneten Zusammenhang bringt.
Der Befragte seinerseits muss während des Interviews eigentlich nichts weiter tun, als auf die Fragen so zu antworten, dass sowohl er als auch der Befragende mit den Antworten jeweils ihre Botschaft auf den Weg bringen.

Karin Afshar (* 1958 in der Eifel/D)
Es gibt etliche Fälle misslungener Interviews. Die meisten bekommen Leser oder Zuschauer oder Hörer nie zu sehen, aber hin und wieder macht eines in den Medien die Runde.
Ein echtes Skandal-Interview war eines mit Klaus Kinski, geführt mit einer jungen Reporterin, in einem Park (vielleicht Hamburg), im Beisein seiner Frau und einigen Fernsehleuten. Es ging um Kinskis damals gerade herausgekommenes Stück «Jesus Christus».
Nun war Kinski als «unmöglich», als enfant terrible bekannt, und was Interviews anging als störrisch verschrien. Ein Interview mit ihm also eine heikle Sache, die guter Vorbereitung bedurfte. Die junge Reporterin tappte gleich zu Beginn in ein erstes Fettnäpfchen, indem sie ihre Frage um das bedeutungsschwere Wort «ausgefallen» erweiterte. Das zweite Näpfchen stellte sich ihr in den Weg, als sie Kinski als «negativen Helden» bezeichnete, der sich nunmehr (überraschenderweise, ausgerechnet) des Neuen Testaments angenommen hätte… Kinski eskalierte sofort und ließ sich auch nicht mehr beruhigen. Der Rest des Interviews ist Geschichte.

Interview-Fettnäpfchen-Zerstörer Klaus Kinski (im legendären Park-Interview 1971)
Mein Gesprächspartner ist nicht Klaus Kinski (der ist auch inzwischen etliche Jahre tot), sondern ein lebender, kürzlich Geburtstag feiernder Schweizer Schriftsteller: Dominik Riedo. Als Nicht-Schweizerin und als Nur-noch-Sporadisch-Lesende kenne ich Herrn Riedo nicht. Eine Lücke, die ich schließe, indem ich im Netz recherchiere. Dominik Riedo studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in Zürich, Berlin und Luzern, von 2004 bis 2006 war er Lehrbeauftragter an der Universität Zürich, seit 1993 ist er Schriftsteller, Mitherausgeber von «Aufklärung und Kritik» (Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie), war 2010-2012 der Präsident des Deutschschweizer PEN-Zentrums und von 2007-2009 der Kulturminister der Schweiz. Er publiziert Bücher in verschiedenen Verlagen, betreibt eine Webseite und schreibt einen Blog, in dem er Aphorismen und Auszüge aus seinen Arbeiten einstellt. Ich lasse mir drei seiner neuesten Bücher (2014 erschienen) kommen.
Geplant ist ein E-Mail-Interview; diese Form von Interviews gewinnt immer mehr an Beliebtheit, folgt aber eben eigenen journalistischen Regeln, die man auch kennen sollte. Der größte Unterschied zu normalen Interviews ist der, dass die beiden Gesprächspartner nicht die Möglichkeit haben, eine gestellte Frage zu erweitern oder zu erörtern, sondern die Befragung und Beantwortung statischer sind und demzufolge strukturiert vorbereitet sein wollen. Zehn Fragen, so steht in den Leitlinien, die ich alsbald finde, sollten es in der Regel sein.
Ich schreibe Herrn Riedo eine erste Mail, um mich vorzustellen und um anzukündigen, dass demnächst meine Fragen kommen. Ich muss mich erst «warm laufen».
Frage: Was lesen Sie zurzeit? (Und ist es eher ein dickes oder dünnes Buch?)
Riedo: Proust und Lovecraft und Barnes.
Anlass zur Frage ist ein Zitat: «Literatur ist auf der einen Seite wie ein dickes Buch, auf der anderen wie ein dünnes. Im dicken, das im unmöglichen Idealfall ein Weltwälzer wäre, kann man sein ganzes Leben fortlesen, ohne aus dem Traum in die Realität niedersteigen zu müssen. Beim dünnen, das bis zu einem Wort, zu einem Zeichen nurmehr, zusammenschmelzen soll, wird durch das Gelesene eine plötzliche Einsicht in die Wirklichkeit bewirkt.»
Riedo: Man kann nicht sämtliche Literatur in einem Menschenleben lesen. Darum ist es vor allem wichtig, von elementaren Werken zumindest den Nukleus – also das, was ein bestimmtes Werk im Innersten zusammenhält, was es ausmacht und determiniert – zu verstehen; man sollte (selbst als unkreatives Wesen) zumindest begreifen, warum ein Autor ein solches Buch überhaupt schreiben wollte und konnte.
In einer späteren Mail, nachgefragt, wie es Proust jetzt «ginge»:
Riedo: Proust steckt fest. Der dritte Band ist zu zäh. Mal sehen, ob ich ihn durchgehe oder überwinde. Im Moment einiges andere auf dem Nachttisch.

Dominik Riedo: «Uns trägt das Angesungene» – edition taberna kritika
Ich lese derweil in «Uns trägt das Angesungene». Es ist ein rosa-/magentafarbenes A6-formatiges Taschenbuch mit Textschnipseln, mit Angedachtem, farbig im Text belassenen Korrekturanmerkungen und geschwärztem Text. Sieht interessant aus. Der Klappentext hebt an mit der Frage, ob Skizze auch Werk sein kann, so unfertig wie sie ist. Das Buch werde zur doppelten Allegorie, in dem es die (Un)Fertigkeit einer offengebliebenen Korrektur schamlos ausstelle. Ich stolpere über das erste von zwei Attributen, die man Riedos Arbeit zuweist.
Frage: Was meinen die Rezensenten und auch der Verlag mit der «schamlosen Ausstellung» des (Un)fertigen? Sollten «wir» – die Leser – uns für etwas schämen – und vor welchem Hintergrund sollen wir uns schämen? Lassen Sie alle Scham fallen, weil Sie nicht schreiben, wie es sich «gehört»?
Riedo: Wieso, wie «gehörte» es sich? Oder halt dies: Ich soll mich doch wirklich nicht schämen, das Unfertige zu zeigen: Denn wann ist etwas schon nicht «unfertig‘? Das mit den Leserinnen und Lesern ist eine verzwickte Sache: Eigentlich wäre nicht (fast) alles, was man als Wort-Mensch so schreibt, für deren Augen. Aber irgendwie muss man halt leben.
Ein zweites Attribut ist «verstörend»… Bin erstaunt, bin kaum verwirrt, wegen der Korrekturen nicht (kannte ich schon aus anderen Büchern), aufgrund der Inhalte nicht, muss schmunzeln (viele Ideen! Wenn er das alles zu Erzählungen machte!), bin wiedermal bestätigt: die Welt ist verrückt, so wie sie ist. Und nicht dazu angetan, wirklich heimisch in ihr zu sein.
Frage: Ist das mehr oder weniger auch das, was Sie trägt? – Was Sie hier «ansingen»? – Eine Welt in Auflösung?
Riedo: Die Welt ist ver-rückt: Wenn es nur in den Büchern wäre, fände ich das äußerst anstrebenswert. Aber die Realität … Es ist nicht zu sagen, was heute alles «geht». Eine Lösung wird kommen: Hoffen wir, es ist nicht eine endgültige. Auf dass man immer wieder dagegen ansingen darf. Und doch alle etwas Ungesungenes im Kopfherz tragen können.
Das mit dem Ansingen kenne ich. Dass es in Riedos Angesungenem viele Tote, Morde, Rachegedanken gibt… eben, so ist die Welt. Ver-Rückt. In meinem Alltag fallen mir just in dieser Zeit die kurzen, zusammengedampften Symphonien von Darius Milhaud zu. Der schrieb dergleichen Anfang des 20. Jahrhunderts, verkürzte mal eben eine (klassische Form) 90-minütige Symphonie in vier Sätzen auf acht Minuten. Ankündigung unserer heutigen Zeit-Not? Ein Kürzest-Werk, aber eben auch ein Werk.
Frage: «… Wie in einer musikalischen Struktur …» – haben Sie ein bestimmtes Stück vor Ohren gehabt?
Riedo: Einige; aber vor allem meins: do re mi do ni ki … Aber es sei gegengefragt: Wenn ein fremder Text in mir plötzlich Saiten zum Klingen bringt: Sind das von Geburt her eingezogene oder doch eher literarisch vorgebildete? Die Frage besteht: Gibt es Liebe zu einem Text ohne Vorkenntnisse (mal abgesehen davon, dass man das Alphabet erlernt hat und gewisses Weltwissen) und/oder «Drauf-hinauf-gehoben-Werden»?
Frage: Welche Musik hören Sie und was ist mit der Harmonielehre oder Tonkunst?
Riedo: Wie der Patient sagen würde: Ich bin ein Liebhaber der Tonkunst: Viele tanzen nach meiner Pfeife.
Kein Nachhaken meinerseits, aber zur Gegenfrage fällt mir vieles ein. Das Thema «Musik», über das ich gerne weiter gefragt hätte, bei dem ich dann auf Hindemith und von ihm weiter auf «das Werk» bzw. den Werksbegriff gekommen wäre, bleibt unvollendet. Ich suche noch ein wenig in der «Unterweisung im Tonsatz» – im Vorwort schreibt Hindemith Lehrreiches zum Werksbegriff bzw. über den Umgang der Jüngeren mit der Anwendung des ihnen zur Verfügung stehenden Musikwerkzeugs… Es hätte zu Riedos Interview mit Philippe Bischof gepasst:

Die Facebook-Community als Schriftsteller-Kollektiv: der Zwirbler-Roman
Anlässlich einer Tagung des Kulturministerium.ch hatte Riedo als Kulturminister der Schweiz mit Philippe Bischof, dem Leiter des Luzerner Kulturhauses Südpol ein Gespräch geführt. Riedo hatte gefragt, ob die Schriftsteller eventuell zu elitär geworden seien und ob Theater immer mit Schriftstellern zu tun haben bzw. immer von Schriftstellern geschrieben sein müsse.
Bischof bestätigte, dass dies im Moment (immerhin schon 5 Jahre her), tatsächlich immer weniger der Fall sei. Es gebe eine starke Tendenz dahin, dass der Autor nicht mehr der Schriftsteller allein sei, sondern die Schauspieler, der Regisseur, der Dramaturg zusammen etwas wie einen Kollektivautor bildeten, der auch die Leute draußen, das Publikum und seine Befindlichkeit und persönlichen Bedürfnisse einbeziehe und als dokumentarisches Theater diese authentisch aufnehme.
Von der Bühne und den Dramatikern, von der Musik hätte ich zu den Schriftstellern und den Büchern übergeleitet… Dank (preisgünstiger) E-Book-Publikationsmöglichkeit gibt es immer mehr Autoren und auch immer mehr zielgruppenorientiertes Schreiben. Da wird der Leser miteinbezogen, der Autor schreibt, was sein Leser sich von der Geschichte wünscht, ja, sogar mehrere Autoren schreiben kollektiv an einer Geschichte (z.B. der Zwirbler-Roman, der erste Facebook-Roman).
Frage: Sind diese eigentlich noch Schriftsteller zu nennen? Was ist ein Schriftsteller heute noch?
Riedo: Man könnte es über die Gewerkschaft definieren: Beim AdS («Autorinnen und Autoren der Schweiz») wird nur aufgenommen, wer bestimmte Minimalkriterien erfüllt. Andererseits ist «Schriftsteller» keine geschützte Bezeichnung, war es noch nie. Und das ist vielleicht auch gut so. Stichwort: «Offen für alles Kommende» … Der Untergang kommt früh genug …
Frage: Ist Schreiben ein Ausdruck seiner selbst, oder ist Schreiben als Erfüllung der Bedürfnisse anderer, besonders der Leser zu denken?
Riedo: Das geht durchaus Hand in Hand.

Dominik Riedo: «Die Schere im Kopf» – Offizin Verlag
«Die Schere im Kopf». Das Buch lässt mich nicht an sich heran, verärgert mich im Anlesen – und lässt mich «im Fenster der Nacht des Hierseins» – zurück, mit diesem «Herunterzählen» an Wörtern und Satzfetzen, bis hin zum letzten unverständlichen Wort. Ich bin alles andere als sicher, ob ich überhaupt verstehe, worum es geht. An manchen Stellen kann ich sogar vor Wut nicht weiterlesen.
Riedo: Auch ich war oft wütend angesichts des Textes. Aber er musste geschrieben werden. Und wäre es nur meinetwegen.
Frage: Provokation? Fishing for Widerspruch?
Riedo: Ne, nicht mehr … Das habe ich mit dem Kulturministerium hinter mir gelassen.
Fünf mal 24 Stunden hat der Erzähler in diesem Buch noch zu leben. Er liegt mit Krebs im Endstadium in einem Spitalbett und weiß, dass die Schmerzen trotz verabreichter Medikamente nicht mehr enden werden. Dennoch fürchtet er sich weniger vor dem elenden Ende, verspürt kaum Angst vor dem nahenden Tod, den er in seinem Überdruss willkommen heißt.
In aufeinanderfolgenden Bewusstseinsschüben beschreibt er nun sein abgelebtes Leben, zerreißt es rückblickend. Der Leser erfährt, dass der Erzähler früher einmal geglaubt hatte, das große Werk schreiben zu können, dass er zwar zwei Instrumente spielte, aber nicht ganz so musikalisch wie Mozart war. Er war Lehrer, einmal sogar Dozent an der Uni, arbeitete im Gefängnis (wo er feststellte, dass auch Verbrecher sich selbst beschwindeln) und hatte weitere Gelegenheitsjobs. Der Leser erfährt von den Frauen. 129 sollen es gewesen sein. Bei der Abrechnung überlegt der Sterbende, ob es ihm ein Trost wäre, wenn alle Menschen gleichzeitig mit ihm stürben. Fragmentarisch denkt er auch – an die Schweiz, an ihre unveränderbare Bürgerlichkeit und fasst zusammen, dass ihn auch das Reisen anwiderte, nachdem er alles bereist hatte.
Wie gesagt: das Buch widersetzt sich mir. Vielleicht wegen des Fragmentarischen, des «gestreamt» Vexierhaften – Vexierhaftes irritiert mich. Schostakovitsch und seine 15. Symphonie fallen mir ein. Sie beginnt mit dem Zitat aus Rossinis «Wilhelm Tell»-Ouvertüre. Das leichte, lockere Leben endet alsbald in Fragmenten und setzt sich mit dem Sterben auseinander. Es ist die letzte Symphonie des Russen, er ist schwerkrank und er komponiert unter stalinistischen Bedingungen, wandert dabei auf einem schmalen Grat zwischen ideologischer Vereinnahmung und künstlerischer Selbstverwirklichung, zwischen Leben und Tod. Ja, Schostakowitschs Musik evoziert Ähnliches wie die «Schere».
Die Schere im Kopf lege ich zur Seite. Sie schneidet meine Energie und meinen Elan ab. Auch die Antworten, die ich auf meine erste Mail bekomme, lege ich zur Seite. Jetzt spüre ich den Hauch des Proust-Effekts. Aufschieben, sage ich mir. Aufschieben, dann wird der rechte Augenblick kommen. Habe auch zur Zeit mit der Veröffentlichung der Aphorismen eines anderen jungen Mannes zu tun, fast gleicher Jahrgang, sogar ähnliche Gedanken.
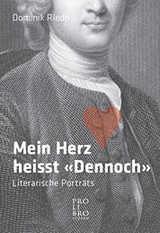
Dominik Riedo: «Mein Herz heisst ‘Dennoch’» – Pro Libro Verlag
Kurz vor Weihnachten schickt mir der Verlag pro libro aus Luzern das dritte Riedo-Buch: «Mein Herz heisst «’Dennoch’ – Literarische Porträts». Darin geht es um Schriftsteller und Denker, die anders als ihre Mitmenschen waren. Die Werke, die sie aus ihrer Andersartigkeit heraus geschrieben haben, werden heute bewundert. Den Erschaffenden aber machte das Anderssein zu schaffen. Sie haderten mit sich, mit der Welt, mit dem eigenen Werk. Riedo versammelt in diesem Buch literarische Porträts, die gewissermaßen den Finger auf die offene Wunde legen. Die Wunde ist die der Verdrängung des Haders der «Anderseienden» aus der heutigen Bewunderungsperspektive.
Sag ich doch! Mein Reden. Voller Vorfreude nehme ich das Buch in die Hand und vor die Augen. Riedo ist einer, der Einzelgänger zu mögen scheint. Seine Antworten zu sich selbst mögen da für ihn sprechen.
Frage: «Widerstand der Welt, den diese Denker und Schriftsteller erfuhren, aber auch Widerstand, den sie selbst der Welt entgegensetzten, der unbeirrbare Glauben der Porträtierten an das «Dennoch» – an die Keimzelle der unsterblichen Literatur.» Keimzelle? Unsterbliche Literatur?
Riedo: Unsterblich, denke ich, ist doch praktisch nichts. Die Keimzelle jedoch steckt in mir – und bringt ihre Triebe voran… Gegen den vorangegangenen Gegendruck …
Frage: Sind Sie ein lustig-melancholischer Mensch oder eher ein ernst-alberner? Oder ist die Frage zu persönlich?
Riedo: Beides wohl, wild durcheinander. Am ehesten ein melancholisch-heiterer.
Frage: Sie scheinen ein Faible für Einzelgänger zu haben oder sind Sie etwa selbst einer? Sehen Sie sich als einer?
Riedo: An der Party zu meinem 20. Geburtstag kamen 81 Gäste, an der zu meinem 40. Geburtstag noch 12 …
Und jetzt kommt die Kinski-Klippe, das Fettnäpfchen, in das ich treten könnte. Riedo war – wie bereits erwähnt – für zwei Jahre Schweizer Kulturminister – ein Zeitraum in seiner Biografie, den ich natürlich ansprechen muss.
Frage: Wie kam es überhaupt zu der Idee, Kulturminister werden zu wollen, sich als Kandidat zur Wahl (mittels Internet-Wahl aus 25 Kandidatinnen und Kandidaten) zu stellen?
Riedo: Weil ich, beim Sprung ins kalte Wasser, etwas lernen wollte.
Frage: Macht man das mal eben so? Haben Sie nicht genug zu tun gehabt?
Riedo: Ich mache eigentlich nichts «einfach so».
Frage: Wie haben Sie die 2 Jahre als Kulturminister verändert? Haben sie Sie verändert?
Riedo: Oh ja!
Meine zehn Fragen sind gestellt, und ich habe kein schlüssiges, rundum befriedigendes Bild. Ich habe gar nichts und muss erkennen, dass ich die falschen Fragen gestellt habe, und mir trotz allen Hin- und Herüberlegens kein Weg eingefallen ist, sie aufzubereiten. Riedo hat mich weite und inspirierte Denkwege zurücklegen lassen. Aber das Interview… wenn ich doch eine Tasse Kaffee mit ihm trinken könnte!
Es ergibt sich keine Gelegenheit. Im Gegenteil, ich entferne mich räumlich noch weiter von der Schweiz, fahre in den Norden, sitze in einem Bahnhofsrestaurant und – spreche mit Riedo.
Was trinken wir? Kaffee? Wie trinken Sie ihn? Mit Milch und ohne Zucker? – Der Kaffee kommt. Jetzt würde ich sie stellen – die wirklich wichtigen Fragen:
01. Wann können Sie am besten schreiben?
02. Wo kommen Ihnen so richtig gute Ideen?
03. Welche Stadt würden Sie gerne in nächster Zeit besuchen?
04. Haben Sie Freunde in Deutschland?
05. Welchen Film haben Sie kürzlich gesehen?
06. Haben Sie einen Lieblingsregisseur?
07. Trinken Sie lieber Kaffee oder lieber Tee? Eine Idee, warum das so ist?
08. Essen Sie gerne Fisch?
09. Welches ist Ihre derzeitige Lieblingsfarbe (hatte ich das nicht schon gefragt???)
10. Können Sie zeichnen?
Nichts mit Literaturwissenschaftlichem zu «Werk» und «Fragmentarismus», oder Lebensabrissen und Bewusstseinsströmen, genug des Zweifelns an der verrückten Welt, die uns dazu bringt, gegen sie anzuschreiben. Wozu? Um uns ein Denkmal zu setzen – oder uns am Leben zu erhalten? Wer dieses neue Interview liest, soll sich wohlfühlen und einen Menschen sehen, und sich darin wiederfinden – oder auch nicht. Etwas Riedo-haftes klingt in allen von uns… und sowohl ein Klaus Kinski als auch ein Dmitri Schostakowitsch waren als Künstler und als Menschen nicht einfach, noch unumstritten. Sie waren anders. Und dennoch!
Einen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Herr Riedo. ■
_________________________
Dies sind die Antworten, die mir Dominik Riedo auf meine obigen 10 Fragen gab:
01. Wenn mich an der Welt etwas stört, aber nicht in meinem Arbeitszimmer.
02. Beim Lesen.
03. Marsala. Ich werde März oder April dort sein.
04. Ja.
05. Verfilmungen von Philip K. Dick. Ich möchte einen Essay über ihn schreiben.
06. Orson Welles.
07. Kaffee. Weil ich als Kind bereits Mocca-Glacé über alles liebte. Aber warum das? Keine Ahnung.
08. Ich bin Vegetarier.
09. Schwarz.
10. Ich konnte es mal ganz gut und habe Freundinnen damit «beschenkt». Heute hab ich das etwas verloren.
.
Weitere Beiträge von Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Jörg Schuster: «Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900»
.
Der Brief als artifizieller Schutzraum und schriftliche Selbststimulation
Dr. Karin Afshar
.
 1. Vorwort zu einer Besprechung
1. Vorwort zu einer Besprechung
Vor mir liegt eine Habilitationsschrift, ein Buch von 396 Seiten, ohne Literarturverzeichnis. «Kunstleben» heißt dieses Buch – der Untertitel lautet: Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes. Auf dem Einband: Rilke – schreibend.
Abgesehen davon, dass ich einen Vorteil habe (ich muss und werde nie eine Habil-Arbeit verfassen), habe ich ein Problem: ich kann das Thema und das Buch nicht auf einer Seite besprechen. Machen Sie sich auf ein längeres Verweilen-Müssen gefasst. Ferner hoffe ich, dass sowohl Jörg Schuster als auch der Wilhelm Fink Verlag Verständnis dafür haben, wenn ich die Rezension so gestalte, dass sie auch für Nicht-Wissenschaftler lesenswert und informativ wird. Deshalb werde ich meinen Text nicht als Literaturwissenschaftlerin oder auch nur annähernd als Germanistin verfassen, sondern als neugierige Leserin, die wissen will, was es mit dem Briefeschreiben um 1900 (zugegebenermaßen interessiert mich Rilke mehr als Hofmannsthal) auf sich hat.
Ich hoffe außerdem, dass auch jene meine Rezension lesen, die vielleicht niemals das Fachbuch – ein ausgezeichnetes Kompendium voller Details und Verknüpfungen – in die Hände bekommen.
Es geht also um Briefe, und um eine bestimmte Art von Briefen, die zu einem bestimmten Zweck und mit bestimmten Inhalten mit ganz bestimmten Mitteln geschrieben wurden. Die Aufgabe, dieses «bestimmt» zu beschreiben, hat sich Jörg Schuster gesetzt. Der Mann hat Neuere deutsche Literatur, Allgemeine Rhetorik und Philosophie studiert. Seine Dissertation hat er in Tübingen über die «Poetologie der Distanz – Die ‘klassische’ deutsche Elegie 1750-1800» verfasst. Das war 2001, 2012 legte er in Marburg, wo er an der Philipps-Universität als Wissenschaftlicher Mitarbeiter wirkte, seine Habilitationsschrift vor. Wie ich dem Netz entnehmen kann, lehrt er zur Zeit am Germanischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universtät in Münster.
2. Wer waren Hugo von Hofmansthal und Rainer Maria Rilke?
Sie lesen diese Rezension bestimmt deshalb, weil Sie einen der beiden Herren kennen? Bevor ich zu den Briefen komme, erlauben Sie mir, Ihnen einige Angaben zu Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke ins Gedächtnis zurückzurufen. Ersterer lebte von 1874 bis 1929, war österreichischer Schriftsteller, Dramatiker und Librettist. Er wird als der Repräsentant des fin de siècle und der Wiener Moderne schlechthin bezeichnet und hat – «Triumphpförtner» österreichischer Kunst – die Salzburger Festspiele (1918/1919) mitgegründet, die vielleicht nicht eine Gegenidee, so doch aber Entwurf zu einer Alternative zur Wiener Moderne sein wollte: klerikal, antidemokratisch, antiaufklärerisch.1)
Hugo von Hofmannsthal hatte bereits promoviert und habilitiert, als er um 1900 in eine persönliche Krise stürzte. Am 18. Oktober 1902 erschien Ein Brief («Chandos-Brief» – ein fiktiver Brief eines Lord Chandos, der seine Zweifel an den Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks niederschreibt) in der Berliner Literaturzeitschrift Der Tag. Der Chandos-Brief zeigt, aus welchen Gedanken heraus Hofmannsthal die Poetologie seiner Jugend ablegt, und markiert eine Zäsur in Hofmannsthals Kunstkonzept. Rückblickend erscheint ihm das bisherige Leben als bruchlose Einheit von Sprache, «Leben» und Ich. Nun aber kann das Leben nicht mehr durch Worte repräsentiert werden; es ist vielmehr direkt in den Dingen präsent… Neben lyrischen und theatralischen Werken ist eine umfangreiche Korrespondenz Hofmannsthals in Höhe von etwa 9’500 Briefen an nahezu 1’000 verschiedene Adressaten überliefert.
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) gilt als bedeutendster Lyriker Deutschlands. 1895 bestand er die Matura und begann Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie in Prag zu studieren, wechselte 1896 zur Rechtswissenschaft und studierte ab September 1896 in München weiter. Etwa von 1910 bis 1919 hatte Rilke eine ernste Schaffenskrise, der dann allerdings eine um so intensivere Schaffenszeit folgte. Er vollendete innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Duineser Elegien. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstanden auch die beiden Teile des Gedichtzyklus Sonette an Orpheus. Beide Dichtungen zählen zu den Höhepunkten in Rilkes Werk. Sein umfangreicher Briefwechsel – wird mit mehr als 10’000 Briefen angegeben – bildet einen wichtigen Teil seines Schaffens. Es wurden mittlerweile 70 Bände mit Rilke-Briefen herausgegeben. Allein eine Ausgabe von 2009 umfasst 1134 «Briefe an die Mutter», darin enthalten sind die Briefe aus der Kinder- und Jugendzeit. Es hat den Anschein, als hätte Rilke in seinen Briefen gelebt. Hofmannsthal wie Rilke waren «manische» Briefeschreiber.
3. Warum Briefe untersuchen?
Bevor ich weiter auf ausgewählte Themen eingehe, die Schuster in seiner Arbeit herausarbeitet, wende ich mich an Sie. – Schreiben Sie (noch) Briefe? – Würde ich gefragt werden, würde ich antworten: ich habe früher viel geschrieben, heute greife ich kaum noch zu Papier und Stift und schreibe einen Brief von 10 oder 12 Seiten. Meine heutigen Briefe beschränken sich auf in die Tastatur geschlagene Buchstaben in Mails, die ausgedruckt allerhöchstens die Länge einer halben DIN A 4-Seite erreichen.
Briefe sind ein Medium, das uns zur Verfügung steht, um zu Papier zu bringen, was an Gedanken mehr oder weniger geordnet in uns herumschwirrt. Briefe schreiben wir, weil und wenn unser Gegenüber abwesend ist. Der Gesprächspartner, mit dem wir uns im Dialog befinden, ist räumlich oder zeitlich von uns getrennt – wir möchten ihm etwas mitteilen. In diesem Wunsch, mitzuteilen, schreiben wir von uns, von dem, was uns zugestoßen ist, was wir gedacht, gefühlt und getan haben. Im Schreiben erwachen Empfindungskräfte – wir empfinden uns als uns, wir finden unsere Identität und – auch das ist möglich, unsere Individualität. Tagebuchschreiben und das Schreiben von Briefen haben diese identitätssteigernde Kraft.
Briefe zeugen vom Schreiber und seiner Autobiographie; sie entstehen nie in einem Vakuum. Manche Briefe sind als Liebesbriefe exklusiv, und zwei Menschen und deren Beziehung zueinander vorbehalten, andere sind Abbildungen der Alltäglichkeit, vielleicht Beschreibungen der Lebens- und Gedankenwelt, andere Briefe gehen über Schreiber und Leser hinaus und sind Abbilder der Zeit und Umstände, Abbilder der Problemlösungsfindungen dieser Menschen, noch andere sind Korrespondenzen zwischen Lehrer und Schüler, Ratgeber und Ratsuchender.
Und manchmal sind die Umstände, unter denen man schreibt, kritisch – dann sind die Briefe «Krisensymptome» (vgl. Angelika Ebrecht 2000) des Selbst wie auch der Zeitepoche.
Briefe können inspirieren, d.h. der Gedanke, jemandem darüber zu schreiben, woran man gerade arbeitet, kann neue Ideen freisetzen, zu Höhenflügen bringen. Je nach Briefpartner stachelt man sich gegenseitig an, oder zieht sich herunter.
Das Gros der Literaturwissenschaftler hat jedenfalls die Korrespondenzen von um 1900 als Spiegel von «Krisensymptomen» gelesen und bezeichnet: Als Ausdruck der Unsicherheit, die «das Bürgerliche» erfasst hatte. Die Modernisierungsprozesse sind eine nächste Interpretationssicht auf die Bedeutung der Briefe: Was machte die Urbanisierung, Industrialisierung, die Steigerung der Mobilität und die Beschleunigung mit den Menschen überhaupt? Jörg Schuster jedenfalls fragt in seinem Buch nach einer noch «anderen» Funktion der Briefe – nach der produktiven kulturpoetischen, und er hat sich zur Beantwortung seiner Frage der Briefwechsel jeweils von Hofmannsthal und Rilke angenommen.
Was findet er? – Analog zum Jugendstil in der Bildenden Kunst und Architektur findet er Briefe als Form der «Gebrauchskunst». Diese Art von Kunst reagiert auf anstehende Modernisierung. Inwieweit es sich um die Konstruktion einer Text- und Lebenswelt, die nur als ästhetische zu ertragen ist, handelt, ist Gegenstand von Schusters Buch. Er studiert und analysiert genauer hin, er nimmt «Versuche literarischer Kreisbildung» und Experimente «ästhetischer Erziehung» ebenso unter die Lupe wie die Ökonomie des Briefs und – im Kontext einer Kulturpoetik des (Innen-)Raums um 1900 – Konzepte des «epistolaren Interieurs». (Zugegeben, das habe ich dem Ankündigungstext entnommen.)
Das Buch ist, wie bereits gesagt, umfangreich. Ich greife deshalb nur einzelne Kapitel heraus und stelle Sie Ihnen genauer vor.
4. Hofmannsthals bitterer Briefwechsel mit Stefan George –
symbolisches Experiment am Vorübergehenden
Schuster beginnt mit einem Gedicht Hofmannsthals2) – George nach einem Treffen überbracht –, in dem es zunächst unverfänglich um eine poetische Standortbestimmung geht, bei der George vom Jüngeren die Rolle des Lehrers zugewiesen bekommt. Hofmannsthal ist 17, George 23 Jahre alt. Dem Gedicht ist ein Geschenk vorangegangen: George hat Hofmannsthal seinen ersten, im Vorjahr erschienenen Gedichtband Hymnen geschenkt und ihm vermutlich auch Einblick in seine Übersetzungen aus dem Französischen gegeben. Der Ältere erläutert dem Jüngeren das Pariser Vorbild einer «poésie pure», die mit der Tradition der Weltabbildung in der Literatur radikal gebrochen hat: das Gedicht ist nunmehr subtiles Gewebe von bildlichen Übergängen, von Klängen und rhythmischen Einheiten, ein autonomes Gebilde, das die Möglichkeiten der Sprache und nicht die Zwänge der Wirklichkeit offenbart. Hofmannsthal lernt schnell. Schon wenige Tage später, am 21. Dezember 1891, schickt er George dann sein Gedicht, das von Anspielungen auf die ausgetauschten und besprochenen Texte durchsetzt ist.
Das Gedicht ist eine klingende Antwort auf ein Vorübergehen, das steht fest, und es gleicht einem Gedicht Baudelaires «À une passante», das George übersetzt hatte. Was ist die Absicht Hofmannsthals? Meint er mit dem Vorübergehenden George, oder sich selbst? – Viele Andeutungen, über die sich zu lesen lohnt, und ein flüchtiges Erlebnis als Inspiration zur Kunst. – Interessanterweise gibt es dieses Gedicht in zwei Versionen. Eine in deutscher Schrift, mit großen Anfangsbuchstaben und Interpunktion auf Papier mit dem Wappen Hofmannsthals. Das andere in lateinischer Schrift, mit kleinen Anfangsbuchstaben, ohne Interpunktion. Diese Version zitiert Georges Schriftstil und dieses ist es, was Hofmannsthal ihm überreicht.
Gedicht an einen Vorübergehenden ist ein Widerspruch an sich, aber er wirkt. Hofmannsthal selbst gibt an, dass es ein persönliches Bekenntnis sei – er selbst sei der Vorübergehende, der Inspirierte. George allerdings fasst das Gedicht als Ausblick auf eine festere, dauerhaftere Zusammenarbeit auf – als ein Angebot zu Nähe. Es kommt zu einem Missverständnis, das die beiden Männer anschließend immer weiter bearbeiten. Jörg Schuster geht nun dem darauf folgenden Briefwechsel nach und findet «den Haken» in der Beziehung zwischen den beiden Männern und spannt einen Bogen zur Funktion des Briefes.
Auch der Briefwechsel hat den Charakter eines Gesprächs zwischen Meister (George) und Jünger (Hofmannsthal): der Meister ist in Besitz des Geheimnisses des mit der künstlerischen Produktion verbundenen Leidens (S. 49), das er nach und nach lüften wird, indem er Andeutungen macht. Die Briefe nun atmen die Sehnsucht nach poetischer Inspiration auf beiden Seiten, für George noch essentieller als für Hofmannsthal. Im Verlaufe des Briefwechsels kehrt George von der «verletzbaren Gewalt» (ein Bekenntnis, das er abgelegt hat) zu einem vornehmen Pathos der Distanz zurück, woraufhin Hofmannsthal ratlos nachfragt, was geschehen sei. Dazu verweigert George die weitere Kommunikation und bricht in ein Schweigen ab.
Hofmannsthal schreibt einen nächsten Brief an George: «Ich kann auch das lieben, was mich ärgert», bekennt er. George findet diesen Brief zu diplomatisch, zu glatt und neutral. Hofmannsthal halte sich bedeckt. Die Korrespondenz eskaliert, und mündet in Georges Androhung zum Duell. Wie nun rettet sich Hofmannsthal? – Er beruft sich auf seine Nerven («Verzeihen Sie meinen Nerven […] jede vergangene Unart»). Die Nerven erlauben dem reizbar-sensitiven Künstler alles. George hat allerdings mit der Androhung übertrieben, und versucht in der Folge abzuwiegeln. Dabei wirkt er beinahe «komisch» (S. 53), Hofmannsthal kann das nicht einordnen – der Bruch in der Beziehung ist nicht zu vermeiden.
Hofmannsthal und George ringen in ihrem Briefwechsel um Distanz und Nähe. Sie kennen sich aus Briefen, haben sich aber nur selten getroffen, in ihrer distanzierten Nähe sind Briefe ihr Medium zum Austausch von Lebenszeichen. – Nun ist George aber der, der die Regeln vorgibt. Der Jüngere entzieht sich, bleibt auf «orientalisch» (S. 55) und auf einschmeichelnde Art konsequent und virtuos. Hofmannsthal beherrscht schon hier die Kunst der «epistolaren insinuatio» (rhethorisches Mittel, das jemand verwendet, wenn er von vorneherein davon ausgeht, dass sein Zuhörer gegen ihn ist): er entzieht sich, macht sich klein, gibt vor, dem Gegner nicht gewachsen zu sein.
Alles in allem betrachtet, ist dieser Briefwechsel das Land, in dem die Krise (die je eigene der beiden und die ihrer Beziehung) in gegenseitigem Bekennen, Fordern, Ausweichen, Vereinnahmungsversuchen als Krisenbriefwechsel ausgetragen wird.
5. Die einsame Imagination, Lebensverdächtigung und ein
verfehlter Geburtstagsbrief – Der Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann
In den vorangehenden Kapiteln hat Schuster bereits eine «Brüchigkeit» in Hofmannsthals Briefen herausgearbeitet. Im Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann tritt eine neue Qualität hinzu.
Mit Beer-Hofmann verbindet Hofmannsthal «große menschliche Vertrautheit» (S. 118), die beiden kennen einander gut und treffen sich häufig. Auch sie sind junge Männer, als sie sich (um 1896/97) kennenlernen: Beer-Hofmann ist etwa 31 und Hofmannsthal 23 Jahre alt. Ihre Begegnungen haben für beide einen hohen Stellenwert, es gibt viele Gespäche über Machtverhältnisse und die Rollenverteilung. In diesem (im Vergleich zu dem mit George) Briefwechsel ist Hofmannsthal der Zudringlichere und Beer-Hofmann der Zurückhaltende. Ausgerechnet der Ästhet Hofmannsthal lässt sich hinreißen und schreibt «Hässliches, ja Ekelhaftes» (S. 119). Hofmannsthal sucht die Konfrontation und provoziert. «Epistolares Imponiergehabe», heißt es bei Schuster, lege er an den Tag. Er trifft auf einen, der sich nicht zwingen lässt: «Ich weiß, Sie nehmen es mit mir nicht genau; Briefe «schuldig sein» ist ja auch nur ein Bourgois-Begriff.» (S. 120). Doch Hofmannsthal nimmt es sehr genau, und ärgert sich. «Warum schreiben Sie mir nicht?» – Beer-Hofmann verweigert sich. Er will nicht als «Inspirationsmittel» für die poetische Produktion jüngerer Kollegen fungieren. Er identifiziert sich mit der Rolle des «Hemmschuhs». Hofmannsthal wiederum fühlt sich nicht geachtet genug. Es deprimiert ihn, dass die Beziehung sich nicht als ideale poetische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entwickelt bzw. gestaltet. Es gelingt ihm nicht, Beer-Hofmann aus dem Leben hinein in seine Briefwelt zu ziehen (S. 124), schreibt in einer Mischung aus Zudringlichkeit und Ich-Bezogenheit.
In einem Geburtstagsbrief (vom 6. Juli 1899) an Beer-Hofmann bricht – völlig deplaziert und verfehlt – die Erwartung aus Hofmannsthal heraus. Hier liegt ein Konflikt, so schreibt Schuster, zwischen dem Menschlichen (dem Leben) und der produktiven Fähigkeit (bzw. der Poesie) vor. Das Leben kann sich uns im Brief nur in Form von Schrift und Imagination nähern, wobei die Imagination eine emphatische ist. Einfühlung ist hier das Stichwort – paradoxerweise fühlt sich Hofmannsthal so sehr in Beer-Hofmann ein, dass er ihm mit seiner Kritik und den Vorwürfen zu nahe tritt und die Grenze des guten Anstands überschreitet. Beer-Hofmann antwortet lakonisch: «Lieber Hugo, Sie haben Recht, nur […] an einen Arzt oder Medikamente glaube ich bei diesen Dingen nicht.» – Bündiger, so Schuster, könne die eigene Resignation, aber auch das Zurückweisen der selbstbezogenen Zudringlichkeit Hofmannsthals nicht ausgedrückt werden (S. 126). Briefe – so sehen wir hier – können und werden im Sinne einer «Distanzmedizin» geschrieben (S. 181).
«Medizinbriefe» wie die an Beer-Hofmann sind einseitig – sie sind und bleiben Hofmannthals «Welt in der Welt». Anders als der Poet Hofmannsthal beherrscht der Briefschreiber Hofmannsthal etliches nicht: souveränes, prägnant-wirkungssicheres sprachliches Übertragen und Hervorrufen von Stimmungen. – Dass und wie es im Briefwechsel zu einer Wende kam, ist im Buch nachzulesen – die Auflösung auf Seite 147. In dieser Art, ausführlicher und noch mehr Hintergründe heranziehend, geht Schuster die Briefe durch, die er in größere und kleinere Kategorien zusammenfasst.
6. Rilkes transportable Welt und sein fein verteiltes Irgendwo-Sein
Wussten Sie, dass Rilke täglich durchschnittlich an die zehn Briefe schrieb? – Stellen Sie sich vor, Sie schrieben heutzutage täglich an 10 Personen aus Ihrem Bekanntenkreis 10 Seiten!? An manche dieser Personen zweimal pro Woche.
Rilke produziert in guten Zeiten Briefe «mit Dampf» – und vermerkt außerdem noch alle Daten rund um die Briefe. Ist er ein Maniker? Ist er nicht – schon einmal vorweggenommen. Hätte es damals facebook oder überhaupt das Internet gegeben – Rilke hätte es genutzt: um ein Netzwerk aufzubauen, um seine Werke vorzubereiten und sich selbst zu vermarkten. Er war ein Öffentlichkeitsarbeiter.
Wir erfahren, dass Rilke Wert auf das Aussehen seiner Briefe legte: Briefpapier wird von ihm speziell ausgewählt, er schreibt in einer besonderen Handschrift («th» und «y» schreibt er auf unverwechselbare Weise und lädt sie mit einer besonderen Bedeutung auf). Rilkes Briefe sind Gesamtkunstwerke, die gleichzeitig den Alltag poetisieren und entpragmatisieren – und die doch wieder nützlich werden. Im Kreis des literarischen Betriebs Fuß zu fassen, ist Rilkes Absicht. Die Briefe dienen ihm als Ersatz für noch nicht erlangten Erfolg vor größerem Publikum. Er schafft sich einen Kreis, in dem die Briefe einen Heimatersatz für ihn, den Ortlosen, bilden. Doch das «Irgendwo», das er sich damit verschafft (dazu mehr weiter unten), ist nicht der letzte Aspekt dieser Briefe.
Für Rilke ist der Brief nicht Medium der Intimität, sondern Vorzeigeobjekt. Das epistolare Subjekt Rilke – so Schuster – bildet eine Funktionsstelle ähnlich einer Durchgangsstation, eines Relais (S. 222). Rilkes Briefe sind nämlich öffentlich: sie dürfen und sollen von den Adressaten anderen im Bekanntenkreis gezeigt werden. Auch das «Subjekt des Empfängers» wird somit zur Funktion: er soll multiplizieren.
Rilke, der Vielschreiber, versteht die an einem Tag geschriebenen Briefe als eine Einheit – und als Werk an sich, das erlaubt, das Leben ätherisch und literalisiert zu «rezipieren und zu modellieren» (S. 224).
Ganz abgesehen davon macht Rilke das, was auch heute die Selfpublisher mit ihren selbstveröffentlichten Werken tun: Sie probieren Entwürfe und Vorarbeiten im Netz aus. Sie achten auf ihre Wirkung und Rückmeldung, nehmen Anregungen auf, ändern ab. – Vorab in den Briefen Rilkes öffentlich gemachte Textabschnitte finden sich in seinen literarischen Werken wieder. Rilke inszeniert den Schaffensprozeß in seinen Briefen.
7. Esoterik der Briefe und die Exoterik der Konversation
Dass Rilke zwischen einem Gespräch und einem Brief einen großen Unterschied macht, ist bereits mehrfach durchgeschimmert. Das Konkurrenzverhältnis der beiden «Medien» zueinander ist über Jahrzehnte sein Thema (S. 224): Dem Draußen des Gesprächs steht das einsame Drinnen des Briefs entgegen. Briefe zu schreiben, ist ein Sich-Sammeln. «Als ob Du bei mir eintreten könntest» ist der Titel eines Abschnitts (S. 249ff), in dem Schuster sich mit einem Brief Rilkes an Lou Andreas-Salomé und dem nachfolgenden Briefwechsel beschäftigt. Der Brief, um den es gehen wird, ist vom 13. Mai 1897. Es ist Rilkes erster Brief an die 10 Jahre ältere Frau, die später 30 Jahre lang erst seine Geliebte, dann Vertraute und «Beichtmutter» sein wird. Ohne Lou Andreas-Salomé wäre Rainer Maria Rilkes Leben anders verlaufen, heißt es. Er lernt sie in München, wo er studiert und Kontakte zur literarischen Szene sucht, im Mai 1897 eher zufällig kennen. Er ist 26 Jahre alt, Lou Andreas-Salomé bereits renommierte Autorin. Man kennt ihre Erzählungen und Romane, ihr Buch über Ibsen. Sie hat gerade einen Heiratsantrag von Nietzsche abgewiesen. Der erste Brief, den Rilke schreibt, verrät eine geradezu religiöse Verehrung und er verfolgt eine deutliche Absicht: er möchte ein exklusives Verhältnis zu ihr haben, schreibt sie persönlich und sehr höflich an, versichert ihr, dass es eine «Auszeichnung» sei, sie kennenzulernen – und möchte ihr imponieren (S. 249). Was Rilke dabei schon damals «beherrscht» ist, was man heute «name-dropping» nennt.
Rilke hatte die Dame am Vortag getroffen und möchte – enttäuscht von der mündlichen Kommunikation – seine Bewunderung auf dem brieflichen Weg ausdrücken. Der Brief, so Schusters Hypothese, stiftet somit eine Beziehung zu Lou Andreas-Salomé im Sinne «eines der Exoterik des gesellschaftlichen Gesprächs entgegengesetzten esoterischen Mediums» (S. 250).
In diesem Fall sehen wir den Brief als «Medium der Nähe und der Intimität», wobei er dem Gespräch, der vollständigeren Form der Kommunikation, unterlegen ist. Die bereits angedeutete Thematik «Gespräch vs. Brief» bleibt während der Korrespondenz und im Verlauf der Liebesbeziehung zu Lou Andreas-Salomé bestehen. Nach Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehung gilt jeder Brief, den er ihr schreibt, dem Wunsch nach dem Gespräch. Da dieses zwischen beiden schwierig ist, sehnt sich Rilke alsbald nach an einem Ort, nach einer Wohnung, an dem und in der er das nötige «setting» findet, den Ruheort, um die nötigen Briefe schreiben zu können. Überhaupt fehlt Rilke eine «Stube», also erbaut er sich eine («ein Stück Stube […], die ich mir damals erbaut habe» (S. 257) – er arrangiert sich ein Stück Wirklichkeit. Der Nachteil dieser Wirklichkeit besteht darin, dass es sich nicht um Lebenswirklichkeit handelt, sondern um das Hervorbringen von Schrift und Poesie. Der Verfasser der Schriften jedoch ist nicht mehr als eine «zerbrochene Schneckenschale». Das Briefeschreiben wird nicht nur zum Ausweg aus der Suche nach dem (Schreib-) Ort sondern auch aus Rilkes Dilemma. Im Laufe des Briefwechsels mit Lou Andreas-Salomé wird der Brief immer mehr der Ort der Ruhe, die Schreibsituation des Briefes verwirklicht seine Sehnsucht – und das ersehnte Gespräch damit schließlich überflüssig (S. 264). Wie es nun im Einzelnen mit Rilke und AS endete, kann dem Buch entnommen werden. Soviel an dieser Stelle. Zusammenfassend kann gesagt werden: auch wenn zwar im Falle dieses Briefwechsels ein «Ausschluss der Öffentlichkeit» vorliegt, ordnet Schuster den Brief bzw. den Briefwechsel in letzter Konsequenz doch eher dem «Zweck einer Stimulation» zu.
8. Lebenspraxis + Briefpoesie = die kleine Lebenshilfe?
Die vorangegangenen Seiten haben lediglich einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtwerk gezeigt. Es gibt ungleich mehr zu entdecken. Der ältere Hofmannsthal schreibt in seinen Briefen anders und über anderes, ebenso der ältere Rilke, der viele Briefe von männlichen wie weiblichen Lesern erhält und «Lehrbriefe» schreibt. Schuster analysiert etliche dieser Briefwechsel. Zu kurz gekommen in der Rezension ist der Lebens- und Schaffenshintergrund der Beteiligten, der Briefe zu Ratgebern werden lässt. Dieses und eine akribische Untersuchung der dichterischen Sprache habe ich links liegen gelassen.
Zu Anfang hatte sich Schuster die Frage gestellt, inwieweit die Briefkultur um 1900 symptomatisch für die kulturgeschichtliche Situation des fin de siècle und des frühen 20. Jahrhunderts ist. Was leisten Briefe dieser Zeit, was bringen sie auf kommunikativem Weg hervor? (S. 388)
Die Funktion der Briefe ist – alles in allem und zusammenfassend – dass sie dem Zweck dienen, Distanz zu schaffen und zu wahren. In dieser Distanz werden sie zu Repräsentanten des «Jugendstils» und damit – Gebrauchskunst (S. 389), mit der die Autoren die «artifizielle Innen-Einrichtung ihrer sozialen Welt» gestalten.
Hoffmannsthal arrangiert sich die Wirklichkeit, wie man einen Ausstellungsgegenstand hinstellt und arrangiert (S. 388), und Rilke verwebt sich, mittels seiner Briefe kontinuierlich in den Kokon einer Einrichtung.
Die Briefe fungieren als zugleich «private» wie auch höchst artifizielle Schutzräume, statt eines tatsächlichen Zusammenwirkens herrschen einsame Imagination und schriftliche Selbst-Stimulation vor, bei denen die Adressaten als Vorwand dienen (S. 392). Bei Rilke haben wir noch den Eindruck, wir könnten jederzeit eintreten, dennoch hält er eine tatsächliche Begegnung in der Schwebe.
Zwei Repräsentanten ihrer Zeit – und es bleibt mir nach der Lektüre die traurige Frage (sie wird hoffentlich erlaubt sein): Was wohl, wenn wir unsere heutigen Briefwechsel ähnlich akribisch unter die Lupe nähmen und eine Anamnese vornehmen würden, die Diagnose ergäbe? Für mich ganz persönlich nehme ich mit, dass ich in puncto Rilke die richtige, hier bereits angedeutete, Vermutung hatte. Leider konnte ich nicht auf all die anderen Fragen eingehen, die im Buch aufgeworfen und beantwortet werden. Leider, auch das bereits angedeutet, bin ich zu wenig Literaturwissenschaftlerin, um Schusters Werk für die Literaturwissenschaft würdigen zu können. Es sei dennoch ans Herz gelegt: wenn wir unsere Geschichte verstehen, verstehen wir auch die Gegenwart! ■
Jörg Schuster: Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes, 428 Seiten, Wilhelm Fink Verlag, ISBN 978-3770556021
.
1) Norbert Christian Wolf: Eine Triumphpforte österreicherischer Kunst – Hugo von Hofmannsthals Gründung der Salzburger Festspiele, Jung und Jung (Salzburg)
2) Herrn Stefan George
einem, der vorübergeht
du hast mich an dinge gemahnet
die heimlich in mir sind
du warst für die saiten der seele
der nächtige flüsternde wind
und wie das rätselhafte
das rufen der athmenden nacht
wenn draussen die wolken gleiten
und man aus dem traum erwacht
zu weicher blauer weite
die enge nähe schwillt
durch pappeln vor dem monde
ein leises zittern quillt
.
Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Essay über Bildung und Schule von Karin Afshar
.
Bildung heute – Spiegel innerer Besitzlosigkeit?
Dr. Karin Afshar
.
Schule, Lehrer, Lernen – das ist in aller, und wenn nicht in aller, dann doch in vieler Leute Munde, und ständig in den Medien. Zu recht? Etliche Lehrer schreiben offene Briefe über die Unerzogenheit von Schülern, Eltern sind aufgebracht gegen Lehrer und das restrukturierte und rerestrukturierte System, und Buchautoren analysieren die Bildungsmisere ebenso vehement wie Mediziner konstatieren, dass die Kinder Konzentrationsdefizite und Lernstörungen haben, ja sogar z.T. mit 10 Jahren auf dem emotionalen Stand von 16 Monate alten Kleinkindern stünden. Ich tue einen Stoßseufzer: bin ich froh, dass meine Kinder aus der Schule sind, und ich heute nicht mehr zur Schule gehe! Ich meine nicht nur als Schülerin, sondern auch als Lehrerin. Und trotzdem mache ich mir immer wieder Gedanken zu meinem Lieblingsthema: Lernen und Bildung. Auf den nächsten Seiten gibt es etwas dazu, was Lernen mit den Menschen und mit Bildung zu tun hat.
.
1. Vom Wesen des Lernens
Menschen lernen. Kinder lernen krabbeln, laufen, sprechen. Sie lernen, wie man mit der Schere ausschneidet, wie man sich an- und auszieht; sie lernen selbständig zu essen und zur Toilette zu gehen… Sie lernen im Kindergarten, in der Schule, in der Lehre, auf der Universität … so geht es immer weiter. «Lernen» ist Entwicklung. Jede Entwicklung hat unterschiedliche Stufen, deren jede genommen werden muss, bevor es zur nächst höheren Stufe geht.
Je nach entwicklungspsychologischer Schule (z.B. Jean Piaget) oder kognitionspsychologischer Schule (z.B. Jerome Bruner) werden die Phasen/Stufen der ersten Jahre unterschiedlich benannt, sagen jedoch in der Essenz: Die Entwicklung geht vom Einfachen zum Komplexen, und (hauptsächlich Piagets Prämisse): keine spätere Phase kann ohne die vollständige Erlangung der früheren erreicht werden.
Im Einzelnen – weil es wichtig ist, uns das Wesen des Lernens zu veranschaulichen – können die Stadien wie folgt charakterisiert werden:
Ein Stadium umfasst einen Zeitraum, in dem ein bestimmtes Schema in seiner Struktur begriffen und schließlich angewendet wird.
Beispiel: Zwischen dem 4. und dem 8. Lebensmonat entdeckt ein Kind, dass es durch eigene Aktivitäten bestimmte Effekte in der Umwelt hervorrufen kann. Es wirft die Rassel aus dem Kinderwagen – die Mutter wird sich bücken, und sie ihm wieder in die Hand geben.
Im Kind wächst die Fähigkeit zwischen einem gewünschten Ziel/einer erwünschten Reaktion und dem angewandten Mittel zur Erreichung des Ziels zu unterscheiden.
Jedes Stadium geht aus einem vorangegangenen hervor, bezieht das Gelernte ein und wendet es in anderen Zusammenhängen an.
Beispiel: Zwischen dem 8. und dem 12. Lebensmonat probiert das Kind aus, wie und womit es die Aufmerksamkeit von Personen erwecken kann. Es wirft den Gegenstand vielleicht nicht mehr weg, sondern macht Lärm mit ihm. Weiterhin werden die bereits vorhandenen Schemata immer besser koordiniert und somit Bewegungsabläufe flüssiger.
Die Stadien laufen immer in der gleichen Reihenfolge ab. Zwar kann es leichte kulturelle Unterschiede in der Auskleidung der Operationen geben, auch können sie verschieden schnell oder langsam durchlaufen werden – aber dass sie in geänderter Abfolge auftreten, ist nicht möglich.
Alle Kinder durchlaufen die Stadien. Bleibt ein Kind in einem Stadium stecken, handelt es sich um eine Entwicklungsverzögerung oder Retardierung.
Jedes Stadium schreitet vom Werden zum Sein.
Die Stufen im Einzelnen: der Stufe der Entwicklung der sensumotorischen Intelligenz (0 bis 1,6/2,0 Jahre) folgt die Stufe des symbolischen oder vorbegrifflichen Denkens (ca. 1,6/2,0 – 4,0 Jahre), dann kommt die Stufe des anschaulichen Denkens (4,0-7,0/8,0), gefolgt von der Stufe des konkret-operativen Denkens (7,0/8,0-11,0/12,0 Jahre) und der Stufe des formalen Denkens (ab dem 12. Lebensalter).
Beispiel: Der bekannteste Versuch von Piaget zeigt anschaulich die «logischen Irrtümer» der unter 7-Jährigen: Zeigen Sie Ihrem Kind ein breites Gefäß (vielleicht eine Brotdose) mit Wasser und schütten Sie das Wasser vor seinen Augen in ein hohes schmales Glas um. Zu Beginn der präoperationalen Phase wird Ihr Kind meinen, dass im Glas viel mehr Wasser ist, als in der Brotdose war. Erst mit einem Alter von ca. 7 Jahren «wissen» Kinder, dass die Flüssigkeitsmenge sich beim Umschütten nicht verändert.
Beispiel: Ab ca. 4 Jahren, in der intuitiven, anschaulichen Phase, vermindern sich zwar einige «logische Irrtümer», dennoch ist das Denken der Kinder stark egozentrisch, d.h. sie betrachten die Welt ausschließlich von ihrer Warte aus: Das Kind hat seine Ansicht und hält seine Ansicht für die einzig mögliche und somit auch für die einzig akzeptable. Ein egozentrisches Kind kann sich die Sichtweise anderer nicht zu eigen zu machen, denn Egozentrismus bedeutet nicht etwa Ichbezogenheit, sondern ganz einfach nur die Schwierigkeit, sich eine Sache oder aus einer anderen Sicht anzusehen oder sich in eine andere Person hineinzuversetzen. (Dieser Satz wird später noch wichtig werden!)
Beispiel (nach Mönks & Knoers 1996):
– Peter, hast du einen Bruder?
– Ja.
– Wie heißt denn dein Bruder?
– Hans.
– Hat Hans auch einen Bruder?
– Nein.
Alles Lernen ist ein stetiger Prozess, in dem der Lernende – in unserem Beispiel das Kind – immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen versucht. Die Anpassung vorhandener Schemata an eine aktuelle Situation geht in zwei Teilprozessen vor sich: Assimilation und Akkommodation.
Beispiel: Ein Kind hat bereits gelernt, einen Apfel zum Mund zu führen, den Mund zu öffnen und ein Stück abzubeißen. Jetzt bekommt es eine Birne – und wird in sie hineinbeißen. Es erkennt Apfel und Birne als ähnlich.
Assimilation bedeutet die Eingliederung neuer Situationen oder Erlebnisse in ein bereits bestehendes Schema (um in der Begriffswelt von Piaget zu bleiben). Die Wahrnehmung der Ähnlichkeit von Apfel und Birne führt dazu, dass das Schema «grün-annähernd rund-essbar» an-gewendet, bestätigt und um ein neues Element erweitert wird. Assimilation ist die Reaktion auf eine Situation, die auf bereits in uns abgebildetes Wissen oder Erfahrungen trifft.
Beispiel: Ein anderes Kind versucht, in einen Plastikapfel zu beißen. Auch sein Schema sagt: «grün-apfelförmig-essbar». Von einem Plastikapfel aber kann es nichts abbeißen – das Kind muss akkommodieren und sein Schema insofern differenzieren, als echte Äpfel und unechte Äpfel verschiedene Kategorien bilden.
Akkommodation tritt auf den Plan, wenn die Assimilation nicht ausreicht, eine wahrgenommene Situation mit den vorhandenen Schemata zu bewältigen. Diese werden erweitert und angepasst. Akkommodation ist die Reaktion auf eine Situation, die noch nicht in uns abgebildet ist.
Ich könnte viele weitere Beispiele für die phantastische Leistung der kindlichen Entwicklungswege anbringen, möchte aber nun doch vom Entwickeln zum Lernen kommen. Lernen als Gegensatz zum Erwerb können wir am Beispiel von Sprechen und Sprachen betrachten:
Eine erste Sprache erwirbt jeder Mensch als Kind. Manche Kinder erwerben zwei oder drei Sprachen1) gleichzeitig. Von Erwerb spricht man, wenn das Aneignen «ungesteuert» und ohne Anleitung geschieht. Die Entwicklung der Kognition2) ist bei einem Kind noch nicht abgeschlossen, was bedeutet, dass der kindliche Spracherwerb mit der Entwicklung des Denkens, des Wahrnehmens und des Bezeichnens einhergeht. Noch anders ausgedrückt: als «Erwerb» bezeichnet man einen unbewussten Prozess, der ohne Anleitung, durch Kontakte in einer natürlichen Umgebung in alltäglichen sozialen Zusammenhängen (z.B. beim Einkaufen oder auf der Straße) auskommt.
Sprachenlernen dagegen erfolgt bewusst, ist angeleitet, wird gesteuert. Jedes Lernen bzw. jeder Lernende bedient sich der Kognition. Lehrer innerhalb von Institutionen (Schulen) oder außerhalb dieser strukturieren den Lernfortgang und geben Anleitungen. Schulisches Lernen vor Erreichen einer bestimmten Kognitionsstufe (vergl. Piaget oder Bruner) macht keinen großen Sinn, sondern stört nachgerade. Die Aufgabe des Lehrers im Lernprozess des Schülers ist, den Stand seines Schülers einzuschätzen und nach einer bewältigten Unterrichtseinheit den nächsten Schritt vorzugeben.
Auch das Lernen folgt dem Prinzip «Vom Einfachen zum Komplexen», und bevor komplexe Strukturen verstanden werden, müssen die einfachen Operationen sitzen und hinreichend eingeübt sein. Es ist am Lehrer, die Anleitungen hilfreich und verständlich anzubringen. Unterricht ist dann am ergiebigsten und motivierendsten, wenn er mit dem Wesen der Schüler in Einklang steht. Ein Unterricht mit einem Lernstoff, der den Schüler erreicht, wird ihn bilden. Lehrer, die auf ihre Schüler eingehen, sind wie Hebammen, die heben, was bereits in jenen schlummert und Anleitungen geben, die die Gebärenden befolgen können. An das bereits Eigene können diese dann die Informationen der Welt knüpfen und assimilieren. Und was sie nicht in sich finden, sondern im Außen neu erkennen, hilft ihnen ihre Innenwelt zu erweitern. Ein Lehrer öffnet Augen, Ohren und Herzen und ist im Leben von Menschen, und nicht nur von jungen, enorm wichtig. Deshalb muss ein Lehrer ein Mensch sein, der sich selbst gut kennt. Denn wenn er sein Eigenes erkannt hat, kann er andere Menschen erkennen.
.
2. Bildung und das Höhlen-Gleichnis (Platon)

“Das Einzige, das schlimmer ist als zu erblinden, ist als Einzige zu sehen.“ (aus: Stadt der Blinden)
Illustrationen: K. Afshar
Die unterirdische Höhle ist bei den Griechen allgemein ein Bild für den Hades, das Reich der Toten. Platons Höhle steht für unsere alltägliche Welt, in der wir leben. Wir Menschen, so zeigt uns Pla-ton in seinem Gleichnis, sind Gefangene in unserer gewohnten Behausung.
Oberhalb von und hinter den Gefangenen brennt ein Feuer. Die Höhle wird von diesem Feuer beleuchtet. Die Gefangenen sitzen nun unbeweglich da, denn sie sind an ihre Sitze gefesselt. Das heißt nicht etwa, dass sie sich nicht bewegen, nein, sie sind sehr rege, was Verkehr, Wettstreit und anderes angeht. Nur sind sie unbeweglich, was ihre Einstellungen angeht. Sie haben eine unveränderliche Einstellung zu dem, was sie für das Wirkliche halten.
Außer den Gefangenen gibt es nun noch (Platon nennt sie die Gaukler) andere Gestalten. Sie bewegen sich vor dem Feuer hinter den Gefangenen, und ihre Schatten werfen sich auf die Wände der Höhle vor ihnen. Sie sind die (modernen) Intellektuellen, die Künstler, die Politiker, die Designer, die Psychologen, die Moderatoren, die Berater… Sie bestimmen den Hinblick, sie entwerfen die Bilder für die Menschen. Die Gefangenen halten ihre Schatten für das Wahre.
Überhaupt sehen die Menschen sich und ihre Mitgefangenen und die Gaukler als Schatten – sie sehen immer nur die Projektion. Bei Homer ist «Schatten» der Name für die Seelen der Toten.
Im Schattendasein der Menschen (in diesem Traum in einem Traum) wird nun einer der Gefangenen von seinen Fesseln erlöst. Er steht auf, geht einige Schritte, blickt hoch zum Licht, ist geblendet, wendet sich ab und blickt noch einmal hin … sieht, dass er bis jetzt lediglich das Abbild des wahren Lichts (von außerhalb der Höhle) gesehen hat und begreift unter Schmerzen sein Gefangensein.
Der, der ihn losgebunden hat, war ein Lehrer. Er hat dem Gefangenen eine neue Sichtweise ermöglicht, hat ihn «sehend» gemacht. Dem allerdings ist das helle Flimmern des Lichts zunächst ungewohnt, und er erkennt das Gesehene nicht, er findet es unheimlich und befremdlich. Der Gefangene steht ganz am Anfang seiner neuen Freiheit und muss lernen im Licht zu sehen. Seine Augen aber beginnen zu schmerzen. Bald will er nicht mehr ins Feuer des Lichts blicken, er will zurück zu den Schatten, und er wendet sich ab und flieht zurück.
Der Versuch einer Befreiung ist zunächst misslungen. Bildung – und das ist u.a. die wechselweise Anwendung von Assimilation und Akkomodation von Wahrgenommenem – ist Platon zufolge etwas, das Menschen nicht unbedingt wollen… Man muss sie zum Sehen zwingen, ansonsten ziehen sie es vor, blind für das Licht zu bleiben.
Sokrates, der unbequeme Lehrer, wurde wegen seines «schlechten Einflusses» auf die Jugend von den Athenern umgebracht. Platon seinerseits hat seine Akademie außerhalb der Polis errichtet. Und Aristoteles, der zehn Jahre lange Platons Schüler in der Akademie war, ergriff in ähnlicher Situation die Flucht aus Athen, als ihm der Asebie3)-Prozess gemacht werden sollte.
Lehrer zu sein bedeutet, nach oben zu gehen und den Weg wieder nach unten steigen zu müssen, um vom Gesehenen zu berichten… Wer jedoch von oben kommt, wird verlacht, wird nicht ernst genommen, denn er berichtet von merkwürdigen Dingen, die es gar nicht gibt. Bildung ist ein Prozess, der, je weiter er fortschreitet, umso mehr Distanz zu den Blinden bedeutet.
.
3. Das Bild vom Menschen
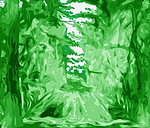
“Mich interessiert nicht wie du aussiehst.” – “Aber wie können wir uns dann erkennen?” – “Ich kenne den Teil in dir, der keinen Namen hat und das ist es doch was wir sind, richtig?” (aus: Stadt der Blinden)
Schauen wir uns den Begriff «Bildung» noch näher an, finden wir ihn als einen Schlüsselbegriff in der Epoche Goethes. Hier wie aber auch schon zuvor bei Meister Eckhart, Johannes Tauler oder Heinrich Seuse hat er seinen Ursprung in einem zentralen Gedanken der Mystik. Das Bild ist die Gestalt, das Wesen dessen, was ist (das griechische idea und eidos stecken darin). Die Mystik denkt die Wiedergeburt des Menschen in drei Stufen: Entbilden, Einbilden und Überbilden. Entbilden heißt frei werden von den Bildern dieser Welt als Voraussetzung für die nächsten Stufen. Ziel ist das Sich-Hinein-Verwandeln in Christus bzw. das Eins-Werden mit dem Göttlichen. Transformari haben die Mystiker mit «Überbilden» übersetzt. Das trans gibt das Ziel an: das reine Licht des Göttlichen. Die christliche mittelalterliche Mystik denkt das Sein als Herausbildung des im Menschen angelegten Bildes Gottes.
Aus der islamischen Mystik ist ein dem christlichen nicht unähnliches Bild dazu bekannt: Der Sufi Al-Halladsch hatte einen der 99 Namen Gottes für sich selber «beansprucht», indem er den Ausspruch anā al-haqq tat. Seine Lehre brachte ihm später eine Fatwa ein, seine in den Augen der damaligen Religionswächter häretische Aussage war mit dem Tode zu bestrafen. Niemand, kein lebender Mensch, konnte und kann nach exoterischer Lesart wie Gott sein, sondern immer nur durch Gott. In den Werken der Sufi-Dichter wie u.a. Yunus Emre, Rumi und Nezami trifft man auf Al-Halladschs Lehre der Eins-Werdung mit Gott bzw. der Auflösung des Ichs in Gott.
Der Hauptgedanke der Mystik – in modernen tagesverständlichen Worten ausgedrückt – besagt, dass der Mensch sich zum Menschen dadurch entwickelt, dass das in ihm angelegte Bild, sein Wesenskern, sich entfaltet. Ein Mensch kann werden, was er bereits ist – aber er kann nichts werden, das er nicht bereits in sich birgt. Was wie eine Begrenzung erscheinen könnte, kann als Bestimmung und Aufgabe umschrieben werden. Diese zu erkennen und zu erfahren ist die Eins-Werdung mit dem Göttlichen: das zu sein, als das man gedacht ist.
Unsere Zeiten sind säkulär-moralisch, ungern bezieht man sich auf diese Urbilder, aus denen unser heutiger Begriff aber nun einmal hervorgegangen ist. Heute denkt man Bildung als etwas, das dem Menschen «sozialgerecht» von außen angetragen wird, ohne dass sie auf den Einzelnen eingeht. Pädagogik ist ein Studienfach, das Lehrer unbedingt, Mystik eines, das sie ganz bestimmt nicht belegen müssen. Was die Mystik letztlich und paradoxerweise – und zwar unabhängig von der vordergründigen Religion – lehren kann, ist Demut.
Ein demütiger Lehrer wie auch ein demütiger Schüler haben Achtung vor dem Sein. Die Neugier des Schülers richtet sich auf ganz bestimmte Dinge, die ihn befähigen, sich selbst zu erkennen. Und selbst wenn der Schüler lernen muss, was in der Schule im Lehrplan vorgesehen ist, ohne dass es eine vordergründige Beziehung zu ihm hat, wird ein «mystischer» Lehrer es schaffen, dem Schüler das Wissen der Welt ehrfürchtig ans Herz zu legen.
.
4. Bildung und Humboldt

„Hast du Angst deine Augen zu schließen“ – „Nein, aber sie wieder zu öffnen.“ (aus: Stadt der Blinden)
Etwa um die Jahrhundertwende von 1800 herum bezog man sich auf den mystischen Bildungsbegriff – und aktualisierte ihn. Jetzt ging es nicht mehr so sehr um die Verwirklichung der Gottesgeburt in der eigenen Seele, als vielmehr um die allumfassende Ausbildung aller Fähigkeiten. – Diese Ausbildung wird in einem Mittelpunkt (Wissen um die Bestimmung des Menschen) zentriert. Der klassische Bildungsbegriff geht in Richtung Allgemeinbildung, und Wilhelm von Humboldt hatte ein Ideal vor Augen. Sein Bildungsideal entwickelte sich um die zwei Zentralbegriffe der bürgerlichen Aufklärung: den Begriff des autonomen Individuums und den Begriff des Weltbürgertums. Die Universität sollte ein Ort sein, an dem autonome Individuen und Weltbür-ger hervorgebracht werden bzw. sich selbst hervorbringen.
Wer ist man, wenn man Weltbürger ist? – Weltbürger sein heißt heute, sich mit den großen Menschheitsfragen auseinanderzusetzen. Der dahingehend Gebildete bemüht sich um Frieden, Gerechtigkeit, um den Austausch der Kulturen, andere Geschlechterverhältnisse oder eine neue Beziehung zur Natur.
Humboldt blickte auf den einzelnen Menschen als unverwechselbares, einzigartiges Individuum. In diesem Blick lag die Sehnsuchtsbewegung des menschlichen Lebens: fest verwurzelt sich bis an seine, ja, über seine Grenzen hinaus strecken zu können. Was tun junge Menschen? – Sie gehen in die Welt hinaus, nehmen sie in sich auf, entfalten die Fähigkeiten, die in der menschlichen Natur liegen, stärken und üben sie. Anschließend kehren sie zurück und nehmen ihren Platz dort ein, wo sie verwurzelt sind. Inwieweit ist dieses heute noch aktuell?
Ein zweiter Exkurs zum Lernen von (Fremd)Sprachen – immerhin ist Wilhelm von Humboldt auch «mein Ziehvater»: Das Erlernen fremder Sprachen hat nicht allein einen ökonomischen Nutzen (der durchaus in der Bildung von Menschen liegt), sondern einen Nutzen in einem emphatischen Sinn. Eine fremde Sprache zu lernen, heißt nämlich eine andere An-Sicht der Welt kennen zu lernen und eine andere Weise, sich in der Welt zu bewegen. Der Sprachlehrer kann als der Bringer eines neuen Selbstverständnisses, das das Eigene ergänzt und es bereichert, gesehen werden. Je mehr ich mir bewusst gemacht habe, desto mehr sehe ich in der Welt. Das, womit ich mich bekannt gemacht habe, ist mir nicht mehr fremd – ich muss es nicht mehr bekämpfen. Ein Lehrer, der vermag, dieses Feuer in seinem Schüler zu wecken, ist ein Brückenbauer, und der Schüler, der sein Feuer trägt, wird nicht mehr brandschatzen, sondern wertschätzen.
.
5. Bildung und der Einzelne
In unserer heutigen (westlichen) Welt brechen uns die Traditionen ein, ach, wir stellen sie derart in Frage, als gälte es, uns in selbstvernichtendem Bestreben für eine große Schuld zu bestrafen. Sinnstiftende Weltbilder sind auch in früheren Zeiten immer wieder zerbrochen, doch dann sind neue an ihre Stelle getreten. Jetzt scheint es, als seien die Menschen gewissermaßen experimentierend auf einem ziellosen Weg, auf dem das Individuum noch nicht einmal unterwegs erfährt, wer und was es ist. Da ist kaum Substanz, kaum Wesen, das in einer individuellen Lebensgeschichte zu entfalten wäre.
Um mit Sartre zu sprechen: Selbstverwirklichung heißt heute Verwirklichung von Nichts, nämlich von nichts Vorgegebenem. Es bleibt das Experiment, das der Mensch mit sich selber macht. Wir sind inzwischen sogar noch weiter, als Sartre beschrieb. Inzwischen erschöpft sich das Leben in nichts weniger als in aberwitzigen Vorgängen und Funktionen. Erlebnis und Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung und Entfaltung der je eigenen Individualität sind heute unbedingte Werte, die alle anstreben – und paradoxerweise zeigt nachgerade das vehemente Bestreben, sie zu erreichen, ihre Abwesenheit. Psychotherapie wird zum Dauerzustand. Alle wollen mehr und anderes sein als die anderen, und als das, was sie in ihrem Kern wären, in ihren mitgebrachten Umständen sind. An die Stelle des Seins – wie gesagt – ist der Vorgang getreten. Wir leben, indem wir tun und in der Welt agieren.
Meistens tun wir das durch das Setzen von Regeln und verzeichnen dabei den Verlust realer Allgemeinheit. Das heißt, wir wissen nicht mehr, wer wir als Menschen sind, und was wir als Menschen zu sein hätten. Zusammen mit der Tradition haben wir das Wissen um die Bestimmung des Menschen und um die Menschheit in uns verloren.
Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich Ihnen von meinem Abstecher an eine Schule, einer Stätte modernen Lernens und von Bildung erzählen muss. Obwohl ich keine ausgebildete Pädagogin mit Staatsexamen und absolviertem Referendariat bin, unternahm ich vor sieben Jahren den Versuch, an einer öffentlichen Schule zu unterrichten. Ich bewarb mich an einem Gymnasium auf eine Stelle als Deutschlehrerin. Knapp 49 Jahre alt war ich, und sehr gespannt auf das, was mich erwartete: zwei zehnte und eine neunte Klasse. Zuvor hatte ich mir Gedanken gemacht. Hier sind einige von ihnen zusammengefasst, auf dass meine Sicht auf das Lernen und Unterrichten deutlicher werde.
Gedanke 1: Ein Mensch lernt dort, wo er sich konfrontieren kann, zu provozieren versucht oder Provokation erfährt. Widerspruch ist im Lernprozess sehr wichtig. Wo er nicht möglich ist, und eigene und fremde Erkenntnisse im Fragen nicht freigelegt werden können, versiegt das Lernen und ein Glaube muss her.
Gedanke 2: Lernen ist nur dann und dort möglich, wenn und wo Menschen frei sind, ihre Erkenntnisse zu haben, und sich diese Freiheit auch erlauben. Diesen Gedanken habe ich bei Konfuzius gefunden. – Die Möglichkeit, die sich uns in einem kleinen Zeitfenster bot, war die der Möglichkeit, sich zu dieser Freiheit zu entscheiden. Das Fenster in der Zeit ist wieder geschlossen, und die Errungenschaften der Menschwerdung scheinen im ewigen Kreislauf in einen neuen – vermutlich niederen – Zustand überzugehen.
Gedanke 3: Einer von Konfuzius‘ wesentlichen Gedanken war der der zweifachen Menschlichkeit. Diese besteht im Bewusstsein der persönlichen Mitte und der Fähigkeit, andere gerecht und unparteiisch zu behandeln. Nur ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist, kann das Wesen anderer Menschen verstehen. Dann wird er im Umgang mit anderen keine Konflikte brauchen, keine Verwicklungen, weil er jene für etwas benutzt, das er ins Außen übertragen muss. Kämpfe zwischen Menschen entstehen aus falschen Gewohnheiten heraus; Menschen sind durch Konventionen, deren Bedeutungen sie nicht verstehen, schlimmer noch: durch Konventionen, die möglicherweise bar jeder Bedeutung sind, voneinander getrennt.
Ich fand mich drei Fronten gegenüber: die eine bestand aus den Eltern. Oh, da ist eine Lehrerin, die kein Referendariat durchlaufen hat. Ist sie in der Lage, mit unseren Kindern umzugehen? – Ich sage es gleich hier: ja, ich war in der Lage. Die Eltern hatte ich am Ende des ersten Halbjahres durchweg auf meiner Seite. Die zweite Front waren die Schüler. 75 an der Zahl, in einem Alter zwischen 13 und 16, geringfügig mehr Mädchen als Jungen, einige der Schüler mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Dies Alter ist bekannt als jenes, in dem junge Heranwachsende am allermeisten mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihrem erwachsenden Körper und ihrem erwachenden Trieb in die Welt hinein. Sie haben Fragen und wollen Antworten.
Die ersten Wochen vergingen mit Annäherungen – an den Unterricht, an die verschiedenen Menschen, an den Lernstoff. Es kostete mich doppelt so viel und dreimal mehr Zeit, den Stoff vorzubereiten als es einen routinierten Lehrer gekostet hätte. Ich fing mit allem bei Null an, auch mit der Notengebung und überhaupt mit den Bewertungsrichtlinien. Es kostete viel Geduldenergie, die Tests der Schüler zu durchlaufen, um ihnen zu beweisen, dass ich sie ernst nehme. Es bedurfte – im Nachhinein besehen – großen Mutes, Dinge zu tun, die «man sich» nicht mehr im Unterricht leistete. Die ersten Streiche überstand ich, mit Rotwerden, mit Herzklopfen. Ich überstand die Unlustattacken, die sich im Lärmpegel niederließen, den offenen Widerstand mit Verweigerungen. Ich bestand die Nagelprobe mit Theaterbesuch, Besuch einer Zeitung und eines Kinos, und die ersten Zeugniskonferenzen. Danach hätten wir zur Normalität übergehen können, aber ich streckte die Segel.
Grund dafür war die Front Nummer 3 – die Lehrerkollegen. Dazu weiter unten mehr. Als die Schüler soweit Vertrauen gefasst hatten, dass sie offen mit mir redeten, kam ihr Frust zutage. Wir wissen nicht, warum wir das lernen sollen. Frau Deutschlehrerin stellte dann gleich etwas klar: ihr wisst sehr wohl, warum. Eure Frage ist: Wozu müssen wir das lernen? – Ihr fragt, was die aristotelische Poesie mit der Welt da draußen zu tun hat. Ihr fragt, was die rhetorischen Muster in Remarques «Im Westen nichts Neues» mit eurer Realität zu tun haben? – Ich sagte es ihnen. Ein Schüler fragte zweifelnd, warum er eine Zwei im Referat bekommen hatte, während der sonstige Klassenbeste eine Drei bekam: ob ich wüsste, dass es andersherum sein müsste. Ein anderer Schüler, sonst schriftlich auf Vier abonniert, bekam von mir eine Zwei. Einer, der kaum etwas sagte, ging mit einer Zwei nach Hause; eine Schülerin, die sich ständig mündlich äußerte, mit einer Drei. Ich erspare uns hier Einzelheiten. Um es zusammenzufassen: ich versuchte, den Lernstoff mit dem Lebensumfeld der Schüler in Zusammenklang zu bringen, ich stellte Tiefenverbindungen her und nahm mir dafür Zeit. Ich brachte unbekannte Komponisten via CD mit ins Klassenzimmer, und wir sahen uns gemeinsam einen Film an, bei dem die Schüler darauf gewettet hatten, ich würde ihn nicht kennen. Wir lasen eine ernsthafte Lektüre zu Faschismus und machten ein Drehbuch daraus, wir lasen Dürrenmatt und vertieften uns in Medea, kamen bei Christa Wolf und dem Geteilten Himmel heraus. Sie lernten nebenbei so viel, weil sie nicht merkten, dass sie lernten, sondern ihr gewecktes Interesse stillten. Die Klassenarbeiten, die wir schrieben, waren auf diese Art Lernen zuge-schnitten. Ich glaube, nach zwei Durchgängen brauchte keiner mehr Angst zu haben, er würde völligen Unsinn abliefern. Denn ich hatte gesagt: das gibt es gar nicht! Natürlich mussten wir in der Vergleichsarbeit scheitern! Ich scheiterte, weil mich die Kollegen nicht einbezogen, was die Wahl des Themas, seine Präsentation und die Aufgaben anging. Sie waren zu viert und sich einig, ich war alleine. Meine Schüler scheiterten, denn ich hatte ihnen in nur sieben Monaten eine Art zu arbeiten gezeigt, die sie aufgeweckt hatte, aber das war nicht vorgesehen. Ich hatte sie damit verdorben, und das ließ man mich spüren.
Als ich es merkte, war die erste Hälfte des zweiten Halbjahres fast vorbei. Ich beraumte eine Sitzung mit meinen Schülern ein und eröffnete ihnen, dass ich gehen würde. Nichts sagte ich von den Kollegen, wohl aber sagte ich, dass ich merkte, ich wäre am falschen Ort. Sie verraten uns! riefen sie zu Recht. Das sei nun mal so gelaufen – ich hatte das nicht erwartet. Weiterzumachen aber täte mir nicht gut, denn ich hätte immer das Gefühl, sie nicht auf das vorzubereiten, was von ihnen verlangt würde. Ich eigne mich nicht zu dieser Art von Ausbilder, und deshalb müsse ich gehen. Sie gingen heim, zwei Wochen später hatte der Schulleiter einen Brief aller Klassenvertreter mit der dringenden Bitte, meinen Vertrag zu verlängern und mich da zu behalten, auf dem Tisch. Meine Entscheidung aber war unumstößlich.
An dieser Schule ist mir klar geworden: es geht nicht mehr um Bildung, es geht, wenn überhaupt auch das noch, um Aus-Bildung. Schüler sammeln ein Wissen, das weit davon entfernt ist, in Zusammenhang mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stehen, das eingeatmet, und sobald die Klassenarbeit vorüber ist, wieder ausgeatmet wird.
.
6. Der Mensch in der Bildungswüste
Die Bildung des Menschen zu sich selbst, das Sehenlernen des wahren Lichtes, auf dass man sich und die anderen erkenne, die Vielfalt der Selbstverständnisse – alles das ist in einer Landschaft des Unterschiedlosen untergegangen. Es hat ganz schleichend angefangen. Vielleicht mit der französischen Revolution, vielleicht mit der Industrialisierung, vielleicht mit dem Kapitalismus, der als die andere Seite des Kommunismus nicht viel anders als jener ist. – Alle Menschen sind Funktion von etwas oder einem anderen. Alle Menschen sind gleich. Erst vor dem Recht und schließlich vor den Vielen. Gleichmacherei steht der Bildung des Eigenen entgegen. Da, wo nicht unterschieden wird, wird auch nicht geachtet, wert geschätzt. Dann haben wir die Einöde, die Wüste.
.
Exkurs

„Kein Araber liebt die Wüste. Wir lieben Wasser und grüne Bäume. In der Wüste ist nichts. Kein Mann braucht Nichts.“ (aus: Lawrence of Arabia)
In einem papiernen Aufschrei hatte ich vor langer Zeit einmal geschrieben, ich wolle nicht akzeptiert, sondern toleriert werden (etwa: «Du musst mich nicht mögen oder mir zustimmen, aber lass mich sein, wie ich bin!»). Anschließend hatte ich in einem öde langen Text versucht, zu definieren, was denn nun Toleranz und was Akzeptanz sei. Am Ende war alles – von Augen Dritter ungelesen – in einem der digitalen wie realen Ordner verschwunden. Und war vergessen worden.
Nun habe ich ihn wiedergefunden. Zu meinem Schrecken verstand ich meine eigenen Worte nicht mehr. – Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Ich sprach/schrieb sofort alarmiert mit etlichen Leuten und erfragte ihre Definition von Toleranz und Akzeptanz. Fragte dabei auch nach, welchem sie den Vorrang geben würden. In meiner Verwirrung hätte ich keine Prognose abgeben wollen, tendierte aber immer noch zur Toleranz, wie vor Jahren. Die Befragten allerdings legten den Schwerpunkt auf die Akzeptanz. Akzeptiert zu werden bedeute die Anerkennung der Meinung, die man vertrete, las ich da. Man werde mit den eigenen Ansichten und Taten in eine Gemeinschaft, die diese für gut befände, aufgenommen.
Toleranz, sagten sie, sei eine Einstellung der Nicht(be)achtung. Eine, die in sich trage, dem Toleranten sei das Gegenüber egal. Man interessiere sich nicht wirklich, sondern bleibe unverbindlich und beziehe keine Position. In einem Artikel, den ich im Internet fand, las ich, dass etwas aus der Position eines Herrschenden heraus zu akzeptieren etwas völlig anderes – sogar gegensätzliches – sei als zu tolerieren. Letzteres heiße, etwas zu dulden und zu erlauben (auch etwas, das falsch sei, was natürlich überhaupt nicht gehe!), während ersteres bedeute, etwas als wünschenswert anzunehmen und zu fördern. Toleranz sei eine Haltung des Verzichts auf ein bestimmtes, klar umrissenes Menschenbild, demgemäß man als Einzelner die Gesellschaft formen könne. Zwar habe eine tolerante Person eine ungefähre Ahnung, wie sich Menschen der eigenen Meinung nach verhalten sollten, doch ob sie das auch wirklich täten, würde dann nicht weiter beachtet. Das Führen des eigenen Lebens gehe jenen vor dem Einwirken auf das Leben der anderen, und das sei Gleichgültigkeit. Ich verstummte und ging in mich.
Meine Verwirrung weigerte sich beharrlich zu weichen, nein, sie vergrößerte sich: war nicht früher, vor nicht allzu vielen Jahren Toleranz der Wert in unserer Mitte, dem das größere Gewicht beigemessen wurde? Was war aus Nathan dem Weisen aus der Ringparabel Lessings geworden? Darin ging es doch um Toleranz, oder? Oder hatte ich alles falsch verstanden?
Mir fehlte ein entscheidender Baustein zum Verständnis des hausgemachten Unverständnisses, und ich entwickelte den Verdacht, dass hier eine Umgewichtung, eine Umdeutung der Begriffe, die mich in ihren Strudel gerissen hatte, im Gange war.
Der fehlende Baustein kam in Form einer Zigarette, die jemand vor der Tür eines Restaurants stehend rauchte, daher. Zigaretten sind gefährlich, d.h. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Ist bekannt. Das hört und liest man allerorten, steht auch auf den Schachteln drauf. Also wird was dran sein. Wenn dem so ist, dann empfiehlt es sich, möglichst nicht zu rauchen, insofern man gesund bleiben will oder bleiben muss. Das könnte man als Dogma formulieren. Ihr Arzt vertritt möglicherweise dieses Dogma, d.h. er macht die Aussage der Gefährlichkeit der Zigaretten für sich zur ausschließlich gültigen Aussage. Wenn Sie ihn aufsuchen, wird er Ihnen nahelegen – eingedenk der später eintretenden Folgen – sofort mit dem Rauchen aufzuhören. Er wird sagen: Sie sollten aufhören zu rauchen, denn sonst… Und dann wird er Ihnen freistellen, ob Sie seinen Rat befolgen oder nicht. Der Mensch Arzt als Dogmatiker wird Sie nicht persönlich dafür abstrafen, dass Sie Raucher sind. Er wird Sie aber vielleicht durchaus interessiert fragen: Genießen Sie Ihre Zigaretten wenigstens? Und das meint er nicht ironisch.
Hat Ihr Arzt eine hohe Moral, dann wird er Ihnen ebenfalls sagen, dass Sie aufhören sollten zu rauchen. Er wird dies ebenfalls mit der Gefährlichkeit begründen, und er wird anführen, dass Rauchen auch die anderen Menschen gefährdet, jene, die in Ihrer Nähe leben, die Sie einnebeln, die passiv mitrauchen. Er ist ein Moralist, denn er wird eine bedrohliche Information in seiner Empfehlung mitschwingen lassen: Hör auf zu rauchen, sonst müssen wir dich ausschließen, sonst müssen wir uns überlegen, wie wir dich vom Gegenteil überzeugen. Die Moralisten haben es inzwischen geschafft, die Raucher draußen vor die Tür zu schicken.
Ein Dogmatiker kann tolerieren, dass jemand etwas für sich Falsches tut, wenn er nur die Konsequenzen seines Handelns übernimmt. Ein Moralist muss jemanden, der im Begriff ist, einen Fehler zu begehen, davon überzeugen, es anders zu machen, nämlich so, dass es mit der Mehrheitsgemeinschaft konform geht. Ein Moralist kann akzeptieren, was seinen Grundsätzen ähnlich ist. Es ist nicht so, dass ein Dogmatiker nicht weiß, was für den anderen gut wäre – nur: er wird es nicht einfordern. Das jedoch tut der Moralist.
In unseren Zeiten ist diese Begrifflichkeit verwischt. Weil Schwarz-Weiß ein Ideal ist und es dieses real nicht gibt und folglich auch nicht geben darf, dafür immer nur verschiedene Abstufungen von Grau, haben sich im Zuge der Relativierung und Neutralisierung Verwechslungen eingeschlichen. Das tut es immer, wenn man die Pole, zwischen denen sich das Leben abspielt, nicht mehr eindeutig benennen darf. Immer gibt es und hat es Mischtypen gegeben. Inzwischen allerdings kommen Dogmatiker moralisch verkleidet daher, und Moralisten wechseln auch schon mal ins dogmatische Lager, wenn eine angesagte Meinung in eine andere Phase tritt. Was zu beobachten ist: wir haben einen gewollten Überhang zum Moralischen. Die Werte an sich sind verloren gegangen (sage nicht nur ich), der Ethos ist futsch. Stattdessen haben wir Normierungen und Regelungen.
.
7. Rekonstruktion von Bildung
Fassen wir zusammen: Das Leben ist ein Traum oder ein Schattenspiel. Die Menschen darin – blind und ohnmächtig – jene, die das, was wirklich ist, nicht sehen, die das, was keineswegs wirklich ist, für wirklich halten. – Das war das Thema von Aischylos, damit sind wir wieder zurück bei den Griechen – und den Höhlenmenschen. Die Blinden, die Gefangenen könnten lernen zu sehen, und wollen es doch nicht.
Die Mystik mit dem Bild vom innewohnenden Wesen, das in einem Äußeren eingewickelt ist: die ganze Eiche ist bereits in der Eichel angelegt, der Baum wird sich von innen nach außen entfalten und entwickeln. Das ist im Groben das Wesen des mystischen Bildungsweges. So könnte es aussehen, doch die exoterischen Auslegungen haben der Mystik und den Menschen diesen Weg versperrt. Es bleib in heutiger Zeit ein Abklatsch – die kommerzielle Esoterik, die in Dualität zum Ursprung geht.
Humboldt zeigte an der Gestalt eines Baumes die Bewegung auf, die Sehnsuchtsbewegung, die das menschliche Leben voranzieht: Überhaupt liegt in den Bäumen ein unglaublicher Charakter der Sehnsucht, wenn sie so fest und beschränkt im Boden stehen, und sich mit den Wipfeln, so weit sie können, über die Grenzen der Wurzeln hinausbewegen. Ich kenne nichts in der Natur, was so gemacht wäre, Symbol der Sehnsucht zu sein. – In der Erde verwurzelt, wissend, wer wir sind, könnten wir die Welt erobern. Doch es ist etwas geschehen:
Statt Nächstenliebe haben wir den Sozialstaat. Nächstenliebe ist die Liebe zum Nächsten, den man in seinem Schicksal zu verstehen sucht. Wir mildern uns gegenseitig das Begreifen unserer Schicksale, d.h. unserer jeweiligen Bestimmungen, was uns nicht dessen enthebt, uns selbst und unser Leben eigenständig zu leben. Im Nächsten tolerieren wir sein je Eigenes. Mit «sozial» hat das nichts zu tun.
Wenn ich sozial bin, befinde ich mich von vorneherein, als mich bedingend und sichernd, in einem Kollektiv. In einem Kollektiv geht es nie um den Einzelnen, das Individuum. Da können sie reden, wie sie wollen: das geht nicht zusammen!
In der Nächstenliebe werden die Unterschiede zwischen den Menschen bewahrt und geachtet. Im Sozialen geht es darum, diese Unterschiede aufzuheben, so dass es keine Einzelnen, keine Individuen mehr gibt. In-dem wir die Unterschiede ausgleichen wollen und die Diskriminierung (das Bezeichnen der Unterschiede, und im Zuge dessen das Handeln, das diesem Bezeichnen folgt) zu vermeiden versuchen, geben wir die Möglichkeit zur Toleranz preis – und auch die Möglichkeit zur Entwicklung des Einzelnen zu dem Baum, der er ist. In einer sozialen Monokultur ohne Unterschiede gibt es keine Konkurrenz. Das könnte Frieden bedeuten, sollte man meinen. Es wird auch so kommuniziert. In Wirklichkeit bedeutet es den Tod.
Der moralische Überhang ist eine der Ursachen dafür, dass wir im Sozialrausch die Chance auf Eigenständigkeit unseres Seins verlieren und aufgeben, und damit die Bildung unseres Selbst. In der Ausübung und im Vorgang-Sein meinen wir, jederzeit einschreiten zu dürfen und setzen den Zwang zum Handeln an die Stelle des Geschehenlassens. Wir sind scheinbar überaus beweglich, dabei äußerlich getrieben und innerlich eingeschlossen und isoliert. Höhle – Sokrates!
Die meisten Lehrer in den Schulen, auf die unsere Kinder gehen, sind davon überzeugt, das Beste zum Besten der Kinder zu tun. Dass sie alles gelten lassen, dabei bewerten, und die Bewertungen sofort relativieren, weil niemand aufgrund eines Unterschieds Vorteile haben darf, ist tägliches Brot.
Dass aber heute die Menschen sich selbst gestohlen werden, wird keine Medizin richten können. Von derlei Dingen muss man sprechen, wenn man über Bildungspolitik spricht, und von noch anderen mehr, die ich hier überhaupt nicht angesprochen habe. ■
1)Sprache im weitesten Sinne, auch Dialekte
2)Kognition: Zu den kognitiven Fähigkeiten zählen: die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Erinnerung, das Lernen, das Problemlösen, die Kreativität, das Planen, die Orientierung, die Imagination, die Argumentation, die Introspektion, der Wille, das Glauben und einige mehr. Es geht im Wesentlichen um Informationsverarbeitung. Der Begriff ist Gegenstand einiger Diskussion; ich verwende ihn in Anlehnung an die Arbeiten der kognitiven Psychologie, zusammengefasst in Oerter & Montada: Entwicklungspsychologie
3)Frevel gegen die Götter
..
___________________________________
Geb. 1958 in der Eifel/D, Studium der Sprachwissenschaft, Finn-Ugristik und Psychologie, Promotion, zahlreiche belletristische und fachwissenschaftliche Publikationen, lebt in Bornheim/D
.
.
Sema Kaygusuz: «Schwarze Galle» (Kurzprosa)
.
Anstupsen, um aufzuwecken? – oder:
Von Hüzünlern und Gramerfüllten
Dr. Karin Afshar
.
 Das Wesen der Melancholie ist überaus schillernd, ihr Ausdruck nicht minder, und ihr Lockruf, sich im Ringen um den Platz und den Sinn des eigenen Ich im Weltengefüge, mit sich und der Welt auseinanderzusetzen, führt meistens zu Fluchttendenzen, namentlich zur Flucht nach innen. Dort finden der und die von Schwermut Heimgesuchte (von nicht wenigen ist sie nicht erworben, sondern als Anlage immer schon da) viel Leidvolles; Melancholiker leiden an der Welt, und wenn sie hernach aus sich heraustreten und in die Welt blicken, sich wieder in sie hineintrauen, um auf ein Neues aktiver Teil in ihr zu sein – sind sie noch fremder als jemals zuvor. Sie sind weit gegangen und dabei der «Welt abhanden gekommen» (Text Friedrich Rückert, in den «Rückert-Liedern» von Gustav Mahler vertont). Nur manchmal begegnen sie Gleichgesinnten, Gleich»gestimmten», und erkennen sich als Heimatlose und Suchende.
Das Wesen der Melancholie ist überaus schillernd, ihr Ausdruck nicht minder, und ihr Lockruf, sich im Ringen um den Platz und den Sinn des eigenen Ich im Weltengefüge, mit sich und der Welt auseinanderzusetzen, führt meistens zu Fluchttendenzen, namentlich zur Flucht nach innen. Dort finden der und die von Schwermut Heimgesuchte (von nicht wenigen ist sie nicht erworben, sondern als Anlage immer schon da) viel Leidvolles; Melancholiker leiden an der Welt, und wenn sie hernach aus sich heraustreten und in die Welt blicken, sich wieder in sie hineintrauen, um auf ein Neues aktiver Teil in ihr zu sein – sind sie noch fremder als jemals zuvor. Sie sind weit gegangen und dabei der «Welt abhanden gekommen» (Text Friedrich Rückert, in den «Rückert-Liedern» von Gustav Mahler vertont). Nur manchmal begegnen sie Gleichgesinnten, Gleich»gestimmten», und erkennen sich als Heimatlose und Suchende.
In Sema Kaygusuz‘ Buch «Die schwarze Galle» treffen wir auf Melancholiker, und dies u.a. in Gestalt von drei Frauen, die den Rahmen für noch andere Charaktere bilden: Birhan ist eine Istanbuler Dichterin, Sema ist die Ich-Erzählerin, und Yasemin wiederum eine Bekannte von Birhan. Alle drei hören Geräusche, und entlang dieser Geräusche steigen auch wir Leser von Anfang an in die Innenräume ihrer Seelen mit hinab.
Beim Gang durch die Unterwelten versteht es Sema Kaygusuz, den Leser ebenso mit eingebetteten Essays, z.B. über den Unterschied zwischen dem türkischen «hüzün» (das sie meint nicht mit der «Schwermut» gleichsetzen zu können) und der Gram, in der der Schwermütige haust, wie mit Intermezzi von Reflektionen über das Schreiben zu fesseln. Dann wieder erzählt sie parabelhaft die Begegnung eines jungen Mannes mit einer Schneiderin, in vorderorientalischer Erzähltradition von Ezel und Zühal, vom Gärtner und den Hunden, von Musa… Es erwartet die Leserin (und ich glaube, es ist ein Buch für Frauen mehr als für Männer) Schwermütiges, aber das satirisch, lustig, paradox, kurzweilig. Trotz allen zur Sprache kommenden Leides will mir scheinen, als schwebe ein Hauch von Selbstironie über dem Erzählten.
Sema Kaygusuz‘ Sprache trägt zu diesem von mir gefühlten Hauch bei. Wie sie auf Türkisch schreibt, kann ich nicht beurteilen (die deutsche Übersetzung ist in sich und im Ganzen stimmig). Die gewählten Bilder, die Art der Erzählanfänge und das Verweben, die Verweise auf weitere Ebenen, erinnert an – und das wiederum kann ich ein wenig beurteilen – die mündliche wie schriftliche Erzähltradition auch im Iran, in der persischen Literatur. Meister-Schüler-Geschichten, Derwisch-Lehr-Erzählungen, Nasreddin Hodscha. Ihre Sprache ist Empfindungssprache mehr denn Denksprache, und bringt gerade deshalb zum Denken. Leider fallen dann doch einige Formulierungen auf – viele sind es nicht – aber sie sind da, ob nun absichtlich oder unbeabsichtigterweise. Vielleicht sollen diese funktional-intellektuellen Seitenschritte den Bruch bekräftigen, nachgerade die Leserin darauf stoßen, dass wir in Zeiten leben, in denen sich gerade vieles auflöst. Denn in den Erzählungen geht es auch um die Auflösung der Illusion, dass Zeit linear verläuft. Diese Linearität war niemals gegeben, man hatte sie sich konstruiert, weil man meinte, die Vorstellung zu brauchen. Brüche jedweder Art werden erst spür- und anschließend auch sichtbar, wenn die Selbstverständlichkeit des einen auf die des anderen trifft und sich Unvereinbarkeit abzeichnet.

In der Kurzprosa-Sammlung «Schwarze Galle» von Sema Kaygusuz erwartet die Leserin (und ich glaube, es ist ein Buch für Frauen mehr als für Männer) Schwermütiges, aber das satirisch, lustig, paradox, kurzweilig. Trotz allen zur Sprache kommenden Leides schwebt aber ein Hauch von Selbstironie über dem Erzählten.
Jeder Text ist Spiegel seiner «Gegenwart»: Kaygusuz‘ Texte spiegeln das Hin- und Herwandern von Menschen, das Überqueren von Grenzen (was allerdings ein zeitloses Thema ist). Die Möglichkeit unserer Tage indes, Räume innerhalb kürzester Zeit durchqueren zu können und auch zu müssen, bleibt nicht ohne Effekt auf uns; die Schnelligkeit der Wechsel lässt das Empfinden kaum noch nachkommen. Real, fast körperlich, spüren inzwischen die meisten von uns, was es mit der Beschleunigung auf sich hat: sie lässt uns herausfallen.
«Feinstofflich» kann man Sema Kaygusuz‘ Sprache nennen, was Wortwahl und das Gespinst der Worte angeht, gleichzeitig ist der Text durchstrukturiert und doch fragil. Fragil sind natürlich auch die Figuren. Die Sonderlinge von Sema Kaygusuz heißen Yakup, Bora und Helin, Ruth, ja, selbst Gülayşe, die derb und übergriffig in den Lebensraum der Erzählerin einbricht, und sie erinnern mich unwillkürlich an die der deutschen Früh-/Spät-Romantik: Lenz (Georg Büchner), Eduard aus dem «Stopfkuchen» (Wilhelm Raabe), an den Nachtwächter (Bonaventura), an Friedrich Mergel (Annette von Droste-Hülshoff). Oh, wo waren denn da die Frauen?
Lassen Sie sich also auf eine Reise ganz anderer Art mitnehmen und legen Sie das Buch sachte weg, nachdem «Himmel und Erde aufgestöhnt haben». – Gestöhnt habe auch ich ein wenig, das muss ich hier noch anbringen. Ich hätte das Nachwort nicht lesen sollen/dürfen, denn es hat etwas zugebaut, was Sema Kayguzus so leichtfüßig offengehalten hat: Sie hatte Freiräume gelassen, und nicht zuviel angestupst. («Uns braucht niemand anzustupsen, nicht wahr, Birhan, wir wachen von allein auf.») Aber vielleicht brauchen ja andere Leserinnen eine Anleitung, und das Nachwort ist gut gemeint. ■
Sema Kaygusuz: Schwarze Galle, Geschichten, 140 Seiten, Matthes & Seitz Verlag, ISBN: 978-3-88221-049-1
.
Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Jürgen Fürkus: «Literarische Eigenblicke» (Lyrik & Kurzprosa)
.
Was Jürgen Fürkus mit Havergal Brian zu tun hat
Dr. Karin Afshar
.
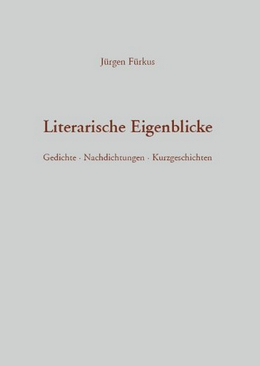 Schon vor Tagen war es angekommen – das Buch, um das es heute geht. Sein Verfasser hat es mir zur Besprechung persönlich zugeschickt. Im Briefkasten am selben Tag auch eine CD mit Kompositionen jenes in der Überschrift ebenfalls genannten Havergal Brian. William Havergal Brian lebte von 1876 (in Dresden, Staffordshire geboren) bis 1972 und war den Großteil seines Lebens als Komponist (hauptsächlich von Wiener Klassik inspiriert, mit Elementen dissonanter Harmonik und Atonalität) eher unbekannt, ja unbedeutend. Legendär indes ist, dass er 21 seiner insgesamt 32 Sinfonien jenseits seines 80. Geburtstags komponierte. 1961 – da war er bereits 85 Jahre alt, wurde seine 1. Sinfonie (die «Gothische») in Westminster aufgeführt. Ich höre sie, während ich dies schreibe, und habe gelesen, dass sie – was den Orchesterapparat angeht – sogar die Anforderungen von Gustav Mahler und Arnold Schönberg übertreffen soll. Nach dem Aufflackern in den 60ern verschwand Brians Werk wieder in den Kreisen seiner wenigen, aber sehr enthusiastischen Anhänger. William Brian, obwohl er sein Leben lang komponierte, erreichte nie die Popularität eines Ralph Vaughan Williams. Wohl aber wusste er sein Handwerkzeug, das er sich autodidaktisch angeeignet hatte, einzusetzen, und war darin alles andere als laienhaft.
Schon vor Tagen war es angekommen – das Buch, um das es heute geht. Sein Verfasser hat es mir zur Besprechung persönlich zugeschickt. Im Briefkasten am selben Tag auch eine CD mit Kompositionen jenes in der Überschrift ebenfalls genannten Havergal Brian. William Havergal Brian lebte von 1876 (in Dresden, Staffordshire geboren) bis 1972 und war den Großteil seines Lebens als Komponist (hauptsächlich von Wiener Klassik inspiriert, mit Elementen dissonanter Harmonik und Atonalität) eher unbekannt, ja unbedeutend. Legendär indes ist, dass er 21 seiner insgesamt 32 Sinfonien jenseits seines 80. Geburtstags komponierte. 1961 – da war er bereits 85 Jahre alt, wurde seine 1. Sinfonie (die «Gothische») in Westminster aufgeführt. Ich höre sie, während ich dies schreibe, und habe gelesen, dass sie – was den Orchesterapparat angeht – sogar die Anforderungen von Gustav Mahler und Arnold Schönberg übertreffen soll. Nach dem Aufflackern in den 60ern verschwand Brians Werk wieder in den Kreisen seiner wenigen, aber sehr enthusiastischen Anhänger. William Brian, obwohl er sein Leben lang komponierte, erreichte nie die Popularität eines Ralph Vaughan Williams. Wohl aber wusste er sein Handwerkzeug, das er sich autodidaktisch angeeignet hatte, einzusetzen, und war darin alles andere als laienhaft.
Während ich das Buch von Fürkus umdrehe und auf dem rückwärtigen Einband zu lesen beginne, geht mir die Koinzidenz der Ankunft durch den Kopf. «In den Gedichten», steht dort, « greift er [Fürkus] vielfältige Momente des Lebens auf und setzt mit dem Reiz von Lyrik Akzente zum Nachdenken und Verweilen.» Ich blättere nach vorne. Erstes Gedicht:
«Der Schatten»
In der Höhe nicht zu messen,
nur als Fläche existent.
Wie von Zauberei besessen,
Projektionen kongruent.
Abbild aller Dimensionen,
stets dem Lichte zugewandt,
plattgewalzt wie Druckschablonen,
auch als Schattenspiel bekannt.
…
Das liest sich gefällig, und ist gereimt. Die Seiten danach lesen sich nicht mehr ganz so gefällig. Da beginnt es zu holpern. Das liegt nicht an den Themen, sondern an der spürbaren Anstrengung, sie in Reimen und Versen bändigen zu wollen. Dabei bleibt die Tiefe auf der Strecke, die Essenz und der Fluss kommen abhanden. Es sind tagesaktuelle Themen wie auch philosophische Betrachtungen unter den Gedichten: Selbstfindung, Erinnerungen, Impressionen, Lebens- und Leidenserfahrung, sowie Reflektionen über Politik – auch Atomkraft – und: ein «lyrischer Exkurs zur deutschen Geschichte». Spätestens hier breche ich ab, überfliege die Nachdichtungen englischer Songtexte, blättere in die Kurzgeschichten (Der Tag in Hallstatt und Krippenstein, Beim Orthopäden, Die Fahrradtour) hinein, und lege dann das Buch weg. Schade. Das war eine verschenkte Stunde. Wenn ich eins mitnehme, dann bestenfalls: hier hat jemand geschrieben und das ist an und für sich nicht zu bewerten. Das Geschriebene kann für einen kleinen Kreis, vielleicht den der Familie, durchaus stimmig sein. Da ist er dann zuständig. Schreiben klärt, Schreiben bringt im Akt des Artikulierenmüssens und -wollens zum Hin- und Einsehen.
Die Absicht einer Publikation, sprich einer Veröffentlichung ist, einen größeren Leserkreis zu erreichen. Den Weg, damit dieser größere Kreis erreicht werde, ebnen Verlage, das ist – unter anderen – ihre Aufgabe. Für das Schreiben für eine Leserschaft außerhalb der Familie oder des weiteren Freundeskreises bedarf es allerdings noch einiger Dinge mehr. Und außerdem einer anderen, weiteren Zuständigkeit.
In dieser Zuständigkeit sollte der Schreibende das Werkzeug beherrschen; er muss es so einsetzen können, dass selbst in einem Anderen, den er nicht von Angesicht kennt, etwas angesprochen wird. Schreiben ist eben doch nicht nur das Herausschreiben dessen, was man in sich selbst findet, sondern auch das An- und Aussprechen der Welt für die Welt.

In Jürgen Fürkus’ «Literarischen Eigenblicken» fehlen nicht nur das Feuer und der Genius, sondern auch der professionelle Umgang mit Sprache. Dem Buch können Güte, Menschlichkeit und Zuversicht nicht abgesprochen werden – aber Literatur ist das nicht…
In Verlagen arbeiten Lektoren, Menschen, die sich der Sprache, des Werkzeugs des Dichters annehmen. Wenn er dieses selbst noch nicht virtuos an den Stoff anlegen kann, zeigen sie ihm zweierlei auf: entweder, wie es gehen könnte (Talent vorausgesetzt, und der Dichter findet im gegenseitigen Prozess seinen Ton, wird eigenständig und wiedererkennbar) oder dass «es» so nicht geht und alle Müh vergebens sein wird (weil ein anderes, nicht aber das Talent zum Schreiben vorliegt).
Bei Book-on-demand bzw. ProBusiness gibt es offenbar kein Lektorat, oder – eine Recherche diesbezüglich ist noch nachzuholen – man muss es extra bezahlen, wenn man sein Buch dort in Druck gibt. Ich habe etliche Schreibbegeisterte erlebt, die glaubten, ihre Texte seien bereits «druckreif» – und ein kostenspieliges Lektorat für überflüssig hielten. Jürgen Fürkus‘ Sprache ist durchsetzt mit Irrtümern über das Lyrische, seine Wortwahl nah am Umgangssprachlich-Funktionalen, mit dem nicht er spielt, sondern das mit ihm spielt. – Das Wesen des Lyrischen ist die Verdichtung. Auch das Genre Kurzgeschichte lebt vom Verdichten. Eine einzelne wahre (vielfach banale) Begebenheit «genügt» einfach nicht, daraus eine Geschichte zu machen.
Indem ich das Buch zuklappe, denke ich das Wort «schal». Es fehlen das Feuer und der Genius. Dass aus den «Eigenblicken» Güte, Menschlichkeit und Zuversicht sprechen, kann und soll ihnen nicht abgesprochen werden; dass sie «literarisch» seien, indes schon. Schreiben sollte man dann doch denen überlassen, die es können. Lesen kann auch etwas sehr Schönes sein. ■
Jürgen Fürkus: Literarische Eigenblicke – Gedichte, Nachdichtungen, Kurzgeschichten, 144 Seiten, ProBusiness GmbH, ISBN 978-3-86386-465-1
.
Weitere Rezensionen von Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Clemens Berger: «Ein Versprechen von Gegenwart» (Roman)
.
Entfremdete Tagleben
Dr. Karin Afshar
.
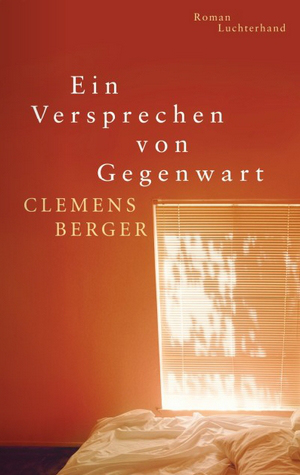 Wie ist es mit Ihnen: Suchen Sie sich Ihren Lesestoff nach Titeln aus? Oder nach Autoren, was heißt, Sie haben Lieblingsautoren und lesen deren Bücher, sobald sie auf dem Markt sind? Arbeiten Sie Bestsellerlisten ab, z.B. solche, die einem aus Illustrierten und Magazinen entgegenprangen? Oder lesen Sie ein Buch, weil Sie eine Besprechung dazu besonders anspricht?
Wie ist es mit Ihnen: Suchen Sie sich Ihren Lesestoff nach Titeln aus? Oder nach Autoren, was heißt, Sie haben Lieblingsautoren und lesen deren Bücher, sobald sie auf dem Markt sind? Arbeiten Sie Bestsellerlisten ab, z.B. solche, die einem aus Illustrierten und Magazinen entgegenprangen? Oder lesen Sie ein Buch, weil Sie eine Besprechung dazu besonders anspricht?
Für den Fall, dass Sie jemand aus der letzten Kategorie sind: hier ist mein Leseeindruck von Clemens Bergers Roman «Ein Versprechen von Gegenwart» für Sie. Kleinformat, 11,8 x 18,7 cm, Hardcover mit Schutzumschlag, terracottafarben, 160 Seiten so lesefreundlich formatiert, wie nur ein gedrucktes Buch zu sein vermag. Mal sehen, ob der Klappentext hält, was er verspricht.
Auf dem rückwärtigen Einband lesen Sie u.a. das Wort «Erotik»; ja – um es vorwegzunehmen – es gibt auch Sex in der Geschichte; die Erotik dieses Buches besteht allerdings in jener Art Erotik, die dem Unerreichbaren innewohnt. – Man kann die Erzählung unter diesem Gesichtspunkt lesen, oder unter noch anderem!
Dem Erzähler (erzählt in der Ich-Form), Kellner in einem Restaurant, fällt ein Paar auf, das in regelmäßigen Abständen zu später Stunde – in der Spanne von kurz vor und kurz nach Mitternacht – auftaucht. Das Paar: eine – und damit wir verstehen, wie es gemeint ist, mehrfach betont – schöne Frau namens Irina und ein Mann, der uns als «Löwe» vorgestellt wird. Was diese beiden verbindet, oder auch nicht verbindet, aber aneinanderhält, ahnen wir bald.
Der Kellner verfällt den beiden, sie beflügeln seine Phantasie, werfen ihn in eigene Erinnerungen; er lässt sich besetzen. Und er lässt den Leser an seinem vorgestellten und halb ausgelebten Voyeurismus, bei dem sich Grenzen verwischen, man nicht weiß: ist er es vielleicht doch selbst? Haben wir es mit einer Spaltung zu tun? – teilhaben. Erzählt wird die Geschichte dieser Liebesbeziehung, die keine ist, als Rückschau, aus der Perspektive von «Löwe» (Berger bedient sich dabei eines «Kniffs» – er spricht ihn als «du» an) und der der «Wildkatze» (ebenso), dann wieder vorgreifend… Der Leser wird in der Zeit umhergeworfen wie die beiden Protagonisten in der ersten und der zweiten Welt. Natürlich wird es eine Katastrophe geben. Sie wird mehrfach angedeutet. Das Wort Auflösung drängt sich mir beim Lesen auf. Ein Versprechen von Gegenwart wird nicht eingelöst und bleibt ein Versprechen. Am Ende dann mein Empfinden, nicht verstanden zu haben, worum es geht, und ich erschrecke. Ich lege das Buch irritiert weg.
Ich komme aus einer Gegenwart, die inzwischen Vergangenheit geworden ist, und das viel schneller als ich mir je hatte träumen lassen. Junge Autoren gehen ganz neu mit Sprache um, sie schreiben über Themen, die ich längst nicht mehr aufrollen muss, die ich hinter mir gelassen habe und über neue Themen, die sich mir nicht mehr stellen werden. Jetzt ist eine andere Gegenwart. Meine Vorlieben für eine bestimmte literarische Sprache ist von meiner gewesenen Gegenwart geprägt. Dass ich diese Vorlieben habe, hat u.a. mit mir zu tun. Schreibstil ist auch eine Charaktersache…
Abgesehen davon schreiben die Autoren von heute anders. Berger schreibt so anders. Daher kommt die Fremdheit. Er hat eine Sprache gefunden, die der aufgelösten (vormals konstruierten) Linearität unserer Moderne entspricht. Manche seiner Sätze fangen so an, wie ich es kenne, und bauen meine Erwartung auf, dann wird sie zerschlagen, endet in einer Sackgasse – der Satz, ein ganzer Absatz scheinen mir unverständlich. Noch einmal zurück, noch einmal von vorne lesen – und jetzt hab ich den Faden wieder. Klar, jetzt verstehe ich. Bis zum nächsten Ruck.
Neben Linearität bzw. deren Aufhebung verspüre ich die Abwesenheit von Kontinuität. An den Strand unserer Gegenwarten (jeder Mensch hat je eigene) schlagen heutzutage heftige Wellen. Sie kommen in kürzeren Abständen, sind stakkatohaft, alles ist beschleunigt. Die eine lange Welle, die aus den zusammengeschichteten Gegenwarten von einer in die andere übergeht, scheint es nicht mehr zu geben. Das Tagleben ist in Episoden zerlegt, die Menschen darin sich entfremdet. Das Tagleben ermöglicht vieles, verhindert aber auch anderes, und das ist dann allenfalls in der Nacht, kurz vor und kurz nach Mitternacht, möglich, in der Grauzone, in der die Grenze liegt, die man übertritt, übertreten kann. Sehe ich es so, verstehe ich durchaus.

Clemens Berger hat in seinem Roman «Ein Versprechen von Gegenwart» eine Sprache gefunden, die der aufgelösten (vormals konstruierten) Linearität unserer Moderne entspricht. Für eine flüchtige Lektüre zwischendurch ist das Büchlein fast zu schade. Auch wenn es sich schnell liest, hat es verdient, mindestens drei-viermal in die Hand genommen zu werden. Von diesem Autor sollten wir noch mehr zu lesen bekommen.
Eine Grenze übertreten sowohl der Ich-Erzähler als Kellner in seinem Tagleben, als auch «Löwe» in seinem „inoffiziellen» Leben mit Irina. Beide gehen zu weit und die Auflösung tritt – wie immer – in Gestalt von Unordnung ein. Die anfängliche Genauigkeit im Beschreiben auf den ersten Seiten, übervoll mit Details, das akribische Beobachten, die ein Stillstehen suggerieren, ein Verweilen in Gegenwart aufbauen, weichen zum Höhepunkt hin mehr und mehr. Nach dem Eklat ist die Sprache fragmentarisch, nicht gerade einfacher dadurch.
Für eine flüchtige Lektüre zwischendurch ist das Büchlein fast zu schade. Auch wenn es sich schnell liest, hat es verdient, mindestens drei-viermal in die Hand genommen zu werden. Von Clemens Berger sollten wir noch mehr zu lesen bekommen. Das hoffe ich doch schwer. ■
Clemens Berger: Ein Versprechen von Gegenwart, Roman, 160 Seiten, Luchterhand Verlag, ISBN 978-3-630-87410-4
.
Weitere Rezensionen von Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Gisela Elsner: «Zerreissproben» (Erzählungen)
.
Nichts für zarte Gemüter
Dr. Karin Afshar
.
 Bestimmt haben Sie als Leser oder Leserin mehr als einmal darüber nachgedacht, zu welcher Gruppe Leser Sie wohl gehören würden, wenn es in Buchhandlungen nicht die üblichen Sparteneinteilungen in Sachbücher, Romane, Fantasy, Frauenromane etc. gäbe, sondern Einteilungen wie z.B. in Kundensparten: «Interessiert sich für die politische Richtung eines Autors», oder «Meint, kein Autor schreibe anders als autobiografisch», oder «Interessiert sich für in Widersprüche verstrickte Autoren», zu deren Regale Sie dergestalt orientiert Ihre Schritte lenken könnten, um sicherzustellen, dass Sie auch genau die Bücher, die Sie interessieren, in die Hände bekämen und nicht unnötigerweise – das Leben hält genug schlechte Überraschungen bereit – solche, die sie enttäuschen würden. Die Sparten in Kombination würden Ihnen jenes Buch auswerfen, um das es in den nächsten Absätzen gehen wird.
Bestimmt haben Sie als Leser oder Leserin mehr als einmal darüber nachgedacht, zu welcher Gruppe Leser Sie wohl gehören würden, wenn es in Buchhandlungen nicht die üblichen Sparteneinteilungen in Sachbücher, Romane, Fantasy, Frauenromane etc. gäbe, sondern Einteilungen wie z.B. in Kundensparten: «Interessiert sich für die politische Richtung eines Autors», oder «Meint, kein Autor schreibe anders als autobiografisch», oder «Interessiert sich für in Widersprüche verstrickte Autoren», zu deren Regale Sie dergestalt orientiert Ihre Schritte lenken könnten, um sicherzustellen, dass Sie auch genau die Bücher, die Sie interessieren, in die Hände bekämen und nicht unnötigerweise – das Leben hält genug schlechte Überraschungen bereit – solche, die sie enttäuschen würden. Die Sparten in Kombination würden Ihnen jenes Buch auswerfen, um das es in den nächsten Absätzen gehen wird.
Wenn Sie den Eingangssatz durchdrungen haben, stehen Sie bereits mitten in einem Labyrinth; so ist es zumindest bei Gisela Elsner. Besagter Satz ist nur ein fader Abklatsch dessen, was sie zu Papier bringt. Die kafkaeske Art ist ihr Stil, ihr Markenzeichen: sie konstruiert Sätze, die erstaunen, zum Lachen bringen, ungeduldig, atemlos, ja, wütend machen. Sie wiederholt, insistiert, ist akribisch, sie zählt auf, spitzt zu, zerpflückt, zerteilt… Dieser Erzählstil unterstreicht natürlich Inhalte, und die sind nicht lustig. Ihre Texte handeln von der Künstlichkeit einer bürgerlichen Welt, die einerseits die Schrauben immer fester anzieht, andererseits verschroben daher kommt.
Elf Erzählungen Elsners hat die Herausgeberin Christine Künzel neu choreographiert, und die Abfolge ist gelungen. Christine Künzel betreut seit 2002 die Werkschau Gisela Elsners im Verbrecher Verlag Berlin: «Die Zähmung», Roman (2002), «Das Berührungsverbot», Roman (2006), «Heilig Blut», Roman (2007), «Otto der Großaktionär», Roman (2008) und «Fliegeralarm», Roman (2009) sind bereits erschienen. Gisela Elsner erhielt etliche internationale Auszeichnungen, darunter den Prix Formentor für ihren ersten Roman «Die Riesenzwerge» (1964), an dessen Erfolg sie nicht wieder anknüpfen konnte. Sie veröffentlichte Romane, Erzählungen, Aufsätze, Hörspiele und das Opernlibretto «Friedenssaison».
Elsner beschreibt in den vorliegenden Erzählungen vor allem Menschen, die sie aus dem Kollektiv herausarbeitet, wie man einen 3D-Abdruck aus einem Nagelbild herausarbeitet: hinten wird gedrückt und vorne entsteht das Bild. Sie beschreibt das Kollektiv, die Welt der Oberfläche, die sie sodann demaskiert, damit das Darunter – das Scheinheilige – zum Vorschein kommt. Die Geschichten verlangen starke Nerven, denn Elsner zerlegt und karikiert so gründlich, dass sie sich selbst und dem Leser den Boden unter den Füßen wegzuziehen vermag.
In «Die Zerreißprobe» (der ersten Erzählung im Band 2) geht es um eine Frau, die sich – als Terroristin verdächtigt – im Fadenkreuz des Verfassungsschutzes glaubt. Ihre Wohnung wird beobachtet. Wenn sie nicht zuhause ist, kommen «sie», schalten Tischlampen aus, verrücken Möbel und schneiden von Kleidungsstücken Stofffetzen ab. Von einem Nachbarn, dem Vormieter dieser Wohnung, in der sie nun lebt, erfährt sie, dass in der Wohnung in erst kürzlich zurückliegender Vor-Nach-Stammheimer Zeit Terroristen untergeschlüpft sein sollen. Der Verdacht – so vermutet die Erzählerin, die auch in der Erzählung Schriftstellerin ist – fällt jetzt auf sie, aber sie geht der Sache auf den Grund.
In «Der Maharadscha-Palast» mokiert sie sich über eine Reisegesellschaft, die am Ort ihrer Unterkunft mit einigen Überraschungen konfrontiert ist: keiner der Betroffenen wird sich – zurück in Deutschland – die Blöße geben und zugeben, sich angesichts des Vorgefundenen entlarvt zu haben.
«Der Selbstverwirklichungswahn» verhöhnt nicht nur die Selbstfindungswelle der frühen 80er Jahre, sondern nimmt die Auswüchse der «Grünlichen» aufs Korn, und dabei nicht weniges vorweg. Wie überhaupt die spitz gezeichneten Bilder sowohl allesamt Abbilder der 70er und 80er sind, als auch eine Vorwegnahme, die wir jetzt – 2013 – im Nachhinein in voller Tragweite bestätigen können. Elsners Geschichten sind meiner Meinung nach mehr als Satire. Unsere Zeit hat die Satire längst eingeholt, und bei manchen Erzählungen ereilt mich der Verdacht, Elsner habe geahnt, worauf es hinausläuft, und ist Opfer ihres persönlichen Minenfeldes geworden. Damit musste sie eine Herausgefallene werden!
In «Der Sterbenskünstler» geht es um die Friedensbewegung und ihre Abstrusitäten, in «Der Antwortbrief Hermann Kafkas auf Franz Kafkas Brief an seinen Vater» bricht sie mit ihrem «Gott» Franz, an dem sich orientieren zu können sie in jungen Jahren glaubte: «Du schreibst, Du wärest mir als das Ergebnis meiner Erziehung peinlich. […] Viel peinlicher indes als das Ergebnis meiner Erziehung ist für mich die Tatsache, dass ich es durch Dich mehr und mehr verlerne, nicht allein die Welt zu begreifen, sondern auch mich. […]» Kafka, ohne dies ergiebig zu vertiefen, lebte vor den Toren zur Gegenwart und trat nicht über die Schwelle ins Jetzt. Seine Hauptthemen waren durchweg voller Anklage an jene, von denen er glaubte, sie verhinderten ihn. Das wiederum übte eine gewisse Faszination – nicht nur auf Elsner – aus.

In ihrem zweiten Erzählband “Zerreissproben” legt Gisela Elsner ein Zeugnis ihrer selbst ab, und das so fundamental und radikal, dass es einem die Luft abdrehen kann. Wir blicken in Abgründe…
«Die Zwillinge» und «Vom Tick-Tack zum Tick» kommen im Vergleich zu «Die verwüstete Glückseligkeit» harmlos daher, zeugen aber gerade deshalb von Elsners – es Talent zu schreiben zu nennen, wäre eine Beleidigung – mal lauter, mal leiser Demontierungswut und Wortgewalt. Elsner geht auch mit sich selbst hart ins Gericht, demontiert sich selbst und erwartet anscheinend doch unendlich viel – oder gar nichts mehr? Was weiß man von dieser Frau? Muss man etwas über sie wissen? Ich finde ja: man muss! Sie ist gegen die Friedensbewegung, sie lehnt die Errungenschaften von 68 radikal ab, sie bekennt sich zum Kommunismus, ist aber doch wankelmütig (Eintreten, dann Austreten, dann Wiedereintreten in die DKP), sie will nicht Dichterin genannt werden, … Sie inszeniert sich selbst und später – als das nicht mehr reicht – ihre Selbstzerstörung. Sie hadert mit sich, ist unzufrieden, gehört nirgendwo dazu, und braucht das vielleicht doch sehr dringend? «Irgendwie» besteht die «reine Möglichkeit», dass das Ende der ganzen Kette von Missständen, dem Abstrusen, dem verhassten Kapitalismus, der Kleinbürgerlichkeit … ein anderes Leben bedeuten könnte – bis es jedoch soweit ist, fehlt ihr eine wirklich positive Perspektive. Gisela Elsner wird 1937 in Nürnberg geboren, und nimmt sich 1992 das Leben.
Im Buch enthalten sind Erklärungen zu Elsners erzählerischem Werk, editorische Notizen zur Historie der einzelnen Erzählungen sowie deren Verortung im Gesamtwerk. Niemand schreibt anders als autobiografisch – zu dieser Ansicht bin ich im Laufe meines Lebens gelangt. Das Herausstechendste an Elsners hier vorgelegten Erzählungen ist: sie legt ein Zeugnis ihrer selbst ab, und das so fundamental und radikal, dass es einem die Luft abdrehen kann. Wir blicken in Abgründe. Nicht viel Spaß wünsche ich nun beim Lesen, sondern viele Erkenntnisse! ●
Gisela Elsner: Zerreissproben, Erzählungen (Band 2), 224 Seiten, Verbrecher Verlag, ISBN 9783943167054
.
.
.
.
.
Peter O. Chotjewitz: «Tief ausatmen» (Lyrik)
.
Über das tiefe Ausatmen von Gedanken
Dr. Karin Afshar
.
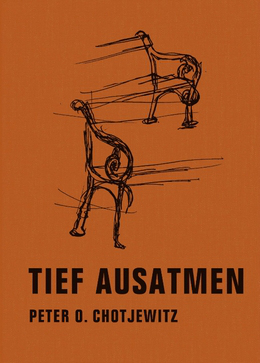 Peter O. Chotjewitz kenne ich nicht. Ich habe mir das Buch ausgesucht, weil mich der Titel angesprochen hat. Tief Ausatmen. Der Einband fühlt sich rauh an, es ist ein ganz einfach gestalteter dunkelorangeroter Leineneinband und im Innern finden sich gelbliche Werkdruck-Seiten, auf ein paar Seiten Illustrationen, Skizzen von Fritz Panzer, die Gedichte – dreizeilig alle, zuzüglich Überschriften. Das Buch ist frisch aus der Druckerei. Sein Geruch ist mir sympathisch.
Peter O. Chotjewitz kenne ich nicht. Ich habe mir das Buch ausgesucht, weil mich der Titel angesprochen hat. Tief Ausatmen. Der Einband fühlt sich rauh an, es ist ein ganz einfach gestalteter dunkelorangeroter Leineneinband und im Innern finden sich gelbliche Werkdruck-Seiten, auf ein paar Seiten Illustrationen, Skizzen von Fritz Panzer, die Gedichte – dreizeilig alle, zuzüglich Überschriften. Das Buch ist frisch aus der Druckerei. Sein Geruch ist mir sympathisch.
Ein erster Hinweis aufs Ausatmen dies:
Ich ging
Nach langer schwerer
geduldig ertragener
Überflüssigkeit
Das mit der Überflüssigkeit macht ihn mir sympathisch. Das ist wohl so, wenn man älter wird, und vieles gesagt ist – man das Leben und die von ihm gebotenenen Dinge eingeatmet hat, um gegen Ende festzustellen, dass die eigene Person doch eigentlich ziemlich unbedeutend ist.
Lesen macht einsam
Mit den Jahren kam
Bücher bis zur Haustür
die Eigentorheit
Wieder hat er mich! Das Wortspiel mit der Torheit, die zum Eigentor wird, und dass man sich bei allem Lesen und Wissen am Ende von den anderen entfernt. Ich unterbreche meine Lektüre und will jetzt wissen, wer der Mann ist, und ob ich ihn richtig verstehe. Also lese ich über Chotjewitz nach, auch um die Ankündigung seines Verlages (er sei «eigensinnig, tiefsinnig, hintersinnig») verstehen, zumindest aber verorten zu können.
Chotjewitz ist 1934 geboren. Seinen ersten Werdegang möge man selbst nachlesen, auch die Geschichte über die Freundschaft mit dem «Oberterroristen» Andreas Baader, dessen Wahlverteidiger er war. Seit Mitte der 1960er Jahre schrieb Chotjewitz realistische Erzählungen und Romane, die er bei Verlagen wie Rowohlt oder Kiepenheuer & Witsch publizieren konnte. Er trat der Gruppe 47 bei, distanzierte sich aber später von deren Monopolstellung: sie hätten den Literaturbetrieb «vergiftet». Chotjewitz – einen ersten Lyrikband hatte er 1965 mit «Ulmer Brettspiele» veröffentlicht, danach keinen mehr – hatte sich als Schriftsteller etabliert, wurde jedoch immer mehr zum Außenseiter: die «neue Innerlichkeit» löste eine Polit-Literatur wie er sie schrieb ab, und der Linksradikalismus der 70er Jahre ging in der Friedensbewegung und den Grünen auf. Chotjewitz zog sich zurück und übersetzte fortan u.a. den Literaturnobelpreisträger Dario Fo aus dem Italienischen ins Deutsche, und gab gelegentlich ein neues Buch heraus, so z.B. den historischen Roman «Macchiavellis letzter Brief». «Fast schien es, als verschwände hier ein Veteran der Linken stellvertretend für seine ganze Generation in der kulturellen und politischen Bedeutungslosigkeit.»
Chotjewitz tauchte wieder auf, nämlich beim Verbrecher Verlag. «Tief Ausatmen» ist posthum in diesem Oktober erschienen. Seine Frau Cordula Güdemann und der Verleger Jörg Sundermaier haben das Material zusammengestellt.
Soweit die Hintergründe, lassen wir jetzt wieder Texte sprechen. Fünf wähle ich noch aus, nicht ganz so willkürlich wie – so schreibt es der Herausgeber – Zeichnungen und Texte im Büchlein miteinander verknüpft sind.
Die Texte muss man sich vorlesen, mehrmals – zeilenübergreifend ergeben sie Sätze, Sinnzusammenhänge. Sie setzen einiges an Vor-, Welt- und auch Geschichtswissen voraus, denn sonst entgehen einem die offenen und versteckten Verweise!
Damals im kalten Krieg
Sehnsucht heißt das alte
Lied der Taiga das schon
meine Mutter sang.
Es ist nicht damit getan, dass man die Zeilen wiedererkennt – man muss sie weiterdenken. Und im Weiterdenken erst erfüllen sie ihren Anstoß.
Bulletin 9/2010
Herr der Sommer war
sehr groß alles voll Knollen
Hals Lunge Leber
Die Gedichte sind Skizzen, die umreißen, ein Tiefergehen erlauben, es aber nicht plakativ einfordern. Sie sind Gedanken im Vorbeigehen, eine Form andeutend. (Die Zeichnungen von Fritz Panzer könnten nicht passender sein.) An anderer Stelle sind sie unstet, kaum zu fassen. Sie wollen nicht festgehalten werden; alles Festhalten scheint dem Schreibenden Zwang.
Die Themen? Vielfältig, aber nicht geordnet. Die Sprache? Es blitzen hin und wieder Bukowskieske Vibes in den Zeilen auf. Manches verstehe ich nicht, weil mir der Kontext fehlt – ich bin eben Chotjewitz-Anfängerin.
Alles spüren
Kühl die schlaflose
Nacht am besten nichts kein Bär
kein Schweif nur liegen
Stilles Feuer
Dich trifft ein Blitz aus
dem Sehschlitz unterm Tschador
wird wild gejodelt

Eigensinnig schreibt Chotjewitz unbedingt, die Vorgabe keiner Formvorgabe ist die Freiheit, die er sich erlaubt. Hintersinnig und tiefsinnig – auch das. Die Verse sind inspirierend in ihrer Kürze, lassen viel Raum. Ein Könner eben.
Es findet sich Selbstironie und Selbstbeobachtung, Spott über andere und Kommentare zu Vergangenem. Eigensinnig schreibt Chotjewitz unbedingt – Elfchen haben wir hier nicht gerade vorliegen, die Vorgabe keiner Formvorgabe ist die Freiheit, die er sich erlaubt. Hintersinnig und tiefsinnig – auch das. Die Verse sind inspirierend in ihrer Kürze, lassen viel Raum. Ein Könner eben. Man kann sich jeden Tag einen Dreizeiler herausgreifen und an ihm eine Weile herumdenken. Und wem etwas einfällt, der möge dies beherzigen:
In der Straßenbahn
Was dir so einfällt
Junge schreib’s auf es könnte
ein Gedanke sein
■
Peter O. Chotjewitz: Tief Ausatmen, Lyrik, Zeichnungen von Fritz Panzer, Herausgeber: C. Güdemann & J. Sundermeier, 140 Seiten, Verbrecher Verlag, ISBN 978-3943167023
.
.
.
.
.
.
.
Corina Caduff: «Kränken und Anerkennen» (Essays)
.
Warum Herr Freud gekränkt war
Dr. Karin Afshar
.
 Ein Essay ist eine aus einem persönlichen Blickwinkel erklärende Darstellung kultureller, gesellschaftlicher oder philosophischer Themen. Ein Essay – auch wenn er grundsätzlich nicht fiktional ist – enthält erzählerische Passagen. Außerdem sind Essays chronologisch, normalerweise eher kurz (5-10 Seiten) – feste Regeln aber gibt es nicht –, und jeder neue Begriff wird eingeführt und vorgestellt. Essays sind, wie die französische Bedeutung des Wortes sagt, Versuche, Großes und Kleines, Wichtiges und scheinbar Unwichtiges zusammenzubringen und zu beleuchten.
Ein Essay ist eine aus einem persönlichen Blickwinkel erklärende Darstellung kultureller, gesellschaftlicher oder philosophischer Themen. Ein Essay – auch wenn er grundsätzlich nicht fiktional ist – enthält erzählerische Passagen. Außerdem sind Essays chronologisch, normalerweise eher kurz (5-10 Seiten) – feste Regeln aber gibt es nicht –, und jeder neue Begriff wird eingeführt und vorgestellt. Essays sind, wie die französische Bedeutung des Wortes sagt, Versuche, Großes und Kleines, Wichtiges und scheinbar Unwichtiges zusammenzubringen und zu beleuchten.
Die Schweizer Literaturwissenschaftlerin Corina Caduff hat sich in zehn solcher «Versuche» knapp 170 Seiten lang mit dem Thema «Kränken und Anerkennen» auseinander gesetzt. Nun sind Essays keine leichte Lektüre – sie verlangen vom Leser ein Mitgehen. Nicht selten sind sie erst dann richtig interessant, wenn das Thema ihn persönlich betrifft. So ging es mir: wie durch Zauberhand legten sich auf meinen Tisch nicht nur das Buch, sondern mehrere Fälle von Beziehungs- und Kommunikationsproblemen, die mit einer nicht geleisteten Anerkennung, mit dem Äußern von Kritik, die als zu vernichtend empfunden wurde und daraus resultierendem Kränkungsgefühl zu tun hatten. Gleichzeitigkeit von Ereignissen nennt man das, und ich hatte mehr als einen Grund, mit Gier und Neugier Caduff zu erlesen, und so trat ich in Gedankenaustausch mit ihr.
Die Essays kommen nicht glatt daher, apodiktische Antworten gibt es nicht – wohl aber vorläufige, die Raum zu eigenen Überlegungen lassen. Die Autorin gibt Einblicke in ihr Denken und Fühlen, lässt den Leser teilhaben und setzt sich einer Kritik aus, die sie kränken könnte. Es erfordert Mut, seine Gedanken zu den Dingen der Welt zu äußern, denn man gibt sich eine Blöße.
«Der wunde Punkt scheint darin zu bestehen, dass sie mit ihrem Produkt, das sie der Öffentlichkeit anvertrauen wollen, aufs empfindlichste verwoben sind.» heißt es im Essay «Kunst und Kritik». Darin geht es um die Beziehung zwischen dem Künstler, seinem Werk und dem Publikum, dem er es darbringen möchte.
 Ein anderer Titel: «Erschrecken». Die Lust am Erschrecken, schreibt Caduff, hat mit Macht und Kontrollausübung zu tun. Endlich bestimmt man als Erschreckender einmal aktiv und unmittelbar sichtbar über eine Reaktion bei anderen. Der Erschrockene wiederum erlebt einen Zeitriss, bei dem er aus dem Zeitkontinuum fällt. Das Eintreten dieses Zeitrisses beschreiben wir landläufig als «plötzlich» – dank Caduff habe ich nun verstanden, warum Geschichtenschreiber sich dieses Wörtchens befleißigen, wenn sie Spannung erzeugen wollen. Der Riss in der Zeit geht mit einem Verlust von Fassung einher und stellt eine Attacke dar; in unserer (evolutionären) Erinnerung ist es das Hereinbrechen des Jägers über sein Beutetier. In unserer zivilisierten Welt nehmen wir das Erschrecktwerden sehr übel – ist es doch der vorübergehende Verlust der Integrität des Selbst, und damit eine Kränkung.
Ein anderer Titel: «Erschrecken». Die Lust am Erschrecken, schreibt Caduff, hat mit Macht und Kontrollausübung zu tun. Endlich bestimmt man als Erschreckender einmal aktiv und unmittelbar sichtbar über eine Reaktion bei anderen. Der Erschrockene wiederum erlebt einen Zeitriss, bei dem er aus dem Zeitkontinuum fällt. Das Eintreten dieses Zeitrisses beschreiben wir landläufig als «plötzlich» – dank Caduff habe ich nun verstanden, warum Geschichtenschreiber sich dieses Wörtchens befleißigen, wenn sie Spannung erzeugen wollen. Der Riss in der Zeit geht mit einem Verlust von Fassung einher und stellt eine Attacke dar; in unserer (evolutionären) Erinnerung ist es das Hereinbrechen des Jägers über sein Beutetier. In unserer zivilisierten Welt nehmen wir das Erschrecktwerden sehr übel – ist es doch der vorübergehende Verlust der Integrität des Selbst, und damit eine Kränkung.
Blicke sind ebenso wie Geld Machtwerkzeuge, angetan, sowohl zu vernichten wie auch zu trösten. In noch weiteren Essays streifen wir Abbildungen von Toten, den Umgang mit Kranksein und Sterben und Begegnungen mit dem Jenseits. Auch die Wissenschaftsgeschichte trägt bei: in «Kränkungen der Menschheit» machen wir einen Abstecher in den Themenkreis «Wissenschaft versus Religion».

Corina Caduff schreibt für Menschen, die sich ihre eigenen Gedanken machen können und – gehört damit zu jener neuen Generation von Philosophen, die sich die Empirie des eigenen Lebens und der eigenen Erfahrung erlauben, auch wenn sie Gefahr laufen, zu wiederholen, was «man» längst weiß. Weiß man es wirklich?
Corina Caduff ist eine Wissenschaftlerin; ihre Gedanken versieht sie mit Querverweisen auf weitere Literatur. Der nun hungrig gewordene, interessierte Leser kann sich in die Themen weiter einlesen und die Hintergründe vertiefen. Caduff schreibt für Menschen, die sich ihre eigenen Gedanken machen können und – gehört damit zu jener neuen Generation von Philosophen, die sich die Empirie des eigenen Lebens und der eigenen Erfahrung erlauben, auch wenn sie Gefahr laufen, zu wiederholen, was «man» längst weiß. Weiß man es wirklich?
Caduffs Stil ist konstant und durchstrukturiert. Da ist nichts dem Zufall überlassen: sie ist pointiert und kokettiert doch mit dem Vorläufigkeitscharakter des «Versuchs». An manchen Stellen gibt es mehr Erzählung, bisweilen verlässt sie die Rolle der Betrachtenden und Reflektierenden und ist dann erlebender Mensch, sehr real und lebendig. «Tote zeigen» beinhaltet einen fünfseitigen Abschnitt über einen Aufenthalt in Kathmandu, und gleich zu Beginn ist es das Erlebnis des Fliegens, das sie mit uns teilt. Im letzten Essay ist es ein Selbstversuch, den sie schildert, und damit beginnt und endet der Zyklus bei der Person – ein persönliches Buch! ■
Corina Caduff, Kränken und Anerkennen, Essays, 168 Seiten, Lenos Verlag, ISBN 978-3857877438
.
.
Ameneh Bahrami: «Auge um Auge»
.
Tragisches Schicksal als literarische Chimäre
Dr. Karin Afshar
.
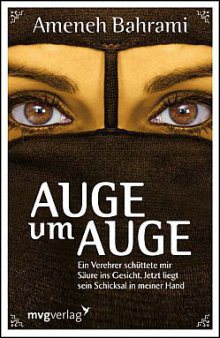 Der MVG-Verlag, in dem das Buch «Auge um Auge» von Ameneh Bahrami erschienen ist, hat eine Philosophie: Man will Mut machen und kompetente Hilfe in allen Lebenslagen bieten. Die Bücher, die im Verlag erscheinen, sollen für ein unbeschwertes, glückliches und bewusstes Leben stehen. Der MVG-Verlag versteht sich als zukunftsorientierter Ratgeberverlag mit den thematischen Schwerpunkten Persönlichkeitsbildung und Motivation. Sein Programm umfasst rund 700 lieferbare Titel. Im Bereich Lifestyle erscheinen Hardcover und Taschenbücher zu verschiedenen Themen. Und so kündigt er das Buch, um das es hier geht, an: «Das Buch gibt allen Frauen Kraft, für ihr Leben und ihre Freiheit einzustehen. Es ist die Geschichte einer unglaublich starken Frau.»
Der MVG-Verlag, in dem das Buch «Auge um Auge» von Ameneh Bahrami erschienen ist, hat eine Philosophie: Man will Mut machen und kompetente Hilfe in allen Lebenslagen bieten. Die Bücher, die im Verlag erscheinen, sollen für ein unbeschwertes, glückliches und bewusstes Leben stehen. Der MVG-Verlag versteht sich als zukunftsorientierter Ratgeberverlag mit den thematischen Schwerpunkten Persönlichkeitsbildung und Motivation. Sein Programm umfasst rund 700 lieferbare Titel. Im Bereich Lifestyle erscheinen Hardcover und Taschenbücher zu verschiedenen Themen. Und so kündigt er das Buch, um das es hier geht, an: «Das Buch gibt allen Frauen Kraft, für ihr Leben und ihre Freiheit einzustehen. Es ist die Geschichte einer unglaublich starken Frau.»
«Auge um Auge» hat 256 Seiten und ist ein Hardcover-Band. Bevor ich auf den Inhalt eingehe, erlauben Sie mir einen Blick auf den Einband. Vorne direkt unter dem Titel steht: «Ein Verehrer schüttete mir Säure ins Gesicht. Jetzt liegt sein Schicksal in meiner Hand.» Zwei Augen in einem ansonsten mit einem Schleier verborgenen Gesicht springen dem Leser – bzw. der Leserin, denn Frauen sind die Zielgruppe – entgegen. Derlei Bucheinbände gibt es mittlerweile vielfach – ja, ist denn dem Verlag nichts Eigenes eingefallen?
Aber sehen wir uns den Titel näher an: «Auge um Auge». Wer kennt das Zitat nicht? Soweit so gut: der Verlag setzt auf zwei bekannte und in vielen Menschen umhergeisternde Vorstellungen, um sein Buch zu vermarkten und neu im Unterbewusstsein zu verankern. Die Leute sollen kaufen! Das ist legitim, denn damit verdient ein Verlag sein Geld. Und er hat Recht: vermutlich geht für eine kurze Zeit – denn länger reicht das Gedächtnis und die Geduld der Leser nicht mehr – genau mit dieser Kombination die Rechnung auf. Daran verdient hoffentlich auch die Autorin.
Auge für Auge (hebräisch עין תּחת עין ajin tachat ajin) ist Teil eines Rechtssatzes aus dem Sefer ha-Berit (hebr. Bundesbuch) in der Tora für das Volk Israel (Ex 21,23–25 EU). In der heutigen Umgangssprache wird Auge für Auge überwiegend unreflektiert als Ausdruck für gnadenlose Vergeltung verwendet. Übersetzt als Auge um Auge (und zusammen mit Zahn um Zahn) wird das Teilzitat zur Anweisung an das Opfer oder seine Vertreter, dem Täter Gleiches mit Gleichem «heimzuzahlen» bzw. sein Vergehen zu sühnen. Dass es ursprünglich auch im Alten Testament (2. Moses 21, 24) darum ging, Rache abzuwehren und Gewalt zu begrenzen, ist nur wenigen präsent.
Im Iran, dem Heimatland der Erzählerin, ist aufgrund der rund 1300 Jahre alten Scharia-Gesetze, die bei vorsätzlicher Tötung und vorsätzlicher Körperverletzung das Vergeltungsprinzip («Qisas») darstellen, sogar vorgesehen, dass der Täter das erleiden soll, was er seinem Opfer angetan hat.
Der Erzählerin wird nach einer Gerichtsverhandlung eben dieser Urteilsspruch zuteil, dergleichen vornehmen zu dürfen. Zwar darf sie für zwei ihrer Augen zunächst nur ein Auge des Täters blenden, aber sie kann ja das zweite hinzukaufen. Eine Frau ist eben nur halb so viel wert wie ein Mann. Sie bekommt schließlich doch seine beiden Augen…

Ein Bild, das um die Welt ging: Ameneh Bahrami nach dem Säure-Anschlag, in der Hand ihre Bilder als Gesunde
Ameneh ist eine junge Frau, die an der Freien Universität in Teheran Elektrotechnik studiert. Vom Tschador hält sie nicht viel: sie trägt lieber einen knielangen weißen Mantel und ein Kopftuch. Damit macht sie sich natürlich nicht nur Freunde, und setzt sich den Männerblicken und auch so mancher Anmache aus. Im Jahre 2003 ist eine Frau im Iran alles andere als hamsar und auf Augenhöhe eines Mannes, und scheint am besten in einer (wie auch immer arrangierten) Ehe aufgehoben. Die Nach-Khomeini-Zeit – aber nicht nur diese – hat seltsame männliche Exemplare und verquer-menschenverachtende Ansichten hervorgebracht. Nun ist es nicht ungewöhnlich und überraschend, dass in einer reglementierten Gesellschaft das Dunkle ungleich böser zum Ausbruch drängt.
Nicht alle sind «infiziert», aber eben viel zu viele. Ameneh kann sich damit nicht abfinden und glaubt an die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens. Sie hat für ihr Studium gekämpft und sich mehrfach beworben, dann hat sie Jobs angenommen, um sich dieses Studium zu finanzieren – etwas, das Frauen im Westen ebenfalls kennen, denn auch uns wird nichts geschenkt. Sie hat einen jungen Mann, in den sie wirklich verliebt war, nicht geheiratet, weil er sich als eifersüchtig und kontrollierend entpuppte und sie am liebsten gleich in die Küche verbannt hätte. Sie hat sich für ein Leben allein entschieden – für solange, bis der «Richtige» käme. Da beginnt ein um drei Jahre jüngerer Mann, sie zu bedrängen – und das Ganze endet in der inzwischen weltweit bekannten Katastrophe: als sie ihn abweist, schüttet er ihr Säure ins Gesicht, sie erblindet.

Was Ameneh durchgemacht hat, ist erschütternd, da gibt es keine Diskussion. Doch dann sind da die gewollten Belehrungen und die ideologischen Knöpfe, die gedrückt werden. Die Emotionalität der Schilderungen ist vielfach kaum zu ertragen. Der Leser wird missbraucht und in eine Meinung gezwungen, anderes als hier geschrieben darf man nicht fühlen. Eine solch künstliche, amateurhafte Erzeugung von Spannung hätte die Geschichte nicht nötig gehabt…
Was Ameneh Bahrami durchgemacht hat, ist erschütternd, da gibt es keine Diskussion. Was nur können Menschen Menschen antun! Und wieso lässt Gott das zu, warum lässt er zu, dass ein heranwachsendes Leben zerstört wird und ein Mensch tiefer und tiefer fällt, bis auf den Grund seiner Menschenwürde? Soll er daran zugrundegehen oder soll er wachsen? Ist das die Lektion des Lebens?
Ameneh bemerkt in ihrer Hilflosigkeit bald, wer Freund und wer Feind ist, sie lernt zu unterscheiden, wer sie versteht, und wer schadenfroh ist. Sie ist bewusst und sich ihrer eigenen Empfindungen gewahr. Der Gedanke an Rache kommt dann auf, wenn man seelisch überfordert ist und von der anderen Seite, die man selbst noch vor sich in Schutz zu nehmen beginnt, keinerlei Reue kommt.
Das hätte ein gutes, ein großartiges Buch über grundsätzliche Fragen werden können. Nicht jedoch jetzt, zu diesem Zeitpunkt, sondern erst viel später. Amenehs Geschichte ist noch nicht zuende – die Medien haben sie ihr aber vorschnell aus der Hand gerissen. Dieses Buch ist eine Chimäre. Ein Verlag publiziert es mit der Herausstellung des Leidensweges einer Frau und liefert eine nur halbwegs durchgearbeitete Geschichte.
Es gibt durchaus Passagen, in denen Ameneh Bahrami anschaulich und erfrischend vom Alltagsleben in Hamadan oder Teheran erzählt. Ich bekomme ein Bild von diesem Mädchen, das sich seinen Platz in der Welt erobern möchte. Es ist ein menschliches Bild, das sich in jedem Land der Welt einstellen könnte. Überall suchen junge Menschen nach Selbstbestimmung und Eigenständigkeit, Anerkennung und Liebe ohne Bedingungen.
Doch dann sind da die gewollten Belehrungen und die ideologischen Knöpfe, die gedrückt werden. Natürlich geht es um Literatur – und das ist hier trotz guter Ansätze eben Betroffenheitsliteratur. Das zeigt sich im Erzählmodus ganz bestimmter Zeitungen, die ein bestimmtes Klientel bedienen. Die Emotionalität der Schilderungen ist vielfach kaum zu ertragen. Der Leser wird missbraucht und in eine Meinung gezwungen, anderes als hier geschrieben darf man nicht fühlen. An der Verwendung des Wortes «plötzlich» übrigens erkennt man die Anfänger, und dieses Wörtchen taucht mir zu häufig auf. Eine solch künstliche, amateurhafte Erzeugung von Spannung hat die Geschichte nicht nötig.
Ameneh Bahrami wünsche ich, dass sie die nahende Zeit, in der das Interesse der Medien nachlassen wird, für sich nutzen kann, um ihren Frieden zu finden. Ihren Großvater habe ich übrigens ins Herz geschlossen. Ob sie auf ihn hört? –
«Was dir die Zukunft bringt, das frage nicht / Und die vergangne Zeit beklage nicht. / Allein das Bargeld Gegenwart hat Wert, / Nach dem, was war und sein wird, frage nicht.» (Omar Khayyam) ■
Ameneh Bahrami: Auge um Auge, MVG-Verlag, 256 Seiten, ISBN 978-3-86882-155-0
.
Leseproben
.
.
.
Alexandra Lavizzari: «Flucht aus dem Irisgarten»
.
…und träumte sich die Seele wund
Dr. Karin Afshar
.
 Das Hardcoverbuch mit den elf Erzählungen ist in diesem Jahr erschienen, edel sieht es aus – die beiden grazilen Irisblüten am rechten Rand erwecken den Eindruck, als wollten sie sich aus dem Blickfeld stehlen, flüchtig und nicht von dieser Welt.
Das Hardcoverbuch mit den elf Erzählungen ist in diesem Jahr erschienen, edel sieht es aus – die beiden grazilen Irisblüten am rechten Rand erwecken den Eindruck, als wollten sie sich aus dem Blickfeld stehlen, flüchtig und nicht von dieser Welt.
Alexandra Lavizzari (*1953 in Basel) ist eine Schweizer Schriftstellerin und Literaturkritikerin. Aus dem Klappentext erfährt man, dass sie in Rom lebt, verheiratet ist und drei Kinder hat; früher hat sie in Nepal, Pakistan und Thailand gelebt.
Die Erzählungen zwischen den Buchdeckeln spielen in der heutigen Zeit. Ihre Sprache ist leicht, was nicht heißt, dass die Sätze einfach aneinandergereihte Aussagesätze wären. Manche muss ich mehrmals lesen, um sie zu verstehen, denn sie sind lang, verschachtelt. Aber das tue ich gerne – sie schmecken beim zweiten Hinlesen noch besser, bekommen eine je eigene Melodie.
Lavizzari entwirft zunächst einen realistischen Hintergrund, vor dem sie dann die Geschehnisse entrollt. Es geht um Frauen, Männer, Kinder, die sich in der eigenen Haut nicht wohl fühlen, die nirgends, vor allem nicht im Familienkreis, heimisch sind. Es sind Entwurzelte in Basel oder im Tessin, in Schweden oder Süditalien: der jeweilige Ort – ganz bestimmt nicht zufällig gewählt – ist die Bühne, auf der sich die unbehagliche Entfremdung im Alltag der Figuren abspielt. Flucht ist ihr Motiv, einmal als blinde, unbewusste Sehnsucht nach dem Anderswo, ein andermal aus Angst, in einer Identität, die nicht als die eigene anerkannt wird, erstarren zu müssen. Es geht um das Loslassen alter Verletzungen, um die Weigerung, zu vergessen (weil z.B. Vergessen Verrat sein könnte), es geht um das Einfrieren in Gewesenem, weil man dem Leben nicht traut, um das Nachgeben einer Begierde gegenüber und den Preis, den man dafür bezahlen muss.
Jenseits der Schleusen ins Unterbewusste greifen die Worte und Bilder der Hier-Welt nicht mehr. Dafür braucht es «andere» Bilder – eben übernatürliche. Es gelingt Alexandra Lavizzari in jeder Geschichte, im Leser die Verbindung zu archetypischen menschlichen Geschichten herzustellen, ohne die profanen Bezeichnungen der Welt zu benutzen. Sie tut es detailreich, aber nie aufdringlich.
In der ersten Geschichte – «Schwimmen» – ist es ein Buch, in das sich die von ihrem Mann ‘Forelle’ genannte Else in ihrer Sehnsucht nach dem Meer versenkt. Der erste Satz in diesem Buch, den wir am Ende der Geschichte erfahren, setzt auch schon gleich eine erste Wegemarke durch das vorliegende Buch: Wasser.
Wasser ist das Ursymbol des Lebens und lebensspendendes Elixier. Es steht für Schöpfung, Geborgenheit, Reinheit, Heilung und stellt die Verbindung zu etwas Göttlichem dar. Ohne Wasser ist Leben auf dieser Erde nicht vorstellbar. Wasser, Meer, Schnee, Wasserfall, See – diese Bilder ziehen sich durch mehrere der Geschichten – und sie führen allesamt in die Vergangenheit der Protagonisten, in der etwas begraben und versunken liegt. Das ist schlüssig, hat Wasser doch auch mit dem Unbewussten, dem vor der Zeit und dem nicht in der Zeit Liegenden zu tun.
Die Geschichte «Flucht aus dem Irisgarten», der das Buch den Titel verdankt, hat vordergründig nichts mit «Wasser» zu tun, dafür mit einer weiteren Allegorie: Der Garten ist die Wohnung der Seelen, der Gärtner selbst ist der Schöpfer des Lebens und in einem Garten bilden Menschen das Paradies nach. Doch lesen Sie selbst, was Alexandra Lavizzari mit den Bildern zaubert.
Sie zeigt auf diesen fünf knappen Seiten das Können einer Schriftstellerin, die mit Sprache malt und umsichtig und klug genau das ungesagt lässt, was der Leser in sich selbst finden muss. Diese Erzählung ist m.E. die bildhafteste von allen.
In der Erzählung «In ihren Armen» ist es ein Umschlag mit Samen, der der Erzählerin überreicht wird. Nun werden wir in eine Geschichte geführt, an deren Ende eine aus eben diesem Samen hervorgegangene Zimmerpflanze in rasend schnellem Wachstum ein alterndes Ehepaar umschlingt und erwürgt. Auch hier das Bild des zur Pflanze werdenden Menschen, des von der Pflanze verschlungenen Menschen. Die Figuren der Geschichte sind auf schicksalhafte und unlösbare Art miteinander verbunden. Die Geschichte liest sich nicht ganz so flüssig, aber das mag daran liegen, dass – obwohl die gleiche Sprache – das Schweizerische Ausdrücke kennt, die dem Deutschland-Deutschen fremd sind.

Die schaurig-spannenden Erzählungen in Alexandra Lavizzaris «Flucht aus dem Irisgarten» haben mich nicht losgelassen, bis ich das Buch ausgelesen hatte. Der Versuch, es aus der Hand zu legen, scheiterte, aber als ich schließlich doch die letzte Zeile gelesen hatte, war mir, als stünde da: «Ich bin das Meer». (Dr. Karin Afshar)
In «Spiegelspiel» geht es um einen Schlüssel, von dem der Leser bald ahnt, dass er zum Zimmer des jüngeren Sohnes gehört, der acht Jahre zuvor Selbstmord begangen hat. Schlüssel wie auch Spiegel – Allegorien.
In den Metaphern und Allegorien schimmert Lavizzaris «persische Geschichte» durch. Sie hat Übersetzungen aus dem Persischen (Warqa und Gulschah von Ayyuqi, literarische Übersetzung aus dem Persischen, 1992 ) veröffentlicht und sich als Ethnologin und Islamwissenschaftlerin ganz gewiss mit den Metaphern sowohl des Koran, als auch der persischen Lyrik und Mystik auseinandergesetzt.
Beim Lesen legt sich bald eine melancholische Stimmung aufs Gemüt, denn fast alle Schicksale münden in Tragödien, oder bleiben zumindest offen, was nicht unbedingt Raum für Hoffnung lässt. «Cristallina» – letzte Erzählung des Bandes – lässt hingegen nichts offen. Ein Mann, der über eine vor 28 Jahren verschwundene Dichterin seine Dissertation geschrieben hat, kommt in das Bergdorf, in dem man die Verstorbene zuletzt gesehen hat. Er recherchiert vorsichtig, unaufdringlich, aber doch deutlich. Und die behinderte Tochter des Herbergspaares, das nicht unverdächtig ist, hilft ihm, ohne zunächst zu ahnen, dass beide dengleichen Menschen meinen. In seinem Ehrgeiz, mehr Informationen zu bekommen, legt der Fremde einen Köder aus, mit dem nun endgültig die die Beteiligten überfordernde Vergangenheit ans Licht kommt. Enden kann dies nur auf eine einzige Weise. Der Kristall ist ein periodisch geordnetes System mit Gitterstruktur – und: Leben heißt Strukturen wandeln, Sterben heißt, sich nicht mehr zu verändern.
Die schaurig-spannenden Erzählungen haben mich nicht losgelassen, bis ich das Buch ausgelesen hatte. Der Versuch, es aus der Hand zu legen, scheiterte, aber als ich schließlich doch die letzte Zeile gelesen hatte, war mir, als stünde da: «Ich bin das Meer». ■
Alexandra Lavizzari, Flucht aus dem Irisgarten, Erzählungen, 180 Seiten, Zytglogge-Verlag, ISBN 978-3-7296-0802-3
.
Themenverwandte Seiten
Lauter Lesenswertes – Cultura fara cenzura
.
.
Leseproben
.
.
Sprach-Essay von Karin Afshar
.
Der Verlust der Herkunft
Dr. Karin Afshar
.
Davon, was Sprache ist, warum die Menschen die Fähigkeit zu sprechen haben und was sie mit dieser anstellen, gibt es unzählige Bücher. Deshalb ist es von mir recht vermessen, in einem kleinen Essay skizzieren zu wollen, warum Sprachen untergehen, und wie sich dies und mit welchen Konsequenzen vollzieht.
Der Auslöser für dieses Unterfangen war die Beobachtung, dass Menschen um mich herum mehr als sorglos mit ihrer Sprache umgehen. Es ist selten der Fall, dass schon vor dem Schreiben eines Artikels der Titel feststeht. Ich schrieb ihn tatsächlich gleich so, wie er oben steht, auf.
Aber ich muss von vorne anfangen, bei zwei Männern, die in den 30er und 60er Jahren um Worte rangen, das Verhältnis des Menschen zu seiner Sprache aufzuzeichnen. Benjamin Lee Whorf und Edward Sapir waren nicht die ersten und nicht die letzten, die herausarbeiteten und beschrieben, dass das linguistische System (und mit ihm die Struktur, die Grammatik) jeder Sprache nicht nur ein reproduktives Instrument zum Ausdruck von Gedanken ist, sondern vielmehr selbst die Gedanken formt.
Welche Sprache Menschen auch sprechen – jede ist Schema und Anleitung für die geistige Aktivität des Individuums, für die Analyse seiner Eindrücke und für die Synthese dessen, was ihm an Vorstellungen zur Verfügung steht. Die Formulierung von Gedanken ist kein unabhängiger Vorgang, sondern er ist von der jeweiligen Struktur beeinflußt. Der Vorgang des Ausdrückens von Gedanken ist daher für verschiedene Grammatiken als mehr oder weniger verschieden anzunehmen.
Das Denken ist nicht bloß abhängig von der Sprache überhaupt, sondern bis auf einen gewissen Grad, auch von jeder einzelnen bestimmten. (Wilhelm von Humboldt)
Als Sprachlehrerin, als die ich tätig bin, kann ich jeden Tag in meinem Unterricht beobachten, wie wirksam diese sprachliche Relativität ist. Wer Deutsch sprechen können will – und damit werden wir mit einer Sprache konkret -, muss Deutsch denken. Das bedeutet, dass er sich der Mittel, die das Deutsche zur Verfügung stellt, bedienen muss, um seine Gedanken oder Informationen so auszudrücken, dass er von anderen Deutsch-Sprechenden verstanden wird. Das gilt analog natürlich für jede Sprache, für Türkisch, Englisch, Japanisch, um nur drei Sprachen zu nennen. Kann der Sprecher dies nicht, findet der Angesprochene seine Welt nicht abgebildet. Wenn wir eine neue Sprache lernen, tun wir dies auf der Grundlage von bereits erworbenen Strukturen, die wir in den wenigsten Fällen hinterfragen, sondern eben einfach verwenden.
Grammatik – für viele Menschen mit unguten Erinnerungen behaftet – ist das System der Regelhaftigkeit einer Sprache. Regeln können in der einen so, in der anderen eben anders sein. Egal wie: beim Erlernen einer Sprache suchen wir nach Regeln bzw. immer wieder auftauchenden Mustern. Wenn wir sie entdecken, können wir sie anwenden, aber manchmal steht selbst dem noch etwas im Wege.
Grammatik ist nun nicht das einzige, was eine Sprache ausmacht – es geht auch um den Wortschatz, d.h. die Laute, die in einer bestimmten Abfolge artikuliert Ausdruck eines Inhalts sind, über den Übereinkunft besteht. Mehrere in bestimmter Reihenfolge geäußerte Laute erhalten eine Bedeutung, die ein Kenner derselben Laute versteht.
Sprache ist die Übereinkunft von Menschen und gewährleistet damit Kommunion.
Dinge, die in der Welt rund um eine (Sprach-)Gruppe herum vorkommen, wird diese alsbald benennen. Alles für den Alltag Relevante wird eine Bezeichnung bekommen. Jenes allerdings, was für den Alltag einer Sprachgemeinschaft – und von einer solchen sprechen wir hier – nicht relevant ist, wird weder benannt noch überhaupt gesehen.
Verschwinden Dinge des Alltags aus dem Blickfeld, verschwindet mit ihnen das alte Wort. Er- scheinen neue Gegenstände, auf welchem Wege auch immer, dann wird dafür ein neues Wort geschaffen. Sprache ist weder unveränderlich noch statisch, sie ist kein Werk, sondern eine immerwährende Tätigkeit.
Menschen begegnen Menschen, Sprachen begegnen sich in ihnen. Es kommt zum Austausch und zur Übernahme von Wörtern, auch wenn die «fremden» Wörter dasselbe Ding bezeichnen.
Ergon ist die laut- und formbezogene Grammatik einschließlich der Wortbildung, die als notwendiges Durchgangsstadium zu einer Energetischen Sprachauffassung angesehen werden kann.
In der deutschen Sprache gibt es eine Reihe neuer Wörter. Über die Flut der Anglizismen ist hinreichend geplärrt und es ist vor ihnen gewarnt worden. Die Anzahl nicht nur englischer Wörter in der Rahmensprache Deutsch nimmt stetig zu. Und die Übernahme von Wörtern hat natürlich eine Rückwirkung auf die Grammatik. Was für ein Prozess aber ist das, der immer tiefer in die Struktur des Deutschen eingreift?
Eine mir lieb gewordene Firma legte im letzten Monat ihren deutschen Namen ab und benennt sich nun Englisch. In der Computer-und in der Medienbranche tragen die technischen und medialen Errungenschaften englische Bezeichnungen. Berufsbezeichnungen (man schaue sich einmal die Stellenanzeigen an) und Studienabschlüsse sind angliziert. Versteht noch jemand, was damit eigentlich gemeint ist?
Nun gab es auch früher «Fremdwörter»; im Deutschen gibt es nicht wenige aus dem Französischen, aus dem Lateinischen, dem Griechischen – sie sind schon lange da und gehören «zu uns». Ich persönlich stecke mein Geld ins Portemonnaie, sitze gerne auf der Couch, beim Arbeitsamt ziehe ich eine Nummer und bin total frustriert, wenn ich lange warten muss.
Das so englisch klingende Wort Mobbing gibt es im Englischen nicht, und schon mal gar nicht in der Bedeutung, die es im Deutschen hat. Fitness ein anderes Beispiel, Handy ein nächstes. Fussball wird bei der hiesigen WM zum public viewing-Ereignis.
Neben der Unsitte, englischklingende Wörter zu erschaffen – was beinahe schon wieder ulkig anmutet -, geschieht mit den und durch die nichtdeutschen Wörtern jedoch noch anderes. Wir haben es mit Bedeutungserweiterungen einerseits und mit Bedeutungsverengungen andererseits zu tun.
Die neuen Wörter – sofern es Substantive sind – benötigen im Deutschen einen Artikel. Die Artikelwörter sind das Trauma jedes Deutschlernenden, der aus einer Sprache kommt, in der es kein grammatisches Geschlecht gibt. Die Regelhaftigkeit erschließt sich nur sehr schwer, da lernt man sie am besten gleich zusammen!
Welchen Artikel gibt man einem Fremdwort? Man hört die Mail und das Mail. Es ist auf Deutsch «die Post» – daraus folgt, dass die Tendenz zum femininen Artikel groß ist. Andererseits gilt: Fremdwörter sind grundsätzlich «das»: das Automobil, das Handy, das Mobile…
Weiterhin brauchen die neuen Wörter eine Pluralform. Im Deutschen gibt es – gewachsen aus der Sprachgeschichte – 8 Pluralformgruppen. «Typisch» für das Deutsche ist die Stammvokaländerung, die auch an anderen Stellen wirksam wird.
Die neuen Wörter bekommen überwiegend ein Plural-s, oder verbleiben in der Form des Singulars (der Computer, die Computer – immerhin in der Anwendung einer Regelmäßigkeit).
Verben sind ein nächster fruchtbarer Boden. Sie tragen im Deutschen im Infinitiv ein -en. to load down wird zunächst zu to download, (ist es ein trennbares Verb?), dann zu downloaden. Wohl dem, der der englischen Schriftkonvention mächtig ist, und das Wort englisch aussprechen kann, wenn er es liest.
Bei richtiger englischer Aussprache bleiben die neuen Wörter Fremdkörper im Deutschen: die offenkundig andere Aussprache passt sich nur störrisch in die deutsche Sprachmelodie ein, und was für ein Spagat, wenn dann auch noch ein Perfekt gebildet werden muss: das habe ich gedownloaded/ downgeloaded.
Der Einbruch des Englischen in das Deutsche ist gleichsam elitär gegenüber dem, was in anderen Teilen der Republik vor sich geht. Die Kanaksprak, Identifikationsmedium einer neuen Kultur, ist alles andere als lustig – sie ist ein Symptom. Wofür, fragen Sie?
Die englische Sprache ist der unseren vorausgegangen, und an ihr können wir etwas lernen. Englisch diente und dient als lingua franca und wurde in die entferntesten Winkel der Welt, als der Handel und nicht nur der begann, getragen. Englisch wird von weit mehr Menschen gesprochen als tatsächlich englische Muttersprachler sind. Es ist die zweite Sprache vieler Menschen, die sie lernen, um sie zu benutzen.
Das Stichwort hier lautet: benutzen. Eine lingua franca ist eine Verkehrssprache, die auf einzelnen Gebieten den Menschen den Verkehr miteinander ermöglicht.
Im Laufe der Kontakte und der Durchmischung mit immer anderen Muttersprachen wurde Englisch pidginiziert. Hervorstechendstes Kennzeichen von Pidginsprachen ist, dass sie eine reduzierte Sprachform darstellen. Als nächste Ausprägung haben wir es mit einer Kreolisierung zu tun:
Kreolsprachen sind Sprachen, die aus mehreren Sprachen entstanden sind. Dabei geht ein Großteil des Wortschatzes der neuen Sprache auf eine der beteiligten Kontaktsprachen zurück.
In manchen Fällen entwickelt sich eine Kreolsprache durch einen Prozess des Sprachausbaus zu einer Standardsprache. Im Unterschied zu den Pidgin-Sprachen sind Kreolsprachen sogar Muttersprachen.
Vor allem die Grammatik, aber auch das Lautsystem der neuen Sprachen sind von jenen der beteiligten Ausgangssprachen deutlich verschieden. Der Prozess dauert lange, und wir sprechen hier abstrakt von «Sprachen». Was macht es aber mit den Sprechern?
Bestandsaufnahme:
1. Neue, fremde Wörter und Begriffe werden nicht adäquat angewendet; 2. Die Wörter verändern die Strukur der Rahmensprache, nicht selten gehen Strukturelemente verloren; 3. Stehen bestimmte Strukturen nicht mehr zur Verfügung, wird nicht mehr in ihnen gedacht; 4. Was nicht gedacht werden kann, weil die Strukturen fehlen, bleibt ungesagt; 5. Der genaue Ausdruck geht verloren; 6. Man trifft sich im Unsagbaren.
Menschen, die eine Sprache nur als Ruine bewohnen, können auch nur ruinenhaft denken.
Und so gerät die Herkunft ins Wanken, wenn das Bewusstsein nicht nachkommt. Sprache ist – und war es immer – Heimat. Und wenn man seine Sprache verliert, verliert man die Heimat, und wenn man seine Heimat verliert, ist es um die Sprache hart bestellt.
Das hat übrigens nichts mit Denken in Nationalstaaten (deren Etablierung sogar nachgerade Sprachzugehörigkeiten ignoriert) oder Intoleranz zu tun, sondern ist die Frage eines Standortes. Nur wenn man den hat, kann man Schritte in das Andere, Fremde, Neue nehmen, und den Fremden für das Eigene, für ihn Neue begeistern. Gibt man seinen Standort auf, steht man im Nichts. ■
.
___________________________________
Geb. 1958 in der Eifel/D, Studium der Sprachwissenschaft, Finn-Ugristik und Psychologie, Promotion, zahlreiche belletristische und fachwissenschaftliche Publikationen, Geschäftsführerin des Korshid-Verlages, Herausgeberin und Lektorin
.
.
Hélène Cixous: «Manhattan»
.
Vom Scheitern einer Besprechung und vom
Herantasten an eine Vorgeschichte
Dr. Karin Afshar
.
 Als ich entschied, das Buch von Hélène Cixous zu besprechen, wusste ich nichts, aber auch gar nichts über die Autorin. Das ist nichts Neues, denn viele Autoren, deren Bücher ich bis jetzt besprochen habe, sind einer weiteren Leserschaft eher unbekannt. Dass ich diese Autorin aber hätte kennen können, wurde mir klar, als ich nachforschte – neugierig geworden, bevor ich das Buch in den Händen hielt: Cixous ist am 5. Juni 1937 in Oran (Algerien) geboren, sie ist Schriftstellerin, Philosophin, Universitätsprofessorin (Anglistik); lebt und arbeitet in Paris und Arcachon als Literaturwissenschaftlerin und Philosophin, vor allem aber als Roman- und Theaterautorin hat Hélène Cixous seit 1967 etwa 70 Bücher veröffentlicht.
Als ich entschied, das Buch von Hélène Cixous zu besprechen, wusste ich nichts, aber auch gar nichts über die Autorin. Das ist nichts Neues, denn viele Autoren, deren Bücher ich bis jetzt besprochen habe, sind einer weiteren Leserschaft eher unbekannt. Dass ich diese Autorin aber hätte kennen können, wurde mir klar, als ich nachforschte – neugierig geworden, bevor ich das Buch in den Händen hielt: Cixous ist am 5. Juni 1937 in Oran (Algerien) geboren, sie ist Schriftstellerin, Philosophin, Universitätsprofessorin (Anglistik); lebt und arbeitet in Paris und Arcachon als Literaturwissenschaftlerin und Philosophin, vor allem aber als Roman- und Theaterautorin hat Hélène Cixous seit 1967 etwa 70 Bücher veröffentlicht.
«Schreiben aus der Vorgeschichte» heißt der Untertitel – was stelle ich mir darunter vor? Das Buch beginnt mich zu interessieren, denn seit geraumer Zeit sammle ich die Geschichte meiner Familie mütterlicher- wie auch väterlicherseits, und da kommt einiges zum Vorschein. Erzählungen aus der Zeit, bevor wir denken lernten, sind nicht zu unterschätzen. Sie können erklären, warum man selbst ist, wie man ist, mit allen Wunden und verqueren Mustern. Auf der Seite des Wiener Passagen Verlags, in dem die Übersetzung erschienen ist, lese ich dies:
«Die Ursache des Schreibens, wo liegt sie? Immer wieder warnt die Autorin ihre Leser (im Ankündigungstext des Verlages): «Ich werde dieses Buch nicht schreiben», und doch bahnt sich das Buch Wege ans Licht der Seiten und umschreibt in bebenden Rucken und heftigen Erschütterungen die zertrümmernde Begegnung mit G.»
Das Buch ist noch nicht da, von Wien nach Frankfurt dauert es mit der Post etwas länger, und ich werde jetzt doch sehr neugierig. Die Qual des Schreibens – oh ja, die kenne ich! Ob ich eine Seelenverwandte finde? Eine, mit der ich mich, ohne sie zu kennen, verstehe und die mir, ohne dass ich sie darum gebeten hätte, Impulse gibt? Währenddessen erlese ich über Cixous noch einiges mehr:
«Hélène Cixous’ immer an der Matrix der französischen Sprache ausgerichtetes literarisches Werk bringt originelle und zugleich traditionsgesättigte Sprachkunstwerke hervor, deren Bezugspole die gesamte abendländische Literaturtradition in sich aufnehmen: Ihr experimenteller Schreibstil ist subjektivistisch, zuweilen changiert ihre Prosa in lyrische Passagen. Schreiben ist für Hélène Cixous weibliche Selbsterkundung und Selbstschaffung, dieser feministische Ansatz wurde von ihr insbesondere während ihrer akademischen Tätigkeit programmatisch entwickelt. Hélène Cixous schreibt radikal antitotalitär und prägt als dekonstruktive Sprachdenkerin (zusammen mit ihrem verstorbenen Freund Jacques Derrida) seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts die poststrukturale Literatur und Philosophie.» (Erwin Rauner über Cixous)
Dekonstruktivismus – was war das noch gleich? Ich recherchiere auch dies und erinnere mich wieder: Es hat etwas mit der Auflösung der binären Opposition zu tun – also z.B. mit der Dualität von Mann und Frau oder dem dominanten Gesellschaftssystem und einem daneben existierenden, anders strukturierten System. Eine Frau, soll Cixous gesagt haben, schreibe deshalb nicht wie ein Mann, weil sie mit dem Körper spreche. Weil das Patriarchat immer geherrscht habe, habe die Frau keine eigene Sprache, und ihr Körper werde ihr einzig nutzbares Mittel. Schreibpraxis und Sinnenfreude fallen bei ihr zusammen – die weibliche Schreibpraxis ist irrational, nicht regelhaft und voller Zerstörung.
Das Buch ist endlich angekommen. Es hat einen schlichten grauen Einband, ist ein Paperback. Auch innen Schlichtheit, gedruckt auf gelblichem Papier, keine weiteren Angaben z.B. zu bereits im Verlag veröffentlichten anderen Büchern. Es erscheint völlig auf den Text konzentriert. Worum es geht?
«Die Liebe zu G. war nicht Liebe zu G., sondern in Wahrheit Liebe zur Literatur. Ja, dass es G. gar nicht gab, dass er Zitat, Abschrift, Imitation und Zusammenschnitt aus den berauschend berückendsten Werken der Weltliteratur war – hätte sie das ahnen können oder sollen, sie, die damals, 1965 in Amerika, glaubte, einen jungen Mann namens Gregor zu lieben? Und wer, wenn nicht die geheimen Andermächte der von ihr über alles geliebten Literatur hatte diesem G. die Schlüssel zu ihrem Wesen in die Hände gespielt: einen Namen zum Beispiel, der klanglich ihre geliebtesten Verstorbenen heraufbeschwor, oder einen leichten Husten und dann die Eingebung, ihr eine Lungenkrankheit vorzutäuschen mit einem Schreiben aus Kafkas Briefen an Milena?» (Verlagsinfo).

Die Verworrenheit, die die Protagonisten in Hélène Cixous’ «Manhattan» durchleben, spiegelt sich in einer Verworrenheit des Schreibstils, basierend auf den vielen literarischen Bezügen, wider – das Lesen ist anstrengend…
Gut, gehen wir’s an. Ich setze mich mit dem Buch auf den Balkon, mitten zwischen meine Brennesseln, die die schönsten im ganzen Innenhof sind, beginne zu lesen. Aber ich komme nicht weit. Wir – das Buch und ich – bekommen keine Verbindung. Die Sätze, die mir entgegenfallen, sind mir zu konstruiert nichtstrukturiert. Die Art von Spiel mit der Sprache ist mir fremd, so fremd, dass es keinen Grund gibt, mich damit auseinanderzusetzen. Bevor ich an einen Punkt gelange, an dem die Geschichte vielleicht richtig anfängt, lege ich das Buch aus der Hand.
Dergleichen ist mir auch bei anderen Autoren passiert. Ich fand jene mit Abstand betrachtet allesamt zu subjektivistisch und zu sehr an Details orientiert, die einen wegführen von dem, was der Kern ist. Sie machen mich zu einer Voyeuristin: ich stehe staunend oder befremdet vor den Reflektionen der Protagonisten. Die Verworrenheit, die die Protagonisten durchleben, spiegelt sich in einer Verworrenheit des Schreibstils, basierend auf den vielen literarischen Bezügen, wider – das Lesen ist anstrengend. Natürlich habe ich mir meine Gedanken zu «Liebe» und Emanzipation oder Feminismus gemacht, und seichte Literatur ist auch nicht, was ich suche.
Im Dekonstruktivismus wird offensichtlich tatsächlich etwas «zerstört», was mich wiederum verstört. Ich bin ja nun auch schon durch einige Wirrungen und Irrungen des Lebens gegangen und wenn ich einen Protagonisten auf seinem Schmerzensweg begleite, dann will ich nicht gleichzeitig Kalkül einer Konstruktion sein, auf deren Rücken eine Theorie ausgelebt wird. Dieses Empfinden habe ich bei vielen Erzählungen der sogenannten Moderne…
Erwähnen will ich noch, dass mir eine Übersetzung vorliegt. Es ist immer eine große Aufgabe, ein Original in eine andere Sprache zu übersetzen. Im Falle von Cixous würde ich sagen: es ist ein Unterfangen, das nahezu unmöglich ist. Man muss sie vermutlich im Original lesen, dies ganz unabhängig vom Vorgesagten und meinen Schwierigkeiten mit der «Moderne».
Eins allerdings hat das Buch in mir geweckt: den Wunsch, nun doch die Geschichte zu schreiben, die von den Abgründen in einer Familie handelt. Mehr noch als Wunsch: ich bin herausgefordert. Aber keine Bange: ich werde mein Buch ebenso wenig schreiben, wie ich dieses vor mir liegende lesen werde. ■
Hélène Cixous, Manhattan, Schreiben aus der Vorgeschichte, Hg: Peter Engelmann, Ü: Claudia Simma, 212 Seiten, Passagen Verlag, ISBN 9783851659269
.
Leseproben
.
.
.
.
Sudabeh Mohafez: «brennt»
.
«Der Feuerwehrmann, den ich küssen werde…»
Dr. Karin Afshar
.
 Es ist die Erzählperspektive, mit der eine Geschichte steht oder fällt. An ihrer Wahl zeigt sich, ob ein/e Erzähler/in die Fäden in der Hand hält und seinen/ihren Stoff beherrscht.
Es ist die Erzählperspektive, mit der eine Geschichte steht oder fällt. An ihrer Wahl zeigt sich, ob ein/e Erzähler/in die Fäden in der Hand hält und seinen/ihren Stoff beherrscht.
Sudabeh Mohafez hat in ihrem neuen Roman «brennt» die Ich-Perspektive gewählt und setzt diese beeindruckend ein. In ihrem Ich wohnen noch weitere Ichs, die der Leser als Pia und Jens kennen lernt. Außerdem ist da Hjartan (was auf Isländisch Herz heißt), der durch Manés Gedanken und Leben geistert. Er spricht jedoch nicht. Dass er tot ist, ist kein Geheimnis, wohl aber, unter welchen Umständen er gestorben ist, und vor allen Dingen: mit welchen Folgen für Mané. Beides bleibt bis kurz vor Ende der Erzählung im Dunkeln.
Zwei Feuerwehrmänner spielen eine Rolle: der eine rettet bei dem Hausbrand – mit dem die Geschichte einsetzt und bei dem Mané alles verliert – die Nachbarin, der andere rettet die Katze und zeigt Mané die dünne Grenze zwischen Leben und Tod auf. Der Brand ist Rahmengeschichte, nicht Ursache, sondern Bereinigung der Vorgeschichte, und in die wird der Leser zusammen mit Mané nun wie auf einer Feuerwehrleiter Schritt für Schritt auf den festen Boden zurückgeführt.
Den Boden hat die Protagonistin nämlich verloren, und sie ist dabei, verrückt zu werden. Ein traumatisches Ereignis muss es vier Jahre zuvor gegeben haben; es hat Manés Herz eingefroren und in einen Zustand versetzt, in dem sie bis jetzt gut funktioniert hat. Den Zustand übrigens, um den es hier geht, bezeichnen Kliniker mit dem Begriff «Posttraumatische Belastungsstörung». Im Feuer verglüht, verraucht und zerschmilzt ihre Mauer, und die Schleusen öffnen sich. Feuer wird von jeher die reinigende Wirkung zugedacht – hier ist es die Katharsis.
Die Erzählung ist mit Abstand und Beteiligung geschrieben, sie ist unsentimental und doch genau deshalb betroffen machend. Die Dramaturgie mit einer Peripetie ebenso wie mit der Katastrophe inszeniert, die Namenwahl der Personen, die Hinweise – es gibt davon etliche, die ich hier nicht verrate – legen dem Leser eine Spur. Sudabeh Mohafez liebt die Doppelpunkte. Sie bedient sich eines gesprochen-sprachlichen Stils, eines stetigen Bewusstseinsstroms mit fragmentarischer Gefühls- und Gedankenwelt, sie ist sprunghaft, unterbrochen und voller Angst – voller Fauchen.
Etwa in der Mitte des Buches «hat» sie den Leser: er ist eingetaucht in das Ringen um Klärung, die Aufarbeitung des Vergangenen und das Manövern an einer Grenze entlang. Nicht wenige Menschen kennen an sich selbst ähnliche Zustände, ähnliche Erfahrungen. Vermutlich sind die die begeistertsten Leser, die bei geklärtem Verhältnis zum Leben, bestätigen, in welche Höllen man absteigen kann. Jene aber werden das Buch fortlegen, die noch nicht einmal begriffen haben, dass sie in einer Hölle leben.
Es gibt viele lebenskluge, lebensweise Bilder in der Geschichte (außer von Geräuschen lebt diese von den Bildern). Eines der ersten, dem der Leser begegnet, ist besagte Szene, in der der Feuermann eine Frau aus dem oberen Stock an Mané vorbei auf der Leiter nach unten schützt. Er legt die Arme um sie, ohne sie zu berühren. Er treibt sie nicht zur Eile an, er mahnt nicht, sondern «tanzt» mit ihr. Das ist der Moment, in dem Mané weiß, dass sie diesen Feuerwehrmann küssen wird. Es ist diese Szene, die die Farbe Rosa des Einbands und den Namen Hjartan erklären – oder umgekehrt. Abgesehen davon, dass es ums Verrücktwerden geht, geht es um Liebe!
Sudabeh Mohafez wurde 1963 in Teheran geboren und lebt heute in Stuttgart. Sie ist die Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters. In ihrem Elternhaus wurde Deutsch, Persisch und Französisch gesprochen. Seit 1979 lebt sie in Deutschland. Nach dem Studium der Musik, Anglistik und Erziehungswissenschaften war sie jahrelang Leiterin eines Frauenhauses. «Wüstenhimmel, Sternenland» erschien 2004, im nächsten Jahr folgte der Roman «Gespräch in Meeresnähe». 2006 erhielt sie den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis. Mohafez wurde von Klaus Nüchtern für den Ingeborg-Bachmann-Preis 2010 vorgeschlagen. ■
Sudabeh Mohafez, brennt, Roman, 208 Seiten, Dumont Verlag, ISBN 978-3-821-9573-1
.
Leseproben
.
.
.
.
Shahriar Mandanipur: «Eine iranische Liebesgeschichte zensieren»
.
Was man sieht, ist nicht das, was es ist
Dr. Karin Afshar
.
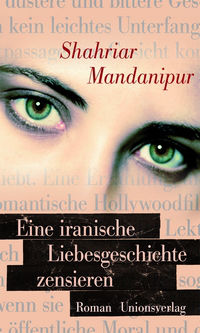 Sie wollen endlich einmal eine Liebesgeschichte von einem Iraner lesen, die gut ausgeht? Shariar Mandanipur verspricht Ihnen dies – in seinem neuesten Roman «Eine iranische Liebesgeschichte zensieren» – zumindest, und kündigt dann noch gleich in der Einleitung an, dass seine Heldin in wenigen Minuten sterben wird. Wie kann das eine glückliche Liebesgeschichte sein?
Sie wollen endlich einmal eine Liebesgeschichte von einem Iraner lesen, die gut ausgeht? Shariar Mandanipur verspricht Ihnen dies – in seinem neuesten Roman «Eine iranische Liebesgeschichte zensieren» – zumindest, und kündigt dann noch gleich in der Einleitung an, dass seine Heldin in wenigen Minuten sterben wird. Wie kann das eine glückliche Liebesgeschichte sein?
Aber wenn Sie an dieser Stelle angelangt sind, haben Sie nun schon einmal angefangen zu lesen und befinden sich bereits mitten in einem ausgelegten Netz, aus dem Sie nur herauskommen, wenn Sie weiterlesen – wenn überhaupt je wieder.
Shahriar Mandanipur ist 1957 in Schiras geboren; man ist sich überein, dass er nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch der modernste unter den iranischen Autoren ist. (Modern, werden Sie bald merken, geht dabei oft mit Schwerlesbarkeit einher.) Auf dem Klappentext lesen Sie, dass der Autor Politikwissenschaften studierte und im iranisch-irakischen Krieg, der vom September 1980 bis zum August 1988 dauerte, Soldat war. Für seine Werke bekam er zahlreiche Preise, darunter den Mehregan Award und den Golden Tablet Award. Wegen der Zensur konnte er zwischen 1992 und 1997 im Iran nichts veröffentlichen und verließ 2006 den Iran. Zur Zeit ist er Gastdozent in Harvard, in Cambridge lebend. Noch mehr Autobiografisches können Sie dem Buch entnehmen.
«Eine iranische Liebesgeschichte zensieren» wurde aus dem Persischen von Sara Khalili ins Englische übersetzt. Autor und Übersetzerin haben gemeinsam daran gearbeitet, die subtile, manchmal heitere Doppelbödig- und stete Symbolhaftigkeit der persischen Sprache zu übertragen. Die deutsche Übersetzung von Ursula Ballin beruht auf der englischen. Sie werden sich trotzdem wünschen, Sie könnten gut genug Persisch, um das Original zu lesen!
Sie heißt Sara, und der junge Mann, um den es hier – Alter ego Mandanipurs? – geht, Dara. Das ist eine geniale Namenwahl. Wenn Sie Iraner kennen, fragen Sie sie, was es damit auf sich hat. Anspielungen, Hinweise – intertextuelle Bezüge auf klassische persische wie auch klassische und moderne westliche Literatur, auf Filme, auf Geschehnisse – finden sich allerorten. Dem Zensor, der «mit viel Einfühlungsvermögen seine Arbeit machen muss, um unmoralische Schriftsteller, welche die iranische Jugend zu verderben drohen, zu entlarven», hat Mandanipur den Namen Porfirij Petrowitsch gegeben. Was – Sie kennen ihn nicht? Und ausgerechnet in Sadegh Hedayats Roman «Die blinde Eule» findet Sara den ersten Liebesbrief von Dara.
Sie bedienen sich Saint-Exupérys «Kleinen Prinzen» ebenso wie Garcia Lorcas. Dara markiert Buchstaben mit Punkten, aus denen Sara nun Briefe dechiffriert. So kommunizieren sie eine Weile, ohne dass sie sich kennen, und so beginnt ihre Liebesgeschichte.
Shahriar Mandanipur ist ein gewiefter Ich-Erzähler, der Sie an der Entwicklung der Geschichte und an seinen Gedanken zu deren Konstruktion teilhaben lässt, eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte erzählend. Sie erfahren viel über das tägliche Leben der Menschen, ihre Nöte und ihren erfindungsreichen Umgang mit auftretenden Problemen, über Reaktionen auf politische Ereignisse und deren Hintergründe.
Um es gleich vorweg zu nehmen: der Ton ist locker, luftig, respektlos, wie ihn nur Menschen haben können, die vor nicht mehr viel Angst haben. Doch was einfach aussieht, ist nicht selten das Ergebnis durchlebten Leids. Auf den ersten Seiten werden Sie öfter herzhaft lachen. Hier bekommen die Iraner ebenso wie die Amerikaner (in Geographie nicht so gut bewandert) ihr Fett weg. Doch täuschen Sie sich nicht: das Buch ist weder eine Liebesgeschichte noch eine belanglose, zufällige Aneinanderreihung beiläufig geschilderter Ereignisse und Hinweise.
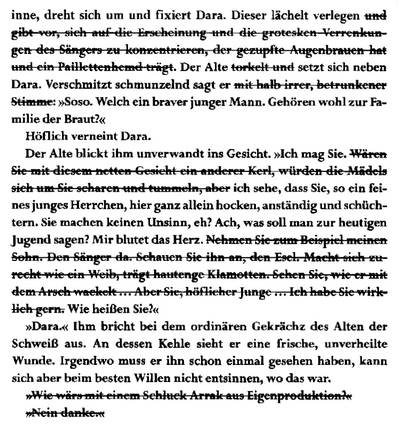
«Der Zensor sitzt bereits im Kopf des Autors, und was dann folgt, ist der Parcours durch eine Welt, in der man nicht glauben darf, was man sieht und liest und nicht sehen darf, was ist, und in der der Spagat zwischen Innen und Außen schier schizophren macht.»
Mandanipur hat 320 Seiten mit Buchstaben gefüllt, die eigentliche Geschichte aber steht zwischen den Zeilen. Es geht eben um Zensur, und Sie werden am Ende des Buches eine Ahnung davon haben, wie Sie werden – sollten Sie jemals unter eine Diktatur geraten – zu schreiben haben.
Widersprüche durchziehen das Buch, wie sie die persische Seele durchziehen. Das macht ihre Anziehungskraft aus, auch wenn sie Leid bedeuten. Denn Leid gehört zum Leben, und dass es nicht immer verbittert geschildert werden muss oder nihilistisch (was aufs Gleiche hinauskommen könnte), zeigt Mandanipur. Sprachverliebt und sprachgewaltig ist er. Es sind nicht nur die vielen Bezüge und die Verschachtelungen, die Ihnen das Lesen schwer machen könnten, sondern auch die Kaskaden von Sätzen und Bildern. Orientierung wird Ihnen durch das Schriftbild zuteil: es gibt fett gedruckte Textstellen, normal gedruckte und durchgestrichene. Setzen Sie sich nicht gleich hin und schreiben einen Brief an den Verlag, weil das Buch suggeriert, es sei zensiert und dann irrtümlicherweise doch mit den zensierten Passagen abgedruckt worden.
Der Zensor allerdings sitzt bereits im Kopf des Autors, und was dann folgt, ist der Parcours durch eine Welt, in der man nicht glauben darf, was man sieht und liest und nicht sehen darf, was ist, und in der der Spagat zwischen Innen und Außen schier schizophren macht.
Wenn Sie von der Kultur Persiens – das es ja nicht mehr in dieser Form und mit dieser Bezeichnung gibt – fasziniert sind und den Menschen, die auf dem Staatsgebiet des heutigen Iran leben, nahe stehen, werden Sie kennen und bestätigen, was Mandanipur schreibt. Wenn Sie das alles erst kennenlernen und verstehen wollen, haben Sie eine große Aufgabe vor sich. Es ist eine Geschichte der Menschheit, von Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. ■
Shahriar Mandanipur (Übersetzung: U. Ballin), Eine iranische Liebesgeschichte zensieren, Roman, Unionsverlag, 320 Seiten, ISBN 3-293-00415-6
.
Leseproben
.
.
.
.
.
.
P.Müller und R.Wieland (Hg.): «Liebesbriefe berühmter Frauen»
.
«Benjamin, Sie haben mein Leben verzehrt!»
Dr. Karin Afshar
.
 Mein Lieber,
Mein Lieber,
es trifft sich gut, dass du weit fort bist. Nein, versteh mich nicht falsch! – Ich vermisse dich und deine Gegenwart, deine brummigen Macken, unser Geschimpfe über die Politik, deine Fürsorglichkeit. Ich vermisse uns.
Aber es trifft sich gut, dass du fort bist, denn nach langer Zeit habe ich wieder ein Buch in die Hand genommen. Du hast dir immer gewünscht, ich möge mich in die Leseecke setzen, jetzt sitze ich hier. Wenn ich dir den Titel sage, wirst du aufstöhnen. Er lautet «Liebesbriefe berühmter Frauen». Es ist ein echtes Frauenbuch.
Es trifft sich gut, dass du fort bist, denn es hat mich nun dazu gebracht, dir nach langer Zeit wieder einen Brief zu schreiben. Weißt du noch, all die Briefe? Liegen sie noch unten im Schrank?
In diesem Buch hier sind 50 Liebesbriefe abgedruckt, Namen bekommst du weiter unten. Zu den Briefen haben die Herausgeber jeweils klare und menschliche Texte geschrieben, damit die Leserin ermessen kann, welchen Stellenwert der Brief und der Adressierte im weiteren Verlauf ihres Lebens hatte. Denn nicht alle Beziehungen, von denen hier geschrieben wird, blieben glücklich. Manche endeten sehr bald, andere beendete der Tod.
Aus nicht wenigen Briefen ist Verliebtheit und fast schon Besessenheit zu erlesen, in anderen die Vorahnung, dass die Liebe gefährdet ist, in noch anderen ist aus Verliebtheit die tiefe Gewissheit der Liebe geworden – und Marie Curie hat ihre Briefe an ihren tödlich verunglückten Mann geschrieben, um seinen Tod zu begreifen. Da können einem Schauer über den Rücken laufen. – Lach nicht. Ich darf so schreiben, ich bin eine Frau.
Was mich auch gefesselt hat, war die Entdeckung, dass Frauen aus vorhergehenden Jahrhunderten ihre Empfindungen und Sehnsüchte ebenso gut, vielleicht sogar zu äußern wussten als manch eine der Emanzen heute. Clara Wieck findet mit 19 Jahren sehr bestimmende Worte; das hat mich beeindruckt. Christiane Vulpius, die an Goethe schreibt, schreibt so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Ganz nebenbei entdecken die Briefe natürlich auch den Angesprochenen!
Im vergangenen Jahrhundert leide ich mit Edith Piaf und Camille Claudel. Du hast mich doch erst vor einigen Tagen auf den wohl berühmtesten Romananfang der Literatur verwiesen: «Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.» – So kann man es wohl auch für die Liebe sagen.
Ich werde der Frage, ob Frauen und Männer unterschiedlich lieben, noch einmal nachgehen müssen, und dann werden wir darüber streiten! Ich meine nämlich unbedingt ja!
Zu diesem Buch gab es bereits einen Vorgänger, die «Liebesbriefe großer Männer». Wie das ausfiel, weiß ich natürlich nicht, aber dieses Buch hier haben Petra Müller und Rainer Wieland sehr liebevoll aufgearbeitet. Ich bekomme Lust, mich einmal mehr mit Simone de Beauvoir und Carson McCullers zu beschäftigen. Frida Kahlo, die du nicht so magst, ist dabei und Paula Modersohn-Becker, deren Bilder dir wiederum sehr gefallen. Ich erzähle dir bei Gelegenheit von ihren Briefen. Von Marylin Monroe ist ein sehr kurzer Brief nur abgedruckt, aber der zeigt meiner Einschätzung nach sehr gut ihr Dilemma. Den Schluss macht die Liebesgeschichte des letzten Jahrhunderts, als ein König auf den Thron vezichtete. Wallis Simpson schreibt an Edward, ob es nicht besser sei, «sie mache sich aus dem Staub». Du weißt, mir gefällt dergleichen.
Man kann den Herausgebern gratulieren, ein gelungenes Buch. Wenn bloß – und jetzt wirst du wieder sagen, ich hätte ja eh immer etwas zu meckern – der Einband nicht so kitschig wäre. Da haben sie doch aus Sex-and-the-City (die Serie, die ich mir übrigens nie angeschaut habe – ehrlich!) Carry und ihren Mr. Big abgedruckt und das auch noch mit pinkfarbener Rückseite. Also, das ist ein bißchen sehr dick aufgetragen und ein Wink mit dem Zaunpfahl an die Zielgruppe.
Dabei hätte es dem Buch gut gestanden, wenn die Frauen, die im Innern zu Wort kommen, auch gezeigt werden. Hilde Knef war eine schöne Frau, Ingrid Bergmann, Sarah Bernard und Virginia Woolf waren bekannt genug, um zum Hingucker zu werden.
Ich werde das Buch noch das eine oder andere Mal in die Hand nehmen, bis du wiederkommst. Und das ist hoffentlich bald, denn ich möchte keinen Tag ohne dich aufwachen und einschlafen. Schön, dass es dich gibt…
P.Müller und R.Wieland (Hg.), Liebesbriefe berühmter Frauen, Piper Verlag, 216 Seiten, ISBN 978-3492257961
.
.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des «Glarean Magazins»
.
Ständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des «Glarean Magazins»
.
 Dr. Karin Afshar (Literatur)
Dr. Karin Afshar (Literatur)
Geb. 1958 in der Eifel/D, Studium der Sprachwissenschaft, Finn-Ugristik und Psychologie, Promotion, zahlreiche belletristische und fachwissenschaftliche Publikationen, lebt als Herausgeberin, Lektorin und Publizistin in Frankfurt – – Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
 Thomas Binder (Schach)
Thomas Binder (Schach)
Geb. 1961, Diplom-Ingenieur, aktiver Schach-Spieler und -Trainer, Co-Autor des Wikipedia-Schach-Portals, lebt als EDV-Berater in Berlin – – Thomas Binder im Glarean Magazin
.
.
 Christian Busch (Musik/Literatur)
Christian Busch (Musik/Literatur)
Geb. 1968 in Düsseldorf/D, Studium der Germanistik, Romanistik und Erziehungswissenschaft an der Universität Bonn, jahrelange Musik-Erfahrung in verschiedenen Chören, arbeitete als Lehrer in Frankreich, Südafrika und Deutschland, lebt Düsseldorf – – Christian Busch im Glarean Magazin
.
.
 Bernd Giehl (Literatur)
Bernd Giehl (Literatur)
Geb. 1953 in Marienberg/D, Studium der Theologie in Marburg, zahlreiche schriftstellerische und theologische Publikationen, lebt als evang. Pfarrer in Nauheim – – Bernd Giehl im Glarean Magazin
.
.
.
 Sigrid Grün (Literatur)
Sigrid Grün (Literatur)
Geb. 1980 in Rumänien, Schauspielausbildung in Regensburg, Studium der Deutsche Philologie, Philosophie und Vergleichenden Kulturwissenschaft, derzeit Promovierung, Sachbuch-Autorin und Betreiberin eines oberbayerischen Kulturportals – – Sigrid Grün im Glarean Magazin
.
.
.
 Michael Magercord (Musik/Literatur)
Michael Magercord (Musik/Literatur)
Geb. 1962, früher als Journalist bei der Berliner Tageszeitung taz und als «Stern»-Korrespondent in Peking tätig, verschiedene Buchpublikationen, lebt als Feature-Autor und Reporter des Hörfunks in Prag/Tschechien – – Michael Magercord im Glarean Magazin
.
.
 Günter Nawe (Literatur)
Günter Nawe (Literatur)
Geb. 1940 in Oppeln/D, von 1962 bis zur Pensionierung 2005 Mitarbeiter eines Kölner Zeitungsverlags, danach freischaffend u.a. als Pressesprecher eines großen Kölner Chores und Buchrezensent für Print- & Online-Medien – – Günter Nawe im Glarean Magazin
.
.
 Wolfgang-Armin Rittmeier (Musik)
Wolfgang-Armin Rittmeier (Musik)
Geb. 1974 in Hildesheim/D, Studium der Germanistik und Anglistik, bis 2007 Lehrauftrag an der TU Braunschweig, langjährige Erfahrung als freier Rezensent verschiedener niedersächsischer Tageszeitungen sowie als Solist und Chorist, derzeit Angestellter in der Erwachsenenbildung – – Wolfgang-Armin Rittmeier im Glarean Magazin
.
.
 Dr. Mario Ziegler (Schach)
Dr. Mario Ziegler (Schach)
Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach. Mario Ziegler im Glarean Magazin
.
.
.
Florence Hervé (Hg.): «Durch den Sand»
.
Leben, träumen, reisen in der Wüste
Dr. Karin Afshar
.
 Das Buch liegt weich und doch fest in der Hand, fast hätte ich etwas Rauheres erwartet, aber nein, der Einband ist glatt. Auf dem Coverfoto sehen wir im Vordergrund Fußspuren im Sand; sie führen erst hin zu einer rot gekleideten, einen langen Strich-Schatten auf ihre rechte Seite werfende Frau genau in der Mitte, und dann wieder von ihr weg, über Sanddünen ihr vorauseilend auf ein fernes Gebirge zu. Bilder von Weite und Leere sind es, die das Wort Wüste in uns aufsteigen lässt, ganz unabhängig davon, ob wir selbst einmal eine reale erlebt haben oder sie aus je eigener innerer Erfahrung kennen. «Wüste» ist auch ein Seelenzustand.
Das Buch liegt weich und doch fest in der Hand, fast hätte ich etwas Rauheres erwartet, aber nein, der Einband ist glatt. Auf dem Coverfoto sehen wir im Vordergrund Fußspuren im Sand; sie führen erst hin zu einer rot gekleideten, einen langen Strich-Schatten auf ihre rechte Seite werfende Frau genau in der Mitte, und dann wieder von ihr weg, über Sanddünen ihr vorauseilend auf ein fernes Gebirge zu. Bilder von Weite und Leere sind es, die das Wort Wüste in uns aufsteigen lässt, ganz unabhängig davon, ob wir selbst einmal eine reale erlebt haben oder sie aus je eigener innerer Erfahrung kennen. «Wüste» ist auch ein Seelenzustand.
«Durch den Sand» ist der Titel der Anthologie, die im Aviva Verlag frisch in diesem Jahr erschienen ist. Florence Hervé ist die Herausgeberin, und sie hat 29 Autorinnen einschließlich sich selber in die Wüste geschickt. Was erwartet den Leser dort? Und wer ist der Leser, an den sich das Buch wendet?
Was sich die Herausgeberin mit diesem Buch vorgenommen hat, erfahren wir im Vorwort. Es kündigt die Autorinnen an und ordnet sie unterschiedlichen Beweggründen, Hintergründen und Absichten zu. Zeitgenössische Schriftstellerinnen kommen zu Wort, aber auch «klassische» aus Vor-Jahrhunderten und -Denkzeiten, bekannte und weniger bekannte, solche, die in Wüstengebieten leben und solche, die sie bereisen.
Beim ersten Durchblättern, das ich mir nicht verkneifen kann, entdecke ich nach fast jedem Beitrag ein Schwarz-Weiß-Foto mit Wüstenmotiven. Zurückhaltung spricht aus dem Layout, Zurückgenommenheit – Farbe hätte hier gestört.
Im hinteren Teil erfahren wir auf 15 Seiten etwas über die Autorinnen, deren Kurzbiographien individuell sind, weil jede ihre eigenen Lebens- und Erlebnis-Schwerpunkte hat. Ich blättere ein wenig, aber die Frauen sprechen noch nicht mit mir.
Die erste Geschichte «Äpfel aus der Wüste» ist genau von der Art, die ich persönlich sehr gerne lese. Jetzt bin ich neugierig auf die nächste. «Die Wüste wirft Buckel» kommt mir im Erzählduktus bekannt vor… Nach der vierten Geschichte muss ich das Buch allerdings zur Seite legen, denn ich kann nicht mehr. Bei «Töchter der Agar» und «An beiden Enden» muss man sehr genau hinlesen, wirken lassen, aufs Verstehen, vielleicht auch auf das inwendige Schaudern, lauschen.
Am nächsten Tag, bevor ich wieder zu lesen beginne, schaue ich mir die Einteilung an. Drei große Blöcke finden sich: ‘Leben in der Wüste’, ‘Träume in der Wüste’ und ‘Reisen in der Wüste’. Der zweite Abschnitt scheint mehr Gedichte als Geschichten zu enthalten, ich habe das nicht ausgezählt. Aber auch die kann man nicht schnell lesen; weit gefehlt haben die, die das denken. Jedes Einzelne fordert Nachlesen ein, lässt die Zeit langsam werden, entschleunigt.
Für wen nun dieses Buch? Leser, die Zerstreuung erwarten, werden das Buch schnell weglegen. Formulierte ich es negativ, würde ich sagen, dass es keine leichte Sommerlektüre für den Liegestuhl am Strand ist, die man aufschlägt und dann verschlingt. Es ist eine schwere Lektüre, die dem Leser, oder der Leserin, etwas abverlangt.
Die Herausgeberin hat sich natürlich Gedanken über die Abfolge der Beiträge gemacht, und die ist gelungen. Sie schließt die Anthologie mit dem «Wüstenalphabet» von Lisette Buchholz und damit einen Kreis – eine beschwerliche Reise haben wir gemacht, sind hinabgestiegen und ganz unten angekommen. Wir verlassen die Wüste geläutert. Den heiteren Ton dieses letzten Beitrags haben wir uns verdient, die Leichtigkeit entlässt uns – in die nächste Wüste? ■
Florence Hervé (Hrsg.), Durch den Sand, Schriftstellerinnen in der Wüste, Anthologie, Aviva Verlag, 220 Seiten, ISBN 978-3-932338-41-0
Probeseite (Vorwort)
.
Vorwort
Sand und Steine. Stille und Sterne. Wind und Weite.
Raum und Zeit. Die Wüste war und ist Quelle der Inspiration
für viele Schriftstellerinnen, Dichterinnen
und Reporterinnen.
Die Wüste ist Ort der Träume und Alpträume, des
Glücks und des Schmerzes, des Lebens und des Todes.
Mythen umgeben sie. Sie ist nicht tot. Sie ist
nicht nur Dürre, Einöde oder Abenteuerland. Sie kann
blühen. Sie ist Symbol für Unendlichkeit, Ewigkeit
und Freiheit, aber auch für Menschenfeindlichkeit
und Einsamkeit. Faszination und Gefahr stehen nebeneinander.
Die ausgewählten 29 Autorinnen aus Australien, Lateinamerika,
Afrika, dem Maghreb, dem Nahen und
Mittleren Osten sowie aus Europa nehmen die Wüste
auf unterschiedliche Weise wahr. Mit ihnen durchwandern
wir die australische, die Mojave- und die Gobi-
Wüsten, die Sahara und den Negev und erleben die
Vielfältigkeit einer Landschaft, die in der europäischen
Sicht meist auf orangefarbene wellige Sanddünen
reduziert wird. Ob sie in der Wüste leben und arbeiten,
ob sie von der Wüste träumen und diese
mystisch erfahren oder ob sie in die Wüste reisen:
Der Blick der Schriftstellerinnen und deren Schreibweise
unterscheidet und verändert sich.
Unter den ersten, die über die Wüste schrieben, ist
im 7. Jahrhundert Maisûn, die Gattin eines Kalifen, die
das schlichte glückliche Wüstenleben besingt. Im
Mittelalter beschreibt die Begine und Mystikerin
Mechthild von Magdeburg den Weg zur Vollkommenheit
als Weg zur »wahren Wüstenei«. In ihrer Meditation
Das fließende Licht der Gottheit wird die
Wüste zum Symbol für das Bescheidene, das Mündige,
das Unabhängige und Spirituelle.
Das 19. Jahrhundert ist von einer literarischen Orient-
Mode erfasst, wobei die Wüste für das Fremde,
das Andere, für Grauen und Faszination, für Aufbruch
und Sehnsucht nach Ursprünglichkeit steht. Der Ort
des Schreckens erfährt eine Umdeutung als Ort des
Erhabenen. Unter den Schriftstellerinnen, die sich
vom Wüstenwind und von den Klängen des Orients
beflügeln lassen, sind die Dichterinnen Karoline von
Günderrode und Annette von Droste-Hülshoff.
Im 20. Jahrhundert wird die reelle Wüste entdeckt.
Abenteuerinnen und reisende Reporterinnen brechen
mit Kamel und Zelt auf, vornehmlich in die Sahara.
Isabelle Eberhardt, sozusagen das weibliche Pendant
zum Poeten Arthur Rimbaud, fordert für sich das
Recht auf ein »unstetes Herumirren«, das Recht auf
Vagabondage: »Welch glückseliges Gefühl, eines Tages
mutig alle Fesseln abzuschütteln, welche das moderne
Leben und die Schwäche unseres Herzens uns
unter dem Vorwand der Freiheit angelegt haben;
sich symbolisch mit Stab und Bettelsack zu rüsten
und fortzugehen!« Die Vagabondage ist für sie Befreiung,
das wandernde Leben Freiheit, die Wüste eine
Stätte der Ruhe, der Schlichtheit und der Schönheit,
eine Oase des Friedens. »Ich liebe meine Sahara, ich
liebe sie mit einer dunklen, geheimnisvollen, tiefen,
unerklärlichen, aber durchaus wirklichen und unzerstörbaren
Liebe.«
Zu dieser Zeit durchstreifte die englische lebensund
reiselustige Adlige Gertrude Bell die Wüsten Arabiens,
unternahm Forschungsreisen nach Palästina
und Transjordanien. Ihr Bericht darüber ist der einer
Orientalistin, Archäologin, Historikerin und Diplomatin.
Für die Schweizer Reisenden Ella Maillart und Annemarie
Schwarzenbach waren das Abenteuerleben und
das Schreiben untrennbar miteinander verbunden.
Zusammen durchquerten sie den Iran, Afghanistan
und die Türkei.
Die bretonische Ethnologin Odette du Puigaudeau,
auch Pionierin der Sahara genannt, reizten Abenteuer,
Herausforderung und Risiko ebenso wie das entbehrungsreiche,
einfache Leben und die Begegnungen,
»die Ankunft an einem Brunnen, das Suchen
nach Weideland, eine Nachtwache am Feuer«. Die
Grenzenlosigkeit berauschte sie.
Die Australierin Robyn Davidson reiste 2.800 km allein
mit vier Kamelen durch Busch, Felsen und Sand.
In Spuren berichtet sie von den Strapazen und Freuden
ihrer Wüstenreise und stellt fest: »Die Fähigkeit
zu überleben ist vielleicht die Fähigkeit, sich von der
Umgebung verändern zu lassen.«
Die »magische Vision« und das »Farbspektakel«
der kalifornischen Wüste beeindrucken Christa Wolf,
die in ihrer Wüstenfahrt von witzigen und nachdenklichen
Begegnungen in den USA erzählt.
Andere Schriftstellerinnen sahen und sehen die Wüste
als einen Ort der Mystik, der Spiritualität, der Religion,
der Selbstfindung, der Zauberei oder gar der
Utopie.
In ihrer utopischen Erzählung Drei Träume in der
Wüste unter einem Mimosenbaum, vor dem Hintergrund der
»unendlichen« und »ewigen« Wüste, zeichnet
die südafrikanische Feministin Olive Schreiner die
Unterdrückung der Vergangenheit und den Kampf
um die Befreiung nach, weist auf die Zukunft eines
gleichberechtigten Lebens hin.
Für die Dichterinnen Else Lasker-Schüler und Nelly
Sachs ist die Wüste verbunden mit dem Heiligen
Land. Die Lyrikerin Mascha Kaléko, die 1945 nach Israel
emigrierte, wurde dort nicht heimisch. Die Wüstenei
ist für sie das Nirgendland, bedeutet Einsamkeit
und Heimatlosigkeit, auch Sehnsucht. Sie fühlt
sich »einsam wie der Wüstenwind« und »heimatlos
wie Sand«.
Für Ingeborg Bachmann ist die Wüste dagegen
eine Reise in das innere Ich, dort kann man sich nicht
entgehen. Die österreichische Schriftstellerin reiste im
Frühjahr 1964 zwei Monate nach Ägypten und in den
Sudan, schrieb an ihrem Wüstenbuch-Projekt: »Ich
nenne es vorläufig ›das Wüstenbuch‹, da eine reale
Wüstendurchquerung den Inhalt ausmacht. Die Wüste
ist der Held.« Sie ist »die unendliche Langeweile für
den einen, die immerwährende Erregung für den,
dessen Augen von ihrem Sand ausgezeichnet werden
«. Der leere und reine Wüstensand steht als Gegenbild
»zur verwüsteten Welt«, von ihm wird Erlösung
erwartet.
In Tanja Dückers Roman Der längste Tag des Jahres
erscheint die Wüste als Rückzugsstätte, als Ort der
Suche nach dem verborgenen Sinn des Lebens und
der Selbstfindung.
Für die Schriftstellerinnen aus dem Maghreb und
aus dem Nahen und Mittleren Osten ist die Wüste
von Ambivalenz geprägt. Manche haben dort Furchtbares
erlebt, Bürgerkriege und Kriege, Gewalt und
Vergewaltigung, aber auch Trost und Freiheit.
Die libanesisch-amerikanische Schriftstellerin und
Malerin Etel Adnan, die zwischen Kulturen, Sprachen
und Orten reist, beschreibt die ostsyrische Wüste von
Lawrence von Arabien als »das offene Nichts« und
die »endlose Wildnis«, die Wüstenaraber werden
»Geschöpfe des Windes« genannt. Ihr Fazit: Die »Eroberung
der Wüste ist eine erotisch befriedigende Erfahrung,
doch sie weist in die Illusion«.
In Fern von Medina besinnt sich die Algerierin
Assia Djebar auf die historischen Quellen des Islams
und zeichnet Porträts von Rebellinnen, darunter Agar,
»die der Sonne Ausgesetzte«. Abraham verließ Agar
und ihren Sohn Ismael in der Wüste.
Malika Mokeddems Darstellung der Wüste ist von
den dort erfahrenen Widersprüchen geprägt. Die algerische
Wüste, in der sie aufwuchs, ist Zelle der Traditionen,
zugleich Gefängnis für Frauen wie Ort des
Trostes, der Klarheit und der Freiheit. Sie schreibt von
der »erhebenden Trostlosigkeit«, vom »unbarmherzigen
Brennglas des Himmels« in der Wüste, aber
auch von der Sandwüste als »ein Meer der Träume«,
als »Raum der Freiheit«. Sie spürt in der Wüste
Angst und Faszination »an der Grenze des Erträglichen«.
Bei ihrem zehn Jahre langen Aufenthalt in Algerien
hat Sabine Kebir ebenfalls Veränderungen und Hoffnungen
erlebt, den Kampf um Frauenbefreiung, aber
auch Rückschläge, Frauenunterdrückung und Gewalt.
Dies beschreibt sie kenntnisreich, schildert die Sahara-
Landschaft und das Alltagsleben.
Die Wüste kann schließlich Synonym für kulturelle
Identität sein. Für die Ägypterin Miral al-Tahawi, die
in einer Beduinenfamilie aufwuchs, ist die Wüste
»lediglich eine Stammeskultur, die unseren Standort
im Dasein bestimmt«. Sie erfährt Unterdrückung und
zugleich Wärme in der Beduinenwelt, in der Frauen
für das Zelt zuständig sind, während Männer jenseits
des Tors die Freiheit erreichen.
Erstaunlich groß ist die Anzahl von Autorinnen, die
die Reise zu den kargen Landschaften und zu den Nomaden
wagen. Auch wenn unsere literarische Reise
lediglich einen kleinen Teil dieser Wüstenreisenden
versammelt, vermag sie doch unseren eigenen Blick
auf die Wüste zu verändern und lädt dazu ein, diese
neu zu erleben und zu erträumen.
Florence Hervé, Januar 2010
..
.
.
Peter Klusen: «Augenzwinkernd»
.
Im Humor macht man sich dümmer als man ist und
wird dadurch stärker als man scheint
Dr. Karin Afshar
.
 Ich kenne ihn nicht und ich kenne ihn doch – den Peter Klusen, geboren im Jahre 1951 in Mönchengladbach, denn ich habe Gedichte von ihm gelesen.
Ich kenne ihn nicht und ich kenne ihn doch – den Peter Klusen, geboren im Jahre 1951 in Mönchengladbach, denn ich habe Gedichte von ihm gelesen.
Friedrich Nietzsche (1844-1900) meinte irgendwann einmal, man könne aus drei Anekdoten das Bild eines Menschen ersehen. Drei oder vielleicht vier Gedichte tun es sicher auch, um das Pendeln eines Dichters zwischen Tragik und Komik zu umreißen und ihn kennenzulernen. Folgen Sie mir bei diesem Versuch.
Ein erstes (nein, es ist das zweite) Gedicht («niederrheinische ver-bindungen»), im «Präludium» des orangefarbenen Paperbackbüchleins, beginnt so:
mit dem
niederrhein
mein gott
verbindet mich doch nichts
Peter Klusen lebt am Niederrhein, in einer Kleinstadt ohne landschaftliche Attraktionen außer den Süchtelner Höhen, so steht es in der Vita hinten im Buch und auf seiner Webseite, ich hab nachgeschaut. Er – so liest man weiter über ihn – ist Germanist, Sozialwissenschaftler, Publizist, Lehrer, Schriftsteller, Cartoonist. Und mit dem Niederrhein verbindet ihn nichts?
Habe ich ihn soeben ertappt? Die letzte Strophe löst auf:
…
nein
mit dem niederrhein und seinen
zugenebelten wiesen voller kuhfladen
kapellen und fettecken
verbindet mich nichts
aber lieber gott
lass mich dereinst nicht
begraben werden wie der
heine
zum beispiel in paris
Im Reich zwischen den Gegensätzen liegen die Quellen des Humors, der u.a. «die wunderliche Traurigkeit […] des Menschenlebens und das Staunen darüber, daß dies jämmerliche Leben trotzdem so schön sein kann» (Hermann Hesse) zum Thema hat. Für diese Art der Traurigkeit (über den Zustand der Welt, den Zustand der Menschen, ihre Würdelosigkeit, ihr Talent zur Zerstörung) finden sich etliche Beispiele im Buch, auf drei Sätze verteilt – drei Sätze wie eine Sinfonie sie hat, deren zweiter in der vorliegenden Komposition liebevoll lamento ostinato genannt, bald mein Lieblingssatz wird.
Humor ist nicht selten die unter Schmerzen errungene Freiheit und Souveränität, die einem tragischen Schicksal gegenüber stehen. Wir kennen das Wort «Galgenhumor» – und zum «Trotzdem» unten mehr. Traurigkeit klingt nun in den Zeilen Klusens an, aber sie übertönt nie das andere – und damit wir als Leser die Anklänge nicht gar so schwer, wohl aber zur Kenntnis nehmen, wird das Ganze ja auch «augenzwinkernd» gesagt.
Humor erkennt man an der Konstruktion eines offenbar unangemessenen, nebensächlichen Standpunkts oder an einer unzulänglichen Verhaltensweise in einer Situation der Gefahr, des Scheiterns oder am Eingeständnis einer Niederlage.
Der lauf der dinge
und wenn ich
eines tages
nicht mehr singe
ist das nichts
als der lauf der dinge
und wenn ich
eines tages
nicht mehr lache
ist das eher
eine nebensache
Ich verrate Ihnen an dieser Stelle nur, dass das letzte Wort der letzten Zeile «gut» lautet. Wie er dahin kommt, lesen Sie am besten selbst nach.
«Humor ist eine Flucht vor der Verzweiflung, ein knappes Entkommen in den Glauben.» (Christopher Fry). Damit wäre Peter Klusen wahrscheinlich nicht ganz einverstanden. Denken wir Glauben zusammen mit Himmel, dann hat es Klusen nicht mit demselben, oder doch? Im fine furioso findet sich dies:
lieber himmel
der himmel muss die hölle sein
vollgestopft mit moralisten
nächstenlieber mahner christen
weit und breit kein hund
kein schwein
der himmel muss die hölle sein
Er spielt mit uns. Wirft etwas aus, und lässt uns dann zappeln. Humor – auch Schadenfreude? –, Humor ist nicht gleich Humor. So sollen Briten einen anderen haben als Franzosen, und diese wiederum einen anderen als Deutsche. Im Allgemeinen versteht der Volksmund im Deutschen unter Humor, wenn man in einer bestimmten Situation «trotzdem lacht». Anders ausgedrückt: der, der sich selbst, die anderen und die Welt nur ernst sieht, wird es (das Leben) auf Dauer nicht aushalten. Die Formulierung mit dem «trotzdem lacht» soll übrigens auf Otto Julius Bierbaum (deutscher Schriftsteller, 1865-1910) zurückgehen. Der schrieb auch Gedichte, und zwar nicht wenige. Ein Hauch seiner Anakreontik klingt im ersten Satz der Klusen-Sinfonie, dem Allegro con amore, an, z.B. im Sommermorgen.
Auslöser humorvollen Lachens können die Fehler sein, die einem – trotz anderer, die man sich schon geleistet hat – noch nicht unterlaufen sind. Man fühlt sich natürlich stark, wenn man sie von anderen liest und hört. Diese künstliche Verdopplung der (eigenen) Schwäche überwindet symbolisch das Bedrohliche der Situation. In diesem Tiefstapeln des Widerstands steckt der optimistische Hinweis, dass man sich der Situation nicht ohne Widerstand ausliefert.
In einer solchen Lesart könnte man das Gedicht von der «nicht-gewalt» verstehen. Es prangert die Sprachlügen unserer Gesellschaft an und ist eigentlich überhaupt nicht lustig, auch wenn es lustig daher kommt.
Nicht gewalt
weil er am morgen den kleinen bruder
geschlagen hatte
schlug ihn der vater am abend
um ihn zu lehren
dass der stärkere den schwächeren
nicht schlagen darf
er sagte dazu
erziehung
nicht gewalt
…
Wortwitz, bisweilen Ironie, immer Freude an bunten und kräftigen Adjektiven und Themen, die alltäglich genug sind, dass jeder sie kennt und schmerzhaft genug, dass wir sie nur allzu gerne nicht ansprechen würden, begegnen uns im Buch. –
Vorliegender kurzer Gang durch die drei Sätze der lyrischen kammersinfonie reicht nicht, jedem der Gedanken gerecht zu werden. Indes soll diese Besprechung weder eine Interpretation noch der Versuch einer Einordnung werden, denn das würde schon wieder ernst und die Freude am Lesen und Entdecken nehmen. Sie werden mir aber vielleicht darin Recht geben, dass wir ihn ein wenig kennengelernt haben: der Mann hat Humor! (Karin Afshar)
Peter Klusen, augenzwinkernd – lyrische kammersinfonie in drei sätzen, Editions trèves Trier, 80 Seiten, ISBN 978-3-88081-505-6
Probeseiten
.
.
.
.
.
.
.
.


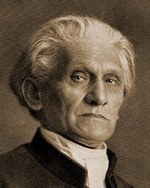
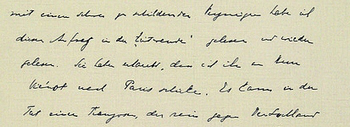
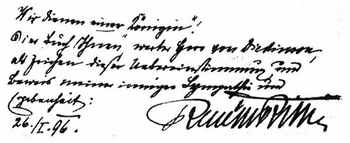

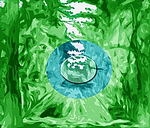






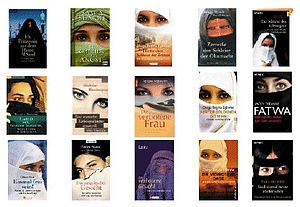
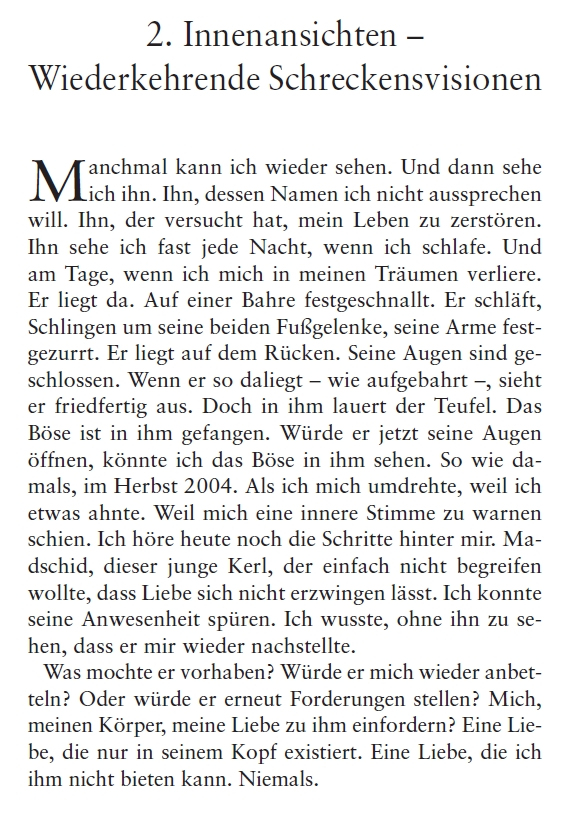
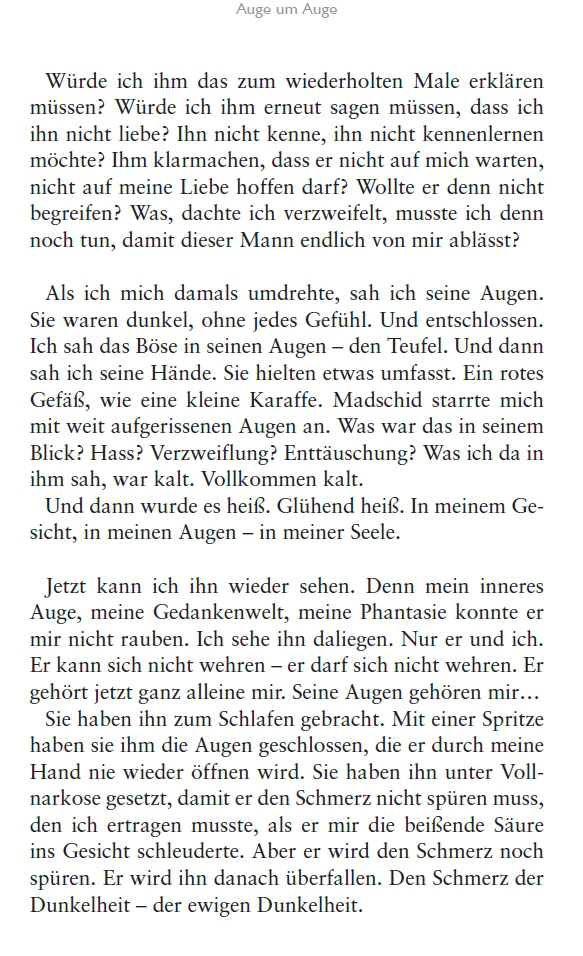














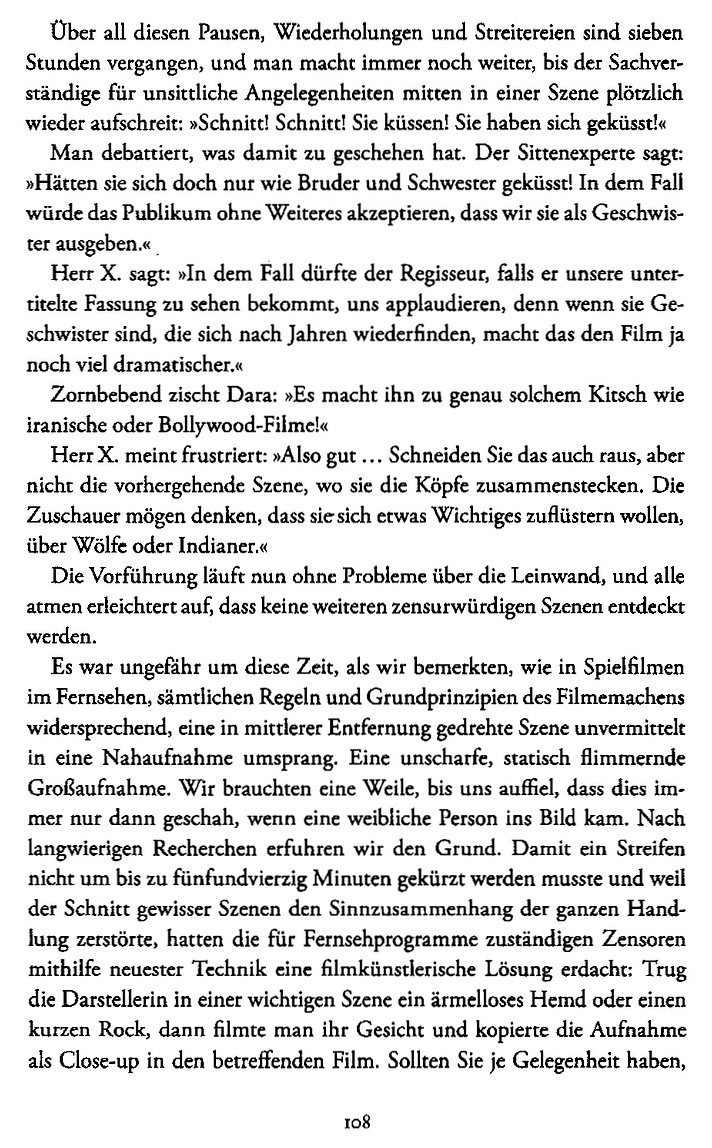
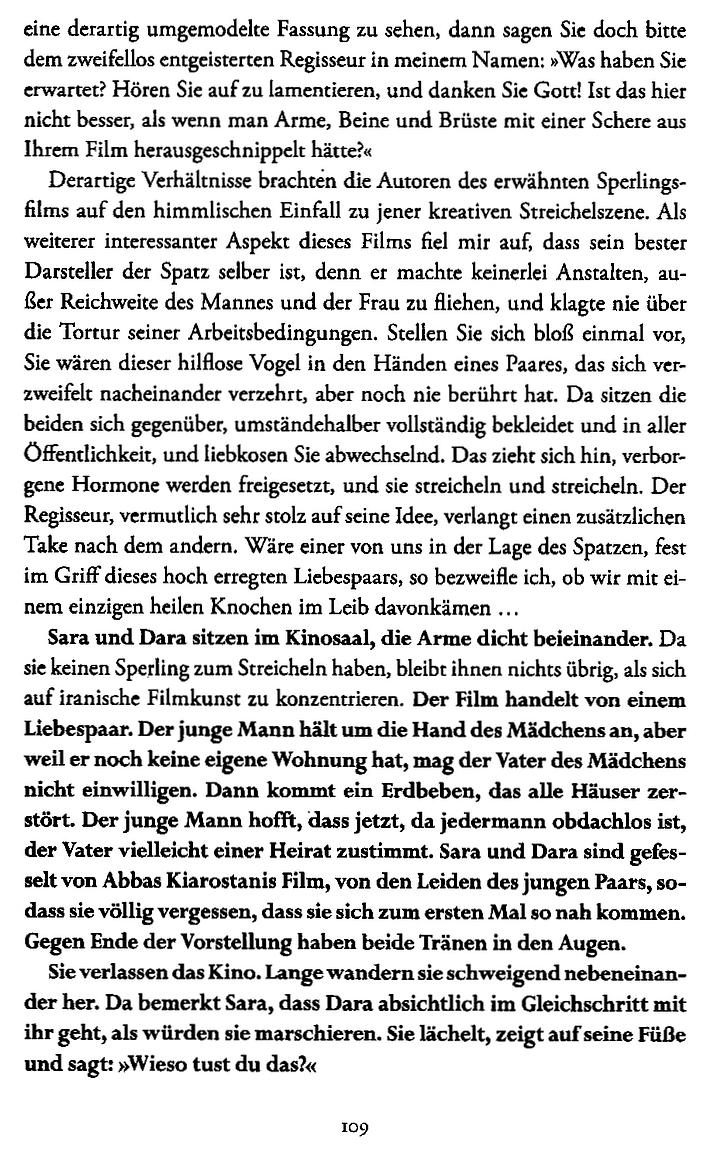











1 comment