Das Zitat der Woche
.
Über den Patriotismus
Samuel Smiles
.
Ein großer Teil dessen, was heutzutage im Namen des Patriotismus geschieht, ist im Grunde genommen bloße Heuchelei und Beschränktheit, die sich in nationalen Vorurteilen, nationalem Dünkel und nationalem Haß darstellen. Diese Gesinnung zeigt sich nicht in Taten, sondern in prahlerischen Worten – in Geschrei, Gestikulationen und kläglichen Hilferufen – im Fahnenschwenken und Absingen von Liedern – im beständigen Ableiern längst begrabener Beschwerden und längst gesühnten Unrechts. Von solchem »Patriotismus« befallen zu werden, gehört wohl zu den schwersten Flüchen, die ein Volk treffen können.
Aber wenn es einen unechten Patriotismus gibt, so gibt es auch einen echten – den Patriotismus, der ein Land durch edle Taten stärkt und erhebt – der seine Pflicht aufrichtig und mannhaftig erfüllt – der ein ehrliches, mäßiges und wahrhaftiges Leben führt und sich bemüht, die Gelegenheiten zur Vervollkommnung, die sich ihm von jeder Seite darbieten, nach besten Kräften zu benutzen; und gleichzeitig gibt es Patrioten, die das Andenken und Beispiel großer Männer früherer Zeit in Ehren halten, von Männern, die durch ihr Leiden um die Sache der Religion oder der Freiheit unsterblichen Ruhm für sich und für ihr Volk, jene Privilegien freien Lebens und freier Einrichtungen, deren Erbe und Besitzer es ist, errungen haben.
Nationen dürfen ebensowenig wie Individuen nach ihrer meßbaren Größe beurteilt werden. Denn um groß zu sein, bedarf eine Nation nicht einer großen Ausbreitung, obgleich diese Begriffe häufig miteinander verwechselt werden. Eine Nation kann an Land und Bevölkerungszahl sehr ausgedehnt und dennoch ohne wahre Größe sein. Das Volk Israel war klein, doch welch großes Leben entfaltete es und welch gewaltigen Einfluß übte es auf die Geschicke der Menschheit aus. Griechenland war nicht ausgedehnt. Die ganze Bevölkerung Attikas war geringer als die von Süd-Lancashire. Athen zählte weniger Einwohner als New York und doch wie groß war es in Kunst, Literatur, Philosophie und Patriotismus! Aber es war eine verhängnisvolle Schwäche Athens, daß seine Bürger kein wahres Familienleben hatten, während die Freien von den Sklaven an Zahl weit übertroffen wurden. Seine Staatsmänner waren in ihrer Moral lax, wenn nicht gar verderbt. Seine Frauen, auch die gebildetsten, waren sittenlos. So war Athens Fall unvermeidlich, und er erfolgte rascher als der Aufstieg.
Ebenso ist der Verfall und Untergang Roms der allgemeinen Korruption des Volkes und der immer weiter um sich greifenden Vergnügungssucht und Trägheit zuzuschreiben – wurde doch die Arbeit in der letzten Zeit als nur für Sklaven passend angesehen. Seine Bürger rühmten sich nicht mehr der Charaktertugenden ihrer großen Vorfahren, und das Reich ging unter, weil es nicht verdiente, weiter zu leben. Und so müssen die Nationen, die träge und üppig sind – die wie der alte Burton sagt, »lieber in einer einzigen Schlacht ein Pfund Blut, als bei ehrlicher Arbeit einen Tropfen Schweiß vergießen« – unvermeidlich aussterben, und arbeitsamen, energischen Völkern Platz machen.
Als Ludwig XIV. Colbert fragte, wie es käme, daß er als Herrscher über ein so großes und bevölkertes Land wie Frankreich das kleine Holland nicht hätte erobern können, antwortete der Minister: »Sire, weil die Größe eines Landes nicht auf der Ausdehnung seines Gebietes, sondern auf dem Charakter seines Volkes beruht. Es war der Fleiß, die Mäßigkeit und die Energie der Holländer, die sie für Eure Majestät unüberwindlich gemacht haben.«
Von Spinola und Richardet, den Gesandten des Königs von Spanien zur Abschließung eines Vertrages in Haag 1608, wird erzählt, daß sie eines Tages acht oder zehn Leute aus einem kleinen Boote steigen sahen, welche sich im Grase niederließen, um eine Mahlzeit von Brot, Käse und Bier einzunehmen. »Wer sind jene Ankömmlinge?« fragten die Gesandten einen Bauern. »Das sind unsere edlen Herren, die Gesandten der Generalstaaten«, war die Antwort. Spinola flüsterte sofort seinem Gefährten zu: »Wir müssen Frieden schließen, solche Menschen lassen sich nicht besiegen.«
Die Stabilität der Einrichtungen muß auf der Stabilität des Charakters beruhen. Eine Anzahl entarteter Gemeinwesen kann keinen großen Staat bilden. Das Volk kann hochzivilisiert scheinen und doch bei dem ersten Angriff zerfallen. Ohne Untadeligkeit des individuellen Charakters gibt es für einen Staat keine wahre Stärke, keinen inneren Zusammenhang, kein gesundes Leben. Ein Volk kann reich, politisch, künstlerisch bedeutend sein und doch schon am Rande des Verderbens stehen. Ein Volk, in dem jeder nur für sich und sein Vergnügen lebt – wo jedes kleine Ich für einen Gott sich hält – ist schon gerichtet, und sein Untergang ist unabwendbar.
Wo der nationale Charakter nicht mehr aufrecht erhalten wird, da ist die Nation verloren. Wo die Tugenden der Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Unbescholtenheit und Gerechtigkeit nicht mehr geschätzt und geübt werden, da verdient niemand mehr, zu leben. Und wenn ein Land durch Reichtum so verdorben, oder durch Vergnügen so entartet, oder durch Parteiung so verblendet ist, daß Ehre, Ordnung, Gehorsam, Tugend und Treue nur noch der Vergangenheit angehören, wenn dann ja noch vorhandene ehrenhafte Männer im Dunkeln umhertasten, um ihres Gleichen Hände zu fassen, so bleibt als einzige Hoffnung nur noch die Wiederherstellung und Hebung des individuellen Charakters; und wenn der Charakter unwiederbringlich verloren ist, dann ist in der Tat nichts mehr übrig, was erhalten zu werden verdient. ▀Aus Samuel Smiles, Der Charakter, Traktat 1895
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Realität
Egon Friedell
.
Wer macht die Realität? Der »Wirklichkeitsmensch«? Dieser läuft hinter ihr her. Gewiß schafft auch der Genius nicht aus dem Nichts, aber er entdeckt eine neue Wirklichkeit, die vor ihm niemand sah, die also gewissermaßen vor ihm noch nicht da war. Die vorhandene Wirklichkeit, mit der der Realist rechnet, befindet sich immer schon in Agonie. Bismarck verwandelt das Antlitz Mitteleuropas durch Divination, Röntgenblick, Konjektur: durch Phantasie. Phantasie brauchen und gebrauchen Cäsar und Napoleon sogut wie Dante und Shakespeare. Die anderen: die Praktischen, Positiven, dem »Tatbestand« Zugewandten leben und wirken, näher betrachtet, gar nicht in der Realität. Sie bewegen sich in einer Welt, die nicht mehr wahr ist. Sie befinden sich in einer ähnlich seltsamen Lage wie etwa die Bewohner eines Sterns, der so weit von seiner Sonne entfernt wäre, daß deren Licht erst in ein oder zwei Tagen zu ihm gelangte: die Tagesbeleuchtung, die diese Geschöpfe erblickten, wäre sozusagen nachdatiert. In einer solchen falschen Beleuchtung, für die aber der Augenschein spricht, sehen die meisten Menschen den Tag. Was sie Gegenwart nennen, ist eine optische Täuschung, hervorgerufen durch die Unzulänglichkeit ihrer Sinne, die Langsamkeit ihrer Apperzeption. Die Welt ist immer von gestern.
Abgeschieden von diesen Sinnestäuschungen lebt der Genius, weswegen er weltfremd genannt wird. Dieses Schicksal trifft in gleichem Maße die Genies des Betrachtens und die Genies des Handelns: nicht nur Goethe und Kant, auch Alexander der Große und Friedrich der Große, Mohammed und Luther, Cromwell und Bismarck wurden am Anfang ihrer Laufbahn für Phantasten angesehen. Und »weltfremd« ist nicht einmal eine schlechte Bezeichnung, denn die erkalkte Welt der Gegenwart war ihnen in der Tat fremd geworden. Man ist daher versucht zu sagen: alle Menschen leben prinzipiell in einer imaginären, schimärischen, illegitimen, erdichteten Welt; bis auf einen: den Dichter.
Die großen Männer sind eine Art Fällungsmittel, das dem Leben zugesetzt wird. Kaum treten sie mit dem Dasein in Berührung, so beginnt es sich zu setzen und zu teilen, zu läutern und zu lösen, zu entmischen und durchsichtig zu werden. Vor ihren klaren Ekstasen entschleiert sich das Leben, und alles Dunkle sinkt schwer zu Boden. ■Aus Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, München 1931
.
.
.
V. Gebhardt:«Lese und höre – Orte der Dichtung und Musik»
.
Auf den Spuren des genius loci
Günter Nawe
.
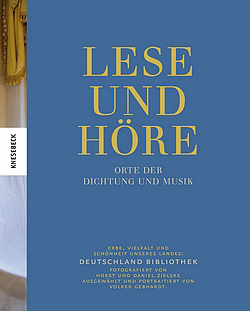 Genius loci ist einer der Begriffe, die immer dann verwendet werden, wenn man den Einfluss von Orten, Häusern und Landschaften unter anderem auf Schriftsteller, Musiker und Philosophen und ihre Werke beschreiben will. Und in der Tat, vielfach hat man eigene Erfahrungen damit gemacht, was das Goethe-Wort bedeutet: «Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen».
Genius loci ist einer der Begriffe, die immer dann verwendet werden, wenn man den Einfluss von Orten, Häusern und Landschaften unter anderem auf Schriftsteller, Musiker und Philosophen und ihre Werke beschreiben will. Und in der Tat, vielfach hat man eigene Erfahrungen damit gemacht, was das Goethe-Wort bedeutet: «Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen».
Nicht immer aber kann man reisen. So ist es oft ein Buch, das dem neugierigen, dem interessierten Leser hilft «zu verstehen». Ein solches Buch ist der opulente Band «Lese und höre» aus der «Deutschland-Bibliothek» des Knesebeck-Verlages. In ihm werden Orte der Dichtung und Musik in Text und Bild vorgestellt. Orte, die zu den schönsten und bedeutendsten unserer Kultur und Kulturlandschaft gehören.
Im Kontext zu den biografischen Daten finden wir einfühlsame Chrakteristika der Häuser und Räume, in denen zum Beispiel Theodor Storm gelebt und gearbeitet hat, in der «grauen Stadt am grauen Meer», in Husum also. Wir lernen das Lessing-Haus in Wolfenbüttel ebenso kennen wie die pompöse Villa Wahnfried, Richard Wagners langjährige Wirkungsstätte. Wir sind sozusagen bei Bert Brecht und Helene Weigel im Sommerhaus am Scharmützelsee «zu Gast», wandern mit Theodor Fontane durch das Ruppiner Land, treffen den Weltbürger Georg Friedrich Händel in Halle/Saale und den großen Johann Sebastian Bach – natürlich in Leipzig. Selbstverständlich auch Goethe und Schiller und…

Genius loci der «Götter-Dämmerung» und des «Parsifal»: Die Villa «Wahnfried» des Dichters und Musikers Richard Wagner
Ihren eigenen genius loci haben nicht nur Wohnhäuser und Arbeitszimmer, sondern auch zum Beispiel Bibliotheken und Konzerthäuser. Das gilt für die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel und den Philosophenweg in Heidelberg, diese herrliche Promenade mit Schlossblick, ebenso wie für das Gewandhaus in Leipzig, die Semperoper in Dresden, die Berliner Phiharmonie, das Opernhaus in Bayreuth und das Beethoven-Haus in Bonn – um nur einige zu nennen. Hier mag sich der Leser selbst auf Entdeckungsreise begeben.

«Lese und höre – Orte der Dichtung und Musik» ist ein opulenter Text- und Bildband, der den Leser zu bedeutenden Orten der Dichtung und Musik in Deutschland begleitet und mit eindrucksvollen Fotos zum «Lies und höre» verführt.
«Dieser Band geht den Spuren der Dichtung und Musik in Deutschland nach», so Volker Gebhardt, der die kluge und gelungene Auswahl vorgenommen und die informativen Porträts geschrieben hat, in seiner Einleitung. Die bestechend schönen Fotos sind von Horst und Daniel Zielske. Sie bestehen sowohl für sich allein als auch als illustrative Ergänzung zum Text.
Schönheit und Vielfalt des Landes in seiner dichterischen und musikalischen Ausprägung sind also in diesem Band zu finden. Augenlust und Leselust werden auf das beste bedient. Und Anregungen, sich mit dem dichterischen und musikalischen Erbe zu beschäftigen, finden sich in Hülle und Fülle. Das Buch entführt – und verführt. ■
Volker Gebhardt / Horst & Daniel Zielske: Lies und höre – Orte der Dichtung und Musik, 190 Seiten, zahlreiche Abb., Knesebeck Verlag, ISBN 978-3-86873-268-9
.
.
.
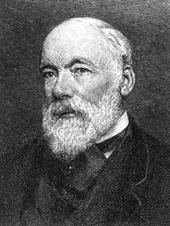






leave a comment