Das Zitat der Woche
.
Von der Wirtschaft und der Kultur
Egon Friedell
.
Den untersten Rang in der Hierarchie der menschlichen Betätigungen nimmt das Wirtschaftsleben ein, worunter alles zu begreifen ist, was der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse dient. Es ist gewissermaßen der Rohstoff der Kultur, nicht mehr; als solcher freilich sehr wichtig. Es gibt allerdings eine allbekannte Theorie, nach der die »materiellen Produktionsverhältnisse« den »gesamten sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß« bestimmen sollen: die Kämpfe der Völker drehen sich nur scheinbar um Fragen des Verfassungsrechts, der Weltanschauung, der Religion, und diese ideologischen sekundären Motive verhüllen wie Mäntel das wirkliche primäre Grundmotiv der wirtschaftlichen Gegensätze.
Aber dieser extreme Materialismus ist selber eine größere Ideologie als die verstiegensten idealistischen Systeme, die jemals ersonnen worden sind. Das Wirtschaftsleben, weit entfernt davon, ein adäquater Ausdruck der jeweiligen Kultur zu sein, gehört, genau genommen, überhaupt noch gar nicht zur Kultur, bildet nur eine ihrer Vorbedingungen und nicht einmal die vitalste. Auf die tiefsten und stärksten Kulturgestaltungen, auf Religion, Kunst, Philosophie, hat es nur einen sehr geringen bestimmenden Einfluß. ■
Aus Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit, Beck Verlag 1931
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Freiheit im Kindergarten
Monika Seifert
.
Die umstandslose Einteilung der Eltern und Erzieher in einen konservativen und progressiven Flügel gilt nur so lange, wie es um die Durchsetzung besserer Bedingungen für die Kindergärten geht. Sobald die praktische Arbeit mit den Kindern beginnt, zeigt sich, daß in jedem von uns Widerstände stecken, den Kindern mehr Freiheit zu lassen.
Die Erfahrungen aus Einrichtungen, in denen die Träger bereits Veränderungen gestattet haben, zeigen allerdings, daß es eine Minderheit von Eltern gibt, die nicht bereit ist, ihre Kinder einen Kindergarten besuchen zu lassen, der ihnen mehr Freiheit läßt. Diese Eltern können unter den augenblicklichen Verhältnissen auch durch noch so gute Elternarbeit ihre Einstellung nicht verändern. Nun werden aber gerade diese Eltern sehr häufig zum Maßstab. Ihre Probleme bestimmen die Diskussion und verhindern damit, daß die konkreten Schwierigkeiten bearbeitet werden können. Solche Eltern sollte man in der gegenwärtigen Situation nicht zu halten versuchen. Ihre Schwierigkeiten treten sonst zu stark in den Vordergrund, gerade weil sie zugleich die mehr oder weniger unbewußten Ablehnungstendenzen in uns repräsentieren, die uns sowieso schwer zu schaffen machen. Uns unterscheidet von diesen Eltern nur, daß wir nicht ganz so total von unseren Bedürfnissen abgeschnitten sind, vielleicht weil wir nicht in gleichem Maße unterdrückt wurden. Die daraus resultierende Fähigkeit, weniger rigid zu Kindern zu sein, kann also von denen, die dazu in der Lage sind, als Glück gewertet werden, und nicht als Leistung. Es wäre jedoch gefährlich zu glauben, unsere Fähigkeit, eine andere Haltung zu Kindern einzunehmen, wäre unerschöpflich. Deshalb kann man die Warnung, sich nicht mit zu großen Schwierigkeiten zu belasten, nicht ernst genug nehmen.Im Umgang mit unsicheren, ambivalenten Eltern muß auf einen langsamen Lernprozeß gesetzt werden. Die Diskrepanz zwischen der Erziehung im Elternhaus und im Kindergarten muß erst einmal ausgehalten und gleichzeitig als Chance begriffen werden. Daß die Kinder an einem Ort, der ganz ihren Bedürfnissen entsprechend organisiert werden kann, mehr Möglichkeiten haben, kann für Eltern ja auch eine Erleichterung bedeuten. Die Erzieher müssen sich in diesem Prozeß sicher sein, daß sie die Interessen der Kinder, und langfristig auch die der Eltern, vertreten. Ein freierer Umgang mit Kindern, von weniger Tabus belastet, ist auch für die Eltern auf Dauer befriedigender. Aber gerade das erfahren sie erst gegen viele innere Widerstände. Fast alle von uns mobilisieren unbewußte Schuldgefühle, wenn wir Kindern gestatten, gegen die Verbote der eigenen Kindheit zu verstoßen. Aufgrund dieses Mechanismus gelingt es den Eltern sehr häufig, Erzieher und Lehrer langfristig doch wieder auf das von ihnen erwartete Erzieherverhalten festzulegen. Schuldgefühle sind mächtiger als intellektuelle Einsichten… ■
Aus Monika Seifert: Antiautoritäre Erziehung, in: Pädagogik und Ethik, Reclam Verlag 1996
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom Staat und seinen Bürgern
Heinrich von Treitschke
.
Der Staat, der die Ahnen mit seinem Rechte schirmte, den die Väter mit ihrem Leibe verteidigten, den die Lebenden berufen sind auszubauen und höher entwickelten Kindern und Kindeskindern zu vererben, der also ein heiliges Band bildet zwischen vielen Geschlechtern, er ist eine selbständige Ordnung, die nach ihren eigenen Gesetzen lebt. Niemals können die Ansichten der Regierenden und der Regierten sich gänzlich decken; sie werden im freien und reifen Staate zwar zu demselben Ziele gelangen, aber auf weit verschiedenen Wegen.
Der Bürger fordert vom Staate das höchstmögliche Maß persönlicher Freiheit, weil er sich selber ausleben, alle seine Kräfte entfalten will. Der Staat gewährt es, nicht weil er dem einzelnen Bürger gefällig sein will, sondern weil er sich selber, das Ganze, im Auge hat: er muß sich stützen auf seine Bürger, in der sittlichen Welt aber stützt nur was frei ist, was auch widerstehen kann. So bildet allerdings die Achtung, welche der Staat der Person und ihrer Freiheit erweist, den sichersten Maßstab seiner Kultur; aber er gewährt diese Achtung zunächst deshalb, weil die politische Freiheit, deren der Staat selber bedarf, unmöglich wird unter Bürgern, die nicht ihre eigensten Angelegenheiten ungehindert selbst besorgen. ▀
Aus Heinrich von Treitschke, Ausgewählte Schriften, Hirzel Verlag 1923
.
.
Walter Janka – Ein ungewöhnlicher Lebenslauf
.
«Tapferer Mensch und Kommunist durch und durch»
Dem ehemaligen Verleger im Ostberliner Aufbau-Verlag
und Freund Walter Janka gewidmet
.
Wolfgang Windhausen
.
Walter Janka – ein tapferer Mensch und Kommunist durch und durch, der sich von Jugend an für seine Überzeugungen und Ideale engagierte und viele Nachteile in Kauf genommen hat. Er war einer der prominentesten reformkommunistischen Intellektuellen, die nach dem XX. Parteitag in Moskau 1956 eine Demokratisierung der DDR verlangten.

Berlin, Juli 1955: Aufbau-Verlags-Leiter Janka (r.) an einer Pressekonferenz mit DDR-Kulturminister Johannes R. Becher (Mitte) und dessen persönlichem Referenten K. Tümmler
Vielen in der DDR wurde der Name Walter Janka erst ein Begriff, als im Ost-Berliner Deutschen Theater der Schauspieler Ulrich Mühe am 28. Oktober 1989 aus den Erinnerungen Walter Jankas «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» gelesen hatte. Über Freunde vom Fernsehen hatte ich noch eine Karte für die schnell ausverkaufte Lesung bekommen. Die total überfüllte Veranstaltung am Abend wurde auch mit Lautsprechern auf den Vorplatz übertragen. Diese Lesung Jankas zählte zu jenen Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben in der vom Verfall ergriffenen Deutschen Demokratischen Republik. Mich bewegte das alles derart, dass ich Kontakt mit Walter Janka aufnahm, der mich dann zu einem Kaffee in sein Haus nach Kleinmachnow bei Berlin einlud. Aus dieser ersten Begegnung, der noch viele folgten, entwickelte sich eine von Achtung und Herzlichkeit geprägte Freundschaft, die bis zu Jankas Tod währte.

Walter Janka (r.) im Gespräch mit dem Autor (Oktober 1990 in Jankas Wohnung – Foto: Charlotte Janka)
In den Gesprächen berichtete der 1914 geborene Walter Janka aus seinem ereignisreichen Leben: Von seiner Lehre und dem Beruf als Schriftsetzer, von seinem Eintritt in die KPD und von seiner Verhaftung nach der Machtergreifung der Nazis 1933 als Mitglied der Kommunistischen Partei. Er wurde zuerst in das Zuchthaus Bautzen und anschließend in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Sein ältester Bruder Albert war KPD–Reichstags-Abgeordneter und wurde 1933 im KZ Reichenbach ermordet.
Walter Janka wurde nach der Haft aus Deutschland ausgewiesen und erlebte drei Jahre lang eine teils schlimme Zeit in den Internationalen Brigaden des Spanischen Bürgerkrieges. Wie er weiter erzählte, war er dort an allen großen Schlachten beteiligt und wurde dreimal schwer verwundet, darunter mit zwei Lungensteckschüssen, die ihm auch später noch zu schaffen machten. Er erzählte von der Internierung in Frankreich und der Flucht 1941 nach Mexiko.
In Marseille lernte er seine spätere Frau Charlotte Scholz kennen, die mit ihm zusammen nach Mexiko ging. Dort traf er mit Genossen zusammen, die Mitbegründer der Bewegung sowie der Zeitschrift «Freies Deutschland» waren. Janka war auch Mitbegründer des Verlages El Libro Libre, dessen Leiter er später wurde. Dieser Verlag war der berühmteste und erfolgreichste Exilverlag auf dem Amerikanischen Kontinent in dem, neben 30 anderen Büchern, auch Anna Seghers bedeutendes «Siebte Kreuz» und Egon Erich Kischs «Entdeckungen in Mexiko» veröffentlicht wurden.
Er kehrte im Januar 1947 mit seiner Lebensgefährtin, die er dann heiratete, zusammen mit Ludwig Renn nach Berlin zurück und wurde Generaldirektor der DEFA. Anfang 1952 übernahm er mit dem Aufbau-Verlag den bedeutendsten belletristischen Verlag der DDR. U. a. schrieb er für Blochs «Wissen und Hoffen» das Vorwort, und unter seiner Ägide erschienen Werkausgaben von Heinrich und Thomas Mann, Arnold Zweig, Leonard Frank, Georg Lukacs und Ernst Bloch.
Walter Janka berichtete mir von Begegnungen mit Halldor Laxness in Berlin, der bei seinen Besuchen dort nie die Vorstellungen des «Berliner Ensembles» versäumte, und der Janka auch zur Nobelpreisverleihung nach Stockholm einlud. Ich erfuhr auch von seinen Beziehungen zu Thomas Mann in Kilchberg; weil Thomas Mann die Honorare für seine in der DDR gedruckten Bücher nicht ausführen konnte, ließ er sich dafür einen Nerzmantel in Ost-Berlin fertigen, den Janka ihm in die Schweiz brachte.( Neben bei bemerkt: Erika Mann leistete sich aus diesem Guthaben, anlässlich eines Berlinbesuches, einen Persianermantel).
Im Laufe der Gespräche streute Walter Janka mitunter auch Anekdoten von Begegnungen mit bedeutenden Persönlichkeiten in Ost und West ein, so u. a. von dem Besuch Thomas Manns in Weimar 1955, von Leonard Frank, Johannes von Guenther und Erich Kästner. Besonders fasziniert war Janka von einem Besuch bei Charlie Chaplin am Genfer See, welchen Thomas Mann vermittelt hatte.

DDR-Justiz-Ministerin und Schauprozess-Vorsitzende im Ulbricht-Staat: Hilde Benjamin, genannt «Die blutige Hilde»
Nach dem Ungarn-Aufstand wird Janka am 6. Dezember 1956 verhaftet. Ihm wird «konterrevolutionäre Verschwörung» gegen die Regierung Ulbricht vorgeworfen. Im anschließenden Schauprozess beschuldigt man ihn, er habe «das Haupt der Konterrevolution Georg Lukacs» von Budapest nach Ost-Berlin schmuggeln wollen. Janka erzählte mir, wie betroffen er gewesen sei, dass niemand seiner Kollegen und Freunde gegen die unwahren Behauptungen im Prozess protestierte; Anna Seghers, Willi Bredel, Bodo Uhse, Helene Weigel und andere, die von Ulbricht «verdonnert» waren am Prozess teilzunehmen, blieben stumm. Janka berichtete ebenfalls von dem Prozess, in dem er sich trotz brutaler Verhöre und übelster Haftbedingungen kein Geständnis abpressen ließ. Das große Interesse der Regierung an diesem Prozess wurde dadurch dokumentiert, dass die gefürchtete Hilde Benjamin, die damalige DDR Justizministerin, häufig persönlich an ihm teilnahm. (Hilde Benjamin wurde im DDR-Volksmund auch die «Rote Guillotine», «Rote Hilde» oder «Blutige Hilde» genannt, weil sie für eine Reihe von Schauprozessen gegen Oppositionelle, Sozialdemokraten und willkürlich angeklagte Personen sowie für zahlreiche Todesurteile mitverantwortlich war). Sehr ausführlich schildert Walter Janka den Schauprozess in seinem Buch «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» (Rowohlt Taschenbuch 1989). Obwohl Jankas Anwälte mutig für Freispruch plädierten, wurde er zu fünf Jahren Zuchthaus mit verschärfter Einzelhaft verurteilt, die er im Staatssicherheitsgefängnis Bautzen verbrachte. In Bautzen erkrankte er so schwer, dass seine Frau ihre eigene lebensgefährliche Erkrankung verschwieg.

Widmungsfoto an den Autor: «Herrn Wolfgang Windhausen in Freundschaft und mit grossem Respekt gewidmet – Walter Janka / Charlotte Janka»
Nach seiner Entlassung war der einst einflussreiche Walter Janka arbeitslos. Demütigende Angebote lehnte er ab, genauso wie attraktive Angebote aus dem Westen. Frühere Autoren verhalfen ihm zu einer Stelle als Dramaturg bei der DEFA, und Marta Feuchtwanger ebenso wie Katia Mann machten Vergaben von Roman-Filmrechten an die DEFA davon abhängig, dass Janka an der Realisierung mitwirkte. Insgesamt zwölf Spielfilme entstanden unter seiner Beteiligung, u.a. «Lotte in Weimar» und «Die Toten bleiben jung».
1972 wurde Janka pensioniert. In seinen letzten Jahren konnte er sich wieder zu Wort melden, auch in Publikationen der DDR zu Themen, die den Spanischen Bürgerkrieg berührten. Zum 1. Mai 1989, kurz vor seinem 75. Geburtstag, wurde ihm der «Vaterländische Verdienstorden» verliehen. Eine Rehabilitierung für das an ihm verübte Unrecht war das nicht; diese wurde erst 1990 vom Obersten Gericht der DDR ausgesprochen.
1990/91 kommt es zwischen Wolfgang Harig und Walter Janka zu einem Prozess wegen Verleumdung. Janka hatte in seinen Erinnerungen Harig wegen dessen Verhalten während seiner Verfolgung durch das Ulbricht-Regime kritisiert. Diese Kritik wurde von Harig zurückgewiesen bzw. zu relativieren versucht; 1993 endet das Gerichtsverfahren mit einem Vergleich.
Zuletzt sah und sprach ich Janka anlässlich einer meiner Lesungen in Berlin, einige Monate vor seinem Tod im März 1994. – Über zwei Jahrzehnte hin wurde Walter Janka vergessen, aber ich hoffe sehr, dass dieser integere, sich selbst und seinen Idealen treu gebliebene Mensch auch von den Nachgeborenen wieder entdeckt und gewürdigt wird. ▀
.
________________________________________________
Geb. 1949, Schriftsteller, Lyriker, Menschenrechtler; zahlreiche Veröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften des In- und Auslandes, über 20-jähriges Engagement bei Amnesty International, Mitglied des Internationalen P.E.N. – Träger des «Niedersachsen-Preises für Bürgerengagement»; Mitarbeiter des Deutschen P.E.N.-Komitees «Writers in Prison»; Lebt in Duderstadt/BRD und Berlin (Foto: H. Hauswald)
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über den Patriotismus
Samuel Smiles
.
Ein großer Teil dessen, was heutzutage im Namen des Patriotismus geschieht, ist im Grunde genommen bloße Heuchelei und Beschränktheit, die sich in nationalen Vorurteilen, nationalem Dünkel und nationalem Haß darstellen. Diese Gesinnung zeigt sich nicht in Taten, sondern in prahlerischen Worten – in Geschrei, Gestikulationen und kläglichen Hilferufen – im Fahnenschwenken und Absingen von Liedern – im beständigen Ableiern längst begrabener Beschwerden und längst gesühnten Unrechts. Von solchem »Patriotismus« befallen zu werden, gehört wohl zu den schwersten Flüchen, die ein Volk treffen können.
Aber wenn es einen unechten Patriotismus gibt, so gibt es auch einen echten – den Patriotismus, der ein Land durch edle Taten stärkt und erhebt – der seine Pflicht aufrichtig und mannhaftig erfüllt – der ein ehrliches, mäßiges und wahrhaftiges Leben führt und sich bemüht, die Gelegenheiten zur Vervollkommnung, die sich ihm von jeder Seite darbieten, nach besten Kräften zu benutzen; und gleichzeitig gibt es Patrioten, die das Andenken und Beispiel großer Männer früherer Zeit in Ehren halten, von Männern, die durch ihr Leiden um die Sache der Religion oder der Freiheit unsterblichen Ruhm für sich und für ihr Volk, jene Privilegien freien Lebens und freier Einrichtungen, deren Erbe und Besitzer es ist, errungen haben.
Nationen dürfen ebensowenig wie Individuen nach ihrer meßbaren Größe beurteilt werden. Denn um groß zu sein, bedarf eine Nation nicht einer großen Ausbreitung, obgleich diese Begriffe häufig miteinander verwechselt werden. Eine Nation kann an Land und Bevölkerungszahl sehr ausgedehnt und dennoch ohne wahre Größe sein. Das Volk Israel war klein, doch welch großes Leben entfaltete es und welch gewaltigen Einfluß übte es auf die Geschicke der Menschheit aus. Griechenland war nicht ausgedehnt. Die ganze Bevölkerung Attikas war geringer als die von Süd-Lancashire. Athen zählte weniger Einwohner als New York und doch wie groß war es in Kunst, Literatur, Philosophie und Patriotismus! Aber es war eine verhängnisvolle Schwäche Athens, daß seine Bürger kein wahres Familienleben hatten, während die Freien von den Sklaven an Zahl weit übertroffen wurden. Seine Staatsmänner waren in ihrer Moral lax, wenn nicht gar verderbt. Seine Frauen, auch die gebildetsten, waren sittenlos. So war Athens Fall unvermeidlich, und er erfolgte rascher als der Aufstieg.
Ebenso ist der Verfall und Untergang Roms der allgemeinen Korruption des Volkes und der immer weiter um sich greifenden Vergnügungssucht und Trägheit zuzuschreiben – wurde doch die Arbeit in der letzten Zeit als nur für Sklaven passend angesehen. Seine Bürger rühmten sich nicht mehr der Charaktertugenden ihrer großen Vorfahren, und das Reich ging unter, weil es nicht verdiente, weiter zu leben. Und so müssen die Nationen, die träge und üppig sind – die wie der alte Burton sagt, »lieber in einer einzigen Schlacht ein Pfund Blut, als bei ehrlicher Arbeit einen Tropfen Schweiß vergießen« – unvermeidlich aussterben, und arbeitsamen, energischen Völkern Platz machen.
Als Ludwig XIV. Colbert fragte, wie es käme, daß er als Herrscher über ein so großes und bevölkertes Land wie Frankreich das kleine Holland nicht hätte erobern können, antwortete der Minister: »Sire, weil die Größe eines Landes nicht auf der Ausdehnung seines Gebietes, sondern auf dem Charakter seines Volkes beruht. Es war der Fleiß, die Mäßigkeit und die Energie der Holländer, die sie für Eure Majestät unüberwindlich gemacht haben.«
Von Spinola und Richardet, den Gesandten des Königs von Spanien zur Abschließung eines Vertrages in Haag 1608, wird erzählt, daß sie eines Tages acht oder zehn Leute aus einem kleinen Boote steigen sahen, welche sich im Grase niederließen, um eine Mahlzeit von Brot, Käse und Bier einzunehmen. »Wer sind jene Ankömmlinge?« fragten die Gesandten einen Bauern. »Das sind unsere edlen Herren, die Gesandten der Generalstaaten«, war die Antwort. Spinola flüsterte sofort seinem Gefährten zu: »Wir müssen Frieden schließen, solche Menschen lassen sich nicht besiegen.«
Die Stabilität der Einrichtungen muß auf der Stabilität des Charakters beruhen. Eine Anzahl entarteter Gemeinwesen kann keinen großen Staat bilden. Das Volk kann hochzivilisiert scheinen und doch bei dem ersten Angriff zerfallen. Ohne Untadeligkeit des individuellen Charakters gibt es für einen Staat keine wahre Stärke, keinen inneren Zusammenhang, kein gesundes Leben. Ein Volk kann reich, politisch, künstlerisch bedeutend sein und doch schon am Rande des Verderbens stehen. Ein Volk, in dem jeder nur für sich und sein Vergnügen lebt – wo jedes kleine Ich für einen Gott sich hält – ist schon gerichtet, und sein Untergang ist unabwendbar.
Wo der nationale Charakter nicht mehr aufrecht erhalten wird, da ist die Nation verloren. Wo die Tugenden der Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Unbescholtenheit und Gerechtigkeit nicht mehr geschätzt und geübt werden, da verdient niemand mehr, zu leben. Und wenn ein Land durch Reichtum so verdorben, oder durch Vergnügen so entartet, oder durch Parteiung so verblendet ist, daß Ehre, Ordnung, Gehorsam, Tugend und Treue nur noch der Vergangenheit angehören, wenn dann ja noch vorhandene ehrenhafte Männer im Dunkeln umhertasten, um ihres Gleichen Hände zu fassen, so bleibt als einzige Hoffnung nur noch die Wiederherstellung und Hebung des individuellen Charakters; und wenn der Charakter unwiederbringlich verloren ist, dann ist in der Tat nichts mehr übrig, was erhalten zu werden verdient. ▀Aus Samuel Smiles, Der Charakter, Traktat 1895
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Weiblichkeit
Rosa Mayreder
.
Versucht man, einen konkreten Gehalt für das zu finden, was man unter Weiblichkeit verstehen will, so gibt es dafür dreierlei Möglichkeiten. Man kann das Häufige, das Durchschnittliche, das Gewöhnliche als Norm aufstellen; oder man kann ein Idealbild konstruieren, indem man physische Vorgänge als Gleichnis und Analogon für psychische benutzt, und Aktivität und Passivität, Produktivität und Rezeptivität in gegensätzlichen Typen einander gegenüberstellt; oder man kann aus der physiologischen Beschaffenheit zurückschließen auf psychische Eigenschaften, die notwendigerweise damit verknüpft sein müssen.
Durch jede dieser drei Methoden wird ein fiktiver Typus geschaffen, vermittelst dessen man die Geschlechter in eine Majoriät sogenannter normaler und in eine Minorität sogenannter abnormer Individuen teilt. Aber schon aus den angeführten widersprechenden Aussagen läßt sich, soweit es sich um die Weiblichkeit handelt, ersehen, daß die Resultate der drei Methoden keineswegs übereinstimmen, so daß Erscheinungen, die nach der einen unter die »abnormen«, also mit der wahren Weiblichkeit unvereinbaren gezählt werden, nach der andern noch in das Gebiet der Normalität fallen und umgekehrt.
Ganz unzulänglich erscheint die Durchschnittsmethode. Abgesehen von den philiströsen Beschränkungen und den subjektiven Vorurteilen, denen sie den Maßstab liefert: es handelt sich bei dem Problem der Geschlechtspsychologie nicht so sehr darum, die bekanntesten und landläufigsten Merkmale aufzuzeigen, aus denen sich generelle Bestimmungen herleiten lassen, sondern vielmehr, ein Naturprinzip bloßzulegen, das widerspruchslos als ein Gemeinsames in dem Wesen aller Weiber – sofern sie körperlich intakte Geschlechtswesen darstellen – zu allen Zeiten und bei allen Völkern nachzuweisen wäre, ein Prinzip, das dort am deutlichsten erkennbar sein müßte, wo die Willkür des menschlichen Bewußtseins noch nicht die Unmittelbarkeit der natürlichen Vorgänge gestört hat – an den weiblichen Geschöpfen des Tierreiches.
Noch weniger kann uns bei der Beurteilung des einzelnen Individuums mit dem Maßstabe gedient sein, den das Idealbild liefert. Vor allem muß man zweierlei auseinander halten: die Frage nach dem, was »das Weib« sein soll, und die Frage nach dem, was »das Weib« vermöge seiner Naturanlage ist. Das Idealbild könnte höchstens den Kanon abgeben, nach welchem der Geschlechtswert des Einzelnen unter sozialen oder ethischen Gesichtspunkten zu bemessen wäre; dabei bliebe die Frage dennoch offen, wie weit die Differenzierung nach den Endpolen der Geschlechtlichkeit ein wünschenswertes Ziel sei. Für eine voraussetzungslose, von willkürlichen Annahmen möglichst freie Untersuchung über das, was das Weib wirklich ist, wird nur die dritte Methode in Betracht kommen.
Während man Männlichkeit und Weiblichkeit in ihrer gegenwärtigen Gestalt aus ursprünglichen und primitiven organischen Bedingungen zu erklären strebt, übersieht man, daß sie in vielen wesentlichen Stücken bloße Kulturprodukte sind, also nichts Feststehendes und Abgeschlossenes, noch auch etwas allgemein Zutreffendes. Bei den meisten wilden Völkern ist das Bild der Arbeitsteilung zwischen Mann und Weib ein durchaus anderes als bei den Kulturvölkern. Fast überall sind die Frauen die ersten Lastträger, die ersten Ackerbauer, die ersten Baumeister, die ersten Töpfer, wie überhaupt die industrielle Seite des primitiven Lebens samt einem großen Teile der dazu gehörigen ersten Erfindungen ein Werk des weiblichen Geschlechtes ist. (Siehe Ellis, Mann und Weib.) Vermutlich würde auch die physiologische Beobachtung dieser primitiven Frauen vielfach zu anderen Ergebnissen führen als diejenige der Kulturfrauen.
Will man sich aber auf die psychosexuellen Erscheinungen innerhalb des europäischen Kulturkreises beschränken, so wird man vor allem eine Tatsache berücksichtigen müssen, deren Bedeutung nach vielen Richtungen sehr hoch anzuschlagen ist – die höhere Stufe der individuellen Differenzierung.
Es ist eine Eigentümlichkeit, die zur Auszeichnung des Menschen gehört, daß die Geschlechtsanpassung bei ihm nicht wie bei den Tieren eine generelle ist, sondern individuell sehr verschieden. Ein Löwe, ein Pferd, ein Hase sind im Grade ihrer Männlichkeit und Weiblichkeit durch ihre Gattung und nicht als Individuen bestimmt. An sich betrachtet ist eine Löwin ein viel männlicheres Tier als etwa ein Rehbock – da man ja, ganz allgemein genommen, aggressive Impulse als Begleiterscheinung der männlichen Differenzierung anspricht –. Aber schon bei den höchststehenden Säugetieren lassen sich die Spuren einer beginnenden individuellen Differenzierung bemerken; und innerhalb der menschlichen Gattung sind es nur die ganz primitiven Völker, bei denen die Geschlechter sich in ziemlich homogene Gruppen scheiden.
Mit steigender Kultur, unter günstigen Lebensbedingungen und in freieren sozialen Zuständen beginnt der Einzelne sich nach Eigenart zu entfalten – vielleicht, weil der Zwang der Sozietät in gesicherten Verhältnissen nachläßt, und der Druck, den sie auf ihre Mitglieder ausübt, nicht mehr eine Notwendigkeit der Selbsterhaltung bedeutet, also nicht mehr als »heilig« betrachtet wird; vielleicht, weil die Anpassung an die Bedingungen der sexuellen Auswahl, die den primitiven Mann zum Raub oder Kauf des Weibes nötigen und das Weib zum willenlosen Gegenstand des Raubes oder Kaufes machen, sich mit den Bedingungen selbst ändert. Der Reichtum und die Entwicklungsfreiheit äußerer Lebensformen geht parallel mit dem Reichtum und der Entwicklung der inneren. Die Natur selbst, nach der evolutionistischen Auffassung ein ewiges Fortschreiten von primitiven und einfachen Formen zu immer komplizierteren und vollendeteren, von der Einheitlichkeit zur Mannigfaltigkeit, äußert sich innerhalb der menschlichen Gattung als ein Fortschreiten vom Typischen zum Individuellen.
Eigenschaften, von denen jede für sich betrachtet sowohl dem einen wie dem anderen Geschlechte angehören kann, machen als Komplex in ihrer besonderen Kombination die Eigenart der Persönlichkeit aus. Die außerordentliche Mannigfaltigkeit dieser Kombinationen allein ist ein Einwand gegen das Bestreben, die Persönlichkeit als eine bloße Spiegelung der Sexualität zu deuten, Mann und Weib nach ihrem geistigen Charakter einfach als Paraphrasen ihres Geschlechtsapparates aufzufassen. Sollte es wirklich möglich sein, die Bewußtseinsleistung eines so komplizierten Organismus, wie des menschlichen, aus so einfachen Ursachen, wie der Beschaffenheit der Keimzellen oder die Vorgänge der Ernährung und des Stoffwechsels zu erklären? ■Aus Rosa Mayreder, Zur Kritik der Weiblichkeit, Verlag Frauenoffensive 1981
.
Zitat der Woche
.
Von der christlich-sittlichen «Erziehung»
Franziska Gräfin zu Reventlow
.
Von uns «modernen» Menschen, die der jüngeren Generation angehören, haben viele – ich darf wohl ruhig sagen, die meisten – einen schweren Kampf kämpfen müssen, ehe sie sich von dem angestammten Milieu, von dem Einfluß einer sogenannten guten Erziehung und all ihren vorsündflutlichen Moralprinzipien und Anschauungen freimachten, um sich auf den Boden einer freieren und froheren Lebensauffassung zu stellen.
Es ist deshalb auch wohl mehr wie selbstverständlich, daß wir danach trachten, diese Errungenschaften des Kampfes unseren eigenen Kindern zukommen zu lassen.Wir werden uns dabei unbedingt in einen schroffen Gegensatz zu der Erziehungsmethode stellen müssen, die in allen guten Familien üblich ist und deren Hauptcharakteristikum das Verschleiern und Vertuschen aller das Geschlechtsleben betreffenden Fragen ist.
Eben dieses Vertuschungssystem soll durch die Lex Heinze nun auch der Allgemeinheit im öffentlichen Leben – soweit es sich innerhalb des Gebietes von Kunst und Literatur bewegt – aufoktroyiert werden. Eines seiner Hauptmomente ist die Verpönung des Nackten in der Kunst.
Wir aber sehen im Nackten überhaupt – sowohl im Leben wie in der Kunst – nicht nur keine «Sünde», sondern ein positives erzieherisches Moment von hoher Bedeutung. Denn wir wollen die heranwachsenden jungen Seelen nicht in dem lüsternen Schauder vor der Nacktheit erziehen, sondern zur gesunden Freude an allem Schönen, mag es nun Kunst oder Natur, nackt oder angezogen sein – zum gesunden Abscheu vor allem, was wirklich unschön ist. Sie sollen jenes künstlich angezüchtete «Schamgefühl» gar nicht kennenlernen, das in jedem Wesen des anderen Geschlechts einen Gegenstand der verbotenen Neugier sieht und eben dadurch auch am eigenen Körper ein unheimlich lockendes Rätsel wittert.
Und wie leicht wäre das zu erreichen, indem man das Kind nicht mehr ängstlich vor dem Anblick der persönlichen oder bildlichen «Nudität» schützt und seine natürliche, naive Neugier durch eine seinem Verständnis angemessene Antwort zufriedenstellt, anstatt sie durch das obligate «Das verstehst du noch nicht» – oder «Davon spricht man nicht» – noch mehr zu reizen. Wir wollen ihm grade seine Unbefangenheit bewahren, indem wir das Sexuelle so viel wie möglich aus den das Leben des Kindes bedingenden Elementen ausschalten. Dieser Zweck kann nur dadurch erreicht werden, daß das Geschlechtsbewußtsein, so lange es irgend angeht, zurückgedrängt wird. Und das Mittel, ihn zu erreichen, ist nicht etwa jenes Versuchungssystem, das das Kind in ewigem Zweifel läßt und eben dadurch seine Neugier reizt – sondern eine gemeinsame Erziehung beider Geschlechter ohne alle überflüssige Geheimnistuerei und verbunden mit der Ausbildung eines rein-ästhetischen Wohlgefallens an der Nacktheit.
Wir wollen deshalb in der Erziehung darauf hinwirken durch häufige Betrachtung des Nackten – sei es im Leben oder in künstlerischen Darstellungen, sei es am eigenen oder am Körper eines anderen –, darauf hinwirken, daß die Wertung des Schönen immer stärker in den Vordergrund tritt. Und eine solche Anschauungsweise wird das «Schnüffeln» nach den Sexualcharakteren ganz von selbst aufheben. Es wird uns auf diese Weise unendlich viel leichterfallen, das Kind vor jeder verfrühten Schädigung seines Geschlechtslebens zu bewahren, es zu lehren, daß der Maßstab seiner Handlungen nicht sein «moralisches», sondern ausschließlich sein ästhetisches Gefühl sein soll. Das ist meiner Ansicht nach das beste Schamgefühl, was wir in unsren Kindern entwickeln können.
Tritt dann später bei dem geschlechtsreifen jungen Menschen durch Betrachtung des Nackten eine sinnliche Reaktion ein, so brauchen wir dieselbe nicht zu fürchten. Wir wollen die Auslösung des Geschlechtstriebes nur so weit als möglich herausschieben – bis sie mit dem Eintritt der völligen physiologischen Reife zur gebieterischen inneren Notwendigkeit wird. Mir speziell als Mutter würde es weit sympathischer sein, wenn mein Sohn mit achtzehn Jahren ein ihm gleichstehendes junges Mädchen verführt, als wenn er sich seine Unschuld bis in die Zwanziger hineinbewahrt, um sie dann schließlich im Bordell zu verlieren.
Wenn dann Knabe und Mädchen sich beim Erwachen als Mann und Weib wiederfinden, so wird diese bestätigte Erkenntnis des eigenen wie des anderen Geschlechts ihnen zu einer Offenbarung werden, aus der sie als neue Menschen hervorgehen. Und dann werden sie auch den Verlust der «Unschuld» nicht etwa als Niederlage, sondern als Triumph, als frohen Sieg empfinden.
Zur Niederlage hat ihn überhaupt erst das Christentum gemacht, das bei seinen altruistischen Tendenzen jede Forderung, die aus rein persönlichem Empfinden hervorgeht, mit der unliebenswürdigen Bezeichnung «Sünde» belegt.
Aber das lebendige Recht, das jede normale und erst recht jede starke Persönlichkeit in sich trägt, läßt sich durch tote Abstraktionen und dogmatische Formeln nicht aus der Welt schaffen. Um so weniger, da all diese moralischen Forderungen von einer einzigen, dazu noch mythisch-sündlosen Persönlichkeit – Christus – abgeleitet sind.
Das Christentum hat den Menschen in einen unlöslichen Konflikt zwischen seine eigene Natur und die ihm aufgezwungene Moral gestellt. ■Aus Franziska Gräfin zu Reventlow, Erziehung und Sittlichkeit, Verlag der Nation, Berlin 1991
.
.
.
Göttinger Vorträge zur «Zukunft des Buches und der Note»
.
«Belletristik ist nicht gefährdet»
Adrienne Lochte
.
Die technische Entwicklung hat vor dem Buch nicht haltgemacht, E-Books sind auf dem Vormarsch. In den USA erzielen Publikumsverlage bereits fünf bis zehn Prozent ihres Umsatzes mit digitalen Büchern – ein Trend, der sich allerdings so noch nicht in in den deutschsprachigen Ländern durchgesetzt hat.
Der Verleger Klaus Gerhard Saur fasste die hierzulande vorerst zurückhaltende Entwicklung auf einem gemeinsamen Vortragsabend der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen zum Thema «Die Zukunft des Buches – Die Zukunft der ,Note’» in Zahlen: Der Anteil von E-Books liege heute bei 1,2 Prozent, vor fünf Jahren sei es ein Prozent gewesen.
Dennoch wagt Saur, der bis zu seinem Ruhestand 2008 den international tätigen K.G. Saur Verlag geleitet hat, die Prognose, dass sich Nachschlagewerke wie Telefonbücher, Wörterbücher und Lexika in gedruckter Form auch weiterhin massiv reduzieren würden.
Die Belletristik, Kinderbücher, Lehrbücher und Kunstbände hält Saur hingegen für «nicht gefährdet». Texte auf dem Bildschirm flimmerten vorbei, «es bleibt nichts haften, das ist nichts für Lesetexte», meint Saur. Zudem baut er auf das «haptische Vergnügen», ein Buch in der Badewanne, am Bett oder auch am Strand genießen zu können. Zahlen stützen auch diese Annahme: Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 92’000 Neuerscheinungen gedruckter Bücher, und die Zuwachsrate bei gedruckten Büchern in Entwicklungs- und Schwellenländern liegt bei über zehn Prozent.
Anders sieht die Entwicklung bei Notentexten aus. Andreas Waczkat, Professor am Musikwissenschaftlichen Seminar der Georg-August-Universität Göttingen, sprach zunächst von den Grenzen einer Verschriftlichung von Musik. Improvisation etwa könne gar nicht verschriftlicht werden, und auch in vielen nicht-westlichen Kulturen wird Musik nicht durch Notentexte repräsentiert. Das haptische Vergnügen spiele bei der Note auch keine besondere Rolle.
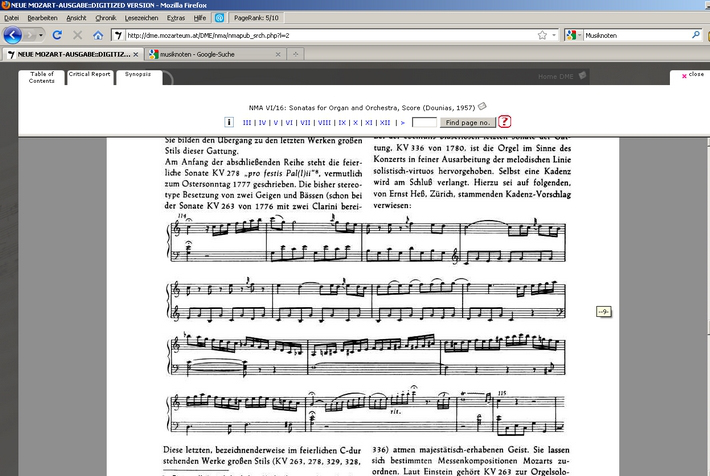
Vorteile der Online-Musiknotation und -Recherche: Screenshot der Neuen Mozart-Ausgabe (mit Kritischem Begleittext)
Die elektronischen Möglichkeiten in der Musik hingegen hätten einige Vorteile. Waczkat nennt als Beispiel u.a. die Homepage der Neuen Mozart-Ausgabe, auf der man neben den Noten gleichzeitig auch den kritischen Bericht sehen kann. Auch Notentexte, die anstatt auf einem Notenständer digital auf einem Bildschirm vor den Musikern erschienen, böten so manchen Vorzug: Einige Noten-Dateien ließen sich vergrößern, manche gar mit einem Knopfdruck in andere Tonarten transponieren. Und in der Luxusausgabe könnten die Seiten mit Hilfe eines Pedals virtuell umgeblättert werden… ■
.
___________________________
 Adrienne Lochte ist Journalistin/Redakteurin und Pressereferentin der «Akademie der Wissenschaften zu Göttingen»
Adrienne Lochte ist Journalistin/Redakteurin und Pressereferentin der «Akademie der Wissenschaften zu Göttingen»
.
.
.
.
Ameneh Bahrami: «Auge um Auge»
.
Tragisches Schicksal als literarische Chimäre
Dr. Karin Afshar
.
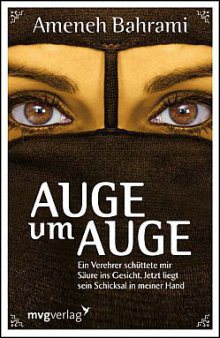 Der MVG-Verlag, in dem das Buch «Auge um Auge» von Ameneh Bahrami erschienen ist, hat eine Philosophie: Man will Mut machen und kompetente Hilfe in allen Lebenslagen bieten. Die Bücher, die im Verlag erscheinen, sollen für ein unbeschwertes, glückliches und bewusstes Leben stehen. Der MVG-Verlag versteht sich als zukunftsorientierter Ratgeberverlag mit den thematischen Schwerpunkten Persönlichkeitsbildung und Motivation. Sein Programm umfasst rund 700 lieferbare Titel. Im Bereich Lifestyle erscheinen Hardcover und Taschenbücher zu verschiedenen Themen. Und so kündigt er das Buch, um das es hier geht, an: «Das Buch gibt allen Frauen Kraft, für ihr Leben und ihre Freiheit einzustehen. Es ist die Geschichte einer unglaublich starken Frau.»
Der MVG-Verlag, in dem das Buch «Auge um Auge» von Ameneh Bahrami erschienen ist, hat eine Philosophie: Man will Mut machen und kompetente Hilfe in allen Lebenslagen bieten. Die Bücher, die im Verlag erscheinen, sollen für ein unbeschwertes, glückliches und bewusstes Leben stehen. Der MVG-Verlag versteht sich als zukunftsorientierter Ratgeberverlag mit den thematischen Schwerpunkten Persönlichkeitsbildung und Motivation. Sein Programm umfasst rund 700 lieferbare Titel. Im Bereich Lifestyle erscheinen Hardcover und Taschenbücher zu verschiedenen Themen. Und so kündigt er das Buch, um das es hier geht, an: «Das Buch gibt allen Frauen Kraft, für ihr Leben und ihre Freiheit einzustehen. Es ist die Geschichte einer unglaublich starken Frau.»
«Auge um Auge» hat 256 Seiten und ist ein Hardcover-Band. Bevor ich auf den Inhalt eingehe, erlauben Sie mir einen Blick auf den Einband. Vorne direkt unter dem Titel steht: «Ein Verehrer schüttete mir Säure ins Gesicht. Jetzt liegt sein Schicksal in meiner Hand.» Zwei Augen in einem ansonsten mit einem Schleier verborgenen Gesicht springen dem Leser – bzw. der Leserin, denn Frauen sind die Zielgruppe – entgegen. Derlei Bucheinbände gibt es mittlerweile vielfach – ja, ist denn dem Verlag nichts Eigenes eingefallen?
Aber sehen wir uns den Titel näher an: «Auge um Auge». Wer kennt das Zitat nicht? Soweit so gut: der Verlag setzt auf zwei bekannte und in vielen Menschen umhergeisternde Vorstellungen, um sein Buch zu vermarkten und neu im Unterbewusstsein zu verankern. Die Leute sollen kaufen! Das ist legitim, denn damit verdient ein Verlag sein Geld. Und er hat Recht: vermutlich geht für eine kurze Zeit – denn länger reicht das Gedächtnis und die Geduld der Leser nicht mehr – genau mit dieser Kombination die Rechnung auf. Daran verdient hoffentlich auch die Autorin.
Auge für Auge (hebräisch עין תּחת עין ajin tachat ajin) ist Teil eines Rechtssatzes aus dem Sefer ha-Berit (hebr. Bundesbuch) in der Tora für das Volk Israel (Ex 21,23–25 EU). In der heutigen Umgangssprache wird Auge für Auge überwiegend unreflektiert als Ausdruck für gnadenlose Vergeltung verwendet. Übersetzt als Auge um Auge (und zusammen mit Zahn um Zahn) wird das Teilzitat zur Anweisung an das Opfer oder seine Vertreter, dem Täter Gleiches mit Gleichem «heimzuzahlen» bzw. sein Vergehen zu sühnen. Dass es ursprünglich auch im Alten Testament (2. Moses 21, 24) darum ging, Rache abzuwehren und Gewalt zu begrenzen, ist nur wenigen präsent.
Im Iran, dem Heimatland der Erzählerin, ist aufgrund der rund 1300 Jahre alten Scharia-Gesetze, die bei vorsätzlicher Tötung und vorsätzlicher Körperverletzung das Vergeltungsprinzip («Qisas») darstellen, sogar vorgesehen, dass der Täter das erleiden soll, was er seinem Opfer angetan hat.
Der Erzählerin wird nach einer Gerichtsverhandlung eben dieser Urteilsspruch zuteil, dergleichen vornehmen zu dürfen. Zwar darf sie für zwei ihrer Augen zunächst nur ein Auge des Täters blenden, aber sie kann ja das zweite hinzukaufen. Eine Frau ist eben nur halb so viel wert wie ein Mann. Sie bekommt schließlich doch seine beiden Augen…

Ein Bild, das um die Welt ging: Ameneh Bahrami nach dem Säure-Anschlag, in der Hand ihre Bilder als Gesunde
Ameneh ist eine junge Frau, die an der Freien Universität in Teheran Elektrotechnik studiert. Vom Tschador hält sie nicht viel: sie trägt lieber einen knielangen weißen Mantel und ein Kopftuch. Damit macht sie sich natürlich nicht nur Freunde, und setzt sich den Männerblicken und auch so mancher Anmache aus. Im Jahre 2003 ist eine Frau im Iran alles andere als hamsar und auf Augenhöhe eines Mannes, und scheint am besten in einer (wie auch immer arrangierten) Ehe aufgehoben. Die Nach-Khomeini-Zeit – aber nicht nur diese – hat seltsame männliche Exemplare und verquer-menschenverachtende Ansichten hervorgebracht. Nun ist es nicht ungewöhnlich und überraschend, dass in einer reglementierten Gesellschaft das Dunkle ungleich böser zum Ausbruch drängt.
Nicht alle sind «infiziert», aber eben viel zu viele. Ameneh kann sich damit nicht abfinden und glaubt an die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens. Sie hat für ihr Studium gekämpft und sich mehrfach beworben, dann hat sie Jobs angenommen, um sich dieses Studium zu finanzieren – etwas, das Frauen im Westen ebenfalls kennen, denn auch uns wird nichts geschenkt. Sie hat einen jungen Mann, in den sie wirklich verliebt war, nicht geheiratet, weil er sich als eifersüchtig und kontrollierend entpuppte und sie am liebsten gleich in die Küche verbannt hätte. Sie hat sich für ein Leben allein entschieden – für solange, bis der «Richtige» käme. Da beginnt ein um drei Jahre jüngerer Mann, sie zu bedrängen – und das Ganze endet in der inzwischen weltweit bekannten Katastrophe: als sie ihn abweist, schüttet er ihr Säure ins Gesicht, sie erblindet.

Was Ameneh durchgemacht hat, ist erschütternd, da gibt es keine Diskussion. Doch dann sind da die gewollten Belehrungen und die ideologischen Knöpfe, die gedrückt werden. Die Emotionalität der Schilderungen ist vielfach kaum zu ertragen. Der Leser wird missbraucht und in eine Meinung gezwungen, anderes als hier geschrieben darf man nicht fühlen. Eine solch künstliche, amateurhafte Erzeugung von Spannung hätte die Geschichte nicht nötig gehabt…
Was Ameneh Bahrami durchgemacht hat, ist erschütternd, da gibt es keine Diskussion. Was nur können Menschen Menschen antun! Und wieso lässt Gott das zu, warum lässt er zu, dass ein heranwachsendes Leben zerstört wird und ein Mensch tiefer und tiefer fällt, bis auf den Grund seiner Menschenwürde? Soll er daran zugrundegehen oder soll er wachsen? Ist das die Lektion des Lebens?
Ameneh bemerkt in ihrer Hilflosigkeit bald, wer Freund und wer Feind ist, sie lernt zu unterscheiden, wer sie versteht, und wer schadenfroh ist. Sie ist bewusst und sich ihrer eigenen Empfindungen gewahr. Der Gedanke an Rache kommt dann auf, wenn man seelisch überfordert ist und von der anderen Seite, die man selbst noch vor sich in Schutz zu nehmen beginnt, keinerlei Reue kommt.
Das hätte ein gutes, ein großartiges Buch über grundsätzliche Fragen werden können. Nicht jedoch jetzt, zu diesem Zeitpunkt, sondern erst viel später. Amenehs Geschichte ist noch nicht zuende – die Medien haben sie ihr aber vorschnell aus der Hand gerissen. Dieses Buch ist eine Chimäre. Ein Verlag publiziert es mit der Herausstellung des Leidensweges einer Frau und liefert eine nur halbwegs durchgearbeitete Geschichte.
Es gibt durchaus Passagen, in denen Ameneh Bahrami anschaulich und erfrischend vom Alltagsleben in Hamadan oder Teheran erzählt. Ich bekomme ein Bild von diesem Mädchen, das sich seinen Platz in der Welt erobern möchte. Es ist ein menschliches Bild, das sich in jedem Land der Welt einstellen könnte. Überall suchen junge Menschen nach Selbstbestimmung und Eigenständigkeit, Anerkennung und Liebe ohne Bedingungen.
Doch dann sind da die gewollten Belehrungen und die ideologischen Knöpfe, die gedrückt werden. Natürlich geht es um Literatur – und das ist hier trotz guter Ansätze eben Betroffenheitsliteratur. Das zeigt sich im Erzählmodus ganz bestimmter Zeitungen, die ein bestimmtes Klientel bedienen. Die Emotionalität der Schilderungen ist vielfach kaum zu ertragen. Der Leser wird missbraucht und in eine Meinung gezwungen, anderes als hier geschrieben darf man nicht fühlen. An der Verwendung des Wortes «plötzlich» übrigens erkennt man die Anfänger, und dieses Wörtchen taucht mir zu häufig auf. Eine solch künstliche, amateurhafte Erzeugung von Spannung hat die Geschichte nicht nötig.
Ameneh Bahrami wünsche ich, dass sie die nahende Zeit, in der das Interesse der Medien nachlassen wird, für sich nutzen kann, um ihren Frieden zu finden. Ihren Großvater habe ich übrigens ins Herz geschlossen. Ob sie auf ihn hört? –
«Was dir die Zukunft bringt, das frage nicht / Und die vergangne Zeit beklage nicht. / Allein das Bargeld Gegenwart hat Wert, / Nach dem, was war und sein wird, frage nicht.» (Omar Khayyam) ■
Ameneh Bahrami: Auge um Auge, MVG-Verlag, 256 Seiten, ISBN 978-3-86882-155-0
.
Leseproben
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Wo die Musik heute «spielt»
Irmgard Jungmann
.
Neue »ernste« Musik wird nur von einem kleinen Bevölkerungskreis aufgenommen und lässt sich kaum verkaufen. Sie fristet ein vergleichsweise kümmerliches Dasein im großen Weltmarkt der Musik, der Markt für traditionelle klassische Musik scheint mit der »Aufwärmung« des immer Gleichen mehr oder minder gesättigt zu sein.
Die Musikkonzerne sind aber, da sie es mit künstlerischen Produkten zu tun haben, von den Medienexperten, den Künstlern, den Ausführenden ebenso wie den komponierend »Mischenden«, ihrem Erfindungsgeist, ihrer »Innovationskraft« abhängig.
Die großen Marktchancen liegen inzwischen längst im Bereich der Popularmusik, die ihre Fähigkeit zu musikalischer Entwicklung, zur Innovation, zum Experimentieren mitAlthergebrachtem ebenso wie mit Neuem unter Beweis gestellt hat, die ohne die Behinderung durch ästhetische Bedenken Bach, die Gregorianik, Minimal Music, indische Kunstmusik oder jede Art von Folklore verarbeiten kann und inzwischen längst neue Stile und Moden wie Rock, Rap, Techno, Hiphop geschaffen. In diesem Bereich »spielt die Musik«. ■Aus Irmgard Jungmann, Sozialgeschichte der klassischen Musik – Bildungsbürgerliche Musikanschauung im 19. und 20. Jahrhundert, J.B. Metzler Verlag 2008
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Wissenschaft in der Gesellschaft
Leo Kreutzer
.
Im Herbst 1977 – einem »deutschen Herbst«, wie man alsbald zu sagen begann —, im besonders vernebelten November jenes Jahres also fand im Bonner Konrad-Adenauer-Haus eine Tagung statt, die den »geistigen und gesellschaftlichen Ursachen« des Terrorismus nachgehen sollte. Als erster der Wissenschaftler, die man hatte kommen lassen, referierte der Zürcher Sozialpsychologe und Soziologe Gerhard Schmidtchen. In einer alert systemtheoretischen Skizze unserer Gesellschaft interpretierte er den Terrorismus als ein kraß dysfunktionales Phänomen, als »destruktives Verständigungsmuster« in einer »Grammatik des sozialen Handelns«.
Fixiert auf die Vorstellung andauernder Perfektibilität und maximaler Effektivität eines alle Bereiche sozialer Interaktion regulierenden handlungsgrammatischen Systems, prüfte er durch, welche gesellschaftlichen »Subsysteme« dieser Vorstellung gegenwärtig bereits nahekommen, welche andern bedauerlicherweise immer noch zu den »Defizitbereichen« gehören. Und da vermochte Schmidtchen lediglich einem dieser Subsysteme die Bestnote zu erteilen, dem »Wissenschaftssystem«. »Das Wissenschaftssystem kontrolliert über Schule, über die Betriebsorganisation und den hohen augenfälligen Gebrauchswert einer technischen Industrieproduktion, die Denkstile, das Weltbild und großenteils die Motive der Massen. Die Sozialisation wissenschaftlichen Denkstils ist so wirkungsvoll, daß Wahrheiten, die sich nicht in diesen übersetzen lassen, nicht mehr als Wahrheiten akzeptiert werden können… Das Sozialisationssystem für die Durchsetzung eines wissenschaftlichen Denkstils hat eine imponierende Perfektion.«Es besteht Anlaß zu der Befürchtung, daß Herr Schmidtchen recht hat. Daß also der wissenschaftliche Denkstil gegenwärtig in einer Weise alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens kontrolliert, wie das so umfassend und wirksam keiner anderen Instanz oder Institution auch nur annähernd gelingt, vergleichbar allenfalls der Kontrollfunktion, welche im Mittelalter die Religion innehatte: Was sich da nicht in den religiösen Denkstil übersetzen ließ, konnte nicht als Wahrheit akzeptiert werden.
Dieser Vergleich kommt nicht von ungefähr. Er vermag den Funktionswandel zu verdeutlichen, den die Wissenschaft durchgemacht hat, um zu ihrer heutigen Geltung zu gelangen. Angetreten, am Beginn der Neuzeit und ihn markierend, die Kontrolle durch den religiösen Denkstil zu durchbrechen, also das Denken aus dieser es blockierenden Aufsicht zu befreien, ist die Wissenschaft ihrerseits zu einer alles beherrschenden Kontrollinstanz geworden und wirkt heute, wie Herbert Marcuse in »Triebstruktur und Gesellschaft« ausgeführt hat, »zerstörerisch gegenüber jener Freiheit, die sie einst versprach«.Aus Leo Kreutzer, Mein Gott Goethe, Reinbek/Rowohlt 1980
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die ewige Flut des Neuen
Nick Currie
.
Wir leben in einem Zeitalter des Überangebots. Es gibt von allem zuviel. Das ist ebenso beängstigend wie erfreulich. Beängstigend, weil das meiste im Handumdrehen wieder verschwindet. Erfreulich, weil an seine Stelle sofort etwas Neues tritt.
Früher, als der Kapitalismus sich auf die bloße Produktion beschränkte, konnte man ihn durchaus als ein «materialistisches» System bezeichnen; wir waren angehalten, die Gegenstände zu bewundern, die der Markt zu bieten hatte. Heute jedoch, in Zeiten der Überproduktion, scheint der Kapitalismus mehr und mehr zu einem metaphysischen System geworden zu sein. Gegenstände sind nicht genug. Bewundern sollen wir nun Wachstum, Überfluß und die grenzenlosen Verheißungen, die uns die grenzenlose Überproduktion verspricht. Es geht nicht mehr um konkrete Produkte, sondern um Abstrakta.
Und so haben wir gelernt, die ewige Flut des Neuen zu genießen. Wir werden derart mit Produkten überschwemmt, dass wir die Welt quasi nur noch durch einen Schleier wahrnehmen. Wir machen uns die Denkart von Nomaden und Buddhisten zu eigen, lernen, die ständige Veränderung und Vergänglichkeit um uns herum zu schätzen, so wie auch die eigentümliche Distanz zu Produkten und deren Akkumulation. ■Aus Nick Currie, Schluss mit den Meisterwerken, in: Sky Nonhoff, Don’t believe the Hype!, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2005
.
.
Das Zitat der Woche
.
Von der Massenliteratur
Franz Stadler
.
Ein Bucherfolg sei «das Zeichen eines geglückten soziologischen Experiments, der Beweis dafür, daß wieder einmal eine Mischung von Elementen gelungen ist, die dem Geschmack der anonymen Lesermassen entspricht»: so 1931 Siegfried Kracauer (1889 – 1966).
Der Leihbücherei-Roman, der Illustrierten-Roman, der Heftroman, das Serien-Taschenbuch: sie sind kalkulierte steadyseller, zu störungsfreiem Absatz – als Periodika – entschlossen: der Sensation bedürftige und doch nolens volens risikoscheue Industrieware. Die Moderation der Abmischungen «geglückter/mißglückter Experimente» gibt Auskunft – über Teilnehmer und Teilhaber des Literaturmarkts.An der profitablen Massenliteratur läßt sich das Widerspiel von Freiheit und Marktmacht, von Promotion, Werbe-Umfeld-Anpassung, Kampf um Vertriebsspannen, «Prüfstellen»-Regulativen, Richtlinien von «Freiwilligen Selbstkontrollen» und Lektorats-Anweisungen studieren.
Sie wird für ein Publikum produziert, dem Bildungsforscher alle paar Jahre attestieren, daß ihm (bis zu) 30% als sekundäre (funktionelle) Analphabeten nur als Leser-Zombies angehören. Die Zahlen der «nicht buchreifen» Pflichtschul-Abgänger und der Nie-Buch-Leser (je über 50%) interpretieren einander. Die Leseforschung (in der BRD und im Österreich der siebziger Jahre) hat ein knappes Drittel der lesefähigen Bevölkerung als «bekennende» Leser von (Heft-) Serienliteratur ermittelt; etwa 55% der Lesefähigen lesen (gerne nur) «Unterhaltungsliteratur».Doch eiliger Ineinssetzung von «Bildungs-Unterschicht» und «Trivialkultur» stehen entgegen: die soziale und Bildungs-Streuung der Heftleser wie die verbreitete Erscheinung des «manischen» Heftlesers einerseits; zum anderen der durch Studien über Werkbüchereien u.ä. erbrachte Nachweis des proletarischen Lesers mit breit gefächerten Lese-Weltorientierungs-Bedürfnissen. Wohl begründbar ist auch die «selektive more-and-more-rule» der Medienforscher: die vom Einzelnen präferierten Lektüre-Muster werden auch in seiner sonstigen Mediennutzung bevorzugt. ■
Aus Franz Stadler, Massenliteratur, in: Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1995, Haupt Verlag 1997
.
.
J. Klinger & G.Wolf (Hg.): «Gedächtnis und kultureller Wandel»
.
Annäherung an den Zusammenhang
zwischen Erinnerung und Literatur
Jan Neidhardt
.
 Im Zuge stetig wachsender Erkenntnisse im Bereich der Neurophysiologie spielt der Erinnerungsdiskurs in den Kulturwissenschaften eine immer wichtigere Rolle. Im Herbst 2007 fand der Deutsche Germanistentag in Marburg unter dem Titel «Natur, Kultur. Universalität und Vielfalt in Sprache, Literatur und Bildung» statt. Darin ging es vor allem um die neuen Herausforderungen, die sich für die Germanistik aus den enormen Fortschritten im Bereich der Neurophysiologie, Kognitionspsychologie und in verwandten wissenschaftlichen Bereichen ergeben.
Im Zuge stetig wachsender Erkenntnisse im Bereich der Neurophysiologie spielt der Erinnerungsdiskurs in den Kulturwissenschaften eine immer wichtigere Rolle. Im Herbst 2007 fand der Deutsche Germanistentag in Marburg unter dem Titel «Natur, Kultur. Universalität und Vielfalt in Sprache, Literatur und Bildung» statt. Darin ging es vor allem um die neuen Herausforderungen, die sich für die Germanistik aus den enormen Fortschritten im Bereich der Neurophysiologie, Kognitionspsychologie und in verwandten wissenschaftlichen Bereichen ergeben.
Dem Erinnerungs- bzw. dem Gedächtnisdiskurs kommt in diesem Zusammenhang wachsende Bedeutung zu. Die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes, Judith Klinger und Gerhard Wolf, haben hier 18 Aufsätze zusammengetragen, die eine Auswahl aus den insgesamt etwa 40 eingereichten Beiträgen darstellen. Die Texte basieren auf Vorträgen, die auf dem Germanistentag gehalten wurden.
Sie beleuchten das Thema sowohl aus der diachronen Perspektive – durch die «Analyse der Entstehung von kollektiven Gedächtnissen und narrativen Ordnungen am Beginn der frühen Neuzeit und um 1800», als auch aus der synchronen – im Rahmen verschiedener Vergleiche von modernen Werken.
Anhand verschiedener Autoren (überwiegend des 20. Jahrhunderts) wird in den Beiträgen eine Annäherung an den Zusammenhang zwischen Erinnerung und literarischem Schaffen versucht.
Erörtert werden sowohl die Perspektiven als auch die Kontroversen der Erinnerungsforschung. Welche Rolle spielen beispielsweise methodische Ansatzpunkte aus der Sozialpsychologie? Und inwiefern ließen diese Annahmen sich kritisch hinterfragen? Erinnert der Mensch sich in der Moderne genau so wie der Mensch vor 200 Jahren? Und was bedeutet das für die Literaturwissenschaft? Man vergleiche nur mal Goethes «Wahlverwandtschaften» mit einem zeitgenössischen Werk.

Die Themen Werksetzung und Niveaulosigkeit schon in der Romantik diskutiert: Friedrich Schlegel («Gespräch über die Poesie»)
Wie wird Erinnerung literarisch verarbeitet? Wie beschreibt beispielsweise Dieter Bohlen in seiner Autobiographie «Nichts als die Wahrheit» sein Leben? Und werden Bekenntnisse a la Bohlen eigentlich erst seit der Moderne, dem «Zeitalter der Bücher», als niveaulose Publikationen empfunden? Gab es so etwas früher überhaupt schon? Ein Blick in die deutsche Kulturgeschichte zeigt, dass dieses Phänomen nichts Neues ist, denn bereits in der Romantik ging Friedrich Schlegel in seinem «Gespräch über die Poesie» auf die Themen Werksetzung und Niveaulosigkeit ein. In seinem Aufsatz «Mich kennen die Leute – Erinnerungsarbeit bei Rainald Goetz und Dieter Bohlen», geht der Autor Ulrich Breuer im Zuge eines Vergleichs der Werke «Nichts als die Wahrheit» (Bohlen) und «Abfall für alle» (Goetz) auf den Unterschied zwischen Autobiographie und autobiographischem Schreiben ein.
Doch nicht nur die jüngste und/oder triviale Literatur ist Thema. Klaus Schenk nähert sich dem Thema «Erinnerndes Schreiben – Zur Autobiographik der siebziger Jahre und ihren didaktischen Konsequenzen» an, indem er das Konzept der Autofiktionalität an Texten von Elias Canetti, Thomas Bernhard und Christa Wolf erläutert.
Weitere Themen sind «Erinnertes und sich erinnerndes Ich» (Jürgen Joachimsthaler), «Mythos und Ruhm – Zur Funktion zweier Konzepte des kulturellen Gedächtnisses in Gedichten um 1800» (Dirk Werle) u.v.m. Mehrere Beiträge sind dem wichtigen Thema «Bewältigung des Nicht-Bewältigbaren» gewidmet. Darin geht es u.a. um die «Erinnerungsliteratur von Tanja Dückers, Günter Grass und Uwe Timm» – ein interessanter Beitrag von Michael Braun, der sich auch den «Enkeln» widmet, die den Krieg nicht selbst erlebt haben und «jetzt […] anfangen zu fragen». Auch Günter Grass, dessen Geständnis, Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein, für erbitterte Debatten gesorgt hat, wird hier im Zusammenhang mit dem «Verschweigen» thematisiert.
Jan Süselbeck schreibt über «Das Nachzittern des Grauens. Metonymien und Erinnerungen der Shoah in Texten Arno Schmidts und Thomas Bernhards» und bezieht verschiedene interdisziplinäre Ansätze (v.a. aus dem Bereich der Neurobiologie) in seine Analysen mit ein.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass den Herausgebern und Autoren mit diesem Sammelband ein ausgesprochen interessanter und bereichernder Beitrag zur aktuellen kulturwissenschaftlichen Diskussion um Gedächtnis und Erinnerung gelungen ist. Die Aufsätze machen Lust auf die tiefergehende Lektüre der besprochenen Werke. ■
Judith Klinger / Gerhard Wolf (Hg.), Gedächtnis und kultureller Wandel – Erinnerndes Schreiben: Perspektiven und Kontroversen, De Gruyter Verlag, 280 Seiten, ISBN 978-3110230970
.
Inhalt
Vorwort SEKTIONSSITZUNG A (PLENARVORTRAG): GEDÄCHTNIS UND KULTURELLER WANDEL Günter Oesterle: Kontroversen und Perspektiven in der Erinnerungs- und Gedächtnisforschung SEKTIONSSITZUNG B: IDENTITÄT UND NARRATIVITÄT – SUBJEKTBILDUNG IM ERINNERN Klaus Schenk: Erinnerndes Schreiben. Zur Autobiographik der siebziger Jahre und ihren didaktischen Konsequenzen Jürgen Joachimsthaler: Die memoriale Differenz. Erinnertes und sich erinnerndes Ich IDENTITÄT UND NARRATIVITÄT – INDIVIDUELLE UND KOLLEKTIVE GEDÄCHTNISPRODUKTION Eva Kormann: Bruchstücke großer und kleiner Konfessionen. Vom gelegentlichen Widerspruch zwischen individuellem, familiärem und kulturellem Gedächtnis: Grass, Timm und Wilkomirski Nils Plath: Zu Brechts kalifornischen Musterhäusern. Betrachtungen zum Weiterlesen im Arbeitsjournal, 1942–1947 Ulrich Breuer: „Mich kennen die Leute“. Erinnerungsarbeit bei Rainald Goetz und Dieter Bohlen BEWÄLTIGUNG DES NICHT BEWÄLTIGBAREN Michael Braun: Die Wahrheit der Geschichte(n). Zur Erinnerungsliteratur von Tanja Dückers, Günter Grass, Uwe Timm Jan Süselbeck: Das Nachzittern des Grauens. Metonymien und Erinnerung der Shoah in Texten Arno Schmidts und Thomas Bernhards VI Inhalt Hannes Fricke: Wer darf sich wann, warum und woran erinnern – und wer darf von seinen Erinnerungen erzählen? Über Binjamin Wilkomirski, Günter Grass, die Macht der Moralisierung und die Opfer-Täter-Dichotomie im Zusammenhang der Debatte um neurobiologische Ansätze in den Geisteswissenschaften SEKTIONSSITZUNG C: AUSLÖSCHUNG UND VERLEBENDIGUNG Timo Günther: Den Toten eine Stimme geben? Konzepte der Erinnerung bei Botho Strauß; mit einem Ausblick auf Robert Harrison Michael Ostheimer: „Monumentale Verhältnislosigkeit“. Traumatische Aspekte im neuen deutschen Familienroman ÄSTHETISIERUNG UND TRADITIONSBILDUNG –MEMORIA UND ERFAHRUNG Ralf Schlechtweg-Jahn: Natur- und Kulturbilder zwischen Epochenbruch und Umbesetzung Benedikt Jeßing: Doppelte Buchführung und literarisches Erzählen in der frühen Neuzeit Dirk Werle: Mythos und Ruhm. Zur Funktion zweier Konzepte des kulturellen Gedächtnisses in Gedichten um 1800 (Hölderlin, Goethe, Schiller) Axel Dunker: Das ‚Gedächtnis des Körpers‘ gebiert Ungeheuer. Das Golem-Motiv als Gedächtnis-Metapher SEKTIONSSITZUNG D: NATURALISIERUNG UND FIKTIONALISIERUNG Daniel Weidner: Zweierlei Orte der Erinnerung. Mnemonische Poetik in Uwe Johnsons Jahrestage Uwe C. Steiner: Dinge als Gedächtnis und Dinge als zweite Natur in der frühen kritischen Theorie Jens Birkmeyer: Das Gedächtnis der Emotionen. Alexander Kluges Chronik der Gefühle als verborgene Erinnerungstheorie Namenregister Sachregister
.
___________________________
Geb. 1979 in Wilhelmshaven/D, Biologie- und Politik-Studium in Oldenburg, zurzeit Studium der Vergleichenden Kulturwissenschaft, Theologie, Medienwissenschaften und Geschichte in Regensburg, Verfasser eines Sachbuches, Rezensent des ostbayerischen Online-Kulturmagazins Kultur-Ostbayern
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die schlechten Schüler
Klaus Mollenhauer
.
Bis vor wenigen Jahren noch ist man in der deutschen Pädagogik der Meinung gewesen, daß eine Bildungstheorie möglich sei, die sich auf die allgemeine Bildung für alle beziehen könne und die nicht nur prinzipiell denkbar sei, sondern der Realität unserer Schulen entspreche. Ungleichmäßigkeiten im Begabungsniveau und in der Lernfähigkeit wurden als individuelle Faktoren interpretiert, denen indessen mit geeigneten unterrichtsmethodischen Praktiken beizukommen sei. Disfunktionen wurden auf den Begriff des »schlechten Schülers« gebracht, wobei man gerne zugab, daß die schwachen schulischen Leistungen ihre Ursache auch in sozialen Faktoren haben könnten, etwa in ungünstigen Familienverhältnissen, die dann ebenfalls in der Rolle disfunktionaler Störfaktoren erschienen.« Das heißt, das Bildungssystem im Ganzen wurde als funktionales Bezugssystem akzeptiert; die Entdeckung von Disfunktionen veranlaßte – des vorausgesetzten theoretischen Modells wegen – nicht dazu, das System in Frage zu stellen, es sei denn in der Form innerer Verbesserungen.
 Nach neueren Untersuchungen nun werden die dort gemachten Voraussetzungen problematisch. Die beobachteten Disfunktionen lassen sich nämlich als Merkmale kollektiven Bildungsschicksals interpretieren. So hat sich z.B. bei Untersuchungen des kindlichen Sprachniveaus gezeigt, daß es schichtenspezifische Sprachformen gibt, die die schulische Leistungsfähigkeit, also auch das, was wir mit dem Ausdruck »Begabung« sinnvoll bezeichnen können, sehr weitgehend bedingen. Andererseits ist kein Zweifel daran, daß unsere Höhere Schule eine Sprachschule insofern ist, als sie ihre Aufgabe vorwiegend in den sprachlichen Fächern betreibt. Konsequenterweise scheitern die meisten Unterschichten-Kinder in eben diesen Fächern. Die Sprachform, deren sich die Lehrerschaft bedient, ist nämlich durchweg die der Mittelschicht.
Nach neueren Untersuchungen nun werden die dort gemachten Voraussetzungen problematisch. Die beobachteten Disfunktionen lassen sich nämlich als Merkmale kollektiven Bildungsschicksals interpretieren. So hat sich z.B. bei Untersuchungen des kindlichen Sprachniveaus gezeigt, daß es schichtenspezifische Sprachformen gibt, die die schulische Leistungsfähigkeit, also auch das, was wir mit dem Ausdruck »Begabung« sinnvoll bezeichnen können, sehr weitgehend bedingen. Andererseits ist kein Zweifel daran, daß unsere Höhere Schule eine Sprachschule insofern ist, als sie ihre Aufgabe vorwiegend in den sprachlichen Fächern betreibt. Konsequenterweise scheitern die meisten Unterschichten-Kinder in eben diesen Fächern. Die Sprachform, deren sich die Lehrerschaft bedient, ist nämlich durchweg die der Mittelschicht.
Natürlich kann man auch diese Phänomene disfunktional nennen, müßte das aber in einem anderen Sinne tun, denn diese Phänomene sind nicht eigentlich störende Abweichungen, sondern resultieren aus dem sozialen System selbst. Betrachten wir nämlich die Schule als eine Stätte, an der sich der gegenwärtige Schichtenaufbau zu reproduzieren hätte, wären diese Phänomene funktional zu nennen. Mit anderen Worten: Sie indizieren eine durch soziale Ungleichheit bestimmte Konfliktsituation, die für unsere Gesellschaft strukturell ist. ■
Aus Klaus Mollenhauer, Disfunktionale Momente der Erziehungswirklichkeit, in: Erziehung und Emanzipation, Juventa Verlag 1968
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom Nihilismus
Gottfried Benn
.
Der Mensch ist gut, sein Wesen rational, und alle seine Leiden sind hygienisch und sozial bekämpfbar, dies einerseits, und andererseits die Schöpfung sei der Wissenschaft zugänglich, aus diesen beiden Ideen kam die Auflösung aller alten Bindungen, die Zerstörung der Substanz, die Nivellierung aller Werte, aus ihnen die innere Lage, die jene Atmosphäre schuf, in der wir alle lebten, von der wir alle bis zur Bitterkeit und bis zur Neige tranken: Nihilismus.
Dieser Begriff gewann in Deutschland Gestalt im Jahre 1885/86, als das Werk >Der Wille zur Macht< teils konzipiert, teils geschrieben wurde, dessen erstes Buch ja den Untertitel führt: >Der europäische Nihilismus<. Aber dieses Buch enthält schon eine Kritik dieses Begriffes und Entwürfe zu seiner Überwindung.
Wollen wir ihn noch weiter zurück verfolgen, wollen wir feststellen, wo und wann dieser schicksalhafte Begriff zum ersten Male in der europäischen Geistesgeschichte als Wort und seelisches Erlebnis auftritt, müssen wir uns, bekanntlich, nach Rußland wenden. Seine Geburtsstunde war der März 1862, der Monat, in dem der Roman >Väter und Söhne< von Iwan Turgenjew erschien. Weiter können auch russische Geschichtsforscher diesen Begriff nicht zurück verfolgen. Aber der Held dieses Romans, namens Basaroff, das ist schon der fertige Nihilist, und Turgenjew stellt ihn mit diesem Namen vor. Dieser Name wurde dann ungeheuer schnell populär, der Autor erzählt in einem Nachwort zu seinem Roman, wie er schon nach wenigen Monaten in aller Munde war, als er im Mai desselben Jahres nach Petersburg zurückkehrte, es war die Zeit der großen Brandstiftungen, des Brandes des Apraxinhofes, rief man ihm zu: »Da sehen Sie Ihre Nihilisten, sie stecken Petersburg in Brand.«Für unser Thema äußerst interessant ist nun, daß der Nihilismus dieses Basaroff eigentlich gar kein Nihilismus in absoluter Form war, kein Negativismus schlechthin, sondern ein fanatischer Fortschrittsglaube, ein radikaler Positivismus in Bezug auf Naturwissenschaft und Soziologie. Er ist zum erstenmal in der europäischen Literatur der siegesgewisse Mechanist, der schneidige Materialist, dessen etwas fragwürdige Enkel wir ja heute noch lebhaft tätig unter uns sehen – hören wir, welche vertrauten Klänge aus den sechziger Jahren zu uns herüberklingen: Ein tüchtiger Chemiker, hören wir, ist zwanzigmal wertvoller als der beste Poet. Ein Stück Käse ist mir lieber als der ganze Puschkin. Halten Sie nichts von der Kunst? Doch, von der Kunst, Geld zu machen und Hämorrhoiden zu kurieren! Jeder Schuhmacher ist ein größerer Mann als Goethe und Shakespeare. George Sand ist eine zurückgebliebene Frau, sie verstand nichts von Embryologie.
Und neben diesen Wahrheiten tritt das Kaschemmenmilieu in Leben und Kunst als letzter Schrei auf, hier und damals entstand also der Stil, den wir bis in gewisse moderne Opern und Opernbearbeitungen verfolgen können: der Kult des Athleten, der Hymnus auf den Normalmenschen, die kindische Gesellschaftskritik: die Gerichte sollen abgeschafft werden, die Erziehung soll abgeschafft werden, die alten Sprachen als ungenial verboten werden, dafür hat man es mit den Trieben: dreckig soll der Mensch sein, die Frauen soll man tauschen und von anderen erhalten lassen, trinken soll man, denn Trinken ist billiger als Essen, und außerdem stinkt man danach, ja, selbst den Dadaismus, dessen Auftreten in Zürich und Berlin unsere Gegenwart kürzlich so interessant fand, finden wir in einem Roman der sechziger Jahre, dem Roman >Was tun< von Tschernischewsky, schon vor: Kunst heißt, lesen wir dort, zwei Klaviere in einen Salon rücken, an jedes eine Dame setzen, um jedes soll sich ein Halbchor bilden, und jeder Beteiligte singt oder spielt dann gleichzeitig recht laut ein anderes Lied vor sich hin. Dies wurde als die Melodie der Revolution und die Orgie der Freiheit bezeichnet. Wir sehen also, die geistigen Auswirkungen des geschichtsphilosophischen Materialismus beginnen in den sechziger Jahren, sind also mindetens achtzig Jahre alt, also eigentlich sind sie das Alte und das Reaktionäre. Eigentlich, und damit stoßen wir in die Zukunft vor, ist heute aller Materialismus reaktionär, sowohl der der Geschichtsphilosophie wie der in der Gesinnung: nämlich rückwärts blickend, rückwärts handelnd, denn vor uns liegt ja schon ein ganz anderer Mensch und ein ganz anderes Ziel.Aus Gottfried Benn, Nach dem Nihilismus (Essay 1931)
.
Links. Gottfried Benn
Wie Gedichte entstehen – Hitler&Benn – Gedichte – Benn&Nationalsozialismus – Kleine Aster – Blinddarm – Herkunft Plagiat – Auf deine Lieder… –
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die moderne Literaturkritik
Hartmut Lange
.
Glücklicher Goethe! Er warnt vor der aufkommenden Literaturkritik noch aus der Sicherheit eines intakten, die eigenen Zusammenhänge begreifenden Kulturbewußtseins. Heute ist das Kulturbewußtsein längst eine Sache des Amüsierbetriebs. Der Großkritiker hat die Medien erobert, und der Schriftsteller kann froh sein, wenn seine Bücher im Fernsehen als Gelegenheit zur Unterhaltung präsentiert werden. Die einflußreiche Literaturkritik ist längst zum Entertainment verkommen, und dem Entertainer sind alle kritischen Maßstäbe lediglich ein Mittel zur Selbstdarstellung.
Kulturkontinuität hieße hier: Der Großkritiker amüsiert sich und seine Zuschauer auf Kosten des aktuellen Literaturangebots, ansonsten bringt er nichts Neues ein. Und da sein öffentliches und mit Stargagen abgegoltenes Amüsement Selektion bedeutet, steuert er den Käufer, der das Amüsierbegehren des Kritikers zur Konsumtion erhebt.
Als Schriftsteller sollte man den Rat Goethes beherzigen und sich unumwunden eingestehen: Eine Literatur von Rang kann heute nur schreiben, wer sich vom Einfluß eines solchen Literaturbetriebs radikal freimacht. Die Kriterien für Literatur findet der Schriftsteller nicht im literaturkritischen Amüsierbetrieb. Und selbstverständlich gibt es Kritiker, die sich dem Zwang zum Entertainment entziehen. Sie werden gebraucht.
Aus Hartmut Lange, Irrtum und Erkenntnis – Meine Realitätserfahrung als Schriftsteller, Diogenes Verlag, Zürich 2002
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Der Glaube des Westens
Theodor Haecker
.
Erst als die jungen Völker Europas, mitbringend nur ihr reiches Blut, ihre ungebändigte edle geistgerichtete Kraft und Leidenschaft, aber auserlesen, das Wertvollste zu empfangen, was die Welt hatte, auf ihren säftestrotzenden Stamm das köstliche Reis übernatürlichen Lebens gepfropft erhalten hatten, entstand auch eine Natur und natürliches Leben umfassende Literatur; indes auch sie war katholisch, niemals die unsichtbare Welt verleugnend, sie immer durchscheinen lassend. Die lateinisch sprechende und schreibende Kirche hat die Nationen Europas deren eigene Sprachen sprechen und schreiben gelehrt. Und damit war der Sinn Europas gegeben und enthüllt. Europa ist das Kind des Einen Glaubens und als dieses Kind der einzige Erbe des griechischen und römischen Geistes, der westlichen Kunst mit der Prävalenz der Leichtheit und Lichtheit strenger Form vor aller Schwere und Nacht chaotischen Inhalts; der westlichen Philosophie mit der Herrschaft des lebendigen Logos über Trieb und Drang und Leidenschaft; der westlichen Wissenschaft mit der Idee des Gesetzes und der Regel und der «Humanität». Das ist der «Westen» und das der Sinn des Westens und seiner Literatur, auch wenn diese nicht direkt davon, sondern sachlich von anderen Dingen spricht, was sie muß und soll: Im Gehorsam des Einen Glaubens, welcher das erste ist, an das Heil, das von den Juden kam, die Erben zu sein der Griechen, der Dämonie wie der Heiterkeit ihrer Kunst, der Exaktheit ihrer Wissenschaft, der Erhabenheit ihrer Metaphysik und ihrer großen Idee, der Humanität – Erben, nicht Sklaven, legitime Erben in aller Unmittelbarkeit ihres eigenen Lebens mit allen Rechten ihrer eigenen unvergleichlichen Natur, in der Freiheit und Gebundenheit ihrer eigenen mitgegebenen an die Nationen einzeln verteilten Gaben.
Dieses, aber zuerst den Glauben haben, das ist der geistige Sinn der europäischen Völker, das, und das allein, ist ihre verborgene Einheit, von diesem Sinne leben sie mitten in Schuld und Blut und Sünden, verlieren sie ihn ganz, sterben sie, wenn auch schreiend und schreibend. Es haben Zeiten gemeint und diese Tage meinen es noch, daß das antike Erbe: Philosophie, Kunst und Wissenschaft, wie nur der Westen sie hat, und Humanität, wie nur der Westen als Idee sie kennt, bewahrt und realisiert werden könne auch trotz oder gar wegen der Emanzipation von dem Einen Glauben. Ein gewaltiger Irrtum! Ohne den christlichen Glauben ist Europa nur ein Sandkorn im Wirbelwind der Meinungen, Ideen und Religionen, es wird morgen auf den Knien liegen vor den Russen, übermorgen vor den Japanern, in drei Tagen vor den Chinesen, in vieren vor den Indern, am letzten aber ganz gewiß die Beute der Neger sein; es wird morgen das Matriarchat haben und übermorgen die Pornokratie; seine Literatur wird nur mehr kennen und sagen die untergeistigen Dinge, nämlich die gnostischen, die unterseelischen, nämlich die psychoanalytischen, die unterleiblichen, nämlich eben diese in Unzucht und Perversion.
Aus Theodor Haecker, Der Sinn des Abendlandes (Tag- und Nachtbücher) 1939-45
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die Kultur in Zeiten der Krise
Ansgar Wimmer
.
Ein Grund für die Dramatik der Finanzkrise war, dass Menschen Geld in Finanzinstrumente investiert haben, die sie nicht wirklich verstanden haben. Sie sind ihnen nicht vermittelt worden, sie waren zu komplex, die Sprache der Banker war zu fremd oder die Gier war schlicht zu groß. Gier frisst Hirn, so lautet eine saloppe Formulierung in der Bankenwelt.
Nun hat Kunst und Kultur – Gott sei Dank – in ihrer Rezeption schlicht eine andere Ausgangsbasis als Finanzinstrumente und Investmentprojekte. Man muss sie nicht immer verstehen, auch ein schlicht ästhetischer oder emotionaler Zugang reicht häufig völlig aus. Dass ein bloß emotionaler Zugang zu finanziellen Investitionsentscheidungen demgegenüber nicht ausreicht, ist den Anlegern von Bernie Madoff leider etwas zu spät klar geworden.
Allerdings ist auch der umgekehrte Schluss mancher Kulturschaffender nicht immer hilfreich. Immer wieder erreichen mich in meiner Arbeit als Stiftungsvorstand Entwürfe grandioser Kulturprojekte, innovativer, komplexer, manchmal unverständlich-intellektueller Gedankengebäude, neuer Festivals oder Angebote, die nach Ansicht ihrer Urheber dringend realisiert werden müssen, mit der Bitte um Förderung durch die Alfred Toepfer Stiftung. Auf meine dann regelmäßig erfolgende Frage, an wen sich denn dieses Vorhaben richte, also wer denn die Zielgruppe der Bemühungen sein solle, ernte ich sodann ebenso oft entweder unverständliches Kopfschütteln oder die Auskunft «Na, die allgemeine Öffentlichkeit, halt.»Damit ich nicht missverstanden werde:
– Kultur und insbesondere Kulturförderung, die sich nur an möglichen Abnehmern orientiert, ist genauso trostlos und entbehrlich wie die vermeintlich unvermeidlichen Volksmusikhitparaden der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Deutschland.
– Gerne verteidige ich jeden Künstler, der zum Ausdruck seiner eigenen künstlerischen Identität mir völlig unverständliche Dinge tut, und manchmal fördern wir als Stiftung auch so etwas.
Ein junger Kammermusiker aber, der im Rahmen seines Programms nicht über seine Musik sprechen kann – oder jemanden kennt und mitbringen kann, der über seine Musik sprechen kann – hat heute und in der Krise seinen Beruf verfehlt – oder muss sehr exzellent sein. Wenn unsere Stiftung heute unter dem Titel «concerto 21» eine Sommerakademie für Aufführungskultur und Musikmanagement durchführt, dann ist das Ziel der Aktion, die Kultur nicht einfach, sondern kommunizierbar zu machen. Auch das braucht es in der Krise, allemal in einer Welt, in der Kulturvermittlung nur beschränkt in den Erziehungskanon vieler Elternhäuser gehört. ■
Aus Ansgar Wimmer (Vorsitzender der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.): Neue Chancen für die Kultur in Zeiten der Krise, Vortrag aus Anlass des Jahreskongresses der «Vereinigung deutschfranzösischer Gesellschaften für Europa», Duisburg 2009
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom Verlagsgeschäft im Zeitalter des World Wide Web
Ulrike Langer
.
Wenn Tim Berners-Lee das World Wide Web mit typischem Verlagsdenken ersonnen hätte, dann gäbe es heute kein weltumspannendes Netz, das Webseiten und ihre Inhalte miteinander verknüpft und Weltwissen auf unendlich vielen Pfaden verfügbar macht. Es gäbe bloß Anhäufungen von großen und kleinen und mehr oder weniger autarken Inseln mit Inhalten. Aber keine Möglichkeit, von einer Insel auf die andere zu gelangen und dabei Neues zu entdecken.
Den Kerngedanken des Web – die Verbindung fremder Webseiten per Link – haben die meisten deutschen Verlage bis heute nicht begriffen. Ihre Webportale sind voll von Beiträgen, die außer Hinweisen auf andere eigene Beiträge keinen einzigen hinausführenden Link zu Originalquellen, anderen Perspektiven oder vertiefenden Informationen enthalten. Dahinter steckt die unausgesprochene Prämisse, die Verlage seit ihren ersten Schritten im Internet als gegeben voraussetzen: Man schickt niemals seine Leser auf andere Websites. Sie könnten dort etwas Interessanteres finden, und darüber könnten sie doch glatt vergessen zurück zu kommen.
Weil Verlage ihre Portale nicht als attraktive Knotenpunkte im Web, sondern als autarke Inseln begreifen, tun sie alles (und zwar fast alle das Gleiche), um die Nutzer zum Bleiben zu bewegen und viel zu wenig, um Nutzer dazu zu bewegen, freiwillig wieder zu kommen. Auf diese Weise vergeben sie zahlreiche Chancen:
* Agenturberichte, Kinokritiken oder Kochrezepte gehören nach Verlagsauffassung zu einem vollwertigen Portal dazu. Schließlich sind solche Bausteine, auch wenn sie jeder hat, ja auch Bestandteile der gedruckten Zeitung. Doch das ist Printdenken im Web. Anders als am Frühstückstisch, wo die meisten Menschen nur ein einziges Blatt lesen, sind im Netz die identischen Allerweltsinformationen immer nur einen Mausklick entfernt. So führt das Portaldenken dazu, dass einzigartige Inhalte gegenüber Versatzstücken, die jeder hat, nicht genügend im Vordergrund stehen. Das kleinteilige Design der meisten Zeitungswebsites verstärkt die falsche Prioritätensetzung noch obendrein.
* Verlage reichern ihre Websites nicht mit dem Mehrwert an, den sie durch Verlinkung gewinnen könnten. Das zu beherzigen, fordert Jeff Jarvis: «Tue, was Du am besten kannst und verlinke zum Rest.» In der Linkökonomie muss nicht jeder das Rad neu erfinden und nochmals niederschreiben, was viele andere vielleicht schon treffender gesagt haben. Viel sinnvoller ist, zu den besten dieser Quellen zu verlinken.
* Verlagsportale, die nicht verlinken, denken nicht vom Nutzerinteresse her und bieten ihren Lesern dehalb nicht den größtmöglichen Service. Sie verkennen, dass es für die Leser einen großen Wert hat, von einer Website regelmäßig auf gute externe Websites verwiesen zu werden. Weitere Argumente dazu gibt es bei Beatblogging.org.
* Verlagsportale handeln aber auch nicht in ihrem eigenen Interesse, wenn sie nicht verlinken. Zum Beispiel im Lokaljournalismus. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass aus Lesern von Spielberichten im Kreisligafußball Community-Mitglieder eines von der Zeitung geleiteten lokalen Sportportals werden können, wenn Verlage sich angewöhnen würden, auf die Websites der Vereine zu verlinken und sie aktiv mit einzubeziehen. Das lässt sich für die gesamte deutsche Vereinslandschaft durchdeklinieren.
Der New Yorker Medienprofessor Jay Rosen spricht in einem sehenswerten Vier-Minuten-Video von der «Ethik des Verlinkens». Die meisten Zeitungsportale missachten diese Ethik. Sie profitieren von der Aufmerksamkeit, die andere ihnen durch Links bescheren, geben aber nichts von der Aufmerksamkeit zurück, die sie bekommen.
Auf die Idee, schon das bloße Verlinken und Zitieren (nicht zu verwechseln mit dem widerrechtlichem Kopieren) mit einer Strafgebühr, genannt «Leistungsschutzabgabe», zu belegen, kommt nur jemand, der die Ethik des Verlinkens weder versteht noch beherzigt. Über die praktischen und rechtlichen Probleme der «Verleger-GEMA» haben auch Robin Meyer-Lucht und Matthias Schwenk hier bei Carta schon geschrieben. Die Verlage verwandeln ihre Portale mit einer solchen Abgabe endgültig in abgeschottete Inseln, denn wer will schon dafür bezahlen, verlinken zu dürfen? Der Gedanke ist ebenso absurd wie von Fans eine Abgabe dafür zu verlangen, dass sie kostenlose Mundpropaganda für ein Produkt oder für eine Musikband machen.Die Kosten für ein optimiertes Suchmaschinenranking (SEO) können Verlage bei einer GEMA-Gebühr für das Verlinken konsequenterweise dann auch gleich einsparen, bzw. in Etats für gekaufte Suchwortplatzierung umwandeln, denn Suchmaschinen stufen Websites, auf die nur wenige Links führen, als vergleichsweise unbedeutend ein. Inhalte hinter der Schranke einer Leistungsschutzabgabe für das Verlinken werden so letztlich der öffentlichen Diskussion ebenso entzogen wie Inhalte hinter einer Bezahlschranke für das bloße Anschauen (Paid Content). Und das ist so ziemlich das Gegenteil eines freien Internet, das Menschen und Informationen verbindet, welches Berners-Lee im Sinn hatte, als er das World Wide Web erfand.
Aus Ulrike Langer, «Das Netz besteht aus Verbindungen, nicht aus abgeschotteten Inseln», in: Carta.info 2009
.
.
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über das «Genie» Adolf Hitler
Thomas Mann
.
Ich frage mich, ob die abergläubischen Vorstellungen, die sonst den Begriff des <Genie> umgaben, noch stark genug sind, dass sie uns hindern sollten, unsern Freund ein Genie zu nennen. Warum denn nicht, wenn’s ihm Freude macht? Der geistige Mensch ist beinahe ebensosehr auf Wahrheiten aus, die ihm wehe tun, wie die Esel nach Wahrheiten lechzen, die ihnen schmeicheln. Wenn Verrücktheit zusammen mit Besonnenheit Genie ist (und das ist eine Definition!), so ist der Mann ein Genie: Um so freimütiger versteht man sich zu dem Anerkenntnis, weil Genie eine Kategorie, aber keine Klasse, keinen Rang bezeichnet, weil es sich auf den allerverschiedensten geistigen und menschlichen Rangstufen manifestiert, aber auch auf den tiefsten noch Merkmale aufweist und Wirkungen zeitigt, welche die allgemeine Bezeichnung rechtfertigen.
Ich will es dahingestellt sein lassen, ob die Geschichte der Menschheit einen ähnlichen Fall von moralischem und geistigem Tiefstand, verbunden mit dem Magnetismus, den man <Genie> nennt, schon gesehen hat wie den, dessen betroffene Zeugen wir sind. Auf jeden Fall bin ich dagegen, dass man sich durch ein solches Vorkommnis das Genie überhaupt, das Phänomen des großen Mannes verleiden lässt, das zwar vorwiegend immer ein ästhetisches Phänomen, nur selten auch ein moralisches war, aber, indem es die Grenzen der Menschheit zu überschreiten schien, die Menschheit einen Schauder lehrte, der trotz allem, was sie von ihm auszustehen hatte, ein Schauder des Glückes war. Man soll die Unterschiede wahren – sie sind unermesslich. Ich finde es ärgerlich, heute rufen zu hören: «Wir wissen es nun, Napoleon war auch nur ein Kaffer!» Das heißt wahrhaftig, das Kind mit dem Bade ausschütten. Es ist als absurd abzulehnen, dass man sie in einem Atem nennt: den großen Krieger zusammen mit dem großen Feigling und Erpressungspazifisten, dessen Rolle am ersten Tage eines wirklichen Krieges ausgespielt wäre; das Wesen, das Hegel den «Weltgeist zu Pferde» nannte, das alles beherrschende Riesengehirn, die ungeheuerste Arbeitskapazität, die Verkörperung der Revolution, den tyrannischen Freiheitsbringer, dessen Gestalt der Menschheit als Erzbild mittelmeerländischer Klassik für immer ins Gedächtnis geprägt ist – zusammen mit dem tristen Faulpelz, tatsächlichen Nichtskönner und <Träumer> fünften Ranges, dem blöden Hasser der sozialen Revolution, dem duckmäuserischen Sadisten und ehrlosen Rachsüchtigen mit <Gemüt>…
Ich sprach von europäischer Verhunzung: Und wirklich, unserer Zeit gelang es, so vieles zu verhunzen: Das Nationale, den Sozialismus – den Mythos, die Lebensphilosophie, das Irrationale, den Glauben, die Jugend, die Revolution und was nicht noch alles. Nun denn, sie brachte uns auch die Verhunzung des großen Mannes. Wir müssen uns mit dem historischen Lose abfinden, das Genie auf dieser Stufe seiner Offenbarungsmöglichkeit zu erleben.
Aber die Solidarität, das Wiedererkennen sind Ausdruck einer Selbstverachtung der Kunst, welche denn doch zuletzt nicht ganz beim Worte genommen sein möchte. Ich glaube gern, ja ich bin dessen sicher, dass eine Zukunft im Kommen ist, die geistig unkontrollierte Kunst, Kunst als schwarze Magie und hirnlos unverantwortliche Instinktgeburt ebensosehr verachten wird, wie menschlich schwache Zeiten, gleich der unsrigen, in Bewunderung davor ersterben. Kunst ist freilich nicht nur Licht und Geist, aber sie ist auch nicht nur Dunkelgebräu und blinde Ausgeburt der tellurischen Unterwelt, nicht nur <Leben>. Deutlicher und glücklicher als bisher wird Künstlertum sich in Zukunft als einen helleren Zauber erkennen und manifestieren: als ein beflügelt-hermetisch-mondverwandtes Mittlertum zwischen Geist und Leben. Aber Mittlertum selbst ist Geist.Aus Thomas Mann, Bruder Hitler, Paris 1939
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom Nutzen und Zweck der Arbeit
Richard Wagner
.
Der Künstler hat, außer an dem Zwecke seines Schaffens, schon an diesem Schaffen, an der Behandlung des Stoffes und dessen Formung selbst Genuß, sein Produzieren ist ihm an und für sich erfreuende und befriedigende Tätigkeit, nicht Arbeit. Dem Handwerker gilt nur der Zweck seiner Bemühung, der Nutzen, den ihm seine Arbeit bringt; die Tätigkeit, die er verwendet, erfreut ihn nicht, sie ist ihm nur Beschwerde, unumgängliche Notwendigkeit, die er am liebsten einer Maschine aufbürden möchte: seine Arbeit vermag ihn nur aus Zwang zu fesseln, deshalb ist er auch nicht mit dem Geiste dabei gegenwärtig, sondern beständig darüber hinaus bei dem Zwecke, den er so gerade wie möglich erreichen möchte.
Ist nun aber der unmittelbare Zweck des Handwerkers nur die Befriedigung eines eigenen Bedürfnisses, z. B. die Herstellung seiner eigenen Wohnung, seiner eignen Gerätschaften, Kleidung usw., so wird ihm mit dem Behagen an den ihm verbleibenden nützlichen Gegenständen allmählich auch Neigung zu einer solchen Zubereitung des Stoffes, wie sie seinem persönlichen Geschmacke zusagt, eintreten; nach der Herstellung des Notwendigsten wird daher sein auf weniger drängende Bedürfnisse gerichtetes Schaffen sich von selbst zu einem künstlerischen erheben: gibt er aber das Produkt seiner Arbeit von sich, verbleibt ihm davon nur der abstrakte Geldeswert, so kann sich unmöglich seine Tätigkeit je über den Charakter der Geschäftigkeit der Maschine erheben; sie gilt ihm nur als Mühe, als traurige, saure Arbeit. Die Letztere ist das Los des Sklaven der Industrie…
Aus Richard Wagner, Die Kunst und die Revolution, Dresden 1849
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die großen Frauen
Simone de Beauvoir
.
Männer, die wir groß nennen, sind jene, die – auf die eine oder andere Weise – das Gewicht der Welt auf ihre Schultern genommen haben: Sie sind mehr oder weniger damit fertig geworden, es ist ihnen geglückt, sie neu zu schaffen, oder sie sind gescheitert. Aber zunächst haben sie diese ungeheure Last auf sich genommen. Das hat noch keine Frau getan, aber auch noch nicht tun können. Im Mann und nicht in der Frau hat sich bis jetzt der Mensch «an sich» verkörpern können. Die Individuen nun aber, die uns beispielhaft erscheinen, die man mit dem Namen Genie auszeichnet, sind es, die behauptet haben, in ihrer einzelnen Existenz spiele sich das Schicksal der gesamten Menschheit ab. Keine Frau hat sich dazu für berechtigt gehalten. Wie hätte Van Gogh als Frau auf die Welt kommen können? Eine Frau wäre nicht in Mission nach dem nordfranzösischen Kohlenrevier geschickt worden, sie hätte nicht das Elend der Menschen als ihr eigenes Verbrechen empfunden, sie hätte keine Wiedergutmachung gesucht. Sie hätte auch keine Van Goghschen Sonnenblumen gemalt. Eine Frau hätte nie ein Kafka werden können: In ihren Zweifeln und ihrer Unruhe hätte sie nie die Angst des Menschen wiederempfunden, der aus dem Paradies vertrieben worden ist. Eigentlich hat nur die Heilige Therese auf eigene Kosten, in einer völligen Verlassenheit die menschliche Seinsbedingung durchlebt. Da sie sich jenseits der irdischen Hierarchien stellte, fühlte sie ebensowenig wie der Hl. Johannes vom Kreuz ein beruhigendes Dach über ihrem Haupt. Für alle beide war es dieselbe Nacht, dasselbe Aufleuchten des Lichts, dasselbe Nichts des «Ansich», dieselbe Erfüllung in Gott.
Wenn es so einmal für jedes Menschenwesen möglich sein wird, seinen Stolz jenseits der geschlechtlichen Differenzierung in die schwierige Glorie seiner freien Existenz zu setzen, erst dann wird die Frau ihre Geschichte, ihre Probleme, ihre Zweifel, ihre Hoffnungen mit denen der Menschheit vereinen können. Erst dann wird sie in ihrem Leben wie in ihren Werken versuchen können, die ganze Wirklichkeit und nicht nur ihre Person zu enthüllen. Solange sie noch damit zu kämpfen hat, ein Menschenwesen zu werden, kann sie nicht schöpferisch sein.
Erst kürzlich noch hat das alte Europa die barbarischen Amerikaner mit Verachtung gestraft, die weder Künstler noch Schriftsteller besäßen: «Laßt uns erst existieren, bevor ihr von uns verlangt, daß wir unsere Existenz rechtfertigen», antwortete im wesentlichen Jefferson. Dieselbe Antwort erteilen die Neger den Weißen, die ihnen vorwerfen, sie hätten keinen Whitman und auch keinen Melville hervorgebracht. Das französische Proletariat hat auch keinen Namen, den es einem Rousseau und Mallarmé entgegenstellen könnte. Die freie Frau wird eben erst geboren. Wenn sie sich selbst erobert haben wird, rechtfertigt sie vielleicht die Prophezeiung Rimbeauds: «Die Frau wird das Unbekannte finden! Wird ihre Ideenwelt von unserer verschieden sein? Sie wird seltsame, unergründliche, abstoßende, entzückende Dinge finden, wir werden sie entgegennehmen, sie begreifen.»
Um zu wissen, inwieweit sie eine Sonderheit bleibt, inwieweit ihre Sonderheiten ihre Bedeutung behalten, müßte man recht kühne Voraussagen wagen.
Die Zukunft steht weit offen.Aus Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, Eine Deutung der Frau, Rowohlt Verlag Hamburg 1960
.
.
.
.
Das Zitat der Woche
.
Das hol’ ich mir
Max Nyffeler
.
Im April fällte ein Gericht in Stockholm ein Urteil, das weltweit Beachtung fand. Die vier Betreiber der schwedischen Internet-Musiktauschbörse Pirate Bay wurden wegen «Komplizenschaft bei der Bereitstellung von Raubkopien» zu harten Strafen verurteilt: Je ein Jahr Gefängnis und eine Schadenersatzzahlung von insgesamt 2,7 Millionen Euro. Da Pirate Bay das weitweit größte Netzwerk für den illegalen Austausch von Musikfiles darstellt, wird das Verfahren international als Musterprozess eingestuft. Die Verurteilten haben Berufung eingelegt; sollte das Urteil Bestand haben, wird es in anderen Ländern wohl zu ähnlichen Prozessen kommen.
Im Vorfeld gaben sich die vier Piraten noch siegessicher: Sie versuchten sich als Robin Hood im Kampf gegen die internationalen Konzerne darzustellen und gaben sich als idealistische Musikfreunde aus: Ihr Netzwerk sei eine gemeinnützige Plattform und diene kulturellen Zwecken. Juristisch gesehen täten sie ohnehin nichts Böses; ihr Server stelle bloß die Kontakte zwischen den Tauschwilligen her, aber Musik sei darauf keine gespeichert. Wenn man nach Schuldigen suchen wolle, dann bitte sehr bei den weltweit verstreuten, einzelnen Usern.
Auf solche formaljuristischen Spitzfindigkeiten ging das Gericht nicht ein, zumal die Webseite offenbar auch stattliche Werbeeinnahmen generiert; die schwedische Polizei schätzt sie auf rund 1,7 Millionen Euro jährlich. Von Gemeinnützigkeit kann also keine Rede sein. Auch über ihre Absichten herrscht Klarheit. Sie ist ein Ableger der schwedischen Organisation «Piratbyrån», über die es bei Wikipedia heißt, sie unterstütze «den individuellen Kampf gegen Copyright und geistiges Eigentum durch das Tauschen von Informationen und Kulturaspekten».Dass dieser Prozess ein so heftiges Pro und Contra ausgelöst hat, liegt nicht nur an der juristischen Grauzone, in der er sich bewegte, sondern auch an der altbekannten Tatsache, dass sich das antihierarchisch strukturierte Internet nicht unter Kontrolle bringen lässt. Es ist ein weitgehend rechtsfreier Raum. Von den Anhängern der großen Cyber-Freiheit wurden Fakten geschaffen, die kaum rückgängig zu machen sind. Dazu gehört auch die Aneignung fremden geistigen Eigentums in großem Stil. Ein Unrechtsbewusstsein gibt es dabei kaum, denn es machen ja alle mit bei diesem munteren Versteckspiel, in dem Millionen Jugendlicher dazu angeleitet werden, den bösen Musikkonzernen durch den Austausch von Schwarzkopien eine Streich zu spielen.
«Das hol’ ich mir»: Diese rücksichtslose Selbstbedienungsmentalität wird mit einem dumpfen antikapitalistischen Gerede legitimiert. Dass dabei die Interessen der Autoren und der sie vertretenden Institutionen massiv geschädigt werden, ist den Tätern offensichtlich egal. Die Verhältnisse sind pervertiert: Ein schwedischer Schriftsteller, der den Diebstahl öffentlich beklagte, wurde von der Meute im Netz als «gieriger Autor» beschimpft.
Vielleicht trägt das jetzige Urteil ein klein wenig zur Bewusstseinsbildung bei. Viel Hoffnung sollte man sich nicht machen, denn wird im Internet an einem Ort ein Loch gestopft, tut sich gleich daneben das nächste auf. Doch vielleicht dämmert es langsam auch denen, die bisher schmunzelnd zugeschaut haben, dass diese Räuberpraxis nichts mit Freiheitsrechten und Jugendkultur und schon gar nichts mit Demokratie zu tun hat, sondern schlicht und einfach eine Enteignung der geistig Arbeitenden durch einen anonymen Pöbel darstellt, der sich bei seiner Beschaffungskriminalität an die Grundsätze der Bonusjäger aus der Finanzwelt hält: Raffe, was du kannst, sonst nimmt’s ein Anderer.Aus Max Nyffeler, Beckmesser-Kolumne Mai 2009, in: Beckmesser – Die Seite für neue Musik und Musikkritik
Das Zitat der Woche
.
Über die geistige Situation der Zeit
Karl Jaspers
.
Man hat die Gegenwart mit der Zeit des untergehenden Altertums verglichen, mit der der hellenischen Staaten, in denen das Griechentum versank, oder mit dem dritten nachchristlichen Jahrhundert, in dem die antike Kultur überhaupt zusammenbrach. Jedoch bestehen wesentliche Unterschiede. Damals handelte es sich nm eine Welt, die einen kleinen Raum der Erdoberfläche einnahm und die Zukunft des Menschen auch noch außer sich hatte. Heute, wo der Erdball ganz ergriffen ist, muß, was an Menschsein bleibt, in die Zivilisation eintreten, die das Abendland geschaffen hat. Damals ging die Bevölkerung zurück, heute ist sie in nie dagewesener Vervielfachung angewachsen. Damals war in der Zukunft auch die Bedrohung von außen, heute ist äußere Bedrohung für das Ganze partikular, und der Untergang kann nur von innen her erfolgen, wenn er das Ganze treffen sollte. Der handgreifliche Unterschied gegenüber dem dritten Jahrhundert aber ist, daß damals die Technik stagnierte und zu verfallen begann, während sie heute in unerhörtem Tempo ihre unaufhaltsamen Fortschritte macht. Chance wie Gefahr sind hier unabsehbar. Das äußerlich sichtbare Neue, das allem menschlichen Dasein von jetzt an seine Grundlagen und damit neue Bedingungen stellen muß, ist diese Entfaltung der technischen Welt. Zum erstenmal hat eine wirkliche Naturbeherrschung begonnen.
Wollte man sich unsere Welt verschüttet denken, so würden spätere Grabungen zwar keine Schönheiten zutage fördern wie die der Antike, deren Straßenpflaster noch uns entzückt. Aber es würde gegenüber allen früheren Zeiten schon aus den letzten Jahrzehnten so viel Eisen und Beton zu finden sein, daß man noch spät es sehen könnte: der Mensch hatte jetzt den Planeten in ein Netz seiner Apparatur eingesponnen. Dieser Schritt ist gegenüber allen früheren Zeiten so groß wie der erste Schritt zur Werkzeugbildung überhaupt: die Perspektive einer Verwandlung des Planeten in eine einzige Fabrik zur Ausnutzung seiner Stoffe und Energien wird sichtbar. Der Mensch hat das zweitemal die Natur durchbrochen und sie verlassen, um in ihr ein Werk hinzustellen, das sie als Natur nicht nur niemals geschaffen hätte, sondern das nun mit ihr wetteifert an Wirkungsmacht. Nicht schon in der Sichtbarkeit seiner Stoffe und Apparate ist dies Werk vor Augen, sondern erst in der Wirklichkeit ihrer Funktion; der Ausgräber könnte an den Resten von Funktürmen nicht mehr die durch sie hergestellte Allgegenwart der Ereignisse und Nachrichten auf der Erdoberfläche ermitteln.
Was das Neue sei, durch das unsere Jahrhunderte und durch dessen Vollendung unsere Gegenwart gegen das Vergangene sich absetzen, ist auch mit der Weise der Entgötterung der Welt und dem Prinzip der Technisierung keineswegs begriffen. Noch ohne klares Wissen wird immer entschiedener bewußt, in einem Augenblick der Weltwende zu stehen, die nicht an einer der partikularen geschichtlichen Epochen der vergangenen Jahrtausende gemessen werden kann. Wir leben in einer geistig unvergleichlich großartigen, weil an Möglichkeiten und Gefahren reichen Situation, doch müßte sie, würde ihr niemand genug tun können, zur armseligsten Zeit des versagenden Menschen werden.
Im Blick auf die vergangenen Jahrtausende scheint der Mensch vielleicht am Ende. Oder er ist als gegenwärtiges Bewußtsein am Anfang Wienur im Beginn seines Werdens, aber mit erworbenen Mitteln und der Möglichkeit einer realen Erinnerung auf einem neuen, schlechthin anderen Niveau.
Wurde bisher von Situation gesprochen, so in einer abstrakten Unbestimmtheit. Letzthin ist nur der einzelne in einer Situation. Von da übertragend denken wir die Situation von Gruppen, Staaten, der Menschheit, von Institutionen wie Kirche, Universität, Theater, von objektiven Gebilden wie Wissenschaft, Philosophie, Dichtung. Wie wir den Willen einzelner diese als ihre Sache ergreifen sehen, ist dieser Wille mit seiner Sache in einer Situation.
Situationen sind entweder ungewußt und werden wirksam, ohne daß der Betroffene weiß, wie es zugeht. Oder sie werden als gegenwärtige von einem seiner selbst bewußten Willen gesehen, der sie übernehmen, nutzen und wandeln kann. Die Situation als bewußt gemachte ruft auf zu einem Verhalten. Durch sie geschieht nicht automatisch ein Unausweichliches, sondern sie bedeutet Möglichkeiten und Grenzen der Möglichkeiten: was in ihr wird, hängt auch von dem ab, der in ihr steht, und davon, wie er sie erkennt. Das Erfassen der Situation ist von solcher Art, daß es sie schon ändert, sofern es Appell an Handeln und Sichverhalten möglich macht. Eine Situation zu erblicken ist der Beginn, ihrer Herr zu werden, sie ins Auge zu fassen, schon der Wille, der um ein Sein ringt. Wenn ich die geistige Situation der Zeit suche, so will ich ein Mensch sein; solange ich diesem Menschsein noch gegenüberstehe, denke ich über seine Zukunft und Verwirklichung nach; sobald ich aber selbst es bin, suche ich es denkend zu verwirklichen durch Erhellung der faktisch ergriffenen Situation in meinem Dasein.
Es fragt sich jeweils, welche Situation ich meine:
Das Sein des Menschen steht erstens als Dasein in ökonomischen, soziologischen, politischen Situationen, von deren Realität alles andere abhängt, wenn es auch durch sie allein nicht schon wirklich wird.
Das Dasein des Menschen als Bewußtsein steht zweitens in dem Raum dessen, was wißbar ist. Das geschichtlich erworbene, nun vorhandene Wissen in seinem Inhalt und in der Weise, wie gewußt und wie das Wissen methodisch geschieden und erweitert wird, ist Situation als die mögliche Klarheit des Menschen.
Was er selbst wird, ist drittens situationsbedingt durch die Menschen, die ihm begegnen, und durch die Glaubensmöglichkeiten, welche an ihn appellieren.
Wenn ich die geistige Situation suche, muß ich also beachten faktisches Dasein, mögliche Klarheit des Wissens, appellierendes Selbstsein in seinem Glauben, in denen allen der jeweils einzelne sich findet.Aus Karl Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, De Gruyter Verlag 1931
Das Zitat der Woche
.
Über die Emanzipation von Musik und Dichtung
Günther Patzig
.
Es mag sein, daß Dichtung als gebundene Form der Rede ihren Ursprung in magischen Vorstellungen hatte, daß ohne ein Ritual eine Tradition poetischer Sprachgestaltung nicht hätte entstehen können: Das bedeutet nicht, daß Dichtung demgegenüber nicht ihr Eigenrecht und Eigengesetz haben und entwickeln könnte. Musik und Gesang mögen nach den verschiedenen Hypothesen ihren Ursprung in der rhythmischen Akzentuierung von Arbeitsvorgängen bei gemeinsamen Arbeiten des Stammes haben, oder sie mögen in biologischen Präformationen als Medium der sexuellen Annäherung, vergleichbar dem Balzverhalten anderer Gattungen von Lebewesen, begründet sein: Das ist zwar ein interessantes Faktum, wenn es eins ist, das nicht vergessen werden sollte, wenn man über Musik und Dichtung spricht; aber es kann nicht zur Definition dessen, was Musik ist und welchen Normen sie unterstellt ist, dienen.
Das Sachgebiet Dichtung und das Sachgebiet Musik haben sich von ihren gesellschaftlichen oder biologischen Entstehungsbedingungen längst emanzipiert. Auch die Wissenschaft, Natur- wie Geisteswissenschaften, muß sich in ihrer inneren Sachbestimmtheit von den »leitenden Interessen« distanzieren. Das wissenschaftliche Interesse ist verschieden vom gesellschaftlichen Interesse an der Wissenschaft, daher kann das gesellschaftliche Interesse weder zur Definition noch zum Kriterium der Objektivität der Wissenschaft herangezogen werden.
Wie ein Segelflugzeug auf die Motorwinde oder ein Schleppflugzeug angewiesen ist, um seinen Flug beginnen zu können, so ist die Wissenschaft auf gesellschaftliches Interesse angewiesen, um in Gang zu kommen. Hat sie aber erst einmal die Region erreicht, in der sie vom Aufwind des Wahrheitsstrebens erfaßt wird, so gehorcht sie, wie das Segelflugzeug, ihren eigenen Gesetzen.Aus Günther Patzig, Erklären und Verstehen, Bemerkungen zum Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaften, in Neue Rundschau 84/3 1973
Das Zitat der Woche
.
Über die Realität im Schauspiel
Georg Simmel
.
Wie zurückhaltend und kritisch man auch über die »allgemeine Meinung«, über die Vox populi denken möge – die dunklen Ahnungen, Instinkte, Wertungen der groβen Masse haben in der Regel einen Kern von Zutreffendem und Zuverläβigem, den freilich eine dicke Schale von Oberflächlichem und Verblendetem umgibt; aber er wird im Religiösen und im Politischen, im Intellektuellen und Ethischen doch immer wieder als eine fundamentale Richtigkeit fühlbar werden.
Nur auf einem Gebiet, das sogar zugänglicher als jene anderen erscheint, zeigt sich das Urteil der Allgemeinheit als sozusagen von allen Göttern verlassen, gerade im Fundamentalen schlechthin unzulänglich: auf dem Gebiete der Kunst. Hier trennt ein brückenloser Abgrund die Meinung der Majorität von aller Einsicht in das Wesentliche, und in ihm wohnt die tiefe soziale Tragik der Kunst.
Der Schauspielkunst gegenüber, die mehr als jede andere an das unmittelbare Publikum appelliert, scheint deshalb allenthalben in dem Maβe von dessen massenmässiger Demokratisierung der Wertmaβstab sich von dem eigentlich Künstlerischen weg zu der Unmittelbarkeit des Natureindrucks zu wenden. Und, eigentümlich hiermit zusammenhängend, scheint das Wesen dieser Kunst selbst ihren Naturalismus tiefer als jede andere Kunst zu begründen. Denn so ungefähr wird dieses Wesen populär verstanden: durch den Schauspieler wurde das Dichtwerk »real gemacht«.
Das Drama besteht als abgeschlossenes Kunstwerk. Hebt der Schauspieler dies nun in eine Kunst zweiter Potenz? Oder wenn dies sinnlos ist, führt er, als leibhaftig lebende Erscheinung, es nicht doch in die überzeugende Wirklichkeit zurück? Warum aber, wenn dies der Fall ist, fordern wir von seiner Leistung den Eindruck von Kunst und nicht den von bloβer realer Natur? In diesen Fragen treffen sich alle kunstphilosophischen Probleme der Schauspielkunst.Die Bühnenfigur, wie sie im Buche steht, ist sozusagen kein ganzer Mensch, sie ist nicht ein Mensch im sinnlichen Sinne – sondern der Komplex des literarisch Erfassbaren an einem Menschen. Weder die Mienen noch den Tonfall, weder das Ritardando noch das Accelerando des Sprechens, weder die Gesten noch das Maβ anschaulicher Lebendigkeit der Gestalt kann der Dichter zeichnen oder auch wirklich unzweideutige Prämissen dafür geben. Er hat vielmehr Schicksal, Erscheinung, Seele dieser Gestalt in den nur eindimensionalen Verlauf des bloβ Geistigen projiziert. Diesen nun überträgt der Schauspieler gleichsam in die Dreidimensionalität der Vollsinnlichkeit. Und hier liegt das erste Motiv jener naturalistischen Verbannung der Schauspielkunst in die Wirklichkeit. Es ist die Verwechslung der Versinnlichung eines geistigen Gehaltes mit seiner Verwirklichung.
Wirklichkeit ist eine metaphysische Kategorie, in Sinnesimpressionen gar nicht auflösbar: der Inhalt, den der Dichter zum dramatischen gestaltet hat, zeigt ganz verschiedene Bedeutung, wenn er von da aus in die Kategorie sinnlicher Gestaltung wie wenn er in die der Wirklichkeit überginge. Der Schauspieler versinnlicht das Drama, aber er verwirklicht es nicht, und deshalb kann sein Tun Kunst sein, was Wirklichkeit ihrem Begriffe nach eben nicht sein könnte. So erscheint Schauspielerei zunächst als die Kunst der Vollsinnlichkeit, wie Malerei die Kunst der Augensinnlichkeit, Musik die der Gehörssinnlichkeit ist.
Innerhalb des realen Daseins ist jedes einzelne Stück und Ereignis in endlos weiterwebende Reihen räumlicher, begreiflicher, dynamischer Art eingestellt. Darum ist jede einzelne bezeichenbare Wirklichkeit ein Fragment, keine ist eine in sich geschlossene Einheit. Zu einer solchen aber die Inhalte des Daseins zu gestalten, ist das Wesen der Kunst. Der Schauspieler hebt alle Sichtbarkeiten und Hörbarkeiten der Wirklichkeitserscheinung in eine gleichsam eingerahmte Einheit: durch die Gleichmäβigkeit des Stiles, durch die Logik in Rhythmus und Ablauf der Stimmungen, durch die fühlbar gemachte Beziehung jeder Äuβerung auf den beharrenden Charakter, durch das Abzielen aller Einzelheiten auf die Pointe des Ganzen. Er ist der Stilisierer aller sinnlichen Beeindruckbarkeiten als einer Einheit.
Von neuem aber scheint an diesem Punkt die Realität in den Kunstbezirk einzubrechen, um eine innere Lücke in ihm zufüllen. Woher weiβ der Schauspieler sein durch die Rolle notwendig gemachtes Verhalten, da, wie ich andeutete, es in der Rolle nicht steht und nicht stehen kann? Mir scheint: wie sich Hamlet zu benehmen hat, kann der Schauspieler unmöglich anderswoher wissen, als aus der Erfahrung, der äuβeren und vor allem der inneren, wie ein Mensch, der wie Hamlet spricht und Hamlets Schicksal erlebt, sich in Wirklichkeit zu verhalten pflegt. Der Schauspieler taucht also, von dem Dichtwerk nur geführt, in den Realitätsgrund hinab, aus dem auch Shakespeare es erhoben hat, und erschafft von ihm aus das schauspielerische Kunstwerk Hamlet.
Die Dichtung führt den Schauspieler auf reale Koordinationen von Innerem und Äuβerem hin, von Schicksal und Reaktion, von Ereignissen und dem Luftton um sie herum – Koordinationen, zu denen auch jene Führung ihn nie bringen könnte, wenn er sie oder ihre schlusskräftigen Analogien nicht empirisch, in der Kategorie der Realität, kennen gelernt hätte.
Und nun schlieβt der Naturalismus: da der Schauspieler ausser dem Hamlet Shakespeares nur die empirische Wirklichkeit hat, an der er sich für alles von Shakespeare nicht Gesagte orientieren kann, so muss er sich so benehmen wie ein realer Hamlet, der auf die von Shakespeare vorgezeichneten Worte und Ereignisse festgelegt ist, sich benehmen würde. Dies ist dennoch ganz irrig; über jene Wirklichkeit, zu der der Schauspieler gleichsam an der Hand des Dramas hinabsteigt, über das sozusagen passiv gewonnene Wissen, das den Stoff für die Gestalt Hamlets bietet, kommt nun die Aktivität der künstlerischen Formung, der Aufbau des künstlerischen Eindrucks. Er hält an der empirischen Wirklichkeit nicht still. Jene realen Koordinationen werden umgelagert, die Akzente abgetönt, die Zeitmaβe rhythmisiert, aus allen Möglichkeiten, die diese Wirklichkeit gibt, das einheitlich zu Stilisierende ausgewählt. Kurz, der Schauspieler macht auch um dieser Unentbehrlichkeit der Realität willen nicht das dramatische Kunstwerk zur Realität, sondern umgekehrt, die Wirklichkeit, die jenes ihm zugewiesen hat, zum schauspielerischen Kunstwerk.
Wenn heute viele sensible Menschen ihre Aversion gegen das Theater damit begründen, dass ihnen dort zuviel vorgelogen wird, so liegt das Recht dazu nicht in seinem Zuwenig, sondern in seinem Zuviel an Wirklichkeit. Denn der Schauspieler überzeugt uns nur, indem er innerhalb der künstlerischen Logik verbleibt, nicht aber durch Hineinnehmen von Wirklichkeitsmomenten, die einer ganz anderen Logik folgen.Aus Georg Simmel, Der Schauspieler und die Wirklichkeit, Berliner Tageblatt, 1912
Aufgeschnappt
.
Kultur-Motion von Luc Recordon:
«In der Wirtschaftskrise die Kultur fördern!»
.
Der bekannte Lausanner Ständerat Luc Recordon – Ende 2008 war er offizieller Bundesrats-Kandidat der Grünen Partei Schweiz – hat im Parlament eine Motion eingereicht, welche unter dem Titel «In der einsetzenden wirtschaftlichen Krise die Kultur unterstützen» die Forderung an die Landesregierung stellt, «ein umfangreiches und rasch umsetzbares Programm zur Unterstützung der verschiedenen Kultursparten in der Schweiz auf die Beine zu stellen.»
In seiner kürzlichen Reaktion auf Recordons Vorstoß winkte der Bundesrat bereits ab – mit dem etwas wirren, hilflos wirkenden Hinweis darauf, dass ja das Budget 2009 im «Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege» um 9 Millionen Franken erhöht worden sei und diese Zusatzmittel für die Erhaltung denkmalgeschützter Objekte eingesetzt würde, wodurch «die Auftragslage der auf Denkmalpflege spezialisierten Bauunternehmen positiv beeinflusst» würde… Weitere spezifische Konjunkturmassnahmen im Kulturbereich seien jedenfalls nicht angezeigt.
Für das Schweizer Kulturleben – ob in Musik, Literatur, Film, Tanz oder Theater u.v.a. – bleibt also nur zu offen, dass diese intelligente Initiative aus dem Waadtland in den Rats- und Wandelhallen Berns auf offenere Ohren stößt als bei der zaghaften, um nicht zu sagen verzagten Exekutive des Landes…
Wir geben nachfolgend den Wortlaut der Motion wieder, um die kulturpolitisch weitsichtige Perspektive des Textes zu dokumentieren. (gm)
Eingereichter Text
Der Bundesrat wird beauftragt, ein umfangreiches und rasch umsetzbares Programm zur Unterstützung der verschiedenen Kultursparten in der Schweiz auf die Beine zu stellen.Begründung
Die Finanzkrise zieht eine Rezession nach sich. Diese kommt unweigerlich und könnte schlimmer ausfallen als befürchtet (auch deshalb, weil aus dem Finanzsektor weitere schlechte Nachrichten zu vermelden sind: Fälligkeiten von Subprime-Darlehen im Februar und im August 2009, verschärfte Unterdeckung von Kreditkarten in den USA, Platzen weiterer betrügerischer Blasen wie derjenigen von Madoff usw.). Nun zeigt die Erfahrung aber, dass Unentschlossenheit und abwartendes Verhalten in konjunkturpolitischen Fragen desaströs sind.Der Staat muss sehr rasch handeln – das sagt etwa der Wirtschafts-Nobelpreisträger 2008, Paul Krugman. Denn jede konjunkturpolitische Massnahme braucht eine gewisse Zeit, bis sie ihre Wirkung entfaltet, und jede starke Veränderung eines ökonomischen Zyklus wirkt selbstverstärkend, also prozyklisch («Schneeballeffekt»). Diesen Effekt muss man so früh wie möglich brechen. Nach Krugman müssen die Mittel, die in die Wirtschaft gepumpt werden, umfangreich sein, wenn sie wirken sollen: Es braucht 2 bis 4 Prozent des BIP, d. h. für die Schweiz zwischen 8 und 15 Milliarden Franken. Es ist ganz klar, dass die Exportwirtschaft unterstützt werden muss, aber das reicht nicht aus. Wenn es darum geht, öffentliche Gelder sinnvoll einzusetzen, wird der Kulturbereich regelmässig unterschätzt. Die gegenwärtige Situation ist deshalb günstig, um diesem Mangel abzuhelfen. Es sollen alle Mittel und Wege geprüft werden, wie die verschiedenen Sparten der Kultur gefördert werden können. Diese leisten einen beträchtlichen Beitrag zum Wohlstand unseres Landes im weitesten Sinn. Zu bedenken ist etwa, dass die Kultur nicht unerheblich den Konsum und den Tourismus ankurbeln hilft. Dabei spielen die verschiedensten Bereiche eine Rolle: Film, Theater, Literatur, Tanz, Musik, bildende Künste, Fotografie, Verlags- und Druckwesen usw. Zu erwähnen sind auch die günstigen Auswirkungen staatlicher Kulturförderung auf die oft schwierigen finanziellen Verhältnisse der Kulturschaffenden und anderer im Kulturbereich tätiger Personen. Schliesslich sollte auch der Wert der internationalen Ausstrahlung unserer Kultur in Betracht gezogen werden.
.
.
.
.
Aufgeschnappt
.
Richard Wagner in Israel immer noch gebannt
Nach wie vor scheint die Musik des deutschen Opern-Genies Richard Wagner in Israel absolut unerwünscht zu sein. Und gemäß David Stern, dem neuen Music Director der Israeli Opera in Tel Aviv, wird sich daran auch in Zukunft nichts ändern. Denn obwohl das Oberste Gericht Israels vor einigen Jahren entschied, dass es nicht verboten sei, im Lande Wagner-Musik zu spielen, ist der geniale Romantiker und «Tristan»-Schöpfer für viele Israelis ein Sinnbild für die Kultur der deutschen Nationalsozialisten und antisemitischen Ideologien. Dirigent Stern unlängst im «Wall Street Journal» dazu: «Das ist kein großer Verlust für das israelische Publikum, es gibt vieles anderes, das es sich in Israel zu dirigieren lohnt.»
Grimme Online Award 2009
.
Wettbewerb für hochwertige Websites
 Mit dem «Grimme Online Award» des deutschen Adolf-Grimme-Institutes werden qualitativ hochwertige Websites ausgezeichnet. In vier Kategorien werden insgesamt maximal acht Preise vergeben. Eine unabhängige Nominierungskommission und Jury – Journalisten, Medienwissenschaftler, Internet-Experten und Fachleute aus Kultur und Bildung – bewerten sowohl inhaltliche, funktionale als auch gestalterische Aspekte. Sie orientieren sich bei der Beurteilung an internetspezifischen Bewertungsmaßstäben. Zudem spielen auch journalistische Qualität, soziale Verantwortung und gesellschaftliche Relevanz eine Rolle. Vorschläge einreichen können Sender, Agenturen, Produktionsfirmen oder andere Medien- bzw. Online-Anbieter, aber ebenso alle Internet-Nutzer/innen.
Mit dem «Grimme Online Award» des deutschen Adolf-Grimme-Institutes werden qualitativ hochwertige Websites ausgezeichnet. In vier Kategorien werden insgesamt maximal acht Preise vergeben. Eine unabhängige Nominierungskommission und Jury – Journalisten, Medienwissenschaftler, Internet-Experten und Fachleute aus Kultur und Bildung – bewerten sowohl inhaltliche, funktionale als auch gestalterische Aspekte. Sie orientieren sich bei der Beurteilung an internetspezifischen Bewertungsmaßstäben. Zudem spielen auch journalistische Qualität, soziale Verantwortung und gesellschaftliche Relevanz eine Rolle. Vorschläge einreichen können Sender, Agenturen, Produktionsfirmen oder andere Medien- bzw. Online-Anbieter, aber ebenso alle Internet-Nutzer/innen.
Der Award läuft vom vom 1. Februar bis zum 31. März 2009, die Einzelheiten finden sich hier.
Das Zitat der Woche
.
Vom Hassen und Lieben
Sigmund Freud
.
Sie verwundern sich darüber, dass es so leicht ist, die Menschen für den Krieg zu begeistern, und vermuten, dass etwas in ihnen wirksam ist, ein Trieb zum Hassen und Vernichten, der solcher Verhetzung entgegenkommt. Wiederum kann ich Ihnen nur uneingeschränkt beistimmen. Wir glauben an die Existenz eines solchen Triebes und haben uns gerade in den letzten Jahren bemüht, seine Äußerungen zu studieren. Darf ich Ihnen aus diesem Anlass ein Stück der Trieblehre vortragen, zu der wir in der Psychoanalyse nach vielem Tasten und Schwanken gekommen sind?
Wir nehmen an, dass die Triebe des Menschen nur von zweierlei Art sind, entweder solche, die erhalten und vereinigen wollen – wir heißen sie erotische, ganz im Sinne des Eros im Symposion Platos, oder sexuelle mit bewusster Überdehnung des populären Begriffs von Sexualität – und andere, die zerstören und töten wollen; wir fassen diese als Aggressionstrieb oder Destruktionstrieb zusammen. Sie sehen, das ist eigentlich nur die theoretische Verklärung des weltbekannten Gegensatzes von Lieben und Hassen, der vielleicht zu der Polarität von Anziehung und Abstoßung eine Urbeziehung unterhält, die auf Ihrem Gebiet eine Rolle spielt. Nun lassen Sie uns nicht zu rasch mit den Wertungen von Gut und Böse einsetzen. Der eine dieser Triebe ist ebenso unerlässlich wie der andere, aus dem Zusammen- und Gegeneinanderwirken der Beiden gehen die Erscheinungen des Lebens hervor. Nun scheint es, dass kaum jemals ein Trieb der einen Art sich isoliert betätigen kann, er ist immer mit einem gewissen Betrag von der anderen Seite verbunden, wie wir sagen: legiert, der sein Ziel modifiziert oder ihm unter Umständen dessen Erreichung erst möglich macht. So ist z.B. der Selbsterhaltungstrieb gewiss erotischer Natur, aber grade er bedarf der Verfügung über die Aggression, wenn er seine Absicht durchsetzen soll. Ebenso benötigt der auf Objekte gerichtete Liebestrieb eines Zusatzes vom Bemächtigungstrieb, wenn er seines Objekts überhaupt habhaft werden soll. Die Schwierigkeit, die beiden Triebarten in ihren Äußerungen zu isolieren, hat uns ja so lange in ihrer Erkenntnis behindert.Wenn Sie mit mir ein Stück weitergehen wollen, so hören Sie, dass die menschlichen Handlungen noch eine Komplikation von anderer Art erkennen lassen. Ganz selten ist die Handlung das Werk einer einzigen Triebregung, die an und für sich bereits aus Eros und Destruktion zusammengesetzt sein muss. In der Regel müssen mehrere in der gleichen Weise aufgebaute Motive zusammentreffen, um die Handlung zu ermöglichen. […] Wenn also die Menschen zum Krieg aufgefordert werden, so mögen eine ganze Anzahl von Motiven in ihnen zustimmend antworten, edle und gemeine, solche, von denen man laut spricht, und andere, die man beschweigt. Wir haben keinen Anlass, sie alle bloßzulegen. Die Lust an der Aggression und Destruktion ist gewiss darunter; ungezählte Grausamkeiten der Geschichte und des Alltags bekräftigen ihre Existenz und ihre Stärke. Die Verquickung dieser destruktiven Strebungen mit anderen erotischen und ideellen erleichtert natürlich deren Befriedigung. Manchmal haben wir, wenn wir von den Gräueltaten der Geschichte hören, den Eindruck, die ideellen Motive hätten den destruktiven Gelüsten nur als Vorwände gedient, andere Male z.B. bei den Grausamkeiten der Inquisition, meinen wir, die ideellen Motive hätten sich im Bewusstsein vorgedrängt, die destruktiven ihnen eine unbewusste Verstärkung gebracht. Beides ist möglich.
Ich habe Bedenken, Ihr Interesse zu missbrauchen, das ja der Kriegsverhütung gilt, nicht unseren Theorien. Doch möchte ich noch einen Augenblick bei unserem Destruktionstrieb verweilen, dessen Beliebtheit keineswegs Schritt hält mit seiner Bedeutung. Mit etwas Aufwand von Spekulation sind wir nämlich zu der Auffassung gelangt, dass dieser Trieb innerhalb jedes lebenden Wesens arbeitet und dann das Bestreben hat, es zum Zerfall zu bringen, das Leben zum Zustand der unbelebten Materie zurückzuführen. Er verdiente in allem Ernst den Namen eines Todestriebes, während die erotischen Triebe die Bestrebungen zum Leben repräsentieren. Der Todestrieb wird zum Destruktionstrieb, indem er mit Hilfe besonderer Organe nach außen, gegen die Objekte, gewendet wird. Das Lebewesen bewahrt sozusagen sein eigenes Leben dadurch, dass es fremdes zerstört. Ein Anteil des Todestriebes verbleibt aber im Innern des Lebewesens tätig und wir haben versucht, eine ganze Anzahl von normalen und pathologischen Phänomenen von dieser Verinnerlichung des Destruktionstriebes abzuleiten. Wir haben sogar die Ketzerei begangen, die Entstehung unseres Gewissens durch eine solche Wendung der Aggression nach innen zu erklären. Sie merken, es ist gar nicht so unbedenklich, wenn sich dieser Vorgang in allzu großem Ausmaß vollzieht, es ist direkt ungesund, während die Wendung dieser Triebkräfte zur Destruktion in der Außenwelt das Lebewesen entlastet, wohltuend wirken muss. Das diene zur biologischen Entschuldigung all der hässlichen und gefährlichen Strebungen, gegen die wir ankämpfen. Man muss zugeben, sie sind der Natur näher als unser Widerstand dagegen, für den wir auch noch eine Erklärung finden müssen. Vielleicht haben Sie den Eindruck, unsere Theorien seien eine Art von Mythologie, nicht einmal eine erfreuliche in diesem Fall. Aber läuft nicht jede Naturwissenschaft auf eine solche Art von Mythologie hinaus?Sigmund Freud an Albert Einstein, Wien 1932, in: Warum Krieg?, Briefwechsel Einstein-Freud, Diogenes Verlag 1972
Jörg Dauscher: «Nach Albanien»
.
Poetischer Albanien-Bilderbogen
.
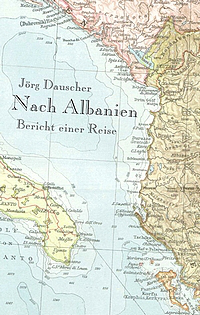 Albanien hat schon alles hinter sich: Zusammenbruch der Industrie, des Finanzsystems, der Märkte. Jörg Dauschers Taschenbuch «Nach Albanien» berichtet vom Leben nach der Krise.
Albanien hat schon alles hinter sich: Zusammenbruch der Industrie, des Finanzsystems, der Märkte. Jörg Dauschers Taschenbuch «Nach Albanien» berichtet vom Leben nach der Krise.
Mit viel Sympathie für Land und Leute schildert er den Alltag in einem nord-albanischen Dorf. Improvisation, Subsistenzwirtschaft und Knappheit bestimmen das Alltagsleben. Dauscher beleuchtet sowohl die schwierigen als auch die reizvollen Seiten eines postindustriellen Zustandes. Dabei ergeben einzelne kurzen Szenen, Beobachtungen und Reflexionen einen poetischen Bilderbogen eines Landes im Umbruch.
Vor zwei Jahren war Dauscher bei einer albanischen Familie zu Gast und wohnte einige Zeit in Nordalbanien. Anschließend bereiste er das gesamte Land bis hinunter zur Südküste. Die gesammelten Eindrücke und Erfahrungen hat er auf knapp 80 Seiten zu einem aufschlussreichen Reisebericht verwoben.
«Nach Albanien» ist die erste literarische Veröffentlichung des 1975 geborenen Berliners. (gm)
Jörg Dauscher, Nach Albanien, Bericht einer Reise, 76 Seiten, BoD/Norderstedt, ISBN 978-3-837-08134-3
.
.
Wer bin ich?
.
Ein Abgrund an Visionen
Ein berühmter Schriftsteller und Zeitgenosse beschrieb mich einmal so: «Er lachte wenig, deklamierte wenig, rauchte wenig, und er trank wenig. Er saß an seinem Tisch, ein Blatt Papier vor sich, eine Feder oder einen Stift in der Hand, manchmal lächelte er, und er zeichnete unentwegt. Was brachte er zu Papier? Er selber wusste es nicht. Eine Laune, die an Wahnsinn grenzte, führte seinen Stift.»
Meine Gegner und Anhänger schwankten zwischen Furcht vor und Bewunderung für mein künstlerisches Werk. Die bizarren Irrationalitäten, die zynischen Perversionen, die grotesken Hybriditäten, die aus jedem Strich meiner illusionären Illustrationen schießen, stießen und stoßen noch heute auf Ehrfurcht wie Angst. Zumal den «Reichen und Mächtigen dieser Erde» blieb angesichts meiner bitterbösen Karikaturen jedes Lachen im Halse stecken.
Und je länger ich lebte und zeichnete, je phantastischer meine zahllosen Schwarz-Weiß-Werke wurden, desto deutlicher überschritt ich alle Dimensionen von Raum und Zeit: «Ein Abgrund an Visionen, durch eine verzweifelte Lustigkeit kaum gemildert, tat sich den Zeitgenossen, tut sich den Nachfahren auf», meinte einer meiner Biographen. Die nachstehende kleine Galerie verdeutlicht, wovon die Rede ist.
Also: Wer bin ich?
Das Zitat der Woche
.
Der moderne U-Journalismus
Sigrid Löffler
.
Wir erleben zur Zeit einen Umbruch im Selbstverständnis der Journalisten, einen Funktionswandel von Journalismus überhaupt – weg vom kritisch argumentierenden Informationsjournalismus (E-Journalismus), hin zum pflegeleichten und marktfreundlichen Dienstleistungsjournalismus (U-Journalismus).
Der E-Journalismus läßt sich bekanntlich nicht rationalisieren. Und zwar deshalb nicht, weil man die Herstellung von Qualitäts-Information nicht technisch vereinfachen kann. Für die Produktion von Information sind Recherche, Analyse und kritisches Urteil erforderlich, die in der Beschaffung aufwendig, mühsam und teuer sind. Der E-Journalismus läßt sich nicht rationalisieren, er läßt sich nur umgehen. Man kann ihn durch Surrogate und Imitate ersetzen, man kann ihn durch Billig-Kopien substituieren. Eben dies ist eine Strategie des U-Journalismus.Der U-Journalismus ist Journalismus light. Er sieht sich als Vehikel der Unterhaltung, nicht als Instrument ernstgemeinter Information. Seine politische Haltung orientiert sich an den Markt-Erfordernissen. Politische Inhalte sind transformiert zur Markt-Veranstaltung. Der U-Journalismus versteht sich nicht mehr als Transporteur von Meldungen, er versteht sich schon gar nicht als kritische Instanz mit ausgebildeter und unabhängiger Urteilskraft, und schon überhaupt nicht als Kontrollinstanz für die Mächtigen, gar als Wahrheitsbeschaffer der Demokratie. Der U-Journalist versteht sich ausschließlich als Mittler zwischen Konsum und Konsument. Er ist ein Marktschreier, er ist ein Entertainer, ein fröhlicher Kumpel jedweder Prominenz und zugleich deren Verlautbarungsorgan. Einschmeichelnd schreibt er der Prominenz nach dem Munde und schmiegt sich deren Erfolgsreichtum an, in kuschelweichem Opportunismus. Er ist kein Journalist im herkömmlichen Sinn, er ist bestenfalls Journalismus-Darsteller.
Vom Typus her ist der U-Journalist der realitätstüchtige Landsknecht, der von jedem Medien-Condottiere angeheuert und beliebig eingesetzt werden kann. Vorausgesetzt, der Sold stimmt. Mit dem Sold ist auch sein Wohlverhalten erkauft. «Pack Journalism» lautet der neueste Modebegriff für jenen Journalisten-Typus, der öffentliche Meinung bloß noch kopiert und simuliert, der schreibt, was gefällt – nicht, was geschah.
Eben weil sich die Produktion von Information nicht rationalisieren läßt, produziert der Unterhaltungs-Journalismus nur noch entweder Soft-News oder Hard-News in Billig-Ausgabe und Pseudo-Fasson – also Talmi-Imitationen von harter Fakten-Recherche. Der U-Journalist sieht sich als Teilnehmer und Bestandteil der Entertainment-Industrie. Information ist eine Ware, und diese Ware soll unterhalten. Unterhaltsamkeit verlangt Anstrengungslosigkeit. Entertainment soll mühelos sein. Auch Urteilskompetenz ist eine Ware, wenn auch keine sonderlich gefragte, weil ihr Unterhaltungswert begrenzt ist und weil sie unter Umständen einen gewissen Denk- und Konzentrationsaufwand erfordert und Aufmerksamkeit erheischt, wo doch eher das flüchtige Durchblättern und Durch-Zappen angesagt scheint. Entweder also läßt sich die Urteilskompetenz zum Entertainment umwandeln, oder sie wird verschwinden. ♦Aus: Sigrid Löffler, Gedruckte Videoclips, Vom Einfluß des Fernsehens auf die Zeitungskultur, Picus Verlag 1997
Das Zitat der Woche
.
Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit
Walter Benjamin
.
Die ältesten Kunstwerke sind, wie wir wissen, im Dienst eines Rituals entstanden, zuerst eines magischen, dann eines religiösen. Es ist nun von entscheidender Bedeutung, daß diese auratische Daseinsweise des Kunstwerks niemals durchaus von seiner Ritualfunktion sich löst. Mit anderen Worten: Der einzigartige Wert des echten Kunstwerks hat seine Fundierung im Ritual, in dem es seinen originären und ersten Gebrauchswert hatte. Diese mag so vermittelt sein sie will, sie ist auch noch in den profansten Formen des Schönheitsdienstes als säkularisiertes Ritual erkennbar. Der profane Schönheitsdienst, der sich mit der Renaissance herausbildet, um für drei Jahrhunderte in Geltung zu bleiben, läßt nach Ablauf dieser Frist bei der ersten schweren Erschütterung, von der er betroffen wurde, jene Fundamente deutlich erkennen. Als nämlich mit dem Aufkommen des ersten wirklich revolutionären Reproduktionsmittels, der Photographie (gleichzeitig mit dem Anbruch des Sozialismus), die Kunst das Nahen der Krise spürte, die nach weiteren hundert Jahren unverkennbar geworden ist, reagierte sie mit der Lehre vom l’art pour l’art, die eine Theologie der Kunst ist. Aus ihr ist dann weiterhin geradezu eine negative Theologie in Gestalt der Idee einer «reinen» Kunst hervorgegangen, die nicht nur jede soziale Funktion, sondern auch jede Bestimmung durch einen gegenständlichen Vorwurf ablehnt. (In der Dichtung hat Mallarmé als erster diesen Standort erreicht.)
Diese Zusammenhänge zu ihrem Recht kommen zu lassen, ist unerläßlich für eine Betrachtung, die es mit dem Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit zu tun hat. Denn sie bereiten die Erkenntnis, die hier entscheidend ist, vor: die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerkes emanzipiert dieses zum erstenmal in der Weltgeschichte von seinem parasitären Dasein am Ritual. Das reproduzierte Kunstwerk wird in immer steigendem Maße die Reproduktion eines auf Reproduzierbarkeit angelegten Kunstwerkes. Von der photographischen Platte zum Beispiel ist eine Vielheit von Abzügen möglich; die Frage nach dem echten Abzug hat keinen Sinn. In dem Augenblick aber, da der Maßstab der Echtheit an der Kunstproduktion versagt, hat sich auch die gesamte Funktion der Kunst umgewälzt. An die Stelle ihrer Fundierung aufs Ritual tritt ihre Fundierung auf eine andere Praxis: nämlich ihre Fundierung auf Politik.
(Aus: Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Suhrkamp Verlag 1955)
Internationales Musik-Symposium in Oldenburg
.
«Böse.Macht.Musik» – Das klingend Diabolische
Dr. Markus Gärtner
.
Ist es ein Wagnis, Verknüpfungen aufzeigen zu wollen zwischen der «unpolitischen», «gefühlvollen» oder wie auch sonst pseudoromantisch verklärten Musik und der Macht des Bösen? Womöglich, aber gerade angesichts der sich kontinuierlich wandelnden globalen Mediengesellschaft muss es der Wissenschaft umso mehr ein Anliegen sein, neue – auch sperrige – Sicht- und Denkweisen anzuregen.  Dieser Aufgabe hat sich das studentische Organisationsteam des vom 10. bis zum 13. Oktober 2008 stattfindenden Oldenburger Symposiums gestellt, das interessierte Studierende, ausübende Musiker/innen, Doktorand/innen und junge Wissenschaftler/innen aus Musikwissenschaft und Nachbardisziplinen einlädt, über Fragestellungen nachzudenken, die mit dem Klischee einer semantisch ausschließlich positiv besetzten Musik brechen. –
Dieser Aufgabe hat sich das studentische Organisationsteam des vom 10. bis zum 13. Oktober 2008 stattfindenden Oldenburger Symposiums gestellt, das interessierte Studierende, ausübende Musiker/innen, Doktorand/innen und junge Wissenschaftler/innen aus Musikwissenschaft und Nachbardisziplinen einlädt, über Fragestellungen nachzudenken, die mit dem Klischee einer semantisch ausschließlich positiv besetzten Musik brechen. –
Seit jeher kennt die philosophische Ethik das Böse als einen zentralen Begriff. Auffälligerweise jedoch sparen die zahlreichen Ansätze einer «Ästhetik des Bösen» den musikalischen Bereich bisher aus. Das Thema «Böse.Macht.Musik» eröffnet Anknüpfungspunkte zu verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen − von der Musikologie über die Philosophie bis hin zur Medien- und Politikwissenschaft. Denn das Böse ist nicht nur ein Grundbegriff zahlreicher Religionen, sondern es bildet seit jeher auch einen zentralen Terminus der philosophischen Ethik. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert etablierte es sich außerdem als ästhetische Kategorie, welche von unmittelbar moralischen Aspekten losgelöst erscheint. Ob nun bei der Lektüre von Charles Baudelaires Gedichtzyklus «Les fleurs du mal» oder bei medial vermittelter Kriegsberichterstattung: Das Böse hat eine ästhetische Anziehungskraft. Allerdings sparen die zahlreichen Ansätze einer «Ästhetik des Bösen» den musikalischen Bereich bisher weitgehend aus. Das Symposium soll als Impuls dienen, diese Lücke zu schließen.

Wagner-Musik beim Massen-Töten – Szene aus F. Coppolas Kult-Film «Apocalypse Now»: Amerikanische Kriegs-Helikopter mähen vietnamesische Zivilisten nieder, zu Klängen des «Walküren-Ritts» (YouTube)
Vorsätzlich haben die Organisatoren ihr Thema sehr weiträumig aufgefasst. Das Symposium versteht sich als Forum, das einerseits den aktuellen Stand der Forschung widerspiegeln, darüber hinaus das «Böse» als ästhetische Idee zu fassen bekommen möchte – ohne Scheuklappen vor unbequemen Antworten. Wo Verbindungslinien bestehen zwischen dem angeblich so lichten Reich der Musik und der Macht des Bösen, wo nach der Differenzierung von Karl Rosenkranz’ «Ästhetik des Häßlichen» (1853) das Verbrecherische, das Gespenstische und das Diabolische zu klingen beginnen, dort werden junge Forscher tiefer bohren und tönende Materialisationen des Bösen genauer unter die Lupe nehmen.
Durch die Beteiligung von Referenten aus unterschiedlichen Ländern wie Kanada, Serbien, Polen und den USA wird es möglich, verschiedene nationale Denk- und Wissenschaftstraditionen als Grundlage für die Beantwortung der skizzierten Fragen heran zu ziehen. So bietet das Symposium die Möglichkeit zum direkten Austausch von Wissenschaftlern, Studenten, Künstlern und Interessierten − und das auf internationaler Ebene. – Ein vollständiges Programm mit allen Vorträgen und künstlerischen Beiträgen kann im Internet abgerufen werden. (M.Gärtner, Teamleiter «Inhaltliche Konzeption») ■
«Böse.Macht.Musik» – Internationales studentisches Symposium vom 10.-13. Oktober 2008, Institut für Musik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Das Symposium findet unter Trägerschaft des DVSM e.V. – Dachverband der Studierenden der Musikwissenschaft – statt.)
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über den Kampf der Generationen
Konrad Lorenz
Es ist eine recht beunruhigende Tatsache, daß die heutige jüngere Generation ganz unzweideutig beginnt, die ältere als eine fremde Pseudo-Spezies zu behandeln.
Dies drückt sich in vielerlei Symptomen aus. Konkurrierende und feindliche ethnische Gruppen pflegen in betonter Weise verschiedene Trachten auszubilden oder ad hoc zu schaffen. In Mitteleuropa sind ortskennzeichnende Bauerntrachten längst verschwunden, nur in Ungarn sind sie überall dort in vollster Ausbildung erhalten geblieben, wo ungarische und slowakische Dörfer dicht nebeneinanderliegen. Dort trägt man seine Tracht mit Stolz, und zwar ganz eindeutig mit der Absicht, die Mitglieder der anderen ethnischen Gruppen zu ärgern. Genau dies tun sehr viele selbstkonstituierte Gruppen rebellierender Jugendlicher, wobei es ganz erstaunlich ist, wie sehr sich bei ihnen – trotz angeblicher größter Ablehnung alles Militärischen – der Drang zur Uniformierung durchsetzt. Die verschiedenen Untergruppen der Beatniks, Teddyboys, Rocks, Mods, Rockers, Hippies, Gammler usw. sind dem «Fachmann» an ihrer Tracht ebenso sicher erkennbar, wie die Regimenter des kaiserlich-königlich österreichischen Heeres es einmal waren.
In Sitten und Gebräuchen sucht die rebellierende Jugend sich ebenfalls so scharf wie nur möglich von der Elterngeneration zu distanzieren, und zwar nicht etwa dadurch, daß sie deren herkömmliches Verhalten einfach ignoriert, sondern indem sie jede kleinste Einzelheit wohl beachtet und in das genaue Gegenteil verkehrt. Darin liegt zum Beispiel eine der Erklärungen für das Auftreten sexueller Exzesse bei Menschengruppen, deren allgemeine sexuelle Potenz anscheinend erniedrigt ist. Ebenfalls nur aus dem intensiven Wunsch nach Durchbrechung elterlicher Verbote zu erklären ist es, wenn rebellierende Studenten öffentlich urinieren und defäkieren, wie das an der Wiener Universität vorgekommen ist.
Die Motivation all dieser merkwürdigen, ja bizarren Verhaltensweisen ist den betreffenden jungen Menschen völlig unbewußt, und sie geben die verschiedensten, oft recht überzeugend klingenden Pseudo-Rationalisierungen für ihr Benehmen an: Sie protestieren gegen die allgemeine Gefühllosigkeit ihrer reichen Eltern, für Arme und Hungernde, gegen den Krieg in Vietnam, gegen die Eigenmächtigkeit der Universitätsbehörden, gegen sämtliche «Establishments» aller Richtungen – wenn auch merkwürdig selten gegen die Vergewaltigung der Tschechoslowakei durch die Sowjetunion. In Wirklichkeit aber richtet sich der Angriff ziemlich wahllos gegen alle älteren Menschen, ohne irgendwelche Berücksichtigung ihres politischen Bekenntnisses. Die linksradikalsten Professoren werden von linksradikalen Studenten nicht merklich weniger beschimpft als rechts orientierte; H. Marcuse wurde einmal von kommunistischen Studenten unter der Führung Cohn-Bendits in der gröblichsten Weise beschimpft und mit wahrhaft hirnerweichten Anschuldigungen überhäuft, zum Beispiel wurde ihm vorgeworfen, daß er vom CIA bezahlt werde. Der Angriff war nicht dadurch motiviert, daß er einer anderen politischen Richtung, sondern ausschließlich dadurch, daß er einer anderen Generation angehört.
Ebenso unbewußt und gefühlsmäßig versteht die ältere Generation die angeblichen Proteste als das, was sie wirklich sind, als haßerfüllte Kampfansagen und Beschimpfung. So kommt es zu einer rapiden und gefährlichen Eskalation eines Hasses, der – wie schon gesagt – wesensverwandt mit dem Haß verschiedener ethnischer Gruppen, d. h. mit nationalem Haß ist. Selbst als geübter Ethologe finde ich es schwer, auf die schöne blaue Bluse des wohlsituierten Kommunisten Cohn-Bendit nicht mit Zorn zu reagieren, man braucht nur den Gesichtsausdruck solcher Leute zu beobachten, um zu wissen, daß diese Wirkung erwünscht ist. All dies verringert die Aussichten auf eine Verständigung auf ein Minimum.
Sowohl in meinem Buch über Aggression (1963) wie in öffentlichen Vorträgen (1968, 1969) habe ich die Frage diskutiert, worin wahrscheinlich die ethologischen Ursachen des Generationen-Krieges zu suchen seien, ich kann mich daher hier auf das Allernötigste beschränken. Dem ganzen Erscheinungskreise liegt eine Funktionsstörung des Entwicklungsvorganges zugrunde, der sich beim Menschen in der Pubertätszeit abspielt. Während dieser Phase beginnt sich der junge Mensch von den Traditionen des Elternhauses zu lösen, sie kritisch zu prüfen und Umschau nach neuen Idealen zu halten, nach einer neuen Gruppe, der er sich anschließen und deren Sache er zu der seinen machen kann. Der instinktive Wunsch, für eine gute Sache auch kämpfen zu können, ist für die Objektwahl ausschlaggebend, besonders bei jungen Männern. In dieser Phase erscheint das Altüberkommene langweilig und alles Neue anziehend, man könnte von einer physiologischen Neophilie sprechen.
Ohne allen Zweifel hat dieser Vorgang einen hohen Arterhaltungswert, um dessentwillen er in das phylogenetisch entstandene Programm menschlicher Verhaltensweisen aufgenommen wurde. Seine Funktion liegt darin, der sonst allzu starren Überlieferung kultureller Verhaltensnormen einige Anpassungsfähigkeit zu verleihen, und ist hierin etwa der Häutung eines Krebses zu vergleichen, der sein starres Außenskelett abwerfen muss, um wachsen zu können. Wie bei allen festen Strukturen, muß auch bei der kulturellen Überlieferung die unentbehrliche Stützfunktion durch den Verlust von Freiheitsgraden erkauft werden, und wie bei allen anderen bringt der Abbau, der um jeder Umkonstruktion willen nötig wird, bestimmte Gefahren mit sich, da zwischen Ab- und Neuaufbau notwendigerweise eine Periode der Halt- und Schutzlosigkeit liegt. Dies ist bei dem sich häutenden Krebs und beim pubertierenden Menschen in analoger Weise der Fall.
Normalerweise folgt auf die Periode der physiologischen Neophilie ein Wiederaufleben der Liebe zum Althergebrachten. Das kann ganz allmählich vor sich gehen, die meisten von uns Älteren können Zeugnis davon ablegen, daß man mit Sechzig eine weit höhere Meinung von vielen Anschauungen seines Vaters hat als mit Achtzehn. A. Mitscherlich nennt dieses Phänomen treffend den »späten Gehorsam«. Die physiologische Neophilie und der späte Gehorsam bilden zusammen ein System, dessen systemerhaltende Leistung darin liegt, ausgesprochen veraltete und neuer Entwicklung hinderliche Elemente der überlieferten Kultur auszumerzen, ihre wesentliche und unentbehrliche Struktur indessen weiter zu bewahren.
(Aus Konrad Lorenz: Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, Piper-Verlag 1973)
Essay: «Wozu Literatur?»
.
Der literarische Text als Geschehnis
Arnold Leifert
.
 «Wozu Literatur?»- Was denn versteht der Fragende unter «Literatur»?1) Und selbst wenn mit dem Stichwort «Belletristik» geantwortet wird – dies ist beruhigend, denn für alle andere, primär und nur unterhaltende, vielleicht auch triviale Literatur beantwortet sich die Frage selbst, – «Belletristik» also, poetische und prosaische Literatur: Der Roman, die Novelle, die kurzen Formen der modernen Prosa, das Drama, das Hörspiel, das Gedicht…
«Wozu Literatur?»- Was denn versteht der Fragende unter «Literatur»?1) Und selbst wenn mit dem Stichwort «Belletristik» geantwortet wird – dies ist beruhigend, denn für alle andere, primär und nur unterhaltende, vielleicht auch triviale Literatur beantwortet sich die Frage selbst, – «Belletristik» also, poetische und prosaische Literatur: Der Roman, die Novelle, die kurzen Formen der modernen Prosa, das Drama, das Hörspiel, das Gedicht…
Auf den ersten Blick könnte man versucht sein, für die verschiedenen Gattungen auch verschiedene Antworten finden zu wollen. Allein: in der deutschen Literatur von 1945 bis heute verweigern sich alle Gattungen dieser Frage, und bekennen sich zugleich ebenso alle zu dieser Frage: «Wozu?»
Wonach aber fragt sie? Nach dem Selbstverständnis des Autors, im Sinne einer ihn treibenden Zielsetzung, Intention, gar Absicht der (Welt-)Veränderung? Oder ist sie gestellt aus der Überschau-Sicht des Historikers und Literatur-Theoretikers, der die Wirkungsgeschichte einzelner Werke oder Epochen im nachhinein und de facto versucht aufzuspüren?
Wozu Literatur? – Grammatikalisch suggeriert dies eine Auskunft über den «Zweck» dieses etwas «verdächtig nutzlosen Unterfangens» namens Literatur. Und heute diese Frage zu stellen, in einer Zeit pervers auf die Spitze getriebenen, technokratischen wie materialistischen Zweckansinnens an alles menschliche Tun, scheint tatsächlich provokant notwendig.  Die Zyniker unter den «Realisten» und Machern in unserer heutigen literarischen Welt haben die Frage längst in ihrem merkantilen Sinne beantwortet: Der Literaturbetrieb, die großen Verlage leben von der «großen Auflage»; ein Buch, das sich eignet, wird «gemacht», die Kasse stimmt, der «Zweck» ist erfüllt. Eine nicht zu unterschätzende Entwicklung; denn schon heute beginnt dieser marktorientierte Umgang mit Literatur das eigentliche Bild unserer literarischen Jahre nachhaltig zu verzerren und zu verschleiern.
Die Zyniker unter den «Realisten» und Machern in unserer heutigen literarischen Welt haben die Frage längst in ihrem merkantilen Sinne beantwortet: Der Literaturbetrieb, die großen Verlage leben von der «großen Auflage»; ein Buch, das sich eignet, wird «gemacht», die Kasse stimmt, der «Zweck» ist erfüllt. Eine nicht zu unterschätzende Entwicklung; denn schon heute beginnt dieser marktorientierte Umgang mit Literatur das eigentliche Bild unserer literarischen Jahre nachhaltig zu verzerren und zu verschleiern.
Immer wieder kann man in Interviews, Gesprächen, poetologischen Exkursen usw. erleben, dass – und es sind wahrscheinlich die meisten von ihnen – die Autoren aller Gattungen, wenn sie gefragt werden: «Zu welchem Zweck schreiben Sie? Glauben Sie, mit Literatur gesellschaftlich etwas verändern zu können?», diese Frage verneinen: «Zunächst schreibe ich für mich selbst! Über die Wirkungslosigkeit von Literatur mache ich mir keine Illusionen!»
Dass bei diesen Antworten dennoch auch heutigen Autoren diese Frage immer wieder gestellt wird, erklärt sich wahrscheinlich aus der Entwicklung der deutschen Nachkriegsliteratur selbst. Sah es in ihr – und einige kurze Jahre sogar ganz entschieden – doch eigentlich so aus, als gingen eine ganze Reihe von Literaten durchaus von so etwas wie einer politischen Intention beim Schreiben aus.
 Sicherlich ist es nicht zufällig, dass ausgerechnet im Jahr 1968 der von da an alleinige Herausgeber der wichtigsten deutschen Literaturzeitschrift, Hans Bender, den «Akzenten» einen neuen Untertitel gab. Hatte sie von ihrer Gründung 1954 bis 6/67 «Zeitschrift für Dichtung» geheißen, hieß sie nun «Zeitschrift für Literatur». Bender formulierte als Begründung u.a.: «Literatur ist […] der weitere Begriff […] Weiter, weil Literatur die Tendenz, in die Zeit wirken zu wollen, nicht verneint, sondern bejaht» (Hans Bender: An die Leser, Akzente 1/68).
Sicherlich ist es nicht zufällig, dass ausgerechnet im Jahr 1968 der von da an alleinige Herausgeber der wichtigsten deutschen Literaturzeitschrift, Hans Bender, den «Akzenten» einen neuen Untertitel gab. Hatte sie von ihrer Gründung 1954 bis 6/67 «Zeitschrift für Dichtung» geheißen, hieß sie nun «Zeitschrift für Literatur». Bender formulierte als Begründung u.a.: «Literatur ist […] der weitere Begriff […] Weiter, weil Literatur die Tendenz, in die Zeit wirken zu wollen, nicht verneint, sondern bejaht» (Hans Bender: An die Leser, Akzente 1/68).
Fünf Jahre später sieht Bender sich in der Einschätzung dieser Tendenz bestätigt und schreibt im ersten Heft des 20. Jahrgangs: «Heute gibt es kaum noch einen Widerspruch, wenn nachgewiesen wird, wodurch die westdeutsche Literatur in den letzten Jahren mehr Beachtung und Wirksamkeit erzielt hat. Vor allem doch durch die Mitsprache in der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung» (H. Bender: Von der Dichtung zur Literatur, Akzente 1-2/73).
Gemeint waren damit sicherlich nicht allein, aber vor allem die Autoren der ersten Generation der «Gruppe 47». Themen und Stoffe der Auseinandersetzung mit erlebtem Faschismus und Krieg, dann aber zunehmend Kritik an der gesellschaftlichen Entwicklung der neuen Republik. Wichtig in unserm Zusammenhang: Die neuen deutschen Autoren hatten ihren Weg gefunden von der apolitischen, zurückgezogenen Dichtungstradition hin zur Literatur der politischen Einmischung.
 Ein deutlich erkennbares, gesellschafts-politisch orientiertes «Wozu?» war Bekenntnis für literarisches Arbeiten. Heinz Ludwig Arnold pointiert: «So war die Gruppe 47 auch eine moralische Institution, nicht nur eine literarische Clique» (H. L. Arnold: Die drei Sprünge der westdeutschen Literatur, Akzente 1-2/1993). Breite Übereinstimmung im Selbst-Verständnis und in der Formu-lierung neuer Aufgaben zeiteingebundener Literatur. Hans Magnus Enzensberger 1962: «Deshalb halte ich dafür, dass die kritische Position unteilbar ist. Sie hat nicht Bewältigung oder Aggression im Sinn; Kritik, wie sie hier versucht wird, will ihre Gegenstände nicht abfertigen oder liquidieren, sondern dem zweiten Blick aussetzen: Revision, nicht Revolution ist ihre Absicht» (H. M. Enzensberger: Einzelheiten, Frankfurt/Main 1962).
Ein deutlich erkennbares, gesellschafts-politisch orientiertes «Wozu?» war Bekenntnis für literarisches Arbeiten. Heinz Ludwig Arnold pointiert: «So war die Gruppe 47 auch eine moralische Institution, nicht nur eine literarische Clique» (H. L. Arnold: Die drei Sprünge der westdeutschen Literatur, Akzente 1-2/1993). Breite Übereinstimmung im Selbst-Verständnis und in der Formu-lierung neuer Aufgaben zeiteingebundener Literatur. Hans Magnus Enzensberger 1962: «Deshalb halte ich dafür, dass die kritische Position unteilbar ist. Sie hat nicht Bewältigung oder Aggression im Sinn; Kritik, wie sie hier versucht wird, will ihre Gegenstände nicht abfertigen oder liquidieren, sondern dem zweiten Blick aussetzen: Revision, nicht Revolution ist ihre Absicht» (H. M. Enzensberger: Einzelheiten, Frankfurt/Main 1962).
Die radikalste Zuspitzung allerdings erfuhr dieses Wozu?-Bekenntnis schon weitere fünf Jahre später, als der gleiche H. M. Enzensberger mit Beginn der Studentenproteste gerade diesen revisionistischen Ansatz geisselt und als Gebot der Stunde 1967 formuliert: «Tatsächlich sind wir heute nicht dem Kommunismus konfrontiert, sondern der Revolution. Das politische System in der Bundesrepublik lässt sich nicht mehr reparieren. Wir können ihm zustimmen, oder wir müssen es durch ein neues System ersetzen. Tertium non dabitur. Nicht die Schriftsteller haben die Alternative auf dieses Extrem begrenzt; im Gegenteil, seit 20 Jahren bemühen sie sich, das zu vermeiden. Die Macht des Staates selbst sorgt dafür, dass die Revolution nicht nur notwendig wird (sie wäre 1945 notwendig gewesen), sondern auch denkbar» (H. M. Enzensberger: Schriftsteller und Politik, Times Literary Supplement, 1967).
 Eine ganze Generation damals beginnender junger Autoren – nicht zuletzt im Kreis auch um Erich Fried – nahm diesen Aufruf zum eigenen Programm: Literatur musste vor allem politisch relevant sein! Eine fast unübersehbare Menge – auch kleiner und kleinster – Literaturzeitschriften aus dieser Zeit zeugt davon. Und es entstand eine Tradition politischer Literatur, die – bei allen noch so unterschiedlichen formalen und inhaltlichen Ausformungen – bis heute angehalten hat. Von der «Gruppe 61» über Werkkreis-Literatur, Reportage-Literatur, die politische Lyrik mit ihrem breiten Spektrum, das politische Lied, das Drama, bis zur Auseinandersetzung mit der deutsch-deutschen Problematik bei DDR- und BRD-Autoren und hin zu den jüngsten Jahren literarischer Arbeiten über die beiden deutschen Gesellschaften und ihre Wiedervereinigung. Dass daneben gerade auch seit «68» eine zweite literarische Strömung – apolitischer, formalistischer, bis hin zu konkreter Poesie und Wiener Schule – entsteht und an Bedeutung gewinnt, sei hier nur angemerkt.
Eine ganze Generation damals beginnender junger Autoren – nicht zuletzt im Kreis auch um Erich Fried – nahm diesen Aufruf zum eigenen Programm: Literatur musste vor allem politisch relevant sein! Eine fast unübersehbare Menge – auch kleiner und kleinster – Literaturzeitschriften aus dieser Zeit zeugt davon. Und es entstand eine Tradition politischer Literatur, die – bei allen noch so unterschiedlichen formalen und inhaltlichen Ausformungen – bis heute angehalten hat. Von der «Gruppe 61» über Werkkreis-Literatur, Reportage-Literatur, die politische Lyrik mit ihrem breiten Spektrum, das politische Lied, das Drama, bis zur Auseinandersetzung mit der deutsch-deutschen Problematik bei DDR- und BRD-Autoren und hin zu den jüngsten Jahren literarischer Arbeiten über die beiden deutschen Gesellschaften und ihre Wiedervereinigung. Dass daneben gerade auch seit «68» eine zweite literarische Strömung – apolitischer, formalistischer, bis hin zu konkreter Poesie und Wiener Schule – entsteht und an Bedeutung gewinnt, sei hier nur angemerkt.
Das anfangs gefragte «Wozu?», somit von seiten der «Autorenintention» beantwortet, – in der gleichen geschichtlichen Entwicklung beginnt auch die Antwort auf die Frage nach dem «Wozu?» im Sinne einer tatsächlichen «Wirkung» von Literatur, findet sich hier doch – zumindest für die deutsche Nachkriegsgeschichte – ein kaum widersprochenes Beispiel für die gesellschaftliche Wirkung (auch) von Literatur.
 Noch einmal sei H. M. Enzensberger zitiert. Denn wenn er auch 1995 im Gespräch mit André Müller seine eigenen Aufrufe von 1968 als «gedroschene Phrasen» entlarvt, ein historisches Ergebnis der damaligen emanzipato-rischen Bewegung bleibt ihm: «Die Studentenrevolte war zivilisatorisch eine Notwendigkeit […] Sie können doch nicht wegdiskutieren, dass die Menschen in diesem Lande heute ein ganz anderes Selbstbewusstsein als damals haben. […] Die fünfziger Jahre […] muffig, reaktionär. Nichts hat sich bewegt […] 1968 ging es darum, eine autoritätsfixierte Gesellschaft in eine mehr demokratische zu verwandeln. […] Die Bundesrepublik, wie wir sie heute kennen, ist doch damals überhaupt erst entstanden […] Der Obrigkeitsstaat existiert nicht mehr. Den hatten wir aber.» (H. M. Enzensberger / A. Müller, Die Zeit Nr. 4/20, 1995).
Noch einmal sei H. M. Enzensberger zitiert. Denn wenn er auch 1995 im Gespräch mit André Müller seine eigenen Aufrufe von 1968 als «gedroschene Phrasen» entlarvt, ein historisches Ergebnis der damaligen emanzipato-rischen Bewegung bleibt ihm: «Die Studentenrevolte war zivilisatorisch eine Notwendigkeit […] Sie können doch nicht wegdiskutieren, dass die Menschen in diesem Lande heute ein ganz anderes Selbstbewusstsein als damals haben. […] Die fünfziger Jahre […] muffig, reaktionär. Nichts hat sich bewegt […] 1968 ging es darum, eine autoritätsfixierte Gesellschaft in eine mehr demokratische zu verwandeln. […] Die Bundesrepublik, wie wir sie heute kennen, ist doch damals überhaupt erst entstanden […] Der Obrigkeitsstaat existiert nicht mehr. Den hatten wir aber.» (H. M. Enzensberger / A. Müller, Die Zeit Nr. 4/20, 1995).
Man mag Enzensberger in dieser Wertung zustimmen oder nicht, die Veränderung – insbesondere im Umgang mit Autorität – ist nicht zu leugnen. Und so, wie die studentische Revolte nicht zu trennen ist von der sie begleitenden, mit vorwärts treibenden, ihr kulturelles Fundament gebenden und sie fortführenden verschiedenartigsten Literatur, so ist ebenso kaum zu erforschen, welchen Anteil an diesem Emanzipationsschub (in Kopf und Herzen der Menschen) nun Demonstrationen und Aktionen und welchen die Literatur hatte und hat, mit ihren mannigfaltigen Erscheinungs- und Veranstaltungsformen. Dass Literatur mit-verändert hat, wird nicht zu widerlegen sein.
Exkurs: Das Lyrische Ich
Aber vielleicht sollten wir von sogenannter «politischer Literatur» einmal ganz absehen:
DU
am Morgen danach
hüpfe ich
von Pflasterstein
zu Pflasterstein
und keiner sieht es
Die Frage «Wozu Literatur?» wurde an das vorstehende, über jede politische Absicht erhabene, kleine Gedicht niemals gestellt. Wohl aber sehr viele andere, verschiedenste Fragen wurden seinetwegen an den Autor gerichtet, bei den unterschiedlichsten Anlässen. Fragen, die, indem sie von Zuhörern und Lesern gestellt wurden, auch dem Autor dieses auffällig kleingeratene Kind seiner selbst von Mal zu Mal näherbrachten.
Ursprünglich wegen Zwergwuchses und vielleicht doch zu auffälligen Untergewichts gar nicht erst ins Manuskript eines neuen Lyrikbandes aufgenommen, tauchte es ganz plötzlich aus der Sendung an den Literaturredakteur einer Zeitschrift wieder auf, wurde brieflich gestreichelt und fand so Eingang in die neue Sammlung. Dann schließlich, von dem Literaturwissenschaftler Thomas Bleicher in einem öffentlichen Vortrag als «eines der wenigen positiven Liebesgedichte der 80er Jahre» bezeichnet, behauptete es sich schnell im Kanon des Bandes wie bei Lesungen. «Sie sollten’s als Postkarte drucken, damit man’s schnell bei der Hand hat, schnell verschicken kann, wenn die Nacht so war und der Morgen so ist!», schlug man dem Autor vor.
«Aber sagen Sie mal: Ich habe das gestern abend noch mal gelesen, habe mir heut die Pflastersteine auf der Straße angesehen, die liegen doch recht eng beieinander!» Auf die etwas hilflose Gegenfrage des Autors: «Hätte ich ’von Platte zu Platte’ sagen sollen?», hilft ein Zuhörer: «Na also, dann überspringt er eben mehrere Pflastersteine dazwischen; wie viele, das hängt dann davon ab, was in der Nacht geschah! In jedem Fall ist etwas Schönes passiert. Das Gedicht strahlt Freude aus!»
«Heimliche Freude!? Es ist so etwas heimlich Verschmitztes darin. Ich kann mir beides vorstellen: Also der (oder eigentlich auch die) auf dem Heimweg am Morgen ist allein auf seinem Weg und hüpft wirklich, wie ein Tanzen aus Freude, oder er/sie geht zwischen vielen Menschen zum Bahnhof z.B. und hüpft innerlich, ‘und keiner sieht es’.»
«Ist Ihnen das so passiert? Es hat so etwas ungeheuer Vitales, fast ein Platzen vor Freude!»
«Das geht mir zu weit. Ihr scheint alle nur von dem einen auszugehen: eine schöne erotische Nacht, zwischen einem Mann (er hat’s ja geschrieben) und einer Frau oder auch umgekehrt (doch, ich kann’s mir auch vorstellen als Liebesbrief an meinen Freund, sagt das junge Mädchen), nein nein, meinetwegen zwei Frauen nach einer Liebesnacht, zwei Männer, aber muss es denn die Erotik sein, sexuell, könnte es nicht einfach nur ein schönes Gespräch gewesen sein, zwischen wem auch immer; ein Gespräch, so nah, so alles, dass man am Morgen die ganze Welt umarmen könnte?!»
«Es ist einfach nur ein Du! Und du kannst dir dein Du einsetzen! Das Erlebte auch!»
«Aber es ist auch ein kleines bisschen Trauer darin. Es ist eine Ansprache, ein Brief fast an ein Du. Aber schon in der ersten Zeile: ‘am Morgen danach’…, es ist eben schon ‘danach’; der schöne Augenblick ist schon vorbei; ein Rückblick, schon fast Erinnerung! Eine bestimmte Art von Glück hält zwar noch an, er hüpft ja noch, aber das, was dieses Glück ausgelöst hat, das eigentliche Geschehen ist längst vorbei; das Glück der Nähe z.B. ist längst wieder, zumindest räumlich, Ferne. Da ist auch etwas Trauriges in dem Gedicht!»
«Aber ist das nicht gerade typisch für uns Menschen? Ist es nicht oft so, oder vielleicht immer, dass wir das Besondere eines erlebten Augenblicks oder einer erlebten Zeit, die ganze Bedeutung, Intensität und Wucht erst im nachhinein, erst in der Erinnerung so richtig spüren!?» – «Das scheint mir einfach zum Menschen zu gehören. Das macht doch auch seine spezifisch menschliche Tragik immer wieder aus, das hängt mit der Fähigkeit des Bewusstseins zusammen, dass Liebe und Schmerz, Freude und Trauer, Leben und Tod nicht voneinander zu trennen sind. Das macht ihn geradezu erst zum Menschen, dass er dazu verdammt ist, bei jedem schönen gelebten Augenblick sofort auch immer dessen Endlichkeit im Bewusstsein mitleben zu müssen.»
«Bei allem, was jetzt über mitschwingende Trauer gesagt worden ist, und ich finde es schön, dass das auch drin ist in diesem kleinen Gedicht: das dominierende Gefühl bleibt für mich die Freude, und durch den Titel wird doch demjenigen, der das Glück ausgelöst oder gegeben hat, genau dieses Glück wieder zurückgegeben.»
Wir wollen hier abbrechen; es ließe sich noch mehr aus den Gesprächen berichten.
Das moderne Gedicht als Selbstverständigung
zwischen Sprache und Realität
Immer wieder aufregend an ihnen ist zu erleben, wie sich das Ich des Autors und das Ich des Lesers begegnen im lyrischen Ich des Gedichts. «Die Poesie ist eine Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, über die man eigentlich nicht sprechen kann.» (ebd.) Dies ist doppeldeutig: Entweder der Autor mag über Bestimmtes, z.B. sich selbst, nicht sprechen, höchstens im Gedicht (und Enzensberger meint genau dies im zitierten Gespräch) oder: er kann es nicht; der gewohnte Umgang mit Sprache reicht nicht aus.
 Heinrich Vormweg beschreibt 1990 das heutige Gedicht «als die pure menschliche Selbstverständigung zwischen Sprache und Realität» (H. Vormweg: Verteidigung des Gedichts, Göttinger Sudelblätter, 1990). So, im Prozess des Schreibens selbst ein Suchender, entlässt der Autor sein Gedicht an den Leser, und ein wechselseitiger Austausch beginnt; dazu Günter Kunert (Bild links): «Der Zweck des Gedichts, glaube ich, ist sein Leser, der, indem er sich mit dem Gedicht befasst, sich mit sich selber zu befassen genötigt wird: in einem dialektischen Vorgang, im gleichen, den ihm das Gedicht vorschreibt und vorexerziert. Das spannungsträchtige lyrische Ich und das Leser-Ich werden während des Lesens identisch und gleichzeitig nicht identisch; das eine verfremdet das andere und deckt es doch gleichzeitig. Das Gedicht färbt die Psyche des Lesers, er wiederum färbt nach seinem Ebenbild das Gedicht» (G. Kunert: Warum schreiben, München 1976).
Heinrich Vormweg beschreibt 1990 das heutige Gedicht «als die pure menschliche Selbstverständigung zwischen Sprache und Realität» (H. Vormweg: Verteidigung des Gedichts, Göttinger Sudelblätter, 1990). So, im Prozess des Schreibens selbst ein Suchender, entlässt der Autor sein Gedicht an den Leser, und ein wechselseitiger Austausch beginnt; dazu Günter Kunert (Bild links): «Der Zweck des Gedichts, glaube ich, ist sein Leser, der, indem er sich mit dem Gedicht befasst, sich mit sich selber zu befassen genötigt wird: in einem dialektischen Vorgang, im gleichen, den ihm das Gedicht vorschreibt und vorexerziert. Das spannungsträchtige lyrische Ich und das Leser-Ich werden während des Lesens identisch und gleichzeitig nicht identisch; das eine verfremdet das andere und deckt es doch gleichzeitig. Das Gedicht färbt die Psyche des Lesers, er wiederum färbt nach seinem Ebenbild das Gedicht» (G. Kunert: Warum schreiben, München 1976).
 Nehmen wir nun noch, um von der scheinbaren Eingrenzung unserer Betrachtung auf die Lyrik wegzukommen, ein kurzes poetologisches Credo des jugoslawischen Romanciers und Essayisten Danilo Kis (Bild rechts). Auf die Frage: «Was ist der schwerste Fehler, den ein Schriftsteller begehen kann?», antwortet er: «Über etwas zu schreiben, was ihn nicht im Innersten berührt. […] Ein echter Text ist ein solcher, der geschrieben wurde, weil er geschrieben werden musste. Das ist aus dem Text zu spüren. Ist es die Wahrheit deines Wesens, die sich im Text ausdrückt, oder stammt dieser Text von einem gewandten und belesenen Vielschreiber? Darin liegt der Unterschied zwischen guten und schlechten Autoren […] Ein echter Text entsteht nicht aus handwerklicher Fertigkeit, sondern aus Zwängen und Empfindungen, die den Autor zum Schreiben getrieben haben» (D. Kis: Homo poeticus, München 1994).
Nehmen wir nun noch, um von der scheinbaren Eingrenzung unserer Betrachtung auf die Lyrik wegzukommen, ein kurzes poetologisches Credo des jugoslawischen Romanciers und Essayisten Danilo Kis (Bild rechts). Auf die Frage: «Was ist der schwerste Fehler, den ein Schriftsteller begehen kann?», antwortet er: «Über etwas zu schreiben, was ihn nicht im Innersten berührt. […] Ein echter Text ist ein solcher, der geschrieben wurde, weil er geschrieben werden musste. Das ist aus dem Text zu spüren. Ist es die Wahrheit deines Wesens, die sich im Text ausdrückt, oder stammt dieser Text von einem gewandten und belesenen Vielschreiber? Darin liegt der Unterschied zwischen guten und schlechten Autoren […] Ein echter Text entsteht nicht aus handwerklicher Fertigkeit, sondern aus Zwängen und Empfindungen, die den Autor zum Schreiben getrieben haben» (D. Kis: Homo poeticus, München 1994).
Wenn im vorigen die Begegnung zwischen dem Ich des Autors, dem lyrischen und dem lesenden Ich auch bewusst an einem möglichst kleinen, überschaubaren, unpolitischen Liebesgedicht dargestellt wurde, so lässt sich nach dieser Prosapoetologie von D. Kis die Frage «Wozu Literatur?» abschließend vielleicht doch etwas allgemeiner beantworten:
Ein «echter Text» (Kis) – und zwar in allen Gattungen – wird nicht geschrieben unter dem Postulat eines klar umrissenen Zwecks («Wozu?»), sondern er geschieht, als existentielle Antwort und Frage des Autors an die Welt und die Scheinbarkeit ihrer Realität. Literatur geschieht – und das zweimal: Einmal durch den Autor, der schreibend sich selbst begegnet, und ein zweites Mal durch den Leser, der lesend sich selbst (und möglicherweise auch dem Autor) begegnet.
Sehen wir einmal ab von anderen nonverbalen Formen der Kommunikation, die wir – viel zuverläßiger und effizienter als die Sprache – bei allen höherentwickelten Lebewesen heute erst langsam zu akzeptieren und zu sehen bereit sind: Literatur – mit ihrem Sitz genau zwischen Denken und Fühlen – geschieht als vielleicht höchste Form der sprachlichen Kommunikation, und zwar mit sich selbst und dem anderen. Und ein solcher Text verändert beide, Autor wie Leser; keiner von beiden ist nach dem «Geschehen» des Textes – ob nun Schreiben oder Lesen – noch ganz der gleiche, der er vor diesem «Geschehen» war. ■
_____________________________________
 Arnold Leifert
Arnold Leifert
Geb. 1940 in Soest/D, Studium der Germanistik, Philosophie und Evangelischen Theologie, ab 1970 Religionslehrer, seit 2000 pensioniert; zahlreiche Publikationen in Büchern und Zeitschriften, in Rundfunk und TV, Träger verschiedener Literatur-Preise, seit 1994 Organisation und Moderation der Lesereihe „Siegburger Literaturforum“; lebt auf einem Bauernhof im Bergischen Land in Much-Hohn
_______________________________
1) Der Autor beantwortet in diesem Essay eine Frage, die der «Glarean»-Herausgeber vor einigen Jahren im Zuge einer geplanten Buch-Anthologie an verschiedene deutschsprachige SchriftstellerInnen richtete.
.
Mauer-Bau und Sex-Revolution
.
Rudolf Großkopff: «Unsere 60er Jahre»
 Flower-Power, Sexuelle Revolution, DDR-Mauerbau, Außerparlamentarische Opposition, Spiegel-Affäre, Contergan-Skandal, Prager Frühling, Mini-Rock: Der Stich- und Reizwörter im Zusammenhang mit den sog. «60ern» sind viele. Und kulturgeschichtlich bedeutsame. Dieses Jahrzehnt der Veränderungen weltweit arbeitet nun eine große, sechsteilige ARD-Politserie auf.
Flower-Power, Sexuelle Revolution, DDR-Mauerbau, Außerparlamentarische Opposition, Spiegel-Affäre, Contergan-Skandal, Prager Frühling, Mini-Rock: Der Stich- und Reizwörter im Zusammenhang mit den sog. «60ern» sind viele. Und kulturgeschichtlich bedeutsame. Dieses Jahrzehnt der Veränderungen weltweit arbeitet nun eine große, sechsteilige ARD-Politserie auf.
Das Begleitbuch zur TV-Serie «Unsere 60er Jahre» (Herbst 2007) des Berliner Publizisten und Historikers Rudolf Großkopff zeigt über die TV-Filme hinaus, wie die globalen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen sich direkt in den Erlebnissen und und Schicksalen zahlreicher Einzelbiographien spiegelten, wobei Autor Großkopff dabei die persönliche Erfahrungen seiner Zeitzeugen mit den «großen» geschichtlichen Ereignissen verwebt. Der Band besticht weniger durch üppige Bild-Illustrierung denn durch historisch vielfältig dokumentierte, den «Geist» der Sechziger differenziert beleuchtende Text-Beiträge. Eine willkommene, die Thematik-Diskussion durchaus bereichernde Edition. (gm/07)
Rudolf Großkopff, Unsere 60er Jahre, Das Buch zur ARD-Serie, Eichborn Verlag, 304 Seiten, ISBN 978-3821856827
Betroffenheitsbericht eines Komponisten
.
Das E und das U in der Musik
oder
…wie eine fragwürdige Unterteilung, entstanden im deutschen Biedermeier, nicht nur für Verwirrung in den Köpfen heutiger Musikliebhaber sorgt, sondern auch kreative Musiker diskriminiert und einer Vielzahl von Komponisten die materielle Lebensgrundlage entzieht
.
Frieder W. Bergner
.
 Schon als ich vor etwa 30 Jahren begann, meinen Lebensunterhalt nur mit dem Spielen und Erdenken von Musik zu verdienen, erfuhr ich (Bild), dass die zeitgenössische Musik in zwei Kategorien eingeteilt wird: In «Ernste Musik» und in «Unterhaltungs-Musik». Ich komponierte damals noch eher wenig, weil ich den Hauptanteil meines Einkommens als Studio-Musiker in einem Rundfunk-Orchester sowie als Instrumental-Solist (Posaune) im Jazz und in der Improvisierten Musik verdiente. Eines war für mich jedoch völlig klar: Wenn in einem Konzert Musik aufgeführt wurde, die ich komponiert hatte, dann wollte ich, dass das Publikum während der Aufführung meiner Werke der Musik zuhörte. Ich wollte nicht, dass die Leute in diesen Konzerten während der Musik miteinander redeten, also sich unterhielten.
Schon als ich vor etwa 30 Jahren begann, meinen Lebensunterhalt nur mit dem Spielen und Erdenken von Musik zu verdienen, erfuhr ich (Bild), dass die zeitgenössische Musik in zwei Kategorien eingeteilt wird: In «Ernste Musik» und in «Unterhaltungs-Musik». Ich komponierte damals noch eher wenig, weil ich den Hauptanteil meines Einkommens als Studio-Musiker in einem Rundfunk-Orchester sowie als Instrumental-Solist (Posaune) im Jazz und in der Improvisierten Musik verdiente. Eines war für mich jedoch völlig klar: Wenn in einem Konzert Musik aufgeführt wurde, die ich komponiert hatte, dann wollte ich, dass das Publikum während der Aufführung meiner Werke der Musik zuhörte. Ich wollte nicht, dass die Leute in diesen Konzerten während der Musik miteinander redeten, also sich unterhielten.
Ich verstand mich deshalb auch nicht als Komponist von Unterhaltungsmusik, denn die Leute sollten ja meiner Musik erst mal zuhören, und sich erst nach dem Konzert darüber unterhalten. Natürlich wollte ich den Anspruch an mein Publikum auch nicht so weit treiben, zu verlangen, dass alle mit ernster Miene meiner Musik lauschten, das erschien mir dann doch übertrieben. Über einen witzigen Einfall des Komponisten sollte schon geschmunzelt oder gelacht werden dürfen, schließlich hatte er dies ja beim Komponieren beabsichtigt.
«Es gibt keine leichte oder ernste Musik,
es gibt nur gute oder schlechte Musik»
Leonard Bernstein
Deshalb verstand ich mich auch nicht als Komponist von Ernster Musik. Überhaupt konnte ich mir nicht recht vorstellen, dass es Komponisten geben kann, die allen Ernstes jegliche humoristische Attitüde in ihren Werken vermeiden wollen und sich deshalb freiwillig als Komponisten sog. Ernster Musik bezeichnen.
Aus diesen Gründen war mir damals schon die Unterscheidung von Ernster Musik hier und Unterhaltungsmusik dort völlig suspekt, all das erschien mir wie ein Kasperltheater um eigenartige Begriffskonstrukte und willkürliche Einrichtung von nutzlosen kulturtheoretischen Schubladen. Und natürlich wusste ich auch noch nichts davon, dass die Tatsache, dass ich bei den Urheberrechtsgesellschaften als U-Komponist geführt wurde, für mich erhebliche finanzielle Einbußen bringen würde.
Musik – bitte Ruhe!
Was ich aber schon damals sehr genau verstand, war dass diese beiden Begriffe immer wieder zu einem bestimmten Zweck benutzt wurden. Menschen, die irgend eine bestimmte Art Musik entweder nicht mochten oder aber nicht verstehen wollten, bedienten sich wechselseitig immer wieder dieser beiden Begriffe, um die jeweils andere Art Musik zu diskriminieren. Der bockwurtskauende, biertrinkende Prolet, der vor der Bühne beim sommerlichen Open-Air (Bild) auf den Auftritt irgendwelcher Schlagerfuzzis mit ihrem epochalen Werk «Das war ein Meisterschuss» wartete, pfiff und krakeelte angeekelt, wenn vor diesem Hit das Orchester ein Stück aus George Gershwins «Porgy and Bess» spielte. Weil ihm das nämlich zu ernste Musik war.
Ähnlich angeekelt reagierte der hochdekorierte Landeskirchen-Musikdirektor Professor P., als mein Freund M., sein Sohn, der eben noch bei den Bach-Wochen in dem mecklenburgischen Städtchen G. den 1. Trompeten-Part im Orchester mit Bravour gespielt hatte, als Student im fernen Dresden Mitglied der «Stern Combo Meissen» wurde – einer Rockband, die damals einfach nur versuchte, interessante moderne Musik zu spielen. Für den Herrn Landeskirchen-Musikdirektor war das – ich zitiere wörtlich – «von Negermusik beeinflusste Unterhaltungsmusik». Und deshalb redete er fortan mit seinem Sohn kein Wort mehr. Und weil er wenig später (mit dem Sohn unversöhnt) starb, hinterließ er jenem ein Trauma, das ihn Jahre später an der Musik verzweifeln und sich dem Alkohol zuwenden ließ.
Eine Geschichte wie aus der antiken Tragödie – und alles nur wegen «E und U»…
Soli Deo Gloria
Natürlich haben Menschen von jeher versucht, Musiken voneinander zu unterscheiden. Dabei waren es weniger die Musiker oder Komponisten, die dies taten, sondern eher jene, die Musik oder auch deren Kategorisierung und Abgrenzung – für welche Zwecke auch immer – benutzen wollten. Der Klerus bestand in alter Zeit strengstens darauf, dass geistliche Musik – «Soli Deo Gloria» (Bild: S.D.G-Signum auf einem Händel-Manuskript) – etwas ganz anderes sei als profane Musik, die ja, wie z.B. Tanzmusik, «fleischliche Gelüste» provoziere. Die Musiker damaliger Zeiten selbst waren da weit weniger pingelig und auf Unterschiede bedacht. Unbekümmert recycelten sie Themen aus eigenen Tanzmusikkompositionen zu Material für Passionen und Messen – und umgekehrt. Tatsächlich funktionierte dies auch bestens: Kein Mann kam beim Hören einer Messe auf die Idee, sich seiner Nachbarfrau in der Kirchenbank unsittlich zu nähern, nur weil das Fugenthema des Kyrie Jahre zuvor schon einmal Thema einer sinnenfreudigen Gigue gewesen war…
 Bei der Uraufführung der Zauberflöte auf der Wieden in Wien (Bild: Mozart / Tom Hulce dirigiert in Formans «Amadeus») herrschte eine Atmosphäre, die einer heutigen Musikkneipe vergleichbar wäre: Spektakuläre Blitze, Explosionen und andere theatralische Effekte waren gefordert, um die Aufmerksamkeit eines essenden, trinkenden und auf Amüsement fixierten Publikums zu erringen. Welches Schicksal wäre dieser Mutter aller Opern wohl beschieden gewesen, hätte es im klassischen Wien die E-U-Kategorisierung bereits gegeben? Nein, diese willkürliche Unterscheidung entwickelte sich, wie wir wissen, später.
Bei der Uraufführung der Zauberflöte auf der Wieden in Wien (Bild: Mozart / Tom Hulce dirigiert in Formans «Amadeus») herrschte eine Atmosphäre, die einer heutigen Musikkneipe vergleichbar wäre: Spektakuläre Blitze, Explosionen und andere theatralische Effekte waren gefordert, um die Aufmerksamkeit eines essenden, trinkenden und auf Amüsement fixierten Publikums zu erringen. Welches Schicksal wäre dieser Mutter aller Opern wohl beschieden gewesen, hätte es im klassischen Wien die E-U-Kategorisierung bereits gegeben? Nein, diese willkürliche Unterscheidung entwickelte sich, wie wir wissen, später.
Im 19. Jahrhundert entstand eine neue «Wissenschaft», die Musikologie. Erste Anstöße dazu gaben u.a. Robert Schumann und sein Lehrer Friedrich Wieck mit der «Neuen Zeitschrift für Musik, herausgegeben durch einen Verein von Künstlern und Kunstfreunden» (Bild). Deren Absicht war (Zitat):
 «An die alte Zeit und ihre Wege mit allem Nachdruck zu erinnern, darauf aufmerksam zu machen, wie nur an so reinen Quellen neue Kunstschönheiten gekräftigt werden können, sodann die letzte (jüngste) Vergangenheit, die nur auf Steigerung äußerlicher Virtuosität ausging, als eine unkünstlerische zu bekämpfen, endlich eine neue, poetische Zeit vorzubereiten, beschleunigen zu helfen.» Den «Davidsbündlern» um Wieck und Schumann ging es also um Abgrenzung von der ihrerseits verachteten Episode des Virtuosentums.
«An die alte Zeit und ihre Wege mit allem Nachdruck zu erinnern, darauf aufmerksam zu machen, wie nur an so reinen Quellen neue Kunstschönheiten gekräftigt werden können, sodann die letzte (jüngste) Vergangenheit, die nur auf Steigerung äußerlicher Virtuosität ausging, als eine unkünstlerische zu bekämpfen, endlich eine neue, poetische Zeit vorzubereiten, beschleunigen zu helfen.» Den «Davidsbündlern» um Wieck und Schumann ging es also um Abgrenzung von der ihrerseits verachteten Episode des Virtuosentums.
Wie wir heute wissen, war die romantische Epoche nicht nur eine Zeit großer Kunst, sondern auch durch zahlreiche, heute grotesk anmutende Grabenkämpfe, durch Rufmorde und gegenseitige Verächtlichmachung der verschiedenen ästhetischen und politischen Lager gekennzeichnet. Möglich wurde dies durch das Entstehen zahlreicher publizierter Printmedien. Damit entwickelte sich das, was wir heute massenmediale Rezeption von Kunst und Kultur nennen. Es gab nun erstmalig in der Kunstgeschichte Menschen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienten, Kulturereignisse für das Publikum zu reflektieren, meist ohne selbst Künstler zu sein. Es schlugen also nicht mehr nur eifersüchtelnde und erfolgsneidische Kreative verbal aufeinander ein (z.B. Börne vs. Heine), sondern inzwischen mischte die neu entstandene Berufsgruppe der Kunstkritiker (z.B. Hanslick vs. Wagner / Karikatur) kräftig mit.
Ernst – und unterhaltend
 Ästhetische wie inhaltliche Abgrenzung mag sinnvoll sein, oft genug jedoch kann man in der Kunst Ziele und Absichten am einfachsten fixieren, indem man sagt, was man nicht will. Die Trennlinie aber zwischen «ernst» und «unterhaltend» zu ziehen ist ebenso dumm wie nichtssagend. Wenn man das Überdauern von Zeitaltern und das Haftenbleiben im kollektiven kulturellen Bewusstsein als vielleicht einziges einigermaßen brauchbares, statistisch begründetes Qualitätskriterium für Kunst überhaupt nimmt, so zeigt sich, dass sich gerade die musikalischen Giganten der Geschichte dadurch auszeichneten, dass ihre Musik je nach kompositorischer Absicht beides war, ernst und auch unterhaltend. Wer würde dem Lacrimosa aus Mozarts Requiem seinen tiefen Ernst und seine Trauer aberkennen wollen, weil es den (tänzerischen = unterhaltsam-profanen) Dreierrhythmus benutzt? Nein, diese beiden Attribute sind so untauglich wie nur eben möglich, in der Geschichte ebenso wie heute.
Ästhetische wie inhaltliche Abgrenzung mag sinnvoll sein, oft genug jedoch kann man in der Kunst Ziele und Absichten am einfachsten fixieren, indem man sagt, was man nicht will. Die Trennlinie aber zwischen «ernst» und «unterhaltend» zu ziehen ist ebenso dumm wie nichtssagend. Wenn man das Überdauern von Zeitaltern und das Haftenbleiben im kollektiven kulturellen Bewusstsein als vielleicht einziges einigermaßen brauchbares, statistisch begründetes Qualitätskriterium für Kunst überhaupt nimmt, so zeigt sich, dass sich gerade die musikalischen Giganten der Geschichte dadurch auszeichneten, dass ihre Musik je nach kompositorischer Absicht beides war, ernst und auch unterhaltend. Wer würde dem Lacrimosa aus Mozarts Requiem seinen tiefen Ernst und seine Trauer aberkennen wollen, weil es den (tänzerischen = unterhaltsam-profanen) Dreierrhythmus benutzt? Nein, diese beiden Attribute sind so untauglich wie nur eben möglich, in der Geschichte ebenso wie heute.
 Die chilenische Dichterin und Nobel-Preisträgerin Gabriela Mistral (Bild) hingegen formulierte ihre Forderungen an den Künstler ebenso einfach wie poetisch: «Du sollst die Schönheit lieben, denn sie ist der Schatten Gottes über dem Weltall. Sie soll aus deinem Herzen aufsteigen in dein Lied, und der erste, den sie läutert, sollst du selber sein. Du sollst die Schönheit nicht als Köder für die Sinne darbieten, sondern als natürliche Speise der Seele.»
Die chilenische Dichterin und Nobel-Preisträgerin Gabriela Mistral (Bild) hingegen formulierte ihre Forderungen an den Künstler ebenso einfach wie poetisch: «Du sollst die Schönheit lieben, denn sie ist der Schatten Gottes über dem Weltall. Sie soll aus deinem Herzen aufsteigen in dein Lied, und der erste, den sie läutert, sollst du selber sein. Du sollst die Schönheit nicht als Köder für die Sinne darbieten, sondern als natürliche Speise der Seele.»
Obwohl ich kein religiöser Mensch bin, sagen diese wenigen Worte mir mehr darüber, wie Kunst sein soll, als alle klugen Aufsätze, die ich von theoretisierenden Kritikern und neunmalklugen Inhabern höchster akademischer Titel und Weihen je gelesen habe. Denn diese Sätze spiegeln die Magie der Kunst ebenso, wie sie die Verantwortung des Künstlers formulieren!
Darin finde ich auch jene wichtigen Schaffenskriterien, die ich für Künstler anerkennen mag. Weitab von E, U und all den geschwätzigen Deklarationen der Theoretiker gelten diese knappen Worte für Franz Schuberts
«Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh´ ich wieder aus» (Bild) mit der unvergleichlichen absteigenden Moll-Melodielinie ebenso wie für das so vollkommen wie einfach komponierte Beatles-Lied aus dem sog. White-Album (Bild): «Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise».
Kunst mit Wissenschaft erfassbar?
Nichts gegen die Musikologie, aber wenn sie Wissenschaft sein will, sollte sie sich in ihren Versuchen zu kategorisieren endlich vom dünnen Eis solcher alles und nichts sagenden Attribute wie «ernst» und «unterhaltend» zurückziehen und sich, wenn dies überhaupt beim Thema Kunst möglich ist, in Definitionen und Fakten äußern. Sonst behalten auf Dauer all jene recht, die rundweg bestreiten, dass Kunst in ihrer Relevanz überhaupt mit den Methoden der Wissenschaft erfassbar ist. Selbst der große Adorno, welcher – wo er sich mit gesellschaftlich-soziologischen Tatsachen und deren Wirkung auf die Kunst beschäftigte – ein brillanter Analysator war, versagte bei den meisten seiner Versuche, den Fragen von Wert oder Unwert der Musik seiner Zeit auf den Grund zu gehen. Dabei wird er unkonkret-schwurbelig bis anmaßend in seinen Urteilen, weil auch er letztlich immer wieder bei den unseligen Buchstaben E und U landet.
Falls für jene unter uns, die heute Musik komponieren, irgendwelche Kategorisierungen und Einordnungen, die mehr zu sagen versuchen als «gut oder schlecht», überhaupt wichtig sein können, dann müssen gerade wir uns mit diesen gesellschaftlichen Fakten beschäftigen, also mit der Art und Weise, wie Gesellschaft und Ökonomie sich mit unserer Kunst befasst, mit deren Praktiken der Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verwertung. Denn genau hier gibt es Erscheinungen, deren Analyse sich lohnt, weil sie durch Zahlen, Mengen und Fakten begründet werden kann: Es gibt Musik, die industriell vermarktet wird, und solche, die nicht industriell vermarktet wird.
Vor der Musikindustrie sind alle gleich
Diese Unterteilung ist für die Komponisten und Interpreten, aber auch für das Publikum mindestens ebenso gravierend, wie die Unterscheidung zwischen gut und schlecht. Und außerdem vollzieht sie sich in vielen Fällen auch noch völlig unabhängig von jener. Es wird ja von der Musikindustrie innovative, ästhetisch anspruchsvolle Musik ebenso intensiv vermarktet wie die grottenschlechte. Letztere lässt sich jedoch im Gegensatz zu ersterer quasi am Fliessband produzieren, was zur Folge hat, dass sie von der Industrie natürlich in viel größerer Menge auf den Markt gekippt wird als erstere.
 Mit der mechanischen Abbildung der akustischen Schwingungen durch Thomas A. Edison 1877 (Bild: Edison diktiert in seinen Phonographen) begann, wie wir wissen, eine neue Epoche für die Musik. Auch diese Kunst konnte nun ihrer Flüchtigkeit entrissen werden, und das einmalige Ereignis, bei dem Musiker einen Moment verzauberten, indem sie die Luft um sich herum in Schwingungen versetzten, konnte konserviert und später wiedergegeben werden. Dies war eine Entwicklung, die, wie viele Erfindungen der Menschheit, Segen und Fluch zugleich bedeutete. Plötzlich konnte sich jeder für wenig Geld den Gesang Enrico Carusos in sein Heim holen und hatte Anteil an einem Kunstereignis, das vorher nur wenigen, privilegierten Reichen vorbehalten war.
Mit der mechanischen Abbildung der akustischen Schwingungen durch Thomas A. Edison 1877 (Bild: Edison diktiert in seinen Phonographen) begann, wie wir wissen, eine neue Epoche für die Musik. Auch diese Kunst konnte nun ihrer Flüchtigkeit entrissen werden, und das einmalige Ereignis, bei dem Musiker einen Moment verzauberten, indem sie die Luft um sich herum in Schwingungen versetzten, konnte konserviert und später wiedergegeben werden. Dies war eine Entwicklung, die, wie viele Erfindungen der Menschheit, Segen und Fluch zugleich bedeutete. Plötzlich konnte sich jeder für wenig Geld den Gesang Enrico Carusos in sein Heim holen und hatte Anteil an einem Kunstereignis, das vorher nur wenigen, privilegierten Reichen vorbehalten war.
Gigantische Überschwemmung mit Musik
Andererseits wurde dadurch auch die so konservierte Musik zu einem Ding, einer Schallplatte, später einer CD, das man nach Belieben produzieren, vervielfältigen und verkaufen kann. Es entstand diese Industrie, die Musik (in Form ihres mechanischen oder digitalen Abbildes) produziert und damit Handel treibt. Und weil Industrien, wie schon Karl Marx herausfand, nur expandieren oder dann untergehen können, sorgte die Musikindustrie fortan für eine Überschwemmung der Welt mit Musik in gigantischem Ausmaß.
«Sklaven, die die Peitsche der Werbung
im Nacken haben»
Udo Lindenberg über die deutschen Radiomacher
Und so entstand auch der Unterschied zwischen Menschen, die durch Komposition von Musik und durch deren Produktion Millionäre wurden – und solchen, die trotz harter, qualifizierter Arbeit als Musiker und Komponisten gerade mal ein Existenzminimum erwirtschaften. (Grafik: Statistik der Musikbranche 2006/2007; Quelle: Bild-Klick)
Es ist also keinesfalls eine Frage von E oder U, oft nicht einmal eine Frage von gut oder schlecht, ob ein neues Musikstück von zahlreichen Menschen zur Kenntnis genommen wird oder nicht, und ob Komponieren oder Musizieren ein lukrativer Job ist oder nicht. Leute in den Chefetagen der Phono- und Veranstaltungs-Industrie entscheiden darüber. Sie bestimmen, welches Produkt – in unserer Sprache: Welche Komposition, welcher Solist, welches Ensemble – der Segnungen des Marketing teilhaftig wird und welche nicht. Also darüber, wofür der Werbeetat der Firma eingesetzt wird.
Kunstszene kontra Industrie, und…
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich rede nicht vom öffentlich subventionierten Kunstbetrieb, wo die bescheidenen Tantiemensummen für die Aufführung eines sinfonischen oder kammermusikalischen Werkes letztlich aus Steuermitteln bezahlt werden, sondern von der Musikindustrie, die wirklich Gewinne von gewaltigen Ausmaß und somit auch Tantiemen in dieser Größenordnung erwirtschaftet.
Für uns Komponisten nun, die aus irgendeinem (oft nicht nachvollziehbaren Grund) in den Verzeichnissen der Tantiemen-Inkassogesellschaften in der U-Schublade gelandet sind, ist es höchst fatal, dass diese, wie z.B. die deutsche GEMA, einfach leugnen, dass es zwei verschiedene Produktions- und Verwertungsebenen in der Musik gibt: In der einen Ebene – ich nenne sie die Kunstszene – wird Musik quasi in handwerklicher, manufakturieller Tätigkeit in Einzelstücken hergestellt, d.h. komponiert und aufgeführt mit dem Ziel, die Welt und das menschliche Leben mit Kunst zu bereichern. Die Aufführungen erreichen im Erfolgsfalle Zahlen im Hunderterbereich und der Verkauf von Tonträgern erreicht Zahlen, die in nur sehr seltenen Fällen über den einfachen Tausenderbereich hinausgehen. Beide zusammen erwirtschaften Tantiemen in Größenordnungen, die nicht weit entfernt von einem mitteleuropäischen Durchschnittseinkommen liegen.
«Wir schützen und fördern die Urheber von Musik, vertreten die Interessen der Komponisten, Textdichter und ihrer Verleger weltweit und begleiten aktiv die Musikmärkte.»
«Wir prägen die kulturelle und wirtschaftliche Identität des Musiklebens und bilden die Brücke zwischen den Urhebern, der Musikwirtschaft und der Öffentlichkeit.»
«Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch respektvollen und offenen Umgang untereinander, durch Wissen und Erfahrung sowie durch Förderung von Eigenverantwortung.» (Aus dem Leitbild der GEMA)
Die andere Ebene – der musikalisch-industrielle Komplex – folgt vollkommen anderen Gesetzen. Musik ist für ihn ein Produkt (wie Autos und Waschmittel), das in riesigen Stückzahlen industriell hergestellt und möglichst gewinnbringend vermarktet wird. Dieser Prozess vollzieht sich nach genau denselben Mechanismen, wie bei anderen Produkten auch. Es wird am Markt nach Bedarfszahlen geforscht, mittels Werbung der Konsum angeheizt und es gibt Erfolge mit riesigen Profiten, aber auch Flops, die rote Zahlen schreiben. Aufführungszahlen im Hunderterbereich, bzw. Tonträgerverkäufe im einfachen Tausenderbereich wie in der Kunstszene, kommen in den Rechnungen der Industrie nicht vor, und wenn doch, dann als extremer Misserfolg.
…Handwerksbetrieb gegen Konzern
Beide Szenen sind ökonomisch ebenso unvergleichbar wie ein kleiner Handwerksbetrieb mit einem weltweit agierenden Konzern. Fatal an der Sache ist eben nur, dass die Produkte letztlich fast keine Unterschiede aufweisen. Ein Konzert ist ein Konzert, und eine CD ist eine CD. Fatal ist ebenso, dass beide Szenen, was das urheberrechtliche Inkasso betrifft, oftmals grundsätzlich gleich behandelt werden. Alle Verteilungsschlüssel und Punktesysteme, die ja auf der untauglichen Unterscheidung zwischen U und E beruhen, sorgen somit dafür, dass Komponisten, deren Stücke (meist in einem völlig mechanischen Akt) als Werke der U-Musik eingestuft sind, pro Aufführung nur ein Bruchteil der Tantiemen-Ausschüttung erhalten, die sie bekämen, wenn ihr Werk E wäre, obwohl die Inkassogesellschaft vom Veranstalter der Aufführung just die selbe Summe eintreibt – in dem Fall gibt es zwischen E und U keine Unterschiede!
Note für Note…
Man begründet dieses Ungleichgewicht heute damit, dass U-Musik grundsätzlich und stets massenhaft aufgeführt und verbreitet wird, während E-Musik ohnehin nur von einer kleinen Gruppe von gebildeten Liebhabern lebt. Deshalb können Komponisten von E-Musik von ihren Tantiemenüberweisungen oft recht gut leben, während U-Komponisten bei gleicher Aufführungszahl nur geringfügige Cent-Beträge ausbezahlt bekommen, von denen sie nicht einmal ihre Briefmarken bezahlen können!
Ein selbst erlebtes Beispiel soll diese (völlig willkürliche) Ungleichbehandlung verdeutlichen: Meine Kantate «Rosen, wild wie rote Flammen» für Vokalsoli, gr. Orchester, Jazzband und Rockensemble nach lyrischen Texten aus H. Heines «Harzreise» (Bild: Erste Partitur-Seite) bekam von der GEMA statt der von mir beantragten E (X, 10) die Einstufung U (XI, 5). Laut Verteilungsplan bedeutete dies ein Verhältnis von 1200 Punkten zu 60, das heißt die GEMA sprach mir ein Anrecht auf genau 5% der zu verteilenden Netto-Tantiemeneinnahmen zu. Die «restlichen» 95% der auszuzahlenden Einnahmen verteilte sie ohne mich zu fragen an andere Komponisten.
«Die Tantiemen aber sollten nach Verwertungszahlen ausgeschüttet werden, d.h. mit steigender Zahl der Aufführungen oder Verkaufszahlen der Tonträger verringert sich deren Auszahlungssumme, und die Differenz wird auf die Auszahlung weniger gespielter Werke aufgeschlagen»
Frieder W. Bergner
Diese Kantate war ein Auftragswerk anlässlich der festlichen Eröffnung einer ostdeutschen Landesgartenschau. Die Honorarsumme lag bei etwa 70% der vom Dt. Komponistenverband veröffentlichten Honorarrichtlinie (Minimum) für Kompositions-Aufträge für Konzert und Musiktheater. Nicht gerade üppig, zumal, wenn ich hinzufüge, dass ich fast ausschließlich daran ca. 6 Wochen gearbeitet habe, 6 Tage pro Woche. Ich denke, ich habe straff gearbeitet, sicher gibt es Kollegen, die 30 Min. konzertante Musik für diese Besetzung schneller schreiben können, aber auch welche, die dafür länger brauchen.
Beim Schreiben dieser Komposition bin ich ethisch-ästhetischen und künstlerischen Impulsen und Kriterien wie auch intellektuellen Ansprüchen gefolgt, die ich ausführlichst darlegen könnte, wenn dies nicht zu weit führte.
Das Stück wird aller Voraussicht nach keine weitere Aufführung haben, nicht weil es durchfiel, sondern weil (hoffentlich) zu einem neuen entsprechenden Anlass ein neuer Auftrag an einen Komponisten erteilt werden wird. Das heißt, dass es für mich einen immensen Unterschied macht, ob ich von der GEMA 60 oder 1200 Anteilspunkte einer Summe X ausbezahlt bekam!
Weniger Geld für gleiche Arbeit?
Nun soll dieser mein Artikel nicht eine Jammer-Arie über Einkommensverluste sein, sondern ich will damit verdeutlichen, dass diese blödsinnige E-U-Trennung nicht nur Unheil in den Köpfen von Musikliebhabern anrichtet, die in der Flut von veröffentlichter Musik nach irgendeiner Orientierung suchen, sondern dass diese für eine große Zahl von Komponisten bewirkt, dass sie von ihrer Arbeit nicht leben können. Nämlich für all jene, die Idiomatik und Interpretationsweisen aus Pop und Jazz in ihren Werken verwenden und deren Werke deshalb zur U-Musik erklärt werden, obwohl sie sich weder in Ästhetik, Anspruch, Umfang noch durch Aufführungszahlen von Werken unterscheiden, die zur E-Musik erklärt wurden.
Die Einstufung einer Kompositionen nach E bzw. U wird den betroffenen Komponisten von der GEMA bezeichnenderweise nur auf Anfrage mitgeteilt. Sie erfolgt in einem ersten Schritt in Unkenntnis der Partitur (!). Erst wenn der Komponist Einspruch dagegen erhebt, darf er das Werk beim sogenannten Werkausschuss vorlegen. Dieser besteht zwar aus durchaus qualifizierten Komponistenkollegen, sie entscheiden aber nach Kriterien, die rein mechanisch sind: «Diese (Kriterien) beinhalten z.B. Changes-Notationen, Spielanweisungen des Jazz, tonale Kadenzierungen, rhythmische Patternbildungen etc. Der Werkausschuss darf sich in seiner Einstufungsentscheidung nur auf die Beurteilung der verwendeten musikalischen Parameter im Gesamtzusammenhang des Werkes stützen. Die Ethik und Ästhetik beim Komponieren verantwortet allein der Komponist, darüber darf der Werkausschuss nicht befinden.» (Zitat: Vorsitzender des GEMA-Werkausschusses). So wird also mit der Begründung, dass man ja keine willkürliche Entscheidung nach ethisch- ästhetischen Prinzipien treffen darf, eine Willkürentscheidung nach der Notation von bestimmten Teilen der Partitur getroffen…
Wie sähe nun eine bessere Welt aus ?
Wahrscheinlich wäre es ganz einfach: Vergessen wir E und U und überlassen die Genrebezeichnungen den Komponisten selbst oder dem Publikum, so sie Schubladen zum Einordnen der Musik benötigen. Bei Jazz, Zwölftonmusik, Be Bop, Mercey-Beat, Minimal Music, New Age und so vielem anderen hat dies doch bestens funktioniert. Die Tantiemen aber sollten nach Verwertungszahlen ausgeschüttet werden, d.h. mit steigender Zahl der Aufführungen oder Verkaufszahlen der Tonträger verringert sich deren Auszahlungssumme, und die Differenz wird auf die Auszahlung weniger gespielter Werke aufgeschlagen. Damit sind zwar künstlerische und ästhetische Prinzipien gänzlich außen vor (spätes Pech für die Davidsbündler…), aber man schafft wenigstens ansatzweise Verteilungsgerechtigkeit, so wie dies heute jeder halbwegs zivilisierte Staat mit verantwortungsbewusster Steuergesetzgebung versucht.
Wert oder Unwert von Musik kann man sowieso weder mit Buchstabenkürzeln wie E und U noch in Tantiemenbeträgen ausdrücken, das Urteil wird im Herzen von Publikum und Musikern gefällt und erhärtet sich in jenen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten, die ein Werk überdauert – oder eben nicht. ■
_____________________________
 Frieder W. Bergner
Frieder W. Bergner
Geb. 1954 in Zwickau/BRD, Studium an der Dresdner Musikhochschule, zahlreiche kompositorische Arbeiten und Arrangements in den Genres Jazz, Pop, Rock und Kammermusik u.a. für Theater und Rundfunk, lebt als freischaffender Komponist und Instrumentalist in Ottstedt/BRD
.
.
.









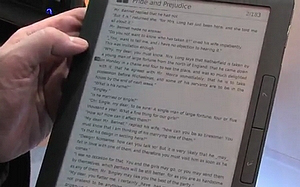
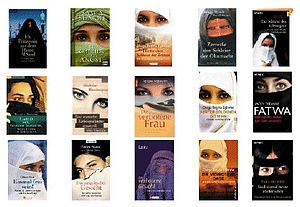
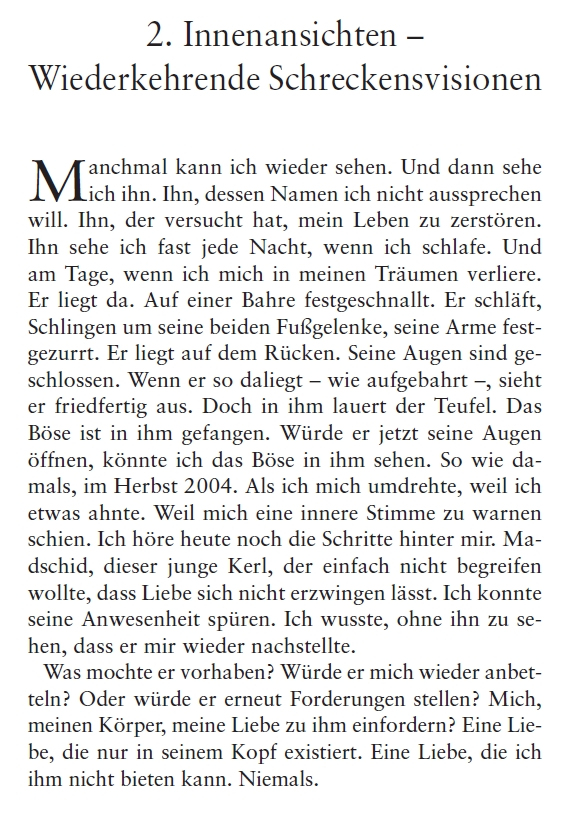
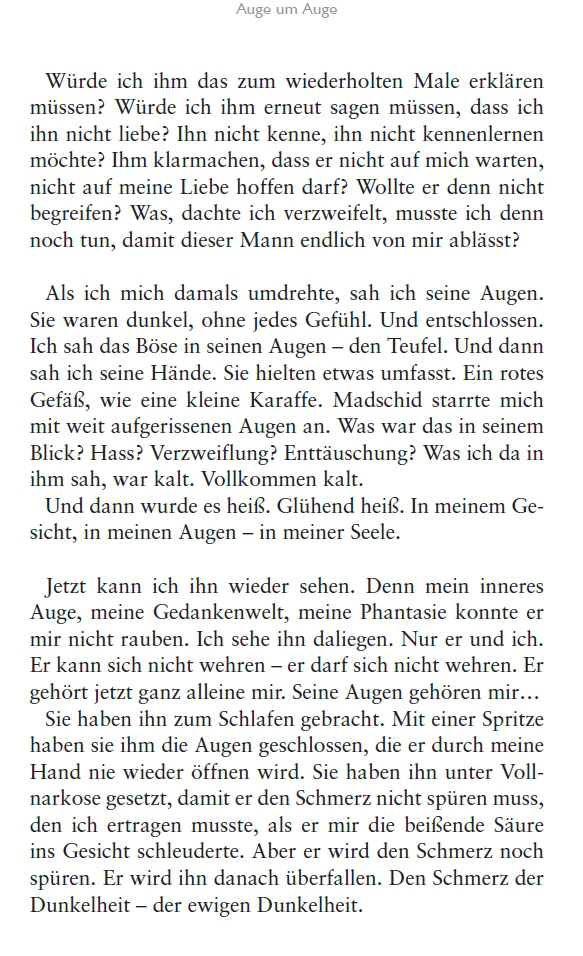







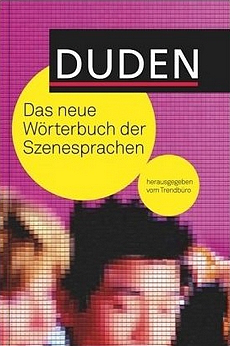
















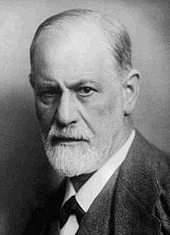





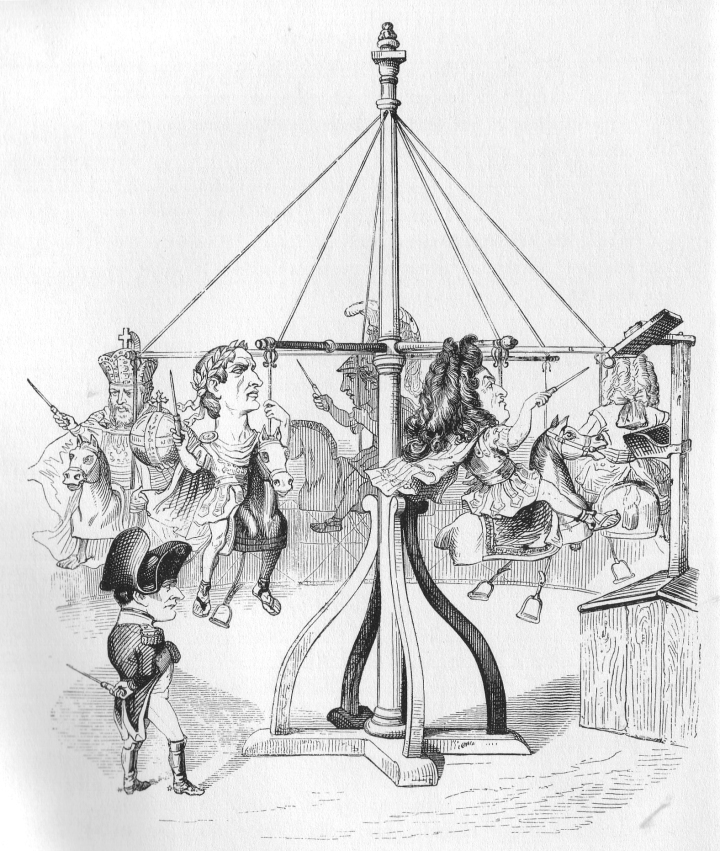

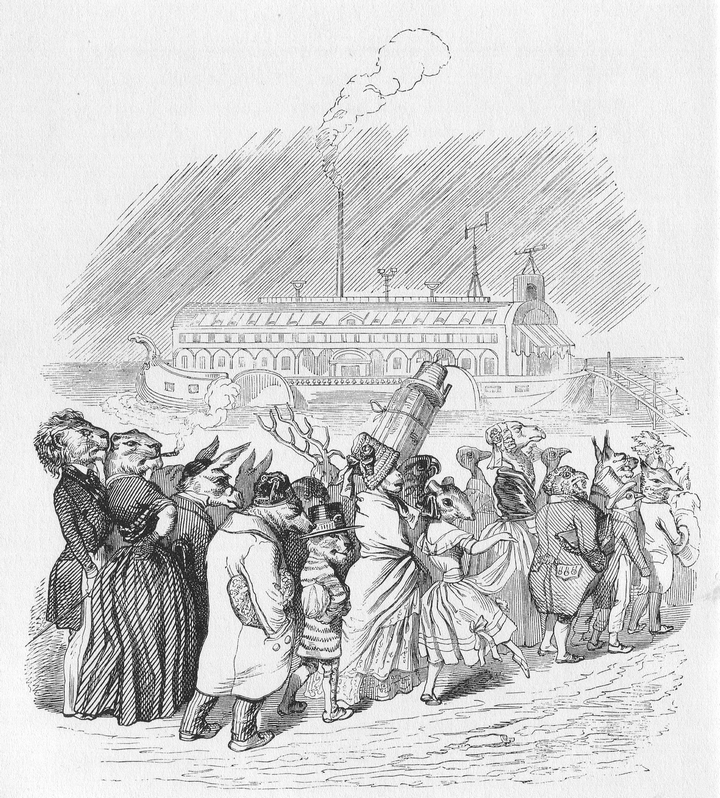


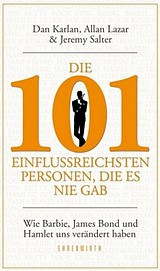













leave a comment