Interview mit der Claudius-Biographin Annelen Kranefuss
.
«Vorrang der Realität vor aller Kunst»
Günter Nawe
.
 Unlängst würdigte unser Magazin die kürzlich bei Hoffmann&Campe erschienene Claudius-Biographie der Kölner Germanistin Dr. Annelen Kranefuss: «Originell und unverwechselbar» – übrigens die erste Biographie seit über siebzig Jahren, die sich dieses Mannes (der als Journalist, als Dichter, als homme de lettres und als Redakteur des «Wandsbecker Bothen» Literaturgeschichte geschrieben hat) wieder umfassend annimmt. Günter Nawe unterhielt sich mit der Autorin über den Dichter Claudius, dessen wissenschaftliche Erforschung noch längst nicht am Ende sei. –
Unlängst würdigte unser Magazin die kürzlich bei Hoffmann&Campe erschienene Claudius-Biographie der Kölner Germanistin Dr. Annelen Kranefuss: «Originell und unverwechselbar» – übrigens die erste Biographie seit über siebzig Jahren, die sich dieses Mannes (der als Journalist, als Dichter, als homme de lettres und als Redakteur des «Wandsbecker Bothen» Literaturgeschichte geschrieben hat) wieder umfassend annimmt. Günter Nawe unterhielt sich mit der Autorin über den Dichter Claudius, dessen wissenschaftliche Erforschung noch längst nicht am Ende sei. –
Glarean Magazin: Frau Kranefuss, es gibt das berühmte Diktum Goethes über die Hauptaufgabe einer Biographie. War es auch für Sie Maßstab ihrer Arbeit?
Annelen Kranefuss: Ja. «Den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen» – das ist in der älteren Claudius-Biographik oft vernachlässigt worden. Damit hat man wesentliche Aspekte seines Schreibens und Lebens ausgeblendet. Die historischen Bedingungen (also auch die sozialen Besonderheiten des jeweiligen Lebensraums) waren nicht nur für sein Leben bestimmend, Claudius hat auch als Literat, als homme des lettres, wie er sich nannte, auf das Zeitgeschehen reagiert. Er hat ja als Journalist angefangen und auch nach dem Ende seiner Zeitungsarbeit in seinen Texten immer wieder auf Zeitereignisse und kulturelle Debatten reagiert, sehr oft indirekt, so dass es für die Nachwelt nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Er hat allerdings auch als Journalist versucht, die Dimensionen von Zeit und Zeitlosigkeit in Beziehung zu setzen und seinen Lesern zu vermitteln, dass es noch etwas anderes gibt als die Tagesaktualität.
GM: Seit der letzten größeren Claudius-Biographie sind rund 70 Jahre vergangen. Woher das Desinteresse der Germanistik an diesem «originellen und unverwechselbaren» Dichter?

Germanistin Kranefuss: «Mich spricht bei Claudius das Lakonische, seine Nüchternheit an, die gleichzeitige Herzlichkeit und Empathie, die Verbindung von Humor und Tiefgang, seine Mitmenschlichkeit und Weltbejahung ohne jede Verharmlosung.»
AK: Das Desinteresse ist nicht so groß, wie es scheint: In den letzten Jahrzehnten hat sich eine Reihe von Germanisten immer wieder intensiv mit dem Werk von Matthias Claudius befasst. Zugegeben: das ist nur eine Handvoll gemessen an der Fülle von populären und oft betulichen Claudius-Darstellungen und im Vergleich zu den kaum noch zu übersehenden Forschungen über andere Autoren, etwa Goethe oder Kafka. Hier geht es Claudius nicht anders als anderen «kleineren Poeten» der Literaturgeschichte. Es interessieren sich für ihn aber auch andere Disziplinen. Es gibt ausgezeichnete theologische Arbeiten über ihn; er hat einen Platz in der Geschichte von Theologie und Frömmigkeit – das heißt, man kann sich ihm im Grunde nur fächerübergreifend annähern. Was in der Forschung bis auf wenige Ausnahmen bisher zu kurz kam, ist ein seriöser biographischer Zugang, der über die älteren erbaulichen Schriften hinausgeht. Biographien galten in der Literaturwissenschaft ja lange als unseriös. Möglicherweise stand im Fall von Claudius auch das überlieferte Klischeebild des frommen Idyllikers und Familienvaters einem größeren Interesse im Wege.
GM: Was hat Sie letztlich bewogen, sich dieses Autors anzunehmen?
AK: Claudius hat mich seit meinem Studium immer wieder begleitet und beschäftigt. In seinen gelungenen Stücken (daneben gibt es durchaus auch Schwächeres) ist er einer der großen Meister unserer Sprache und der kleinen Form. Mich hat auch der dahinter zu spürende Mensch angesprochen, das Lakonische, seine Nüchternheit, die gleichzeitige Herzlichkeit und Empathie, die Verbindung von Humor und Tiefgang, seine Mitmenschlichkeit und Weltbejahung ohne jede Verharmlosung. Er hat unsere Hilflosigkeit angesichts des Todes erfahren und dargestellt. Und es hat mich gereizt, seiner «Mischung von Schöngeisterei und Religion», so beschreibt er die «Idiosynkrasie des Boten», nachzugehen. Das ist nicht zu verwechseln mit der Vorstellung von der ästhetischen Autonomie des Kunstwerks, wie sie die Klassiker zur gleichen Zeit entwickelten. Claudius beharrt auf dem Vorrang der Realität vor aller Kunst, was vielleicht erst heute, nach dem Ende des Zeitalters der Kunstreligion, wieder als künstlerische Möglichkeit neu gesehen werden kann.
GM: An einer Stelle schreiben Sie, dass in der «Verflechtung mit seinem Zeitalter … Claudius’ Eigenart sichtbar» wird. Welches war die «Eigenart» von Matthias Claudius?
AK: Ich habe sie u.a. mit dem Begriffspaar «Eigensinn und Geselligkeit» zu fassen gesucht. Er war weder im Leben noch im Schreiben der isolierte Außenseiter, als den ihn die Literaturwissenschaft lange geführt hat, er hatte Freunde, war gut vernetzt, aber er hat auch – im Dialog mit den Zeitgenossen – immer eine eigene Position zu behaupten gesucht und dem Zeitgeist auch widersprochen. Das wird deutlich, wenn man die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur als Goethezeit betrachtet, sondern den jeweils lokalen Besonderheiten nachgeht.
GM: Sie haben in diesem Buch einerseits mit Legenden aufgeräumt, andererseits von «Leerstellen» in der Claudius-Biographie gesprochen. Ist die Forschung über Claudius noch nicht am Ende?
AK: Mit Sicherheit nicht. Es lässt sich bestimmt noch eine Menge entdecken. Einerseits ganz positivistisch faktenbezogen. Ich denke, dass mit der wissenschaftlichen Edition der Briefe von und an Matthias Claudius, an der unter der Leitung von Professor Jörg-Ulrich Fechner in Bochum gearbeitet wird, noch das eine oder andere ans Licht kommen dürfte, manches wird mögicherweise auch in anderem Licht erscheinen. Ich musste mich noch weitgehend mit der unzulänglichen Briefausgabe von 1938 behelfen. Andererseits geht es ohnehin nicht in erster Linie darum, Lücken in der biographischen Überlieferung zu schließen, manche «weiße Flecken» werden bleiben. Vielmehr sind die Claudius-Texte selbst immer noch einmal genau zu lesen, genauer zu entziffern und im Kontext der Zeit zu deuten. Das habe ich versucht, aber damit kommt man nicht so schnell ans Ende. Das Genre Biographie eignet sich auch nicht als Container für alle Forschungsfragen und -ergebnisse. Schließlich sollte mein Buch nicht allzu dick werden. Und dann wird auch jeder Forscher, jede Epoche wieder andere Fragen an den Autor stellen und einen neuen Zugang finden.
GM: Mit der Ausgabe der «Sämtlichen Werke des Wandsbecker Bothen» hat Matthias Claudius ein einzigartiges Werk geschrieben. Wie ist dieses Werk zu klassifizieren, wo hat es seinen Platz in der Literaturgeschichte?
AK: Ich denke, das müsste aus meinen bisherigen Antworten schon hervorgehen.
GM: In Zusammenhang mit Claudius ist auch einmal von einem «sokratischen Schriftsteller» die Rede. Ist das eine weitere der vielen Facetten, die diese Autor hat?
AK: Das 18. Jahrhundert ist das «sokratische Jahrhundert» genannt worden. Die kirchliche Orthodoxie verdammte Sokrates als Heiden und sprach ihm jede Tugend ab, für die Aufklärer war er eine Symbolfigur im Kampf um Toleranz. In diesem Sinn ergreift auch Claudius Partei für Sokrates. Der Philosoph mit seinem «Ich weiß, dass ich nichts weiß» war auch für ihn ein Gewährsmann in seiner Wendung gegen Pedanterie und abstrakte Gelehrsamkeit. Seine Verehrung geht aber darüber hinaus. Der Sokrates, der in Athen vor Gericht stand und zum Tode verurteilt wurde, war ihm ein Vorbild innerer, religiös verstandener Freiheit.
GM: Was kann Matthias Claudius dem Leser von heute sagen? Kann er dem Leser von heute überhaupt noch etwas sagen?
AK: In vielem sind uns Claudius’ politische Ansichten, seine Lebensform heute fremd, gerade in dem, was z.B. das Bürgertum des 19. Jahrhunderts an ihm schätzte. Wir können die restaurativen Tendenzen seines Spätwerks nicht mehr nachvollziehen. Er ist weder der Dichter zeitloser Wahrheiten noch lässt er sich krampfhaft aktualisieren. Das ist aber auch gar nicht nötig – es gibt viele Züge, in denen wir uns zu diesem Menschen und Schriftsteller in Beziehung setzen, uns ihm annähern können, ohne uns identifizieren zu müssen. Er spricht auf anrührende und einfache Weise von den elementaren Gegebenheiten des Menschenlebens, von den Schönheiten der Natur, von der Vergänglichkeit und den ungelösten Fragen des Daseins und kann uns ermutigen, das zu suchen, was auch ihm wichtig war: «etwas Eigenes», das standhält.
GM: Einige wenige Menschen kennen bestenfalls die erste Strophe des berühmten «Der Mond ist aufgegangen…» und vielleicht noch den Schlussvers. Oder aber den Vers, von dem kaum einer weiß, dass «’s ist leider Krieg – und ich begehre / Nicht schuld daran zu sein!» von Claudius ist. Sollte dieser Dichter nicht wieder im Deutschunterricht von heute seinen Platz finden?
AK: Ich weiß nicht, ob er wirklich so ganz aus dem Deutschunterricht verschwunden ist. Das «Kriegslied» kommt, wie ich höre, durchaus vor. Und gerade hat mir jemand von einer Schulveranstaltung erzählt, bei der Claudius’ Gedicht «Die Sternseherin Lise» rezitiert wurde. Wichtig finde ich, dass die Schule beides vermittelt: die wunderbaren Texte und das Gefühl für die Zeit und die Person des Dichters. ■
.
.
.
Gedicht des Tages
Ein Wiegenlied, bei Mondenschein zu singen
So schlafe nun, du Kleine
Was weinest du?
Sanft ist im Mondenscheine
Und süß die Ruh.
Auch kommt der Schlaf geschwinder,
Und sonder Müh;
Der Mond freut sich der Kinder,
Und liebet sie.
Er liebt zwar auch die Knaben,
Doch Mädchen mehr,
Gießt freundlich schöne Gaben
Von oben her
Auf sie aus, wenn sie saugen,
Recht wunderbar;
Schenkt ihnen blaue Augen
Und blondes Haar.
Alt ist er wie ein Rabe,
Sieht manches Land,
Mein Vater hat als Knabe
Ihn schon gekannt.
Und bald nach ihren Wochen
Hat Mutter mal
Mit ihm von mir gesprochen:
Sie saß im Tal
In einer Abendstunde,
Den Busen bloß,
Ich lag mit offnem Munde
In ihrem Schoß.
Sie sah mich an, für Freude
Ein Tränchen lief,
Der Mond beschien uns beide,
Ich lag und schlief.
Da sprach sie: Mond, o scheine,
Ich hab sie lieb,
Schein Glück für meine Kleine. –
Ihr Auge blieb
Noch lang am Monde kleben
Und flehte mehr,
Der Mond fing an zu beben,
Als hörte er.
Und denkt nun immer wieder
An diesen Blick,
Und scheint von hoch hernieder
Mir lauter Glück.
Es schien mir unterm Kranze
Ins Brautgesicht
Und bei dem Ehrentanze;
Du warst noch nicht.
Matthias Claudius (1740-1815)


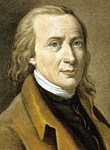





leave a comment