Musik-Satire von Nils Günther
.
Der gemeine Orchesterdirigent
Nils Günther
.
Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer!
In unserer musikzoologischen Vortragsreihe «Die Unterwelt der Musik» wollen wir uns heute einer besonders verbreiteten, aber auch sehr interessanten und in weiten Teilen noch unerforschten Spezies zuwenden: dem gemeinen Orchesterdirigenten.
Zunächst sollten wir den Gegenstand unserer Betrachtungen einmal definieren, denn obwohl den gemeinen Orchesterdirigenten jeder kennt, ja wahrscheinlich viele von Ihnen selber den einen oder anderen davon im Plattenregal stehen hat, stellen wir uns mal ganz dumm und fragen: Was ist ein Dirigent?
Hierzu muss man in der Historie recht weit zurückgehen, eigentlich in die graue Vorzeit, an jenen Punkt, wo einer aus der Herde das Maul besonders weit aufriß und sich dadurch zum Leithammel machte. Dass dafür das Maulaufreißen allerdings nicht lange reichte, kann man sich vorstellen; Argumente allein hatten noch selten ewig Bestand. Daher war es nützlich, sich durchaus physischer Gewalt zu bedienen, etwa indem man einen großen Knüppel nahm und alles, was aufmüpfig war einfach niederschlug.
Aus eben dieser Figur des Leithammels entwickelten sich mehrere bis in die heutige Zeit existente Tätigkeiten, die alle mit Machtpositionen zu tun haben. Der Politiker, der Boxer, der Zahnarzt und der Dirigent: sie alle haben ihre Wurzeln im prähistorischen Knüppelschwinger, nur dass die Knüppel im Laufe der Evolution extrem verkümmert oder überhaupt zu rein geistigen geworden sind. Beim Dirigenten ist dieser letzte Rest des Knüppels aber in Form eines kleinen Stäbchens noch gut zu erkennen, auch wenn sich die Funktion seiner Keule ein wenig gewandelt hat. Sie wird nicht mehr zum direkten Prügeln benutzt, letzteres wird vielmehr bloß noch angedeutet; der Dirigent «gibt den Takt an», wie man sagt. (Ob er viel mehr tut, ist von der Wissenschaft noch nicht endgültig geklärt).
Diverse Sagen ranken sich um einige besonders heroische Dirigenten der Vergangenheit. So erzählt man sich heute noch voller Erschauern die Geschichte von Lully, der sich mit seinem (damals noch durchaus knüppelhaften) Stab den Fuß rammte und kurz darauf verschied. Ein Suizid der besonderen Art!
Doch diese heroischen Zeiten sind eigentlich vorbei, heute scheuen die meisten Dirigenten das Risiko, und kaum einer würde mehr selbst ein solches Opfer für die Kunst bringen. Nein, heute geht es dem Dirigenten in erster Linie darum, dem Komponisten zu zeigen, was eine Harke ist. Wedelnd steht der Dirigent an seinem Pult und fuchtelt alle ihm untergebenen Musiker in die Knie. Selbst bei Messen und anderen geistlichen Werken hat der Dirigent keine Skrupel, statt Andacht das blanke Stäbchen walten zu lassen. Das Werk hat vor dem Maestro zu erzittern, nicht etwa umgekehrt! Was man hört ist nicht Mozart oder Beethoven, sondern Bernstein oder Celibidache.
Der Dirigent muss nur die Auf- und Abwärtsbewegung des Stabes erlernen, nichts weiter. Zählen kann das Orchester allein, und zwar gut genug, um sich nicht durch das unrhythmische Gefuchtel aus der Ruhe bringen zu lassen. Gewiefte Dirigenten bringen es zustande, mit der freien Hand ebenfalls Bewegungen auszuführen. Solche Wunderknaben sind rar, und der tosende Applaus ist ihnen gewiss. Schließlich ist das so, als ob ein dressierter Affe gleichzeitig eine Banane isst und sich mit dem linken Fuß am Kopf kratzt. Vor solcherlei Launen der Natur hatte der Pöbel schon seit jeher Respekt. Zu Recht.
Der Weg zum Dirigentendasein führt also über mehrere Stationen. Zunächst muss man einiges an Feinmotorik mitbringen, um überhaupt ein Stäbchen koordiniert bewegen zu können. Nicht nur muss das Holzstück auf und ab bewegt, nein, es muss dabei auch fest genug gehalten werden, so dass es nicht versehentlich aus der Hand fällt. Einem angehenden Maestro werden in der ersten Probephase denn auch diverse Unfälle nicht erspart bleiben, von ausgestochenen Augen über tote Haustiere und zerstörte Porzellansammlungen bis hin zu unabsichtlich kastrierten Schulfreunden. Ist diese Klippe nach Jahren zermürbernden Trainings umschifft, muss sich der Dirigent einige feinere Eigenschaften antrainieren wie Arroganz, Geldgier, Oberflächlichkeit und Narzissmus. Manche haben darüber hinaus eine rudimentäre musikalische Grundausbildung, doch darauf kann man sich nicht verlassen.
In aller Regel muss man zufrieden sein, wenn der Dirigent weiß, in welche Richtung er zu blicken hat. (Für gewöhnlich hat er ja einen Handlanger, der sich Konzertmeister nennt. Dieser schüttelt dem Dirigenten immer wieder die Hand, damit der Maestro seine Position wieder richtig einnimmt, und auch, damit sich die um das Stäbchen gekrampfte Hand wieder etwas entspannen kann). Intelligentere Exemplare der Spezies sind zudem in der Lage, blitzschnell ihre Position durch eine Drehung um 180 Grad zu verändern, um sich gekonnt zum Publikum hin zu verbeugen. Einigen von ihnen gelingt es sogar, sich anschließend wieder mit katzenartiger Behendigkeit in die Ausgangslage zurück zu bewegen. Doch das ist angeborenes Genie, welches sich dem Normalsterblichen nur schwer erschließt.
Ein weiteres bedeutungsvolles Moment kommt hinzu: die Mimik. Sie ist die wahre Kunst des Dirigenten. So kann man es etwa bei Lorin Maazel beobachten, der mit seinem Blick unmissverständlich zu verstehen gibt, dass er nicht nur alle Musiker und das Publikum, sondern auch die Musik selbst abgrundtief verachtet und nur dort droben auf dem Podest steht, weil der Taxameter tickt und ihm den neuen Swimmingpool als sicher finanziert verspricht.
Der Dirigent ist in der glücklichen Lage, das meiste Geld zu verdienen und dafür am wenigsten tun zu müssen. Er muss in der Regel nur einen Auftakt schlagen, danach läuft die Sache quasi von selbst. Üben kann der Dirigent in seinem Sessel zu Hause mit einem feinen Glas Cognac in der einen Hand und der Partitur in der anderen. Lesen kann er sie größtenteils nicht, und so verbringt er die Zeit damit, die schwarzen Punkte mit einem Buntstift zu verbinden und sich von den entstehenden Bildern überraschen zu lassen.
Es ist natürlich nicht verkehrt, wenn der Dirigent den Schluss der Komposition nicht verpasst. Danach weiterzuschlagen wäre nicht von Vorteil. Denn der gebildete Dirigent weiß, dass der Schluss in 90 Prozent aller Fälle laut und immer von Stille gefolgt ist. Diese Stille muss schnell genug wahrgenommen werden, was schon schwieriger ist, da es zur verbindlichen Natur eines Dirigenten gehört, maximal zehn Prozent Hörfähigkeit zu besitzen. Aber der wahre Künstler hat es halt im Blut und wird blitzschnell reagieren, den Atem anhalten und erstarren, sich kurz darauf mit einem Nicken umdrehen und erleichtert sein, wenn tatsächlich geklatscht wird und er nicht doch einfach bei der Generalpause aufgehört hat. Aber da stehen die Chancen fity-fifty, da kennt die wahre Spielernatur gar nichts.
Ansonsten muss der Dirigent noch ein Autogramm geben können und einen Plattenvertrag unterschreiben, den Rest macht sein Assistent.
Derzeit wird die Dirigententätigkeit für sehr viele arbeitslose Fleischer und Polizisten interessant, doch nur wenige wagen einen solchen beruflichen Abstieg tatsächlich, viele werden wegen Überqualifikation auch gar nicht von den Orchestern angenommen. – Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen einen Einblick in die so faszinierende Welt des auf allen Kontinenten heimischen, aber immer noch rätselhaften gemeinen Orchesterdirigenten gegeben zu haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! ■
.
______________________
Geb. 1973 in Scherzingen/CH, Klavier- und Kompositions-Studium in Berlin und Winterthur, zahlreiche kompositorische Veröffentlichungen und Radio-Aufnahmen, lebt seit 1999 als Komponist in Berlin
.
.
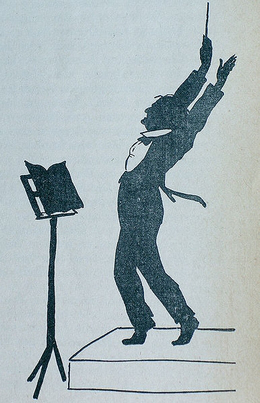


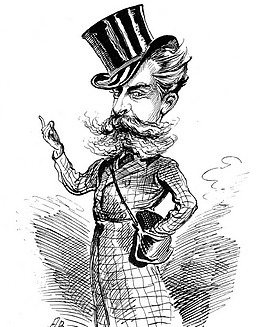






leave a comment