Das Zitat der Woche
.
Von der Freiheit im Kindergarten
Monika Seifert
.
Die umstandslose Einteilung der Eltern und Erzieher in einen konservativen und progressiven Flügel gilt nur so lange, wie es um die Durchsetzung besserer Bedingungen für die Kindergärten geht. Sobald die praktische Arbeit mit den Kindern beginnt, zeigt sich, daß in jedem von uns Widerstände stecken, den Kindern mehr Freiheit zu lassen.
Die Erfahrungen aus Einrichtungen, in denen die Träger bereits Veränderungen gestattet haben, zeigen allerdings, daß es eine Minderheit von Eltern gibt, die nicht bereit ist, ihre Kinder einen Kindergarten besuchen zu lassen, der ihnen mehr Freiheit läßt. Diese Eltern können unter den augenblicklichen Verhältnissen auch durch noch so gute Elternarbeit ihre Einstellung nicht verändern. Nun werden aber gerade diese Eltern sehr häufig zum Maßstab. Ihre Probleme bestimmen die Diskussion und verhindern damit, daß die konkreten Schwierigkeiten bearbeitet werden können. Solche Eltern sollte man in der gegenwärtigen Situation nicht zu halten versuchen. Ihre Schwierigkeiten treten sonst zu stark in den Vordergrund, gerade weil sie zugleich die mehr oder weniger unbewußten Ablehnungstendenzen in uns repräsentieren, die uns sowieso schwer zu schaffen machen. Uns unterscheidet von diesen Eltern nur, daß wir nicht ganz so total von unseren Bedürfnissen abgeschnitten sind, vielleicht weil wir nicht in gleichem Maße unterdrückt wurden. Die daraus resultierende Fähigkeit, weniger rigid zu Kindern zu sein, kann also von denen, die dazu in der Lage sind, als Glück gewertet werden, und nicht als Leistung. Es wäre jedoch gefährlich zu glauben, unsere Fähigkeit, eine andere Haltung zu Kindern einzunehmen, wäre unerschöpflich. Deshalb kann man die Warnung, sich nicht mit zu großen Schwierigkeiten zu belasten, nicht ernst genug nehmen.Im Umgang mit unsicheren, ambivalenten Eltern muß auf einen langsamen Lernprozeß gesetzt werden. Die Diskrepanz zwischen der Erziehung im Elternhaus und im Kindergarten muß erst einmal ausgehalten und gleichzeitig als Chance begriffen werden. Daß die Kinder an einem Ort, der ganz ihren Bedürfnissen entsprechend organisiert werden kann, mehr Möglichkeiten haben, kann für Eltern ja auch eine Erleichterung bedeuten. Die Erzieher müssen sich in diesem Prozeß sicher sein, daß sie die Interessen der Kinder, und langfristig auch die der Eltern, vertreten. Ein freierer Umgang mit Kindern, von weniger Tabus belastet, ist auch für die Eltern auf Dauer befriedigender. Aber gerade das erfahren sie erst gegen viele innere Widerstände. Fast alle von uns mobilisieren unbewußte Schuldgefühle, wenn wir Kindern gestatten, gegen die Verbote der eigenen Kindheit zu verstoßen. Aufgrund dieses Mechanismus gelingt es den Eltern sehr häufig, Erzieher und Lehrer langfristig doch wieder auf das von ihnen erwartete Erzieherverhalten festzulegen. Schuldgefühle sind mächtiger als intellektuelle Einsichten… ■
Aus Monika Seifert: Antiautoritäre Erziehung, in: Pädagogik und Ethik, Reclam Verlag 1996
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die rechte Erziehung
Immanuel Kant
.
Unsern Schulen fehlet fast durchgängig etwas, was doch sehr die Bildung der Kinder zur Rechtschaffenheit befördern würde, nämlich ein Katechismus des Rechts. Er müßte Fälle enthalten, die populär wären, sich im gemeinen Leben zutragen, und bei denen immer die Frage ungesucht einträte: ob etwas recht sei oder nicht? Beispielsweise wenn jemand, der heute seinem Kreditor bezahlen soll, durch den Anblick eines Notleidenden gerührt wird, und ihm die Summe, die er schuldig ist, und nun bezahlen sollte, hingibt: ist das recht oder nicht? Nein! Es ist unrecht, denn ich muß frei sein, wenn ich Wohltaten tun will. Und, wenn ich das Geld dem Armen gebe, so tue ich ein verdienstliches Werk; bezahle ich aber meine Schuld, so tue ich ein schuldiges Werk. Ferner, ob wohl eine Notlüge erlaubt sei? Nein! es ist kein einziger Fall gedenkbar, in dem sie Entschuldigung verdiente, am wenigsten vor Kindern, die sonst jede Kleinigkeit für eine Not ansehen, und sich öfters Lügen erlauben würden.
Gäbe es nun ein solches Buch schon, so könnte man, mit vielem Nutzen, täglich eine Stunde dazu aussetzen, die Kinder das Recht der Menschen, diesen Augapfel Gottes auf Erden, kennen, und zu Herzen nehmen zu lehren. –Was die Verbindlichkeit zum Wohltun betrifft: so ist sie nur eine unvollkommene’ Verbindlichkeit. Man muß nicht sowohl das Herz der Kinder weich machen, daß es von dem Schicksale des andern affiziert werde, als vielmehr wacker. Es sei nicht voll Gefühl, sondern voll von der Idee der Pflicht. Viele Personen wurden in der Tat hartherzig, weil sie, da sie vorher mitleidig gewesen waren, sich oft betrogen sahen. Einem Kinde das Verdienstliche der Handlungen begreiflich machen zu wollen, ist umsonst. Geistliche fehlen sehr oft darin, daß sie die Werke des Wohltuns als etwas Verdienstliches vorstellen. Ohne daran zu denken, daß wir in Rücksicht auf Gott nie mehr, als unsere Schuldigkeit tun können, so ist es auch nur unsere Pflicht, dem Armen Gutes zu tun.
Denn die Ungleichheit des Wohlstandes der Menschen kommt doch nur von gelegentlichen Umständen her. Besitze ich also ein Vermögen, so habe ich es auch nur dem Ergreifen dieser Umstände, das entweder mir selbst oder meinem Vorgänger geglückt ist, zu danken, und die Rücksicht auf das Ganze bleibt doch immer dieselbe.
Der Neid wird erregt, wenn man ein Kind aufmerksam darauf macht, sich nach dem Werte anderer zu schätzen. Es soll sich vielmehr nach den Begriffen seiner Vernunft schätzen. Daher ist die Demut eigentlich nichts anders, als eine Vergleichung seines Wertes mit der moralischen Vollkommenheit. […]
Ob aber der Mensch nun von Natur moralisch gut oder böse ist? Keines von beiden, denn er ist von Natur gar kein moralisches Wesen; er wird dieses nur, wenn seine Vernunft sich bis zu den Begriffen der Pflicht und des Gesetzes erhebt. Man kann indessen sagen, daß er ursprünglich Anreize zu allen Lastern in sich habe, denn er hat Neigungen und Instinkte, die ihn anregen, ob ihn gleich die Vernunft zum Gegenteile treibt. Er kann daher nur moralisch gut werden durch Tugend, also aus Selbstzwang, ob er gleich ohne Anreize unschuldig sein kann.
Laster entspringen meistens daraus, daß der gesittete Zustand der Natur Gewalt tut, und unsre Bestimmung als Menschen ist doch, aus dem rohen Naturstande als Tier herauszutreten. Vollkommne Kunst wird wieder zur Natur.
Es beruht alles bei der Erziehung darauf, daß man überall die richtigen Gründe aufstelle, und den Kindern begreiflich und annehmlich mache. Sie müssen lernen, die Verabscheuung des Ekels und der Ungereimtheit an die Stelle der des Hasses zu setzen; innern Abscheu, statt des äußern vor Menschen und der göttlichen Strafen, Selbstschätzung und innere Würde, statt der Meinung der Menschen, – innern Wert der Handlung und des Tun, statt der Worte, und Gemütsbewegung, – Verstand, statt des Gefühles, – und Fröhlichkeit und Frömmigkeit bei guter Laune, statt der grämischen, schüchternen und finstern Andacht eintreten zu lassen. ■Aus Immanuel Kant, Über Pädagogik, in: Werke in 12 Bänden (W.Weischedel/Hg.), Suhrkamp Verlag 1968 (Bd. 12)
.
Themenverwandte Links
Kindererziehung – Erziehung-Kinder-Familie – Mittelalterliche Erziehung – Eltern unter Druck – Erziehungsdefizite nehmen zu – Kinder stark machen – Kindeswohl oder Ehegattenwohl – Bildungsferne – Warum Kinder sich langweilen sollten – Gender Mainstreaming – Wochenendvati – Ganzheitliche Entwicklung der Kinder – Autoritäre Erziehung&Alkohol
.
.
Das Zitat der Woche
.
Über die schlechten Schüler
Klaus Mollenhauer
.
Bis vor wenigen Jahren noch ist man in der deutschen Pädagogik der Meinung gewesen, daß eine Bildungstheorie möglich sei, die sich auf die allgemeine Bildung für alle beziehen könne und die nicht nur prinzipiell denkbar sei, sondern der Realität unserer Schulen entspreche. Ungleichmäßigkeiten im Begabungsniveau und in der Lernfähigkeit wurden als individuelle Faktoren interpretiert, denen indessen mit geeigneten unterrichtsmethodischen Praktiken beizukommen sei. Disfunktionen wurden auf den Begriff des »schlechten Schülers« gebracht, wobei man gerne zugab, daß die schwachen schulischen Leistungen ihre Ursache auch in sozialen Faktoren haben könnten, etwa in ungünstigen Familienverhältnissen, die dann ebenfalls in der Rolle disfunktionaler Störfaktoren erschienen.« Das heißt, das Bildungssystem im Ganzen wurde als funktionales Bezugssystem akzeptiert; die Entdeckung von Disfunktionen veranlaßte – des vorausgesetzten theoretischen Modells wegen – nicht dazu, das System in Frage zu stellen, es sei denn in der Form innerer Verbesserungen.
 Nach neueren Untersuchungen nun werden die dort gemachten Voraussetzungen problematisch. Die beobachteten Disfunktionen lassen sich nämlich als Merkmale kollektiven Bildungsschicksals interpretieren. So hat sich z.B. bei Untersuchungen des kindlichen Sprachniveaus gezeigt, daß es schichtenspezifische Sprachformen gibt, die die schulische Leistungsfähigkeit, also auch das, was wir mit dem Ausdruck »Begabung« sinnvoll bezeichnen können, sehr weitgehend bedingen. Andererseits ist kein Zweifel daran, daß unsere Höhere Schule eine Sprachschule insofern ist, als sie ihre Aufgabe vorwiegend in den sprachlichen Fächern betreibt. Konsequenterweise scheitern die meisten Unterschichten-Kinder in eben diesen Fächern. Die Sprachform, deren sich die Lehrerschaft bedient, ist nämlich durchweg die der Mittelschicht.
Nach neueren Untersuchungen nun werden die dort gemachten Voraussetzungen problematisch. Die beobachteten Disfunktionen lassen sich nämlich als Merkmale kollektiven Bildungsschicksals interpretieren. So hat sich z.B. bei Untersuchungen des kindlichen Sprachniveaus gezeigt, daß es schichtenspezifische Sprachformen gibt, die die schulische Leistungsfähigkeit, also auch das, was wir mit dem Ausdruck »Begabung« sinnvoll bezeichnen können, sehr weitgehend bedingen. Andererseits ist kein Zweifel daran, daß unsere Höhere Schule eine Sprachschule insofern ist, als sie ihre Aufgabe vorwiegend in den sprachlichen Fächern betreibt. Konsequenterweise scheitern die meisten Unterschichten-Kinder in eben diesen Fächern. Die Sprachform, deren sich die Lehrerschaft bedient, ist nämlich durchweg die der Mittelschicht.
Natürlich kann man auch diese Phänomene disfunktional nennen, müßte das aber in einem anderen Sinne tun, denn diese Phänomene sind nicht eigentlich störende Abweichungen, sondern resultieren aus dem sozialen System selbst. Betrachten wir nämlich die Schule als eine Stätte, an der sich der gegenwärtige Schichtenaufbau zu reproduzieren hätte, wären diese Phänomene funktional zu nennen. Mit anderen Worten: Sie indizieren eine durch soziale Ungleichheit bestimmte Konfliktsituation, die für unsere Gesellschaft strukturell ist. ■
Aus Klaus Mollenhauer, Disfunktionale Momente der Erziehungswirklichkeit, in: Erziehung und Emanzipation, Juventa Verlag 1968
.
.

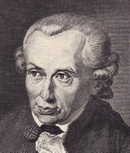





leave a comment