Philosophische Satire von Angela Mund
.
Schlaf gut, mein Freund Hektor
Angela Mund
.
«Verabschieden sie sich endlich von ihrem Idealismus. Denken sie wissenschaftlich!» Er sah mich über seine dickgerahmten Brillengläser hinweg an. Ich glaubte zumindest, dass er mich ansah. Die Gardinen waren zugezogen, in Kombination mit den schwarzen Möbeln glich sein Büro eher dem Vorraum eines Bestattungsinstitutes, und eine matte Dunkelheit hatte sich auf unsere Gesichter gelegt. Ich hatte ein Stück Fingernagel zwischen den Zähnen und schob es mit der Zunge hin und her. «Vielleicht sollten sie mit dem Studium doch lieber aufhören.» Erst jetzt fiel mir ein Bild auf, welches schräg hinter ihm an der Wand hing: Achilles steht auf dem Siegerwagen, die Zügel zweimal um die Hände geschlungen, das Kinn voller Stolz gegen Troja gerichtet, Hektor unkenntlich im Staub hinter sich herziehend. Ich suchte in der Dunkelheit seine Augen und erwiderte zögerlich: «Das hatte ich heute eigentlich vor.» Der Fingernagel schwamm nun etwas verloren auf meiner Zunge und machte mich nervös.
Das Mädchen neben ihm lächelte lakonisch vor sich hin und wackelte bei jedem seiner Sätze bedrohlich weit mit dem Kopf, als wolle ihr Hals jeden Moment umknicken wie eine überdehnte Lanze. Hektor war ein Held, er war der einzige Krieger gewesen, dem es nicht um das Mädchen gegangen war. Er hatte lediglich seine Heimat schützen wollen, seinem Vater Ehre erweisen, den feigen Bruder Paris vor der Schande der Niederlage bewahren und seiner Frau das Schicksal ersparen wollen, Sklavin der Achäer zu werden. Er war ein Held, weil er nach seinen Prinzipien gehandelt hatte, und trotz dieser unumstößlichen Wahrheit hatte man seinen toten Körper über das Schlachtfeld gezogen, anstatt ihn mit Öl zu salben, damit die Haut wie Bronze glänzen konnte.
«Wissen sie eigentlich, was sie da gerade gesagt haben?», dröhnte seine Stimme blechern, als würde ein Pferd in eine Metalluren röhren. Unauffällig nahm ich den Fingernagel aus meinem Mund und klemmte ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. «Ich habe ihnen zu erklären versucht, worin das Problem des Seins besteht.» Das Mädchen kicherte, er zog die Luft scharf ein, Hektor drehte mir den Rücken zu, und der Fingernagel lag nun etwas einsam vor mir auf der grauen PVC-Auslage.
«Das Problem des Seins besteht darin, dass es ein Problem der Wissenschaft geworden ist.» Man stelle sich einmal das Sein in der Mitte vor – ich hatte für diese Erklärung extra eine Skizze angefertigt -, neben dem Sein befanden sich die wissenschaftlichen Fachbereiche fächerartig aufgereiht. Jeder Wissenschaft ordnete ich die jeweiligen Problemfelder zu, beispielsweise der Psychologie. Ihr Problem ist, dass sie die Persönlichkeit aufteilt in 50% Gene, 40% Umwelt und einen Fehleranteil von 10%, den man als freien Willen bezeichnen musste, weil man sonst nichts weiter damit anzufangen wusste. Auf der anderen Seite befand sich die Theologie, die ich deshalb als Wissenschaft angeführt hatte, weil sie ein umfassendes Erklärungssystem bereitstellt, indem die Instanz Gott das Sein legitimiert. Gott offenbart sich jedoch als eine Instanz, von der man bis heute nur sagen kann, was sie nicht ist; auch die Theologie versucht ihre Definitionslücken durch negative Kategorien zu retuschieren. Hinzu kommt die Mathematik, die zwar exakte Formeln aufstellen kann, welche aber nur unter Ausschluss unbekannter Variablen funktionieren. Zum Schluss hatte ich noch die Philosophie angeführt, die daran scheitert, dass sie nicht erklären kann, worauf die Wahrnehmung des Seins beruht und Descartes daher einen Homunkulus annahm, der im Kopf des Menschen sitzt und für diesen wahrnimmt. Diese war von allen Erklärungsfantasien noch die netteste.
Hektor fummelte nervös an seinen Fußfesseln. Die Dunkelheit breitete sich bis in die hintersten Winkel des Raumes aus, und ich musste meine Augen fest zusammenkneifen, um das Bild an der Wand noch erkennen zu können. Ich holte tief Luft und zerbrach die Stille: «Egal, ob 10 Prozent Fehleranteil, Gott, reduzierte Formeln oder Homunkulus – das alles sind nur Hilfskonstruktionen der Wissenschaften, die überspielen sollen, dass sie etwas Entscheidendes nicht erklären können: Das Sein.» Er zog eine Augenbraue nach oben. Am liebsten wäre ich aufgesprungen und hätte Achilles vom Wagen gestoßen, um sein Siegerkinn in den Boden zu pressen. Stattdessen kratzte ich mit dem linken Fuß den Fingernagel unter meinen Stuhl und flüsterte: «Wenn man das Problem nicht kennt, findet man auch keine Lösung.» Die andere Augenbraue schob sich ebenfalls nach oben, das Mädchen mit dem Lanzenhals rutschte ängstlich auf ihrem Stuhl hin und her, das Zimmer kannte keinen Lichtstrahl mehr und ich stand breitbeinig über dem gefallenen Achilles, der mir mit dreckverschmiertem Gesicht erstaunt entgegenblickte. Da trat Hektor hinter mich und legte seine Hand ruhig auf meine Schulter. «Wozu das alles?» Und weil ich ihm die Frage nicht beantworten konnte, murmelte ich mehr zu mir selbst: «Das macht die alte Wissenschaft überflüssig.», während ich das Schwert in Achilles Ferse stieß. Hektor senkte langsam den Kopf. Entgegen meiner Erwartungen beugte sich der Dozent eher gemächlich nach vorn, soweit bis die Tischkante hart gegen seine Eingeweide hätte drücken müssen, und fragte in einem Tempo, als würde seine Zunge eine Apfelsine bearbeiten, indem er jedes Wort im reinsten Hochdeutsch noch einmal zerschälte: «Und welche Lösung schlagen sie vor?» Schemenhaft konnte ich erkennen, wie er mit seinem Stift einen einfachen Strich quer über das Blatt Papier zog, welches vor ihm lag, und den Stift in genüsslicher Ruhe wieder auf den Tisch parallel zu seiner Hand legte.
Ich hatte 14 Semester Philosophie studiert und mich dementsprechend lange auf diese Frage vorbereiten können. Meine Erklärung war einfach, sie musste es sein, damit sie auch von jedem verstanden wird. Ich war mir sicher, dass selbst das Mädchen mit dem Lanzenhals meinen Erklärungen folgen könnte. Es ist nämlich so, dass sich das Sein im Allgemeinen nur auf das Menschsein beziehen kann. Und was ist der Mensch? Er ist ein Tier. «Um das Problem des Menschseins zu lösen, muss man sein Tiersein definieren. Weil aber der Mensch im Zuge der Zivilisierung, Industrialisierung und Urbanisierung sein Tiersein verleugnet hat, kann er auch kein vollkommener Mensch sein.»
Mein Dozent sah mich für einen Augenblick lang entsetzt an, kehrte aber recht schnell wieder zu seinen alten Gesichtszügen zurück, indem er einen Mundwinkel nach oben und den anderen nach unten schob und die Augenbrauen elegant über der Nasenwurzel justierte. Während er also seine Mimik sortierte, reichte er mir mittels rechtem Arm, der durch den hochgezogenen Hemdsärmel nackt war und sich wie ein sterbender Wurm vor mir aufbäumte, das Blatt Papier mit dem nicht ganz akkurat gezogenem Strich darauf. Das Mädchen zwirbelte unablässig eine Strähne ihres dünnen und farblosen Haars und starrte unbeteiligt wie ein Passant am Unfallort auf die anderen Fingernägel, die neben meinem Stuhl verstreut wie Blumensamen herumlagen. «Und ich hatte schon befürchtet, sie sagen etwas zum Thema. Sie können gehen. Sie haben zwar keine Note, aber dafür ihren Abschluss.» Er neigte sich zu seiner Assistentin, die ihren Kopf kaum noch in der Senkrechten halten konnte und raunte ihr zu, als würde ich seine leise Stimme in der Stille nicht hören können: «Hat sie was zu Aufgabe zwei gesagt?» Die Assistentin wisperte: «Nein, nichts, glaube ich.»
Als ich die schwere Tür des Instituts aufstieß, strahlte mir eine kühle Wintersonne unverhohlen ins Gesicht, und ich hielt mir die Hand vor die Augen. Hektor würgte das Blatt Papier in seinen Händen, unschlüssig, ob er es auf den Boden oder doch lieber in die Mülltonne schmeißen sollte. Ohne sich entschieden zu haben, zupfte er mir sogleich am Ärmel und blickte mich aus seinen braunen Augen zweifelnd an, indem er seine Stirn in Falten legte. Ich blinzelte durch meine gespreizten Finger hindurch zu ihm und fragte mich, ob er solch ein Gesicht auch auf dem Schlachtfeld gezeigt hatte und er deshalb seinen Feinden unterlegen gewesen war. Er war unruhig, er zog und schob mich wieder in Richtung Tür, während seine Arme nun hektisch um seinen Körper flatterten. Ich lächelte ihn nachsichtig an: «Nein, den Achilles beerdigen wir nicht, auch wenn es bei euch so Brauch ist. Bei uns lässt man die Toten liegen. Das erledigt nämlich ein Fachmann.» Immer heftiger bedrängte er mich und blickte dabei so verzweifelt, wie nur Kinder blicken können. Ich wand mich aus seinem Griff und drehte ihm, da ich mir nicht anders zu helfen wusste, den Arm auf den Rücken, so dass sein Körper abrupt in sich zusammen sackte.
Mein Lösungsvorschlag war nicht sehr umfangreich, aber es war ein Anfang und nur darum ging es ja. Einer musste den Anfang machen, einer musste für die, die ihm folgen werden, den Weg ebnen, sozusagen mit seiner Fantasie eine Schneise für die kommenden Generationen schlagen. Ich war bereit. Nur musste ich zunächst einmal Hektor davon überzeugen, sich von mir nicht nur die Straße entlang ziehen zu lassen, sondern auf eigenen Beinen zu stehen und mit denen möglichst schnell neben mir her zu laufen. Von einem griechischen Helden hatte ich mehr Wagemut erwartet. Wir durften keine Zeit verlieren, schließlich lag schon der erste braune Schneeschlamm zwischen Fahrbahn und Bürgersteig, der Himmel war ergraut wie das melierte Haar alternder Männer und die Menschen zogen sich die Kapuzen über die frierenden Köpfe. Es würde nicht mehr lange dauern und das Dröhnen der Streumaschinen würde sich über der Stadt ausbreiten und alles unter sich begraben. Der Winter in großen Städten war die Zeit der Selbsterkenntnis und Antidepressiva. Ich hatte dazu eine Statistik gelesen.
Trotz des Widerstandes von Hektor gelangten wir zügig in meine von blattlosen Rotbuchen gesäumte Straße. Um sich dem Tiersein zu nähern, müsste man das tun, was ein Tier tut, in unserem Falle ein Säugetier. Mit einer Hand hielt ich Hektor fest, der sich immer weniger zur Wehr setzte, mit der anderen schloss ich die Tür zu meiner Wohnung auf. Es war nicht nur einfach dunkel im Zimmer, sondern nahezu so schwarz wie die hinterste Windung eines Fuchsbaus. Hektor versuchte vergeblich, den Lichtschalter im Flur zu betätigen, ein sinnloses Unterfangen, schließlich hatte ich schon vor Wochen die Glühbirnen rausgeschraubt, zusätzlich dicke Teppichvorleger über die Fenster gespannt und mit Gaffaband abgedichtet. Um wenigstens die Sauerstoffzufuhr in der Wohnung zu sichern, blieb nur das kleine Fenster im Bad geöffnet, was nicht weiter störte, da es sowieso zum Hinterhof zeigte und dieser von den Schatten umliegender Häuser abgedunkelt wurde. Kurz und gut, es herrschte kaum eine Andeutung von Licht, und so tasteten wir uns blind wie Welpen an der Wand entlang zu meinem Schlafzimmer. Hektor stolperte mir willenlos hinterher und schien jegliche Kraft verloren zu haben. Seine Hand lag schlaff in meiner und hätte ich ihn nicht an den Schultern festgehalten, er wäre wohl zu Boden gegangen. Was war von seiner Stärke noch übriggeblieben? Ich lehnte ihn behutsam gegen den Türrahmen und betastete seine Stirn, die viel schmaler wirkte, als ich sie von heute Nachmittag in Erinnerungen hatte. Seine Haut war kalt und fühlte sich fremd an. «Wenn uns der Verstand nicht zu besseren Menschen macht, herrscht das Gesetz des Instinktes.» Am liebsten hätte ich ihn fest in meine Arme geschlossen und ihm durch sein gelocktes Griechenhaar «Vertrau mir» zugeflüstert, aber ich konnte diese Leere, die mit einem Mal zwischen uns aufgekommen war, nicht überwinden.
So standen wir uns lange schweigend gegenüber, fanden in der Dunkelheit nicht den Blick des anderen, und ich konnte nichts weiter tun als seinem Atmen zu lauschen, welches immer schwerer wurde, als hätte Achilles seinen Fuß auf Hektors Brustkorb gesetzt und würde nun nach und nach sein Gewicht nach vorn verlagern. Ich wartete auf ein Zeichen des Einverständnisses von ihm, er war mein Freund, ich konnte ihn nicht einfach dazu zwingen, mit mir den Anfang zu machen, die Schneise zu schlagen.
Ein Geräusch riss mich aus den Gedanken heraus, besser gesagt, es war das Fehlen eines Geräusches, welches mich irritierte; ich begriff zunächst nicht, was genau an diesem Moment seltsam war. Hektor hatte kurzzeitig aufgehört zu atmen, ich wusste, dass er dies mit Absicht getan hatte, und so schlug ich ihm mit der flachen Hand gegen die Rippen, erst erschrocken und dann aus Wut. «Also los» rief ich ihm zu und schob ihn bestimmt in mein Zimmer, in dem etliche Kissen und Decken wild verstreut herumlagen und uns mit den ersten Schritten einsinken ließen. Die Möbel hatte ich schon im März an die Studenten, die ein Stockwerk unter mir eingezogen waren, verschenkt. Danach wurde mir ein Platz auf ihrem kaputten Sofa angeboten und eine Flasche Bier in die Hand gedrückt. Der Abend begann recht angenehm und es wurden nach und nach weitere Weinflaschen entkorkt.
Ich war gerade dabei, ihnen meine Theorie des Menschseins zu erläutern, immer bestrebt darin, weitere Wegegefährten für die Sache zu gewinnen, als mir ein ziemlich betrunkener Lehramtsstudent ins Wort fiel, in dem er lachend verkündete: «Das ist doch nicht neu. Tarzan hat es vorgemacht!» Nach dem das darauf folgende Handgemenge von den umstehenden Zuhörern aufgelöst wurde, glättete ich bedächtig mein Shirt und überließ diese Menschheit sich selbst. Die Möbel sollten sie trotzdem behalten. Ich hatte schließlich keine Verwendung mehr dafür. Zwischen den Kissen stapelten sich Thunfischdosen, dutzende Packungen verschiedener Trockenkekssorten und Wasserflaschen.
Eine funktionierende Rückbesinnung auf das Tier in uns muss gut vorbereitet sein. Ich drückte Hektor sanft in die Kissen und warf einige Decken über uns. Dann hielt ich ihm meine geöffnete Handfläche entgegen, in der sich zwei kleine, weiße Tabletten versteckten und darauf warteten, verdaut zu werden: «Du eine, ich eine». Hektor berührte vorsichtig meine zerfurchten Fingerkuppen, und für einen kurzen Augenblick fühlte es sich wie ein Streicheln an. Ich tastete wieder nach seiner Stirn und stellte traurig fest, dass er seine Augenbrauen misstrauisch zusammengezogen hatte. «Wenn du aufwachst, nimmst du gleich zwei. Ich hab das genau berechnet.» Nun zwang ich ihm die erste Tablette in den Mund, schluckte auch meine hinunter und legte die kleine Metalldose hinter mich. Ich wollte, dass er mir vertraut und sprach ihm aufmunternd zu: «Du kannst auch was von dem Thunfisch essen, wenn du Hunger hast.» Hektor war ein Held, weil er nach seinen Prinzipien handelte, und doch lag er nun teilnahmslos neben mir, als würde sein Körper wieder der Leichnam sein, den man bis zum Sonnenaufgang über das Schlachtfeld gezogen hatte. Ich empfand plötzlich einen Schmerz irgendwo zwischen Bauch und Hals, ohne mir recht erklären zu können, warum dieser Schmerz da, war und der Umstand, dass ich es mir eben nicht erklären konnte, stürzte mich in eine seltsame Verzweiflung. Er hatte damit begonnen, seinen Kopf von einer Seite auf die andere zu werfen, gleichzeitig hob und senkte er seine Schultern, alles verkrampfte sich in ihm und aus seinem Mund kam ein tiefes Grollen, was mir Angst einflößte. Es war ein Beben und Erzittern, so stark, dass es sich auf mich übertrug, und weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, drückte ich ihm mit zwei Fingern die Augenlider zu, umschlang ihn fest mit Armen und Beinen und flüsterte ihm ins Ohr: «Träum`, Hektor, schlafe und träume etwas Gutes. Wir sehen uns in zwei Monaten wieder, wenn der Winterschlaf zu Ende ist.» ■
.
____________________________
Geb. 1986 in Illmenau/D, Studentin der Psychologie, Kulturwissenschaften und Medienpädagogik, Arbeit im Theaterbetrieb als Regisseurin und Autorin, lebt in Leipzig
.
.
.
.
.
.
.
Kurzprosa von Paula Küng
.
Vier verlorene Tage – oder Paris pour toujours
Paula Küng
.
Eigentlich war’s aus und fertig. Sie wusste es. Dennoch hatte sie sich entschlossen, nach Paris zu fahren. Jetzt war sie da. Aber er hatte keine Zeit für sie. Das alte Lied! Aber es war doch der drittletzte Tag des Jahres, und sie wollte unbedingt Sylvester in Paris verbringen! Von der Schule wusste sie: Champagner auf der Strasse, Umarmungen und Küsschen von Wildfremden. Alles viel lustiger als zu Hause in der braven Schweiz. Waren sie nicht letztes Jahr auf einem Acker zwischen Biel und Benken mit dem Auto stecken geblieben? Bitte, keine Wiederholung von Sylvester mit ihrem kleinen Bruder und seinen Studienkollegen!
In Paris konnte sie in der Wohnung von Freunden übernachten. Sie befand sich im Quartier Latin, an der Rue Monge mit der sinnigen Hausnummer 101; es war eine Parterrewohnung, kalt, dunkel, muffig. Der Kühlschrank lief nicht, aber das spielte jetzt im Winter keine Rolle. Sie brauchte nichts zu bezahlen, das war das Entscheidende. Vier Tage in Paris! Sie war mit dem Nachtzug in der Gare de l’Est angekommen, und sie würde auch wieder mit dem Nachtzug nach Basel über die Grenze zurückkehren, im neuen Jahr.
Endlich erreicht sie Finn am Telefon in der Botschaft, wo er als Laufbursche arbeitet, um sich sein Studium zu finanzieren. Sie treffen sich an der Métrostation Place Saint-Placide, in der Nähe seines Zimmers. Später trinken sie einen Espresso in der Bar eines Auvergnat. Die Wirtin ist nett. Anderntags geht sie in das gleiche russige Lokal, trinkt einen Espresso und denkt an ihren Freund. In der Küche nebenan hört sie die geile Lache der Wirtin, während sie sich mit dem Wirt und mit Gästen unterhält. Sicher machen sie Witze über sie und ihren Freund, wie sie auf der Bank geschmust haben. Es war ein Fehler gewesen zurückzukommen.
An Sylvester wird sie sich mit Finn zum gemeinsamen Mittagessen treffen. Der Bullier ist offen: Es ist das Restaurant universitaire an der Rue de l’Observatoire. Ganz in der Nähe, am Boul’ Mich’, befindet sich das Foyer international pour jeunes filles. Dort, in der Eingangshalle, wartet sie auf ihren Freund. Der Portier hat sie hereingelassen, fragt nach ihren Wünschen. Sie möchte hier warten. Sie setzt sich auf eine Bank, später legt sie die Beine hoch, legt sich hin. Es ist kalt. Plötzlich steht der Wächter vor ihr und fragt, ob es ihr schlecht sei. Nein, nein, sie sei nur müde. Sie entschuldigt sich, setzt sich kerzengerade auf das Bänklein. Endlich kommt Finn. Er trägt seinen grünen Mantel, den Kragen hochgeschlagen. Im Restau U gibt es eine weihnachtliche Bûche zum Dessert. Sie freut sich, Finn zu sehen, und ist ganz zufrieden. Aber mit dem Sylvesterabend ist nichts. Der Botschafter hat eingeladen, wie sollte er sie vorstellen? Die Angehörigen der Botschaft sind dort, es wird über Afrika und über Politik gesprochen. Sie ist eine Weiße.
Am Abend ging sie wieder zur Eglise Saint-Placide. Sie verbrachte den Abend in einem modernen Lokal mit verspiegelten Wänden und großen, breiten Bänken, die mit grünem Plastik über dicken Kunststoffpolstern bezogen waren. Der Plastik zeigte bereits Risse. Das Lokal war eines jener, die so sehr das typische Pariser Café verkörpern. Dazu die grünen Tassen in verschiedenen Grössen, mit oder ohne Zierrand. Um Mitternacht war es, wie sie es von der Schule her wusste: Champagner auf der Strasse, Umarmungen und Küsschen von Wildfremden. Prosit Neujahr. Ihren Freund würde sie am nächsten Abend an der Gare de l’Est wiedersehen. Ihr Zug fuhr um 22.22 Uhr. Es blieb noch Zeit, zusammen einen Grand crème zu trinken, sich zu umarmen, sich zu verabschieden, sich Treue zu schwören und einander das letzte Geld zuzustecken. Das neue Jahr würde zeigen, was es brachte. Ach, es lag noch so viel Zeit vor ihnen! Ach, es war noch nicht aus und fertig. Ihre erste Liebe ließ sich doch nicht an Sylvester begraben, vier Tage in Paris ließen die alte Leidenschaft aufleben, es waren vier gewonnene Tage.
Eine Liebe ließ sich sehr wohl an Sylvester begraben, wusste sie genau zehn Jahre später. Aber das ist eine andere Geschichte. ■
.
.
_____________________________
Geb. 1944 in Budapest/H, Studium der Romanistik, Germanistik und Geschichte in Basel und Paris, Dr. phil., Prosa-Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien, wissenschaftliche Buch-Publikationen, lebt in Reinach/CH
.
.
.
Satirische Fabel von Angela Mund
.
Hundegespräche
Angela Mund
.
«Ich glaube ja, es ist ein Fluss.» – «Nein, vielleicht eher ein Äther!» – «Es fließt auf jeden Fall.» – «Ja, fließt die ganze Zeit.» – «Ewig.» – «Und unsere Seelen schwimmen darin wie Kronkorken in der Pfütze.» – «Klingt irgendwie unlyrisch, versuch doch mal das: Schwimmen darin wie Fische im Strom.» – «Ja, und wenn man eine wichtige Erkenntnis hatte, dann ist man sozusagen eine Kurve weiter.» – «Und das hört nie auf?» – «Nein, niemals.» – «Ich find ja auch das Strom-Motiv ziemlich stark, daher auch solche Redewendungen wie Von-Eifersucht-geschüttelt, oder: Von-Freude-ergriffen» – «Oder: Vom-Zorn-gepackt.» – «Ja, das ist stark, das hat Aussage, da steckt ganz viel drin.» – «Man wird da einfach mit reingerissen.» – «Wichtig ist aber auch die Gerechtigkeit, der Ausgleich, die Harmonie der Dinge.» -«Ja, klar.» -«Ich meine, alles, was man anderen antut, wird einem selbst angetan.» – «Hm, aber letztlich widerfährt man nur sich selbst.» – «Das sagen doch auch die französischen Existenzialisten, glaub ich.»
So saßen die beiden alternden Hunde einander gegenüber und reflektierten ihr Dasein im Angesicht des ewigen Kosmos, während der Lastwagen über eine schlecht gebaute Straße fuhr und die Hunde im Innenraum durchgeschüttelt wurden, als wolle man sie mürbe würfeln. Joe, ein 15-jähriger Mischling, war in seinem Leben immer gut alleine durchgekommen, bis ihn die Arbeiter einer Chemiefabrik in Thessaloniki fanden, abgemagert, sein Fell zerzaust wie ein Weihnachtsbaum Ende Januar, eingelebt zwischen den Kartons auf dem Fabrikgelände. Ausgerechnet ein deutscher Arbeiter hatte Mitleid mit ihm gehabt und eine Tierschutzorganisation benachrichtigt. Diese Gutmenschen hatten dann auch nichts Besseres zu tun gehabt, als ihn seiner Wohnung zu berauben, ihm die Eier abzuschneiden und in einen wenig komfortablen Transporter nach Deutschland zu stecken. Aber ihn hatte man ja nicht gefragt, knurrte Joe.
Im Transporter herrschte eine lichtvergessene Dunkelheit, nur ab und zu funkelte ein glänzendes Augenpaar auf, misstrauisch wie Frühlingsknospen – die Enge war drückend, dutzende Hunde lagen dicht an dicht, jeder konnte das nervöse Zucken im Pelz des Nachbarn spüren, der Gestank ergoss sich in den Raum wie heißer Teer und ließ selbst die Alten würgen.
Jack, ein Boxer mit riesigen Lefzen, nickte bedächtig. Auch ihn hatte die Tierschutzorganisation gekidnappt, bloß weil er ziellos über die Strände von Korfu lief, zufrieden mit den Streicheleinheiten der Touristen und den paar Fischköpfen, die ihm die alten Fischer abends, wenn sie vom Fang zurückkamen, zugeworfen hatten. So dachte man wohl, er hätte kein Zuhause mehr und müsse sofort gerettet werden, damit er als ein Geburtstagsgeschenk von den Eltern an ein kleidtragendes Menschenkind weitergereicht werden kann, die ihm dann eine Puppe auf den Rücken setzt, Kartoffelbrei ins Fell schmiert und das für Liebe hält.
Jack hatte sich mit Buddhismus beschäftigt und war überhaupt im Allgemeinen sehr belesen – das hatte er von seinem ersten Herrchen gelernt, einem herumreisenden Hippie, der ihn nach anderthalb Jahren Straßenurlaub aus Versehen in Griechenland vergessen hatte. Zumindest kannte er von ihm das Prinzip der Wiedergeburt und hielt vor den anderen Hunden umfangreiche Vorträge darüber, um die lange Fahrt etwas angenehmer zu gestalten. Jack und Joe hatten während der Plenarsitzung am Rasthof Eichelborn den Vorschlag unterbreitet, noch eine schlechte Tat zu begehen. Damit, so Jack, würde die Wahrscheinlichkeit steigen, im nächsten Leben als Hund wiedergeboren zu werden. Die anderen Hunde nickten schweigend in tiefem Einverständnis, denn sie hätten sich in dem Moment nichts Besseres vorstellen können als ein Hundeleben im ewigen Äther.
Als der Transporter gerade wieder losfahren wollte, gab Joe ein Zeichen, und alle Hunde begannen gleichzeitig zu jaulen und zu bellen, was ihre müden Stimmbänder noch herzugeben vermochten. Aus den Hundekehlen dröhnte das Getöse in allen erdenklichen Lautstärken und Rhythmen, die sich harmonisch wie ein Choral über den Roggenfeldern wiederfanden und gemeinsam in den Himmel emporstiegen, um auch der höchsten Wolke die Töne ins Fleisch zu schlagen, auf dass sie das Gebet in die Schwärze des Alls begleiten möge. Manche Hunde zitterten schon vor Erschöpfung und röchelten mit letzter Kraft ihr Lied aus dem Leib, und je schwächer der eine wurde, desto lauter kläffte sein Nebenmann für ihn mit. Der Transporter hielt zögerlich auf dem Standstreifen an, die Tierschützer riefen sich aufgeregt ein paar Worte zu und öffneten die Hintertür des Wagens, um nach dem Wohlergehen ihrer Schützlinge zu schauen.
Da sprangen alle Hunde wild heulend aus der Dunkelheit des Verladeraums hinaus in das gleißende Licht einer untergehenden Abendsonne, die ihre letzten Strahlen dem hundgewordenen Himmelfahrtskommando widmen sollte. Wie die Reiter der Apokalypse sprangen sie den verwundert blickenden Tierschützern entgegen, und in ihren Augen spiegelte sich die Ignoranz derer, die außer ihrem Leben nichts zu verlieren haben. Noch im Sprung sahen ihre geöffneten Mäuler aus wie die düsteren Tore zur Unterwelt, und mit einer Wucht, die das Alter der Hunde vergessen ließ, stürzten sie auf die Tierschützer, bohrten scharfe Zähne in leicht teilbares Fleisch, um in wenigen Sekunden die Tierschützerkörper zu zerreißen, so dass ihre Eingeweide in Fetzen wie Schneeflocken rot durch den Himmel perlten und sachte auf das Fell der Hunde fielen. Arme und Beine wurden demokratisch untereinander verteilt. Selbst die Großen wurden satt davon.
Joe blinzelte zufrieden dem Roggenfeld entgegen: «Das sollte reichen. Wir werden wohl keine Menschen mehr.» Jack schmatzte: «Jaja, fast so gut wie die Fischköpfe früher.» ■
.
____________________________
Geb. 1986 in Illmenau/D, Studentin der Psychologie, Kulturwissenschaften und Medienpädagogik, Arbeit im Theaterbetrieb als Regisseurin und Autorin, lebt in Leipzig
.
.
Mini-Groteske von Horst-Dieter Radke
.
Das Allerletzte
Horst-Dieter Radke
.
«Wenn mir sonst nichts mehr einfällt, dann gibt es immer noch das Allerletzte!» sagte Markus.
«Das Allerletzte?» fragte Petra erschrocken und sah ihn mit großen, ängstlichen Augen an. Es war Nacht und dunkel, und sie standen neben ihrem Auto, das keinen Ton mehr von sich gab. Selbst die Zündung klickte nur noch beim Drehen des Schlüssels. Und auch die Batterie war leer und lieferte kein Licht. Laternen gab es hier draußen nicht. Außerdem war Neumond und die Wolken verdeckten die meisten Sterne.
«Ja, das Allerletzte», sagte Markus und nahm ihre Hand.
«Was ist das Allerletzte?» sagte Petra und zog ängstlich ihre Hand zurück.
Markus lachte, und das erschreckte sie mehr, als wenn er sie geschlagen oder zu Boden geworfen hätte.
«Einfach losgehen. Nicht überlegen, wohin und warum. Immer der Straße nach.»
Petra lachte erleichtert, nahm wieder seine Hand und ging glücklich mit ihm in die dunkle, unbekannte Nacht. ■
.
.
_____________________________________
Geb. 1953, aufgewachsen in Hamm/D, lebt heute in Lauda-Königshofen im Taubertal, arbeitet freiberuflich als Autor, Lektor und Journalist, zahlreiche Veröffentlichungen im Sachbuch-Bereich
.
.
Benjamin Stein: «Die Leinwand»
.
Auf der Suche nach der Identität
Günter Nawe
.
 Wer bin ich? – fragen sich die beiden Hauptpersonen in Benjamin Steins raffiniert konstruiertem Roman «Die Leinwand». Und wie lese ich? – fragt sich der Leser. Wie man es auch dreht und wendet: das Buch ist von hinten und von vorn, von vorn und von hinten zu lesen. Und ganz Mutige können auch irgendwo in der Mitte anfangen.
Wer bin ich? – fragen sich die beiden Hauptpersonen in Benjamin Steins raffiniert konstruiertem Roman «Die Leinwand». Und wie lese ich? – fragt sich der Leser. Wie man es auch dreht und wendet: das Buch ist von hinten und von vorn, von vorn und von hinten zu lesen. Und ganz Mutige können auch irgendwo in der Mitte anfangen.
Bei der Buchmesse in Leipzig verkaufte Benjamin Stein sein ungewöhnliches Buch als einen «Akt des Widerstands gegen die Digitalisierung». Das Verwirrspiel um die beiden Hauptfiguren, den Analytiker Amnon Zichroni und den Journalisten Jan Wechsler, hat aber sicher noch einen anderen, einen tieferen Sinn. Ihre gemeinsame deutsch-jüdische Geschichte beginnt, nachdem die Biographien von verschiedenen Seiten aufeinander zulaufen, mit Minsky, einem genialen Hochstapler. Plötzlich leben sie ein anderes Leben – unsicher in ihrem Selbstverständnis, über ihrer Identität. Es geht um die Verlässlichkeit der Erinnerung.
Für Amnon Zichroni heißt das: «Ich glaubte lange Zeit, ich hätte so etwas wie einen sechsten Sinn…» Hat er doch die Fähigkeit, die Erinnerungen anderer Menschen nachzuempfinden, sich in sie hinein zu leben. Beste Voraussetzungen als Psychoanalytiker mit einer Praxis in Zürich. Ganz anders erlebt es Jan Wechsler. Er verliert in seinen Erinnerungen die Orientierung und damit einen großen Teil seiner Lebensgeschichte.
«Aneinander geraten» Zichroni und Wechsler über ein Buch des alten Geigenbauers Minsky, der als Kind Auschwitz überlebt hat. Von Zichroni veranlasst schreibt Minsky seine Erinnerungen; schreckliche Erinnerungen – wie Zichroni sie dank seiner seltenen Gabe miterlebt. Der Journalist Jan Wechsler mit einer DDR-Biographie begibt sich auf Spurensuche und entlarvt das Buch von Minsky als geniale Fälschung. Dafür bedient sich Benjamin Stein einer Geschichte, der Geschichte von Benjamin Wilmorski.
 Benjamin Stein ist ein brillant und aufregend «konstruierter» Roman gelungen, sprachlich brillant, mit großem psychologischem Einfühlungsvermögen für seine Figuren, die durchweg als erstaunliche Charaktere auftreten.
Benjamin Stein ist ein brillant und aufregend «konstruierter» Roman gelungen, sprachlich brillant, mit großem psychologischem Einfühlungsvermögen für seine Figuren, die durchweg als erstaunliche Charaktere auftreten.
Aber damit nicht genug und weiter in der Geschichte. Plötzlich taucht ein ominöser Koffer bei Wechsler auf. Eindeutig sein Koffer, glaubt man den Schriftzügen und dem Namensschild. Allerdings fehlt Wechsler jegliche Erinnerung daran. Auch seine Herkunft, ja seine ganze Biographie stellt sich plötzlich anders dar.
Und weiter treibt der orthodoxe Jude und Schriftsteller Benjamin Stein sein herrlich intelligentes Verwirrspiel – bis hin zu einer alten Mikwe mit ihrem «lebendigen Wasser» in Israel. Auch hier bewegen sich die beiden Protagonisten noch einmal aufeinander zu, bleiben aber «biographisch» immer noch auf unsicherem Grund.
Ein Buch über die existentielle Frage «Wer bin ich?». Zudem eine literarische Glanzleistung. Und: Ein Buch für Leser, die sich gern verwirren lassen und dann umso mehr Freude an der Entwirrung haben. ■
Benjamin Stein, Die Leinwand, Roman, C.H. Beck München, 416 Seiten, ISBN-13 978-3406598418
.
.
.
Florence Hervé (Hg.): «Durch den Sand»
.
Leben, träumen, reisen in der Wüste
Dr. Karin Afshar
.
 Das Buch liegt weich und doch fest in der Hand, fast hätte ich etwas Rauheres erwartet, aber nein, der Einband ist glatt. Auf dem Coverfoto sehen wir im Vordergrund Fußspuren im Sand; sie führen erst hin zu einer rot gekleideten, einen langen Strich-Schatten auf ihre rechte Seite werfende Frau genau in der Mitte, und dann wieder von ihr weg, über Sanddünen ihr vorauseilend auf ein fernes Gebirge zu. Bilder von Weite und Leere sind es, die das Wort Wüste in uns aufsteigen lässt, ganz unabhängig davon, ob wir selbst einmal eine reale erlebt haben oder sie aus je eigener innerer Erfahrung kennen. «Wüste» ist auch ein Seelenzustand.
Das Buch liegt weich und doch fest in der Hand, fast hätte ich etwas Rauheres erwartet, aber nein, der Einband ist glatt. Auf dem Coverfoto sehen wir im Vordergrund Fußspuren im Sand; sie führen erst hin zu einer rot gekleideten, einen langen Strich-Schatten auf ihre rechte Seite werfende Frau genau in der Mitte, und dann wieder von ihr weg, über Sanddünen ihr vorauseilend auf ein fernes Gebirge zu. Bilder von Weite und Leere sind es, die das Wort Wüste in uns aufsteigen lässt, ganz unabhängig davon, ob wir selbst einmal eine reale erlebt haben oder sie aus je eigener innerer Erfahrung kennen. «Wüste» ist auch ein Seelenzustand.
«Durch den Sand» ist der Titel der Anthologie, die im Aviva Verlag frisch in diesem Jahr erschienen ist. Florence Hervé ist die Herausgeberin, und sie hat 29 Autorinnen einschließlich sich selber in die Wüste geschickt. Was erwartet den Leser dort? Und wer ist der Leser, an den sich das Buch wendet?
Was sich die Herausgeberin mit diesem Buch vorgenommen hat, erfahren wir im Vorwort. Es kündigt die Autorinnen an und ordnet sie unterschiedlichen Beweggründen, Hintergründen und Absichten zu. Zeitgenössische Schriftstellerinnen kommen zu Wort, aber auch «klassische» aus Vor-Jahrhunderten und -Denkzeiten, bekannte und weniger bekannte, solche, die in Wüstengebieten leben und solche, die sie bereisen.
Beim ersten Durchblättern, das ich mir nicht verkneifen kann, entdecke ich nach fast jedem Beitrag ein Schwarz-Weiß-Foto mit Wüstenmotiven. Zurückhaltung spricht aus dem Layout, Zurückgenommenheit – Farbe hätte hier gestört.
Im hinteren Teil erfahren wir auf 15 Seiten etwas über die Autorinnen, deren Kurzbiographien individuell sind, weil jede ihre eigenen Lebens- und Erlebnis-Schwerpunkte hat. Ich blättere ein wenig, aber die Frauen sprechen noch nicht mit mir.
Die erste Geschichte «Äpfel aus der Wüste» ist genau von der Art, die ich persönlich sehr gerne lese. Jetzt bin ich neugierig auf die nächste. «Die Wüste wirft Buckel» kommt mir im Erzählduktus bekannt vor… Nach der vierten Geschichte muss ich das Buch allerdings zur Seite legen, denn ich kann nicht mehr. Bei «Töchter der Agar» und «An beiden Enden» muss man sehr genau hinlesen, wirken lassen, aufs Verstehen, vielleicht auch auf das inwendige Schaudern, lauschen.
Am nächsten Tag, bevor ich wieder zu lesen beginne, schaue ich mir die Einteilung an. Drei große Blöcke finden sich: ‘Leben in der Wüste’, ‘Träume in der Wüste’ und ‘Reisen in der Wüste’. Der zweite Abschnitt scheint mehr Gedichte als Geschichten zu enthalten, ich habe das nicht ausgezählt. Aber auch die kann man nicht schnell lesen; weit gefehlt haben die, die das denken. Jedes Einzelne fordert Nachlesen ein, lässt die Zeit langsam werden, entschleunigt.
Für wen nun dieses Buch? Leser, die Zerstreuung erwarten, werden das Buch schnell weglegen. Formulierte ich es negativ, würde ich sagen, dass es keine leichte Sommerlektüre für den Liegestuhl am Strand ist, die man aufschlägt und dann verschlingt. Es ist eine schwere Lektüre, die dem Leser, oder der Leserin, etwas abverlangt.
Die Herausgeberin hat sich natürlich Gedanken über die Abfolge der Beiträge gemacht, und die ist gelungen. Sie schließt die Anthologie mit dem «Wüstenalphabet» von Lisette Buchholz und damit einen Kreis – eine beschwerliche Reise haben wir gemacht, sind hinabgestiegen und ganz unten angekommen. Wir verlassen die Wüste geläutert. Den heiteren Ton dieses letzten Beitrags haben wir uns verdient, die Leichtigkeit entlässt uns – in die nächste Wüste? ■
Florence Hervé (Hrsg.), Durch den Sand, Schriftstellerinnen in der Wüste, Anthologie, Aviva Verlag, 220 Seiten, ISBN 978-3-932338-41-0
Probeseite (Vorwort)
.
Vorwort
Sand und Steine. Stille und Sterne. Wind und Weite.
Raum und Zeit. Die Wüste war und ist Quelle der Inspiration
für viele Schriftstellerinnen, Dichterinnen
und Reporterinnen.
Die Wüste ist Ort der Träume und Alpträume, des
Glücks und des Schmerzes, des Lebens und des Todes.
Mythen umgeben sie. Sie ist nicht tot. Sie ist
nicht nur Dürre, Einöde oder Abenteuerland. Sie kann
blühen. Sie ist Symbol für Unendlichkeit, Ewigkeit
und Freiheit, aber auch für Menschenfeindlichkeit
und Einsamkeit. Faszination und Gefahr stehen nebeneinander.
Die ausgewählten 29 Autorinnen aus Australien, Lateinamerika,
Afrika, dem Maghreb, dem Nahen und
Mittleren Osten sowie aus Europa nehmen die Wüste
auf unterschiedliche Weise wahr. Mit ihnen durchwandern
wir die australische, die Mojave- und die Gobi-
Wüsten, die Sahara und den Negev und erleben die
Vielfältigkeit einer Landschaft, die in der europäischen
Sicht meist auf orangefarbene wellige Sanddünen
reduziert wird. Ob sie in der Wüste leben und arbeiten,
ob sie von der Wüste träumen und diese
mystisch erfahren oder ob sie in die Wüste reisen:
Der Blick der Schriftstellerinnen und deren Schreibweise
unterscheidet und verändert sich.
Unter den ersten, die über die Wüste schrieben, ist
im 7. Jahrhundert Maisûn, die Gattin eines Kalifen, die
das schlichte glückliche Wüstenleben besingt. Im
Mittelalter beschreibt die Begine und Mystikerin
Mechthild von Magdeburg den Weg zur Vollkommenheit
als Weg zur »wahren Wüstenei«. In ihrer Meditation
Das fließende Licht der Gottheit wird die
Wüste zum Symbol für das Bescheidene, das Mündige,
das Unabhängige und Spirituelle.
Das 19. Jahrhundert ist von einer literarischen Orient-
Mode erfasst, wobei die Wüste für das Fremde,
das Andere, für Grauen und Faszination, für Aufbruch
und Sehnsucht nach Ursprünglichkeit steht. Der Ort
des Schreckens erfährt eine Umdeutung als Ort des
Erhabenen. Unter den Schriftstellerinnen, die sich
vom Wüstenwind und von den Klängen des Orients
beflügeln lassen, sind die Dichterinnen Karoline von
Günderrode und Annette von Droste-Hülshoff.
Im 20. Jahrhundert wird die reelle Wüste entdeckt.
Abenteuerinnen und reisende Reporterinnen brechen
mit Kamel und Zelt auf, vornehmlich in die Sahara.
Isabelle Eberhardt, sozusagen das weibliche Pendant
zum Poeten Arthur Rimbaud, fordert für sich das
Recht auf ein »unstetes Herumirren«, das Recht auf
Vagabondage: »Welch glückseliges Gefühl, eines Tages
mutig alle Fesseln abzuschütteln, welche das moderne
Leben und die Schwäche unseres Herzens uns
unter dem Vorwand der Freiheit angelegt haben;
sich symbolisch mit Stab und Bettelsack zu rüsten
und fortzugehen!« Die Vagabondage ist für sie Befreiung,
das wandernde Leben Freiheit, die Wüste eine
Stätte der Ruhe, der Schlichtheit und der Schönheit,
eine Oase des Friedens. »Ich liebe meine Sahara, ich
liebe sie mit einer dunklen, geheimnisvollen, tiefen,
unerklärlichen, aber durchaus wirklichen und unzerstörbaren
Liebe.«
Zu dieser Zeit durchstreifte die englische lebensund
reiselustige Adlige Gertrude Bell die Wüsten Arabiens,
unternahm Forschungsreisen nach Palästina
und Transjordanien. Ihr Bericht darüber ist der einer
Orientalistin, Archäologin, Historikerin und Diplomatin.
Für die Schweizer Reisenden Ella Maillart und Annemarie
Schwarzenbach waren das Abenteuerleben und
das Schreiben untrennbar miteinander verbunden.
Zusammen durchquerten sie den Iran, Afghanistan
und die Türkei.
Die bretonische Ethnologin Odette du Puigaudeau,
auch Pionierin der Sahara genannt, reizten Abenteuer,
Herausforderung und Risiko ebenso wie das entbehrungsreiche,
einfache Leben und die Begegnungen,
»die Ankunft an einem Brunnen, das Suchen
nach Weideland, eine Nachtwache am Feuer«. Die
Grenzenlosigkeit berauschte sie.
Die Australierin Robyn Davidson reiste 2.800 km allein
mit vier Kamelen durch Busch, Felsen und Sand.
In Spuren berichtet sie von den Strapazen und Freuden
ihrer Wüstenreise und stellt fest: »Die Fähigkeit
zu überleben ist vielleicht die Fähigkeit, sich von der
Umgebung verändern zu lassen.«
Die »magische Vision« und das »Farbspektakel«
der kalifornischen Wüste beeindrucken Christa Wolf,
die in ihrer Wüstenfahrt von witzigen und nachdenklichen
Begegnungen in den USA erzählt.
Andere Schriftstellerinnen sahen und sehen die Wüste
als einen Ort der Mystik, der Spiritualität, der Religion,
der Selbstfindung, der Zauberei oder gar der
Utopie.
In ihrer utopischen Erzählung Drei Träume in der
Wüste unter einem Mimosenbaum, vor dem Hintergrund der
»unendlichen« und »ewigen« Wüste, zeichnet
die südafrikanische Feministin Olive Schreiner die
Unterdrückung der Vergangenheit und den Kampf
um die Befreiung nach, weist auf die Zukunft eines
gleichberechtigten Lebens hin.
Für die Dichterinnen Else Lasker-Schüler und Nelly
Sachs ist die Wüste verbunden mit dem Heiligen
Land. Die Lyrikerin Mascha Kaléko, die 1945 nach Israel
emigrierte, wurde dort nicht heimisch. Die Wüstenei
ist für sie das Nirgendland, bedeutet Einsamkeit
und Heimatlosigkeit, auch Sehnsucht. Sie fühlt
sich »einsam wie der Wüstenwind« und »heimatlos
wie Sand«.
Für Ingeborg Bachmann ist die Wüste dagegen
eine Reise in das innere Ich, dort kann man sich nicht
entgehen. Die österreichische Schriftstellerin reiste im
Frühjahr 1964 zwei Monate nach Ägypten und in den
Sudan, schrieb an ihrem Wüstenbuch-Projekt: »Ich
nenne es vorläufig ›das Wüstenbuch‹, da eine reale
Wüstendurchquerung den Inhalt ausmacht. Die Wüste
ist der Held.« Sie ist »die unendliche Langeweile für
den einen, die immerwährende Erregung für den,
dessen Augen von ihrem Sand ausgezeichnet werden
«. Der leere und reine Wüstensand steht als Gegenbild
»zur verwüsteten Welt«, von ihm wird Erlösung
erwartet.
In Tanja Dückers Roman Der längste Tag des Jahres
erscheint die Wüste als Rückzugsstätte, als Ort der
Suche nach dem verborgenen Sinn des Lebens und
der Selbstfindung.
Für die Schriftstellerinnen aus dem Maghreb und
aus dem Nahen und Mittleren Osten ist die Wüste
von Ambivalenz geprägt. Manche haben dort Furchtbares
erlebt, Bürgerkriege und Kriege, Gewalt und
Vergewaltigung, aber auch Trost und Freiheit.
Die libanesisch-amerikanische Schriftstellerin und
Malerin Etel Adnan, die zwischen Kulturen, Sprachen
und Orten reist, beschreibt die ostsyrische Wüste von
Lawrence von Arabien als »das offene Nichts« und
die »endlose Wildnis«, die Wüstenaraber werden
»Geschöpfe des Windes« genannt. Ihr Fazit: Die »Eroberung
der Wüste ist eine erotisch befriedigende Erfahrung,
doch sie weist in die Illusion«.
In Fern von Medina besinnt sich die Algerierin
Assia Djebar auf die historischen Quellen des Islams
und zeichnet Porträts von Rebellinnen, darunter Agar,
»die der Sonne Ausgesetzte«. Abraham verließ Agar
und ihren Sohn Ismael in der Wüste.
Malika Mokeddems Darstellung der Wüste ist von
den dort erfahrenen Widersprüchen geprägt. Die algerische
Wüste, in der sie aufwuchs, ist Zelle der Traditionen,
zugleich Gefängnis für Frauen wie Ort des
Trostes, der Klarheit und der Freiheit. Sie schreibt von
der »erhebenden Trostlosigkeit«, vom »unbarmherzigen
Brennglas des Himmels« in der Wüste, aber
auch von der Sandwüste als »ein Meer der Träume«,
als »Raum der Freiheit«. Sie spürt in der Wüste
Angst und Faszination »an der Grenze des Erträglichen«.
Bei ihrem zehn Jahre langen Aufenthalt in Algerien
hat Sabine Kebir ebenfalls Veränderungen und Hoffnungen
erlebt, den Kampf um Frauenbefreiung, aber
auch Rückschläge, Frauenunterdrückung und Gewalt.
Dies beschreibt sie kenntnisreich, schildert die Sahara-
Landschaft und das Alltagsleben.
Die Wüste kann schließlich Synonym für kulturelle
Identität sein. Für die Ägypterin Miral al-Tahawi, die
in einer Beduinenfamilie aufwuchs, ist die Wüste
»lediglich eine Stammeskultur, die unseren Standort
im Dasein bestimmt«. Sie erfährt Unterdrückung und
zugleich Wärme in der Beduinenwelt, in der Frauen
für das Zelt zuständig sind, während Männer jenseits
des Tors die Freiheit erreichen.
Erstaunlich groß ist die Anzahl von Autorinnen, die
die Reise zu den kargen Landschaften und zu den Nomaden
wagen. Auch wenn unsere literarische Reise
lediglich einen kleinen Teil dieser Wüstenreisenden
versammelt, vermag sie doch unseren eigenen Blick
auf die Wüste zu verändern und lädt dazu ein, diese
neu zu erleben und zu erträumen.
Florence Hervé, Januar 2010
..
.
.
Kurzprosa von Beatrice Nunold
.
…und die Welt ist eine Scheibe
Beatrice Nunold
.
«Verdammt, wo hatte ich so etwas schon gesehen?» Ich starrte auf das hoch komplizierte Kachelmosaik. Unter meinen Füßen wanden sich verschlungene Knoten und Schlingen. «Quasikristalle1 , das sind Quasikristalle.» Die Penroseparkettierung, auch mittelalterliche arabische Knotenornamente wiesen 5-, 8- oder 10-, sogar 12-zählige Rotationssymmetrien auf. Aber dies war das verwirrenste Muster, das mir je unter die Augen gekommen war. Mir schwindelte bei seinem Anblick und dem Versuch eine Ordnung zu erkennen. Von dem Mosaik ging ein diffuses Leuchten aus, als würden die wenigen Photonen, die sich bis hier her durchgeschlagen hatten, reflektiert. Undurchdringliche Finsternis überspannte das nicht enden wollende Plateau. Feiner Nieselregen streichelte mein Gesicht, durchfeuchtete Haar und Kleidung und verlieh den Mosaiken einen geheimnisvollen Schimmer. Da war Musik. Sie füllte meinen Kopf. Leise sphärische Klänge schwollen zu einer gewaltigen Symphonie an. Das kannte ich doch, wenn auch anders, einfacher, rockiger, – die Pea-Brains2, – mein Lieblingslied. Doch kein Dampfhammer-Havey-Metal-Sound dröhnte in meinem Schädel. Vielstimmige Obertöne weiteten mein Bewusstsein, dehnten es bis an die Grenze zur Auflösung, bis an die Schwelle zur Finsternis, die in meinem Hirn heraufzudämmern drohte:
Strings swingen im Quantenschaum, im Quantenschaum,
Ein Gott träumt den 3-Bran-Raum.
«Morgenglanz …»
… im Quantenschaum …
«Esther!! Sieh dir das an …»
Ein Gott träumt…
«Ich glaube nicht, was ich da sehe!»
…den 3-Bran-Raum…
«Esther! Wach endlich auf!»
Tabahs Stimme wurde deutlicher. Der Obertonchor verstummte. Der Himmel lichtete sich. Das Fußbodenmosaik begann aus den Fugen zu geraten. Opaker Goldglanz brach zwischen den Rissen hervor. Ich glaubte zu stürzen. Der eigene Schrei gellte mir in den Ohren.
«Morgenglanz?! Wo bleibst du. Mallion! Schmeiß Esther aus dem Bett!»
Ein Rütteln ließ mein Bewusstsein wieder zum Zentrum meiner selbst zusammenzurren. Jemand schüttelte Goldstaub aus Kleidern und Haaren. Die Luft flirrte und während der Flitter zu nichts verging, erwuchs aus diesem Nichts eine Welt.
«Creatio ex nihilo», hörte ich mich kommentieren.
«Esther, hey! Alles wieder senkrecht?»
Die Welt war lila. Nein, die Welt waren Merrylls Augen, seine lieben lila Augen, die mich besorgt anblickten. Die Corona seines wirren weißen Haares brachte die Sonne in meine Welt zurück.
«Du hast geträumt.»
«Ja, einen Traum aus Quantenschaum.» Ich war immer noch benommen.
«Esther, komm endlich durch. Die Kapitänin wird auf der Brücke verlangt. Tabah flippt aus.»
«Was ist los, Tabah? Fragte ich als wir die Brücke betraten. Der Kamarianer sah mich mit seinen schwarz schimmernden Augen fragend an. Er brauchte nichts zu sagen. Mein Blick klebte am Panoramaschirm. Einen Moment lang glaubte ich, mein Traum spuke noch in meinem Hirn.
Die Besatzung des kleinen Raumschiffs war versammelt. Ich spürte ihre Ratlosigkeit.
«Woher soll ich wissen, was das ist, – irgendeine Quasikristall-Gigantomanie, – keine Ahnung. Was meint unsere Astro-Archäologin?»
«So etwas habe ich schon mal gesehen, nur viel einfacher. Auf Terra, glaub ich, hat die Islamisch-arabische Kultur eine ähnliche Ornamentik hervorgebracht. Vergleichbares gibt es bei uns auf Kama oder auf Kathara, die Mosaiken der Tubanischa und bei vielen anderen Planetenkulturen. Quasikristalle sind quasiperiodisch. Ihre Periodizität wird erst in einem höherdimensionalen Raum verständlich. Mathematik ist universal. Ich nehme an, diverse Kulturen sind auf vergleichbare Lösungen gekommen. Aber so etwas Kompliziertes …. Und wer um alles im Multiversum parkettiert die schwarzen Tiefen des Kosmos? «Fenet schüttelte den Kopf.
Das Schiff schwebte über eine nicht enden wollende Plattform blau-goldener Mosaiken auf weißem Grund. Sie schimmerten fahl in der Weltraumnacht.
Ich starrte unverwandt auf den Schirm: «Computer, Pea-Brains, Neuwelt.»
«Morgenglanz, bist du komplett durchgeknallt?»
«Halt die Klappe, Tabah.»
Aus einer anfänglichen Geräuschekakophonie entspannen sich Töne zu Melodiefäden und woben einen komplexen Klangteppich, darüber konnte der Schwermetallrhythmus nicht hinwegdröhnen. Er hämmerte die verschlungene Melodie auf unsere eindimensionalen Hörgewohnheiten herunter.
«Komplexitätsreduktion.»
«Was? Morgenglanz, ich mach mir ernsthaft Sorgen …»
«Ruhe, Tabah!»
Eternity, die Frontfrau der Band erhob ihre Rockröhre:
Der Tag trägt Trauer,
Die Farben der Nacht,
Ein sanfter Schauer
Streichelt ihn sacht.
Sacht, sacht in den Farben der Nacht, in den Farben der Nacht.
Zum Refrain unterstützten die Jungs grölend ihre Sängerin.
Strings swingen im Quantenschaum, im Quantenschaum,
Ein Gott träumt den 3-Bran-Raum.
Im Quantenschaum…
«Computer, stopp. Ich habe das schon einmal gesehen, – in meinem Traum und diese Musik gehört, nur sagen wir symphonischer, wie Sphärenklänge, – vielleicht eine Superstring-Sphärensymphonie.»
Das Bild auf dem Schirm änderte sich. In den Boden waren schmale, sehr lange Spitzbogenfenster eingelassen. Als wäre das nicht seltsam genug, zeigten diese in alle Richtungen. Hinter den Fensteröffnungen lauerte undurchdringliche Finsternis, manchmal gold-opak changierend.
«Entweder waren diese Baumeister total meschugge oder unfassbare Genies, oder beides,» murmelte ich vor mich hin.
Am Horizont kam so etwas wie eine Barriere ins Bild. Vor uns wuchs eine gewaltige, das ganze Blickfeld ausfüllende Quasikristallmosaikmauer und verlor sich in der Schwärze des Alls. Gemauerte Lanzettfenster zeigten scheinbar willkürlich nach oben, unten, seitwärts als hätte das Bauwerk keine Ausrichtung. Wie bei Vexierbildern kippte hinter den Fenstern samtenes Dunkel in aufglänzendes Gold.
«Transzendenz ohne Transparenz wie der Goldgrund mittelalterlicher Bilder. Die Lichtundurchlässigkeit des Goldes bringt das düsterste Leuchten des Universums hervor. ‚Fürchtet den Tag des Herrn, denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht’, Amos ich weiß nicht was.»
Die anderen Schwiegen.
«Der barbarische Glanz des Goldes ist bloß der Widerschein seiner immanenten Dunkelheit oder doch der Vorschein des Herrn Tag. Auf Terra gibt es das alte lateinische Wort sacer. Es bedeutet sowohl heilig als auch verflucht.»
«Ich bin keine Sprachwissenschaftlerin», meldete sich Fenet, aber zabrach auf Kama oder empur auf Sumfar hat eine vergleichbare Bedeutung.»
Unter uns sahen wir gewaltige Portale. Aus komplizierten Knotenmustern wuchsen groteske Dämonen oder lösten sich in diese auf. Höllenfratzen mit weit aufgerissenen Augen und Mäulern glotzten eher verzweifelt als böse. Wie die Fenster so hatten die Tore keine bestimmte Ausrichtung. Die Horizont und Firmament ausfüllende Mauer, auf die wir zuhielten, zeigte das gleiche Bild.
Tabah erholte sich als erster von dem Anblick: «Wir sollten landen, Morgenglanz, und uns dieses absurde Bauwerk näher ansehen.»
«Noch nicht.»
Ich setzte mich auf meinen Kapitänssessel und steuerte das Schiff senkrecht die Mauer empor. Doch das schien nur so. Die Mauer wandelte sich zum Plateau. Ich drehte das Schiff um 180 Grad. Neben uns ragte das einstige Fußbodenmosaik als Mauer in die schwarze Höhe. Das Schiff setzte auf. Unsere Sensoren zeigten ausreichend Sauerstoff und Schwerkraft.
Fenet, Tabah, Mallion und ich standen auf dem Fußbodenmosaik, das wir zunächst als Mauer identifiziert hatten. Es nieselte und der Tag trug Trauer. Von den Mosaiken ging ein hoffnungsloses Leuchten aus, und doch war der fahle Schimmer wie ein Geschenk.
«Endzeitlicht, Abglanz der Vergänglichkeit.» Meine Stimme klang rau und erstickt.
«Esther, mahnte mich Merryll, «hör auf zu orakeln.»
Vor unseren Füßen dehnte sich ein von unserer Position aus nicht zu überblickendes Fenster und gähnte goldschlierige Dunkelheit. Unwillkürlich wichen wir zurück und lenkten unsere Schritte auf ein Portal in der Mauer.
«Wenn es nicht so kunstvoll gearbeitet und so kompliziert gestaltet wäre, würde ich es als barbarisch bezeichnen.»
Während die Astro-Archäologin sprach, berührte sie mit ihre Hand das Tor. Geräuschlos sprang es nach innen auf und gab den Blick frei in einen riesigen Rundbau, umstanden von einem Säulenwald. Strebepfeiler schossen in die Höhe. Ich konnte nur ahnen, dass sie sich gleich der Euklidschen Parallelen irgendwo im Unendlichen treffen. Zusagen der Raum sei kathedralenhaft wäre eine Verniedlichung. Wir verharrten auf der Schwelle, winzige Wesen, schaudernd vor der bedrängenden Nähe des Unermesslichen. Buntes Licht brach durch den steinernen Forst, glimmte im Dunkel und wogte als farbiger Photonenschleier auf der Rotundenlichtung.
«Und das Licht fiel in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen», ich hauchte die Worte. Abt Suger muss ähnlich überwältigt gewesen sein als er den Kirchenraum von St. Denis betrat. ‚Lux mirabilis et Continua’ …»
«Morgenglanz», unterbrach mich Tabah, «Niemand außerhalb deines Provinzplaneten versteht den Provinzdialekt dieses Himmelkomikers oder kennt diesen Provinztempel.»
«Das ist nicht nötig,» wandte Fenet ein. «In den meisten Planetenkulturen wird Licht als Epiphanie des göttlichen empfunden, als etwas Heiliges.»
«Ja,» bestätigte Merryll, «denk an den Provinztempel der Warinda meines kleinen Provinzplaneten Kathara.»
Ich wollte die Rotunde betreten, zog meinen Fuß aber wieder zurück. Die Strebepfeiler spiegelten sich im Boden und schienen in der Tiefe zu loten, umflossen von einem wunderbar ununterbrochenen Glanz farbig gebrochenen Lichts.
«Esther, seit wann bist du so ängstlich oder wirst du plötzlich religiös. Ziehet eure Schuhe aus, ihr betretet heiligen Boden,» lästerte Tabah, der mal wieder versuchte seine Ergriffenheit mit Coolness zu überspielen. Ich ignorierte ihn. Im Augenwinkel gewahrte ich, wie Fenet sich anschickte über die Schwelle zu treten.
«Nicht!» Ich packte Thyra gerade noch am Arm.
«Trantasch kabir shun!» ‚heilige Scheiße!’ fluchte sie in ihrer Muttersprache, und wich entsetzt mehrere Schritte zurück.
Da war kein spiegelnder Boden, sondern ein gähnender Abgrund. Die Säulen ragten in die Untiefe ebenso wie in die Höhe. Aber gab es überhaupt ein Unten und Oben. Die Tiefe des Abgrundes und die Tiefe des Alls sind ein- und dasselbe und nur für uns nicht das gleiche. Hier musste wahrlich niemand auf den Kopf gehen, um in den Abgrund des Himmels zu blicken.
«Dort», sagte Merryll leise.
Eine Art Floß schwebte durch ein Spalier aus farbig gebrochenem Licht auf uns zu. Das Floß hielt an der Schwelle. Wir sahen uns an. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und verwehrte den Ängsten, die aus dem Untiefen meines Selbst empor krochen, besitzt von mir zu ergreifen. Vorsichtig betrat ich die schwebende Plattform. Sie trug mich, schwankte nicht einmal. Merryll und Tabah taten es mir gleich. Nur Fenet zögerte zunächst. Ich konnte sie gut verstehen. Keine Angst zu haben ist ein Zeichen von Phantasielosigkeit. Auch wenn dies hier unser Vorstellungsvermögen überforderte, die Einbildungskraft belebt selbst das Unvorstellbare mit Phantomen. Kein Bildverbot hat das je zu unterbinden vermocht. Tabah reichte Fenet die Hand und zog sie zu sich hinüber.
Das Floß schwebte durch das Photonenspalier.
«Don’t pay the ferrymen…,» schoss es mir durch den Kopf und «Wer hier eintritt, lasse alle Hoffnung fahren …».
Hinter uns schlugen die Türflügen ins Schloss. Oh, Shit! Was hätte ich für einen Vergil gegeben. Sogar Charon, der die toten Seelen über den abgründigen Styx in den Hades schifft, wäre mir willkommen gewesen.
Musik stieg aus der Tiefe des Raumes empor, dieselbe die ich in meinem Traum vernommen hatte und deren Rockversion mir durch die P(ea)-Bra(i)ns vertraut war. Der Obertonchor hob an:
Der Tag trägt Trauer,
Die Farben der Nacht,
Nur mit Mühe gelang es mir mein Bewusstsein daran zu hindern in die Unendlichkeit auseinander zu driften.
Ein sanfter Schauer
Streichelt ihn sacht.
«Ohren zuhalten!» schrie ich.
Strings swingen im Quantenschaum Schaum,
Ein Gott träumt den 3-Bran-Raum.
Der Sirenengesang klang jetzt etwas gedämpfter, aber er zerrte immer noch an den Neuronen.
Die Sonne hinkt auf ihrer Bahn.
Der Mond erbleicht.
Pan phantasiert im Fieberwahn.
Vergessen ist leicht.
Strings swingen im Quantenschaum Schaum,
Ein Gott träumt den 3-Bran-Raum.
Ich war jetzt in der Lage den Gesang zu orten.
Am Abgrund schlummert ein Stein.
Die Tiefe träumt Welten.
Quarks tanzten Ringelreihen
Als Dimensionen zerschellten.
Das Lichtspalier sang. Ich kann nicht sagen, dass dies zu meiner Beruhigung beitrug.
Strings swingen im Quantenschaum Schaum,
Ein Gott träumt den 3-Bran-Raum.
Manchmal glaubte ich schwache Formen zu erkennen.
Das Meer verdampft zu Silberschein.
Die Ferne geht verloren.
Schweigend rollt der Horizont sich ein.
Neuwelt wird geboren.
Was war das nur für eine Sprache. Seltsamerweise verstand ich sie.
Strings swingen im Quantenschaum Schaum,
Ein Gott träumt den 3-Bran-Raum.
Strings swingen im Quantenschaum Schaum,
ein Gott träumt den 3-Bran-Raum.
Im Quantenschaum, im Quantenschaum…
«Protoglossa,» dachte ich. «Protoglossa…»
Der Gesang verstummte.
«Ihre Gehirne sind für unsere Musik nicht ausgelegt,» erklang ein melodisches Unisono.
Wir lösten die Hände von unseren Ohren.
«Ihre Hirne sind für unser Wissen nicht ausgelegt.»
Ich wollte protestieren, da sah ich, worauf wir zusteuerten. Auf einem schwebenden Mosaik ruhte ein Felsbrocken, ein Findling, – bizarr geformt als hätte ein wüster Äonensturm die rohe Materie erodiert.
«Protomaterie,» schoss es mir durch den Kopf. «Nein, damit assoziierte ich bisher die Strings oder deren angeregte Schwingungszustände die Elementarteilchen. Dieser Fels schien so etwas wie ein heiliges Objekt zu sein, wie die Kaaba in Mekka. Das Floß legte an. Wir betraten die Mosaik-Plattform. Ich hörte Fenet neben mir zitieren: «Am Abgrund schlummert ein Stein, / die Tiefe träumt Welten …»
Da begann ich zu begreifen, oder nein, so etwas wie ein Begreifen ergriff mich und erschütterte mich bis ins Mark. Unsere Welt die Schaumgeborene. Ich fiel auf die Knie und starrte über den Rand in den Abgrund.
«Esther!» Merrylls Stimme überschlug sich fast.
Ich hob mein Haupt und blickte in den Abgrund über mir. Finsternis und opakes Gold durchschienen von farbig gebrochenem Licht. «Das Xaos, Platons Chora3», stammelte ich, «die Amme des Werdens», das Bulk4, – dass ich das Erlebe!
Ich sah mich um. Schlanke Lichtgestalten umstanden uns. Merryll half mir auf.
«Die Prototopologie der Spin-Netze des Quantenschaums5 ist nicht diaphan.» sprach es staunend aus mir.
«Nur der Weltraum ist durchscheinend.»
«Wer seid ihr?!» hörte ich Merrylls verwunderte Frage.
«Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Unbegriffene der Finsternis. Wir sind die Hirten des Seins. Wir sind die Hüter der Endlichkeit. Wir sind die Wächter der Welt, die Engel, die Angeloi, die Karamir, die Marusch. Wir sind das Funkeln der Sterne und des Feuers Schein, das Leuchten in den Augen und das Licht der Vernunft. Wir sind die Grenzposten zur Unendlichkeit.»
Fenet bückte sich und zeichnete mit einem Finger das komplizierte Muster nach. Ein Penroseparkett war nur eine extrem einfache Variante dieses verschlungenen Quasikristallmosaiks.
«Eine dreidimensionale Projektion der unendlichen Tiefe, der All-Dimension aller Branenwelten, aller Zeit-Spiel-Räume der Multiversen, ein abstraktes Bild, stark vereinfacht, von dem, wovon niemand ein Bild sich machen kann, nicht einmal wir. Auch wir sind Gefangene der 3-dimensionalen flachen Scheibe, unserer 3-Branwelt, die unser Universum ist, so wie ihr und alle hadronische Materie.6 Unsere Welt, sie endet hier.»
Bei diesen Worten begannen die Lichtgestalten sich wieder in farbige Photonenschleier aufzulösen.
«Geht jetzt! Dies ist kein guter Ort für hadronische Wesen. Manchmal brechen die Dämme. Ein Multidimensionsstrudel, wir spüren ihn.»
Der Panik nahe sprangen wir auf das Floß. Ich betete zu allen mir bekannten Göttern und Götzen des Multiversums, das Floß möge schnell genug und das Tor wieder offen sein. Schon tauchte es vor uns auf. Es war geschlossen. Hinter uns ein Dröhnen, das unsere Trommelfelle zu zerreißen drohte. Wir wagten nicht uns umzudrehen. Ich ahnte das Aufreißen der sich um uns herum verdunkelnden Welt. Statt der Pforte dräute vor uns Finstergold. Wir schrieen wie aus einer Kehle als wir in die massiv wirkende Goldnacht rasten. Eine Melange von Gold und Schwärze stob an uns vorbei. Das Tor sprang auf. Das Floß rammte die Schwelle. Wir flogen in hohen Bogen auf den Mosaikboden. Hinter uns schlug krachend die Pforte zu. Ich rappelte mich hoch.
«Merryll!»
Er war in eines dieser Lanzettfenster gestürzt und versuchte sich herauszuziehen. Ich flog zu ihm, packte ihn unter den Axeln. Die anderen kamen zur Hilfe. Kaum hatte er festen Boden unter den Füßen, erschütterte ein Beben die Mosaikebene. Es fehlte nicht viel und wir wären gemeinsam in den Abgrund gestürzt, aus dem wir gerade meinen Liebsten befreit hatten. Ohrenbetäubendes Brüllen erfüllte die Luft.
«Zum Schiff!» Schrie ich.
Wir rannten um unser Leben.
Ich startete durch. Die Besatzung presste es in die Sitze. Aus dem Lautsprecher dröhnten die Pea-Brains. Vor uns öffnete sich ein Wurmloch. Wir tunnelten uns in heimeligere Gefilde unseres Provinzuniversums.
Ich drehte mich um. Merryll war grün im Gesicht, ein hübscher Kontrast zu seinen Lila Augen. Tamir Tabah grinste breit, umklammerte aber immer noch Fenets Hand.
«Puh, das war knapp! Dann doch lieber zerstrahlt im Quantennirwana als Verschollen oder Schlimmeres im Outback der Multiversen.» Ich lachte und das Lachen befreite. «Und wo geht’s als nächstes hin? Wie wär’s mit immer der Nase nach von einem Rand unserer 3-Bran-Scheibenwelt zum anderen, – Ptolemäus revistet.»
«Waas?» kam es wie aus einem Munde.
«Vergesst es, – Provinzgeschichte.»
Strings swingen im Quantenschaum, im Quantenschaum,
Ein Gott träumt den 3-Bran-Raum.
Im Quantenschaum…
■
____________________________________________
1 Quasikristalle sind scheinbar aperiodisch. Ihre Periodizität ist erst in einem höherdimensionalen Raum zu erkennen.
2 Wortspiel der Physiker: p-Brane ist lautgleich mit Pea-Brain, Erbsenhirn. Brane: von Membran. p-Brane: Lösung der Einsteinschen Gleichung E=mc². P-Branen expandieren in einige Richtungen unendlich. In einer Dimension wirkt eine p-Brane wie ein schwarzes Loch und fängt Objekte ein. P steht für die Anzahl der räumlichen Dimensionen.
3 Platon, Timaios, 49 a, vgl. 52 d.
4 Als Bulk (engl. Groß, Großsteil, Gros) wird der umfassende höherdimensionale Raum bezeichnet, in dem alle Branenwelten versammelt sind. Er ist die «Ortschaft aller Orte und Zeitspielräume», von der Heidegger spricht, das griechische Xaos, der gähnende Abgrund und Platons Chora, die Tiefe, die Spalte oder Kluft.
5 Hätten wir die Möglichkeit, so geht die Theorie einiger Physiker, die Natur soweit zu vergrößern, dass selbst winzigste Strukturen mit Plank-Länge (10-35 m) sichtbar würden, löse sich die Kontinuität von Raum und Zeit auf und ein diskretes, gequanteltes Spin-Netzwerk eindimensionaler Fäden würde sichtbar, bzw. auf Grund der Unschärferelation, die quantenphysikalische Überlagerung aller möglichen Zustände. Der Spin ist der Eigendrehimpuls eines Elementarteilchens. Seine mathematischen Eigenschaften sind mit Netzwerkverknüpfungen vergleichbar, wie ein Gewebe aus eindimensionalen Fäden. Ist das Bulk eine Art Prägeometrie, so das Spin-Netz oder der Quantenschaum eine Art Protogeometrie oder –Prototopologie, aus der eine konkrete Raumzeit erst emergiert.
6 Normale aus Quarks zusammengesetzte und der Starkenwechselwirkung (Hadron) unterliegende Materie. Während einige Teilchen sich frei in allen Branenwelten und im Bulk bewegen können, solche die Anregungszustände geschlossener Strings sind wie das Graviton, können andere, Anregungszustande offener Strings, sich nur entlang der Raumdimensionen bestimmter Branenwelten bewegen, sind also Gefangene der Branenwelt. Was für die Elementarteilchen gilt, trifft auch auf Objekte und Wesen zu, die aus diesen Teilchen bestehen. Wir leben, so die Theorie einiger Physiker, in einer 3-Branwelt.
.
____________________________________________
Geb. 1957 in Hannover, Studium der Philosophie, Kunstgeschichte, Volkskunde, Sprache und Kultur Vietnams in Hamburg, Promotion; verschiedene wissenschaftliche und literarische Publikationen, lebt als freie Autorin und Philosophin in Goslar/D
.
.
.
.
.
Kurzprosa von Rainer Wedler
.
Keiner hat Gottfried Wilhelm gefragt
Rainer Wedler
.
Keiner hat Gottfried Wilhelm gefragt, wie auch, der war schließlich tot, ziemlich lange schon. Hermann Bahlsen ficht das nicht an. Leibniz hat noch Glück gehabt, weil Bismarck schon für den Hering vergeben war. Nicht auszudenken, ein saurer Leibnizhering mit weichen Gräten! Immerhin kriegt der Leibniz postum als Cakes eine Goldmedaille auf der Weltausstellung in Chicago, wenn schon die Welfen ihren Philosophen nicht zu schätzen wussten. Leibniz – Hannover – Bahlsen – Keks. Natürlich hat der hinterlistige Herr Bahlsen die Konnotation gewollt: Bahlsenkeks – dem Leib nizt! Und was haben wir heute? Den couch cake. Der Gerechtigkeit halber sei allerdings hinzugefügt, dass viele dem Hannoveraner gefolgt sind, die Beukelaers und die Griessons, die Lambertzs und die Coppenraths usw. usf.
Ich kekse, wenn du kekstest.
Ich kaks bereits, sagst du, mein Keksweib, meine Kebse.
Wie schade, wo wir doch stets zusammen keksend auf dem Laken lagen.
Und Krümel piekten.
Nicht wenn ich die Kekse im Apfelkorb versteckte.
Und doch, sagt sie, die Kekse haben Zähne.
Ich weiß, ich weiß, bei Leibniz sind´s gar 48. Wenn ich genau sein will, sind an den vier Ecken noch furchteinflößend große Reißzähne, macht nach Adam Riese 52.
Und du, sagt sie, hast nicht mal 32 mehr.
Du gehst mir auf den Keks, sag ich, ich kekse jetzt allein, du Keifweib von einer Kekse.
Leibniz sei´s geklagt, der Keks ist alt und wabbelig, heraus kriecht die Monade. Die Keksverkäuferin hat mich betrogen, die graugraue Kellerassel, die nachts nackte Egelschnecke. Zu hoch gegriffen, Freund, es fehlt das on, genau schau hin, es ist nur eine Made, eine ganz gemeine Made nur, just made in Moder. Da hat sich´s ausgekekst.
Kegelkekse sollen rollen für den Sieg. Siech heil! Was sollen Prinzenrollen sollen? Nichts und abermals nichts. Kackkekse sind´s, dreh fleißig die beiden runden Deckel gegenläufig in deinen warmen Händen, bis sie sich lösen. Was siehst du dann? Kackbraunen Keksekleber, den Kinder mit viel zu großen Schneidezähnen herunterkratzen, bis sie Keksbrei kotzen (pardon!) und das Verhältnis der Anzahl ihrer Zähne sich bald verschlechtert zur Leibnizzahl von 52.
Der Keksfortschritt in Gestalt des Fortschrittskekses ist unaufhaltsam. Panta rhei. Heraklit soll´s gesagt haben, sagt Simplikios aus Kilikien, sagt die Zunft der Philosophen. Aber auch das Volksgut weiß davon zu berichten: Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein (neues) Kekslein her. Und das heißt: Soft Cake Orange. Kein Agent Orange zwar, doch reicht´s, die Geschmacksknospen zum Verdorren zu bringen. For ever! Einen Big Mac in seinen Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Zur Not kommt er eben als Cake Orange. Basis = ein fluffy Keks, Zwischenlage = Pampe mit chemorange Geschmack, obendrauf ein Schokoladenhut, tut immer gut.
Wer nun glaubt, der Panzerkeks schützte ihn gegen alle Arten von aufdringlichen, aber auch heimtückisch getarnten Keksen, der irrt. Er ist ein großer Irrer vor dem Herrn, aber er möge sich trösten, er ist nicht allein. Hier gilt die altüberlieferte Weisheit: errare humanum est (nach Hieronymus, Brief 57). Der Panzerkeks, auch Panzerplatte, ist zwie- und dri-, gar viegebacken, furztrocken ist er dann und diente einst als Proviant für Krieger und Seeleute. Letztere tunkten ihn ins Brackwasser ihrer Trinkgefäße, dann schoben sie die amorphe Masse zwischen ihre skorbutösen Zähne und würgten sie hinunter. Als Heldenspeise hat das panis militaris bis heute überlebt und soll so manchem zum Überleben verholfen haben. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Schnupftabaksdose des Alten Fritzen. Das schussfeste Stück, nicht Friedrich, die Dose natürlich, kann heute noch im Museum bewundert werden. Und was, bittschön, ist der Unterschied zwischen einem kleinen Holzkästchen und einer Panzerkeks 4x5x0,5 cm?
Alleine keksen ist wie einsam koksen, ergo mach ich kehrt und kriech auf krebsesweise zurück zu meiner Kebse. Genug des Stabens, wo laben wir denn? Im Labsaal, dem dämmerig erleuchteten, da find ich sie, ausgebreitet in ihrer ganzen Pracht, aufbereitet, ja zubereitet und wunderbar drapiert. Für mich? Für mich! Fürcht ich mich? Ich Johann Fürchtegott und sonst nichts auf der Welt.
Mein süßer kleiner Knabberkeks, so fang ich an.
Nichts, nur ihre Kügelchen gehen langsam auf und ab und auf und ab.
Rate mal, was ich dir mitgebracht?
Nichts, nur ihre Kügelchen…
Einen Glückskeks.
Nichts, nur…
Knusper, knusper Knäuschen, welch Sprüchlein ruht in meim Kabäuschen?
Sie stellt die Beine auf, sie lebt!
Ich singe: Wie freu ich mich, wie freu ich mich, wie treibt mich das Verlangen.
Die Quietschkautsch fällt ein in meinen Lustgesang.
Lass den Qietsch, sagt sie unwirsch. Und räkelt sich und röchelt was, ruckeldiezuckel, fällt hinter sich. Aufs Kanapee. Zurück
Bleib liegen, Wittchen weiß wie Schnee! Mein Zweiunddreißigzähnigs.
Wer knappert an meim Kekschen? fragt sie.
Ich bin´s der Wolf und fress dich auf mit Haut und Härchen.
Ich ruf den Jägersmann und dann! Und dann.
Dass ich nicht lach, der weide Mann hat sich verkekst im finstern Tann, wo ihm der Fuchs geklaut sein Navy-Navi. Warum auch hat er nicht sein Waldi-Navi mitgenommen.
Du kecke quecke Schnecke, steh auf und wandle, dich, und mich zum Zwecke, weißt schon was.
Warum schon wieder das!
Why not! Und dies und das, zum Spaks, mein Knabberkeks. Vastekst?
Notwendiger Ekskurs: Prof. Dr. Käk S. Deause will in seiner über erkleksliche Jahre sich erstreckenden Forschungsarbeit herausgefunden haben, dass ein direkter Zusammenhang bestehe zwischen dem Keks als solchem und der Libido als solcher, nicht hingegen zwischen der Libido an und für sich und dem Keks für sich an. Alles Keksolores, meint hingegen sein schärfster Widersacher in rebus panificiorum Prof. Dr. mult. Butt R. Cakes von der Oxford University, Department Cooking & Baking, Deause habe als Franzose die Interessen der Biscuit- und Gâteaulobby der Grande Nation vertreten, man solle sich doch nur einmal seinen Namen genau ansehen. Damit stehe er, Deause, in der verkorksten Tradition des unseligen Marquis de la Galette, der im Fin de Siècle eine Professur an der Sorbet in Paris innehatte, dem man den Schlund beizeiten mit Brei von Keks hätte zustopfen müssen. Der Wissenschaftsgesellschaft wäre viel Ungemach erspart geblieben.
Ich, Schüler des kritischen Empirismus, neige nach zahlreichen Experimenten und deren exakter Auswertung den Ergebnissen der Deauseksen Forschung zu, ja, ich würde sie, wenn es denn sein müsste, jederzeit in einem Streitgespräch verteidigen. Und, dies würde allerdings die Grenzen der Sittlichkeit für manchen überschreiten, und ich würde sogar einen kleinen Kreis von Exzellenzforschern zu einem Feldexperiment einladen.
Zurück in der guten Stube.
Der Boden voller Brösel. Der Bröselhund ist tot, der Putzfrau hat gekündigt, was tun? Tschto delat? (Lenin 1912) Das haben wir´s: Schoko lad. Der dunkle Schokokeks, die Haare wirr, liegt immer noch auf weicher Lade, schade, und weiß nicht, tschto delat.
Der tiefe Brunnen weiß es wohl; In den gebückt, begriffs ein Mann, Begriff es und verlor es dann.
Hartkeks, der ich bin, partiell, doch immerhin, lass ich mich von dir erweichen, deiner weichen Weisheit.
Dann komm, mein Prinz, zum Doppelkeks.
Pan di stelle meldet sich zum Dienst, tiefbraungebrannt, hochdekoriert mit elf Zuckersternen, leuchtend weiß wie Kristall, fürs Nahkampfkeksen ohne Kettenhemd und Helm. Reiß mir die Sterne ab, Kiksilitzchen sind´s sonst nichts, und degradier mich zum Gemeinen! Ganz unten will ich wieder anfangen und mich hochkeksen in der Kekserkarriere, mir Stern für Stern aufs neu im ketzerischen Kebsendienst erwerben.
Nun aber, in Zeiten fortschreitender Profanierung des Heiligen, so auch des allerheiligsten Kekses, duplo und dreieinig, soll´s Kekse geben in Form und Größe von Visa Card und Visitenkarten. Darf ich Ihnen meinen Visitenkeks überreichen? Oder:tut mir leid, aber wir akzeptieren keine Visakekse. Nicht bewährt hat sich der Postkartenkeks. Nicht einer soll den Empfänger nach der Stempelung unverkrümelt erreicht haben, die Deutsche Post weigert sich daher, weiterhin Kartenkekse zu befördern. Natürlich ist es jedem unbenommen, seinen Nachrichtenkeks höchstpersönlich zu überbringen, es sind allerdings nur wenige derartige Fälle bekannt geworden und diese sollen sich auf innerörtliche Bereiche erstreckt haben. Kinder, so geht die Fama, haben sich als nicht zuverlässig erwiesen, weil sie – man hätte es sich denken können – die Nachrichtenkekse kurzermund gegessen haben.
Eine längere Karriere war dem Kassiberkeks beschieden. Lesen und essen ist eins. Da konnten die Ärzte noch so oft röntgen oder lange auf den Stuhlgang warten, nichts zu sehen, nichts zu finden, viel zu riechen. Mancher Kokserchef hat seine Geschäfte aus dem Knast problemlos weitergeführt. Auf welch krummen Wegen nun irgendein Kriminaler, dem das Ganze gewaltig auf den Krimikeks gegangen war, hinter das Geheimnis gekommen ist, weiß die interessierte Öffentlichkeit bis heute nicht. Die Behörden mauern. Den Journalisten zeigen sie die Monsterkekseszähne.
«Back dir deinen Feind» war der Slogan für den Psychokeks aus der Esoterik-Dunkelkammer. Mitgedacht war natürlich „Und friss ihn!“ Menschenschützer haben dem Spuk ein Ende gesetzt. Allerdings mussten sie einen weiten Weg gehen über alle Instanzen bis nach Karlsruhe. Ob der Geschäftsfrachter heute unter fremder Flagge fährt, weiß ich nicht, denkbar ist es alle Mal.
Mir jedenfalls hat der Mörderkeks als solcher sehr gut getan, und keiner kann mich daran hindern, hin und wieder mir einen Feind zu backen und zu fressen und letztendlich der cloaca maxima zuzuführen. In schönster Bastarda für den älteren Feind oder in Verdana für jüngeren steht auf dem keksekleinen Platz, um nur zwei Beispiele zu nennen: Möge es dir übel ergehen im Lande (Bastarda) oder To hell with you, motherfucker! (Verdana). Ich kann mir Zeit lassen, die Rache kalt genießen, erst die Zähne am Rand abbeißen, dann Wort für Wort zerbeißen und zerspeicheln. Genuss ist langsam oder er ist nicht (deutsches Volksgut).
Oh du mein Rehkikslein auf dem Canapee. Schokoladentaler hast du statt Augen! Ohnegleichen locken deine Brüste!! Oh mandelförmiger Cantuccio sempre umido!!! An dir möcht ich mich totfressen, Komet werden am vollbekeksten Firmament, als neuer Keks dort leuchten in Ewigkeit Amen. ■
________________________________
Geb. 1942, nach dem Abitur als Schiffsjunge in die Türkei, nach Algerien und Westafrika; Studium der Germanistik, Geschichte, Politik, Philosophie, Promotion über Burleys «Liber de vita»; zahlreiche Lyrik-, Kurzprosa- und Roman-Veröffentlichungen
.
.
.
.
.
Kurzprosa von Andreas Wieland
.
Mohrenwäsche
Andreas Wieland
.
I, fuge. Sed poteras tutior esse domi.
(Geh, flieh! Aber du könntest
zu Hause sicherer sein.)
Martial, röm. Dichter
.
Ich bin eine Implosion in einer unansehnlichen und gedrungenen Hülle, ich bin Sonnenschein und Schatten zugleich, ich bin Heil und Unheil, ich bin das Zittern und der Schrecken. Äußerlich ein unansehnlicher Zwerg und bereits hierfür tausendmal für schuldig befunden, schuldig gesprochen von vielerlei Herkunft, geächtet, sei dies wegen verschlampter Unterhaltspflicht oder der Entlassung meiner diebischen Sekretärin, jedenfalls bin ich ausnahmslos Teil von dem was passiert, ob in göttlicher Lauterkeit oder Wust und Moderleben. Einem ungeahnt hart zuschlagenden Schicksal erlegen, beraubt jeglichen Verstandes vom dröhnenden Gerede der Leute, fällt jeder noch so abgefeimte Versuch einer Mohrenwäsche ins Wasser, entrüstend und schändlich, selbst die blutrünstige Schicksalsgöttin antiquarischer Herkunft verabschiedete sich von mir mit einem schon fast liebevollen Schmunzeln, als ich zu Tränen gerührt, mich vor ihr und meinem Hausaltar verneigte und darauf vom Leben verschmäht und mit einer kleinen Sporttasche in der Hand meine Wohnung verließ. Einem fremden Willen in die Hände gespielt schaue ich konsterniert und eingeschüchtert einem unaufhaltsamen Schaudern entgegen, einem sich in den Eingeweiden festgebissenen eisigen Hauch, herausgerissen aus prallem Leben. Wohl bin ich nicht mehr der Koryphäe, welchen ich jahrzehntelang mit zartesten Gefühlen in mir wähnte, meine Verdienste und Ehrungen interessieren keinen mehr, sollte mich jetzt jemand mit Doktor ansprechen, wäre dies der unerhörteste Affront seit Gedenken, schlimmer als alle jemals gehörten unanständigen Worte, einschüchternd und verschwörerisch. Auf die Zehenspitzen emporgereckt klatsche ich meine tremolierenden Handflächen auf den Bahntresen und warte, bis sich die Schalterbedienung mir zuwendet, eruptiv vom Stuhl hochspringt und sich meiner annimmt, abtaucht in meine seelisch verstimmte Klandestinität. Doch lässt sich der Jüngling beinahe schamlos viel Zeit, nichtsahnend, dass in mir Gefühle heftigen Zorns aufsteigen und meine Hände sich längst zu gefährlichen Fäusten geballt haben. «Linie 350!», bricht es aus mir heraus und ich fühle mich versucht, den Jungen Herrn über meine Identität aufzuklären und ihm für ein und allemal klar zu machen, wie man sich als Arbeitnehmer in einem Dienstleistungsbetrieb zu verhalten hat. Doch spucke ich ihm außer mir vor Wut, aber auch aus erzieherischen Gründen, ins Gesicht. Dies geschah am 25. Juni 2008.
Nur langsam spüre ich die sanften Sonnenkringel auf meinen geschlossenen Augen und höre den Wind in Büsche und Baumkronen fahren. Den Träumen entnommen liege ich mit Petra auf weichem Gras, eingehüllt in eine karierte Wolldecke, nebenan unser Picknickkorb und die Fahrräder, wild verstreut die Kleider. Doch trete ich schon kurz darauf mit dem einen Fuß gegen zwei Weinflaschen, rau wie ein Reibeisen fühlen sich meine Wangen an und der feuchte Boden zwingt mich aus meiner Kauerhaltung. „Ob es gut geht, ist uns“, knattere ich in reichlicher Enttäuschung vor mich hin und taste mit den Händen nach klagenden Körperstellen. Natürlich hätte ich mir ein Zimmer leisten können, meinetwegen in einem Vier- oder Fünfsternehotel, im DIEHL’s oder im Contel beispielsweise, doch will ich mir meinen Abschied nicht nehmen lassen, aller Verderbnis zum Trotz, soll dieser Wille stärker sein als jeglicher Verstand. Von dieser Tatsache gebeutelt fliehe ich weiter auf das unbekannte Waldstück vor mir zu, zusammenzuckend bei jedem vorbeifahrenden Auto und bereits das leiseste Rascheln im Gras lässt mich Schlimmstes erahnen und an den Fingern zähle ich aufgelöst die Jahre bis zu meiner letzten Starrkrampfimpfung zurück. Von schmerzenden Hungergefühlen geplagt peitsche ich mich weiter durch unwegsames Gelände, unweit von mir höre ich aufheulende Motorsägen und das Krachen von Fichten und Buchen, gefasst werde ich mich als Vogelkundler in eigenem Auftrag ausgeben, sollten mich die bärtigen Holzfäller zu Gesicht bekommen und im Stillen hoffe ich auf deren Bekanntschaft, sei es auch nur um ihnen ihr Pausenbrot streitig zu machen. Die kleine Sporttasche vor mich herschiebend pirsche ich mich auf Ellenbogen an sie heran, auch ihr Geländewagen konnte ich ausmachen, und von diesem aus berechne ich jetzt verschiedenste Radien zu den zwei Holzfällern und ziehe unterschiedlichste lebensrettende Faktoren bei, um mich im Notfall schnellstens aus dem Staub machen zu können.
Mit stolzer Diebesbeute stürze ich mich weiter in die Wildnis und deren unaufhaltsamen Abenteuer, immer geläufiger wird mir Wald und Gelände, kartographiert im genialen Geiste eines Geächteten. So mangelt es mir nur selten noch an Brot und Käse und Wurst und auch in der Zuordnung von Vogelstimmen habe ich beträchtlichen Fortschritt gemacht.
Am 13. August 2008 stahl ich in Berresheim aus einem Schuppen ein Brecheisen, dies vorwiegend aus präventiven Beweggründen denn aus bösartiger krimineller Energie. So sind die Nächte bereits kühl und in keinem Fall darf mich solch läppische Naturgewalt zurück in die Arme der Gesellschaft treiben können, in festem Griff halte ich also dieses seltsame und verrostete Instrument. Von den nächtlichen Lauten wie von Nadeln gestochen erhebe ich mich fröstelnd von meinem Lager und lege das Brecheisen zwischen die in die Sporttasche gestopfte Wäsche. Ausgehungert und mit trockenem Gaumen schreite ich ziellos in Richtung Bernardshof, in Mayen Ost könnte ich dem 312er zusteigen, natürlich kann ich das tun, ob Segen oder Fluch, einmal werde ich mich der Zivilisation wieder annähern wollen, ob heute oder morgen, Lapis iacta est.
Mit noch klammen Fingern umfasse ich zweihändig meine Sporttasche, drücke diese gegen meine Brust wie ein Schutzschild und mit gesprungenen Lippen und schmerzverzogenem Gesicht frage ich mich in Mayen nach einer billigen Pension durch, eine Bruchbude wäre mir am liebsten, sage ich mühsam lächelnd zu einem jungen Herrn und laufe unter seinem richtungsweisenden Arm hindurch wie unter einer Bahnschranke, aufgeregt nach links und nach rechts blickend, die Siegfriedstraße überquerend. Seine angsterfüllte Stimme und den nervösen Fingerzeig memorisiert und strikte befolgt, finde ich die Unterkunft schneller als erhofft und heruntergekommener als erdacht vor, und allmählich spüre ich wie Kopf und Körper von einer beinahe zu unerträglichen Leichtigkeit durchflutet werden. Doch aus dem Schatten des Backoffice heraus bemerke ich den feindlich gesinnten Blick der Besitzerin dieser seltenen und nirgendswo vermerkten Unterkunft, gut beraten ist hier derjenige, der keine Fragen stellt, der weder Zimmerservice noch Frühstück erwartet.
Schwere Regenwolken bedeckten am 28. November 2008 das Gebiet der Osteifel. Wie totes Tuffgestein stechen meine Augäpfel aus tiefliegenden Höhlen und durch meine Pfundnase atme ich den immer dichter werdenden Nebel, die feierabendlichen Abgase und den mir verhassten Gestank von aus Hinterhöfen herüber gewehten Frittierölschwaden ein. Zum ersten Mal seit meinem Ausbruch denke ich an mein leerstehendes Zuhause, an die Plastikblumen auf dem Altar und an meine Schicksalsgöttin. Mit Argusaugen wird sie mich wohl überprüfen und stillschweigend wieder von mir Opfer fordern, diese meist unter Ausschluss meines Bewusstseins oder zumindest so, dass es mir schwer fällt, ihre eigentümliche Sprache zu verstehen. Doch weiß sie haargenau was zu einem gelungenen Leben gehört und somit will ich demütig ihren ausgeklügelten Plänen dienen. Hiervon scheint meine ganze Gestalt durchdrungen zu sein, auf Ablehnung aufgebaut, doch darin behütet und gepflegt wie ein kostbares Juwel. Im Schutze der eingebrochenen Nacht und ihrer wohligen Dunkelheit schleiche ich Mauern entlang und durchquere Hausgärten, stampfe über brachliegende Blumenrabatte und breche alles ab, was den Anschein einer glücklich erlebten Blüte hinterlässt. Und sollte man mich in meinem Tun aufhalten wollen, würde die Kraft göttlichen Schicksals die Erde erneut spalten und Funken speien, implodierend ein weiteres Genie gefährlicher Abtrünnigkeit, in Asche gehalten und verfolgt von der Uneinsichtigkeit und Unvernunft tyrannischer Triebe, unerbittlich und böse würden geheime Bindungen fortgesetzt werden auf dem von mir geebneten Weg. ■
.
_________________________________________
Geb. 1969 in Chur/CH, Studium an der Höheren Fachschule für Hotel- und Tourismusmanagement, anschließend als diplomierter Hotelier in den Kantonen Graubünden, Zürich und Luzern tätig, Kurzprosa- und Roman-Publikationen, lebt als freischaffender Schriftsteller in Walenstadt/CH
.
.
.
.
.
.
Satire von Heinz Wegmann
.
Der Vereinsausflug
Heinz Wegmann
.
Diesmal wagte sich der Verein für Vereine (Kurz: Verein hoch 2) in heimatliche Gefilde. Es stand die traditionelle Herbstwanderung mit Schlachtplatte auf dem Programm.
Unter Führung des rührigen Obmannes traf sich eine erwartungsvolle und frohgelaunte Gruppe beim Friedhof. Der Leiter überraschte die Teilnehmer gleich zu Beginn mit einem reich verzierten, roten Stoffsäcklein, das mit Heftpflastern, Salben, Bandagen und einem Fläschchen Schnaps gefüllt war. So wurden die Stimmbänder gleich ordentlich geschmiert. Leider wollte am Anfang das Wetter nicht so richtig, die sinnflutartigen Regenfälle bewogen viele, sofort wieder den Heimweg anzutreten.
Mit dem Rest der Unentwegten ging es mit dem Car Richtung Urigen (UR) im Unterhintertal, wo sich alle in einem blumengeschmückten Café zuerst mit Kaffee und Gipfeli stärkten. Einer Teilnehmerin blieb ein Brösmeli ihres Gipfelis so unglücklich im Hals stecken, dass man sie zum Notarzt bringen musste, was aber die Unternehmungslust der Gruppe nicht zu dämpfen vermochte.
Ein Fußweg abseits des großen Verkehrs führte nun die Wanderschar durch Feld und Wald, wo sich einige Teilnehmer hoffnungslos verirrten und erst nach langen polizeilichen Suchaktionen wieder aufgefunden werden konnten. Beim Aufstieg kam man so recht ins Schwitzen und bei einigen wollte das Herz nicht mehr so richtig, so dass sie von der Rega zurückgeflogen werden mussten.
Oben wurden aber die Übriggebliebenen belohnt durch eine prächtige Aussicht, die den Mitreisenden manches Ah und Oh entlockte.
Von einer der schneebedeckten Bergspitzen löste sich dann unter den faszinierten Blicken der Teilnehmer ein Erdrutsch, eine sog. Mure, und begrub das malerische Dorf am Gegenhang fast vollständig unter sich.
Nun musste aber der Durst gelöscht werden und gleich anschließend durch die eilends aufgebotene Feuerwehr ein brennendes Chalet neben dem Restaurant, wo ein feines Mittagessen wartete. Die Teilnehmer ließen sich ihre gute Stimmung durch den beißenden Rauch, der von der Brandstätte hinüber wehte, nicht nehmen. Als besondere Überraschung nahm der Wirt die Schlachtung des Schweins «live» unter den interessierten Blicken der hungrigen Schar vor.
Da sich der Himmel unterdessen in strahlendem Licht präsentierte, konnte die Schlachtplatte auf dem offenen Grillplatz serviert werden, was großen Anklang fand und manchen spontanen Jauchzer zur Folge hatte. Die Zeit des Wartens auf die Schinken, Rippli, Öhrli und Schwänzli wurde mit angeregten Gesprächen oder einem gemütlichen Jass überbrückt, und auch der frohe Gesang kam selbstverständlich nicht zu kurz. Einige hauten dann angesichts der riesigen Portionen etwas über die Schnur und mussten übereilt die Toilette aufsuchen, denn zusammen mit dem «Suuser» machte sich die Verdauung unangenehm bemerkbar, was die Unentwegten aber nicht daran hinderte, eifrig das Tanzbein zu schwingen.
Frisch gestärkt ging es dann an den Abstieg, der erneut kleine Opfer forderte: Zwei verstauchte Fußgelenke und ein Beinbruch waren die Bilanz, als man unten ankam. So bekam auch der Dorfarzt wieder unerwartete Arbeit.
Die weidenden Kühe hatten sich von der fröhlichen Wanderschar nicht stören lassen. Selbst als die Mutigsten unter den Teilnehmern auf die originelle Idee kamen, einer Kuh die Glocke abzunehmen und sie als Trophäe heimzuführen, blieben sie stoisch ruhig.
Beim anschließenden Rundgang durch das schmucke Städtchen wurde die Vizepräsidentin in der Fußgängerzone von einem Lieferwagen angefahren und von allen in das nahe gelegene Spital begleitet. Dort überraschte ein langjähriges Mitglied alle Teilnehmer samt Krankenhauspersonal mit dem Vorsingen eines selbstverfassten Liedes, das mit begeistertem Applaus aufgenommen wurde.
Nach einem letzten Zvieri, der für die meisten mit einer – glücklicherweise leichten – Magenvergiftung endete, musste man schon wieder an den Heimweg denken.
Der stets zu einem Späßchen aufgelegte Carchauffeur brachte schließlich nach einer Massenkarambolage auf der Autobahn die müden aber glücklichen Abenteurer wieder an ihren Wohnort Witzwil zurück.
So ging eine von unvergesslichen Eindrücken gespickte Reise zu Ende, und jedermann freut sich schon heute auf den nächsten Ausflug mit Gleichgesinnten. Der kundige Obmann gab angesichts der aufgetretenen Ausfälle seiner Hoffnung Ausdruck, dass nächstes Jahr möglichst zahlreiche neue Mitglieder dieses gesellige Zusammensein bereichern mögen. ■
.
__________________
 Heinz Wegmann
Heinz Wegmann
Geb. 1943 in Zürich Lyrik-, Kurzprosa- und Kinderbuch-Veröffentlichungen sowie Übersetzungen, lebt und arbeitet in Uerikon/CH
.
.
.
.
.
.
Kurzprosa von Beatrix Maria Kramlovsky
.
Der Fisch
Meditation über ein Bild von Georges Braque
Beatrix Maria Kramlovsky
.
.
 Schimmernde Samennetze wabern im Meer. Der Fisch und seine Gefährtin tanzen lautlos im Rausch der Zeugung.
Schimmernde Samennetze wabern im Meer. Der Fisch und seine Gefährtin tanzen lautlos im Rausch der Zeugung.
Die Frau schwebt im Wasser, versucht, in der Strömung ihren Platz zu behalten, nichts aufzuwirbeln, sachte, als sei sie wieder das Kind an der Hand des Großvaters im Wald, schleichend auf der Pirsch in anderen Farben. Sie verhält sich wie ein erregter Jagdhund.
Das Wesen mit der schimmernden Haut vor ihr steht im grünen Licht, Kringel und Spiralen tanzen in zärtlichem Smaragd, schließen Helligkeit ein, Gelb sickert herab, flüssiges Glas, das sich auf die dunkle Haut legt. Der Fisch verharrt völlig bewegungslos, sieht sie immer noch an, abwartend, sehr distanziert, mit diesen starren Pupillen, diesem Schwarz, als presse er sich an ein Okular und verstecke sein wahres Auge dahinter. Er ist schön. Seine Bewegungen sind sparsam, voll verhaltener Energie, sein Körper glänzt fest und glatt, im Schwarz königlichen Leichengepränges.
Sie öffnet ihre Finger zu Fächern, langsam, behutsam, das Wasser rinnt dazwischen durch, streichelt an der zarten Haut ihrer Handteller entlang. Sie spürt die Wärme, die von oben herunterdringt, die Farben und Lebewesen rund um sich, ohne sie bewußt wahrzunehmen, sie spürt, dass sie da sind. Doch alles ist nur offen für das Fischauge gegenüber, und so verharren sie in gegenseitiger Betrachtung.
Im weißen Sandbett ruhen die schwarzen Felsblöcke, rosafarben leckt das Meer an den von grünbraunen Algen überzogenen Wänden. Es ist ein Stein im Schwarz dumpfer Katakomben. In Spalten lauern kobaltblaue Striche, schießen ein in das Schwarz, bewegen sich hin zu violett, aus Rissen rieselt stumpfes Anthrazit. Nackt liegt das Schwarz der prallen Sonne ausgesetzt, die Lebendigkeit der Schatten am Fuß der Felsen weicht starrer Leblosigkeit. Es ist, als zöge sich der Glanz zurück ins uralte, feuchte Innere, hinterließe ein Schwarz, seiner Seele beraubt, das unterm dem tropischen Licht zerbröckelt zu rußigem, apathischem Dunkel. Die Felsen warten. Wie urzeitliche Panzertiere haben sie sich in sich zurückgezogen und brüten über den Farben.
Der Mann nimmt den Apfel und legt ihn auf die nassen Finger der Frau. Salz verkrustet sich im Wind an den winzigen, aufgerichteten Häärchen. Der Apfel ist rot, prall und glatt. Die Frau hält Leben in der Hand.
Licht tanzt über dem Meer, die braunen Erdtöne steigen auf, bieten sich der Sonne dar, Ocker schwelt über Umbra, Karmin, leuchtet im Schatten der grünen Pflanzendächer, Siena vermischt sich mit zartem Rosa und schmilzt ins pudrige Beige des Strandes. Die See ist wie ein Schild, bleiweiß in der vergehenden Hitze verbirgt sie den lautlosen Kampf, die lautlose Schönheit, die lautlose Jagd, das lautlose Werben, die lautlose Vernichtung, die lautlose Geburt.
Unter den Blättern verharrt seufzend die aufsteigende Brise, Schleier ziehen von den Hängen herab. Schräge Bronzetöne verdampfen auf der Haut der Frau. Der Mann beugt sich über die Schatten, beißt in den Apfel, das Fleisch kracht saftig zwischen seinen Zähnen, der Zauber bricht.
Der Fisch und seine Gefährtin umtanzen die befruchteten Schnüre, beobachten das keimende Leben.
Auf dem sich kräuselnden Wasser liegen Boote mit aufgerollten Netzen.
Kraniche staksen nebelig weiß auf dürren Beinen zwischen glänzenden, kunstvoll geschichteten Melonen, den reifen Tomaten, deren sanftes Rot in den Körben schimmert. Die Vögel hocken auf den durchhängenden Planen, wetzen die halboffenen Schnäbel, recken die Hälse und schießen hinunter auf den nassen Tisch mitten zwischen die braunen Hände mit den pastellfarbenen Geldscheinen, die sich den Fischbündeln entgegenstrecken. Sie zielen auf Fischreste, Schwänze und Innereien, schnappen auf, schlucken ruckartig mit den sich krümmenden Hälsen. Die Finger weichen nicht zurück, die Kraniche heben ab.
Ein Fischauge liegt auf dem nassen Holz, Schuppen kleben wie Katzensilber auf dem Tisch, abwaschbare Intarsien des Tiertodes.
Hoch über dem Wasser steht das weiße Haus mit der schmalen Brüstung, auf der Veranda tanzen Menschen. Die grünen Sprossen der glaslosen Fenster leuchten im Kerzenschein. Die Frau und der Mann schauen über die verstreuten Lichter unter ihnen hinaus auf das silbrige Grau des Meeres, die blauschwarzen Kuppen der vorgelagerten Inseln.
Im warmen Bambuston hinter den grünen Sprossen legt eine nußfarbene Frau mit langgezogenen Fingern und weißen Halbmonden auf Perlmuttnägeln ein Stilleben des Todes. Sie hält die Papaya, sie spürt die wächserne Haut der grobporigen Orange, sie fährt über das angelaufene matte Grau der Platte, prüft das Gewebe des Tuches, zieht daran. Auf dem Teller liegen der Fisch und seine Gefährtin, appetitlich und prall. Die gebrochenen Augen verwandeln sich zu Löchern ins bodenlose Schwarz.
Betrachtung hält die Zeit an. Stille. Die Frau lächelt den Mann an, ihre Lippen berühren sich. In der Unbeweglichkeit des Augenblicks verlöscht der Tod im Leben.
»Es ist angerichtet«, sagt die nußbraune Frau, und das Paar wendet sich ihr zu. ■
.
______________________________________________
Geb. 1954 in Steyr/A, Studium der Anglistik und Romanistik, Prosa-Buchveröffentlichungen, verschiedene internationale Kunstausstellungen, diverse Literatur-Auszeichnungen, lebt in Bisamberg/A
.
.
.
Groteske von Konrad Vogel
.
Introkubus
Konrad Vogel
.
Als der renommierte Linguist und spindeldürre Schriftsteller Dr. Felix Introkubus sein eigen Wort zum ersten Mal nicht mehr verstand, fand er dies lustig. Er formulierte, zwar gedankenscharf und endgültig wie immer, seine Wahrheit, die Wahrheit, und – was wichtig ist – er sprach sie aus. Mag sein, sie war im Laufe der Zeit etwas dünner und farbloser geworden, grade so wie er, seine Wahrheit. Als negativ hätte ich sie deswegen nicht bezeichnet.
Er sprach sie also aus und – verstand sie nicht. Wie konnte er sie denn auch verstehen, wenn er seine Worte nicht hörte? Nein, keine Spur von Schwerhörigkeit; er hörte z.B. seine Frau (auch wenn er sie nicht verstand) oder seine Kollegen, die er nicht verstehen wollte; seine eigenen Worte verstand er stets, hörte sie aber nicht, wenn er sie aussprach. Sie verschwanden, kaum ausgesprochen, irgendwo in ihm. Es war, als saugte irgend etwas in ihm, sein Magen vielleicht, seine Worte an. «Retrosprache» fieberte sein Hirn, «ich habe die Retrosprache erfunden. Sprache, die aus mir in mich fließt.»
Wenn Felix Introkubus nun etwas aussprach, aussprechen wollte, erfüllte ihn ein nie gekanntes Glücksgefühl, dem Magersüchtigen gleich, der wieder essen darf. Dieses Glücksgefühl zeigte sich denn auch materiell-organisch: Der spindeldürre Introkubus wurde – zwar appetitlos, er aß kaum noch und er trank nur Wasser, geräuschlos und in großen Mengen, wie das städtische Wasserwerk vermerkte – Dr. Felix Spindeldürr wurde, es sei gesagt, es sei geklagt, ansehnlicher, wohlleibiger, dann – dick.
Seine Ansprachen und Aussprachen, zu Einsprachen geworden, ernährten ihn von selbst. Der Retrolinguist wähnte sich auf dem Gipfel seiner Karriere, und er wurde auch überall herumgezeigt, unser wissenschaftlicher Zoo der Eitelkeit, sprich Universitäten, kennt dergleichen Vorfälle zur Genüge.
Es war auch herrlich, ja göttlich zu erleben, wie er, während er vorlas – kein Mensch verstand ein Wort – rund und runder wurde. Bald mussten zwar die Türen zum Hörsaal erweitert werden, um seinen gewichtigen Kubus, der seinem Namen nun alle Ehre machte, durchzulassen. Ärgerlich war auch, dass nach gehaltener Einsprache die Türe wieder zu eng und ein Verlassen des Saales oftmals unmöglich wurde.
Das alles war aber erträglich, der obligate Preis des Ruhms. Störend fand Introkubus indessen, dass – als er den Fehler beging, sich im Spiegel zu besehen – sein Bauch allmählich dunkel, dann schwarz wurde. Schriftzeichen, aber auch Laute hüpften, glucksten, drängten sich, Tätowierungen und Melodien gleich, unter seiner Haut ans Tageslicht.
Seine Haut wurde zur Leinwand, Worte und Bilder enthüllend; Bläschen bildeten sich, die, aufgestochen, Töne von sich gaben. Es war eindeutig: der Inkubus und Retrolinguist drohte zum lebenden Tonfilm zu werden.
Nichts gegen die Filmkunst, meine Damen, aber wo der Mensch zum Showobjekt mutiert, da stellen sich Gaffer ein. Fragen nach Regie und Kameramann werden erhoben. Kurz, die fragwürdig gewordene Leinwand, Dr. Felix Introkubus, suchte den Arzt auf.
Er fand einen guten. Dr. Martin Dean, ein Lingo-Psychologe und – wie der Name sagt – ein Dehnungsspezialist aus den USA, fand die Therapie.
«Absolute Sprachlosigkeit, mein Herr,» empfahl Dean. «Ihr Zustand ist bedenklich, zweifelsohne. Bauch, Darm, Zwerchfell angespannt bis zum Gehtnichtmehr. Ich warne Sie, ein einziges Wort, das Sie noch einsprechen, und Sie platzen. Es könnte Ihnen gehen wie dem verrückten Archäologen aus meiner `Gefiederten Frau’ – ein einziges Wort und Sie bringen sich um. Übrigens, kennen Sie mein Buch?»
«Leider nein», sagte Dr. Felix Introkubus, was Dr. Dean dazu brachte, eine Reinigungsfirma anzurufen, die sein wortübersätes Büro noch heute zu putzen versucht. ■
__________________________
 Konrad Vogel
Konrad Vogel
Geb. 1944 in Näfels/CH; Studium der Germanistik und Romanistik, Dr. phil; Lehrertätigkeit in verschiedenen Institutionen und Bereichen, militärische Karriere, umfangreiches kommunalpolitisches Engagement in verschiedenen Gremien, Lyrik und Kurzprosa-Veröffentlichungen in Zeitschriften, lebt als Gymnasiallehrer in Horw/CH
.
.
.
.
Kurzprosa von Daniel Mylow
.
Fliegen
Daniel Mylow
.
Wieder zu spät. In schrägen Schnitten fällt Licht auf den Weg. Die Tür öffnet sich. Es ist nicht viel zu besprechen. Dann reden wir doch noch. Die Zeit vergeht. Ich sitze mit dem Rücken zum Wohnzimmer. Es ist so still. Er deutet mit dem Kopf in eine dunkle Ecke des Zimmers. Ob ich Nathalie mit in die Stadt nehmen könne. Der letzte Zug nach Frankfurt. Warum nicht.
Die Häuser des Dorfes bleiben zurück. Wir schweigen. Über den Feldern steigt der Mond. Wunderschön. Am Horizont gefriert Licht. Nathalie ist begeistert. Ein schmaler Feldweg windet sich über die Hügel. Gräser wachsen ins Licht. Auf der Hügelkuppe stelle ich den Wagen ab. Und der Zug, frage ich. Sie lacht. Wir steigen aus. Es ist eine warme Sommernacht. Wiesen im Mondlicht. Ist das kitschig, sagt sie. Plötzlich läuft sie fort. Am Feldrand bleibt sie stehen und zieht sich aus. Sie nimmt mich an den Händen. Unsere Schatten werden lang und länger. Über einen Heuballen fallen wir ins Gras. Es schimmert. Seine fahlen Spitzen brechen ohne Laut. Ich spüre das Gewicht ihres nackten Körpers, wie er auf mir atmet. Danach ist es ganz still. Der Mond steht schon über den Hügeln. Ein rötlicher Dunst schwebt über der Erde. Verdammt. Nur keine Fragen. Oder doch: Wer bist du. Was hast du bei ihm gemacht. Sie schweigt. Einmal noch werde ich sie fragen.
Er hat mir Geld gegeben. Viel Geld. Ich tue es nur manchmal.
Aufstehen und gehen. Mondlicht und den ganzen Romantikscheiss einpacken und gehen. Meine Finger tasten über das Gras. Da ist die Erinnerung an ihre Haut.
Idiot, sagt sie. Trotzig: wirklich nur manchmal. Mir geht es gut. Papa sorgt schon für uns.
Ich schaue sie an. Wie schön sie ist. Also, sage ich. Sie zieht die Knie an ihren Körper. Die Haare fallen ihr ins Gesicht. Ihre Stimme wird hart, als sie erzählt.
Neunzehn Jahre Crivitz, ein kleiner Ort in Mecklenburg. Dann Frankfurt. Der Arbeit wegen. Ihre Schwester ist mit achtzehn fort, niemand weiß wohin. Der Bruder trinkt. Sie holt das Abitur nach. Es wäre besser, zu arbeiten, meint Mama. Die geht selber putzen. Dabei ist Papa doch Ingenieur. Sie erzählt mit leuchtenden Augen. Wie er noch zur See gefahren ist. Geschichten abends am Bett. Seine tiefe Stimme. Seine Geduld. Später ist er zum Militär. Und jetzt? Sie schweigt Dann lächelt sie. Wäre Papa nicht… Sie erzählt und erzählt.
Warum tust du das dann, sage ich. Denke: mein Chef ist ein Schwein. Sie antwortet nicht. Die Scheinwerfer der Autos tasten über die Felder.
Schau mal, sagt sie, und deutet mit dem Finger nach oben. Über den zurückgelegten Köpfen schimmert es dunkel und kalt. Nachtlichter. Ein Flugzeug gleitet langsam durch das Gehäuf blasser Sterne. Noch etwas zu trinken, bitte? Die Kopfhörer befinden sich vor Ihnen in der Ablage. Die Toiletten finden Sie jeweils am Ende der Gänge. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Südamerika? Australien?
Die Erde schrumpft. Fliegen, nur fliegen. Sie schaut dem Flugzeug nach. Es verschwindet über der Stadt auf dem Berg. Jetzt sehen wir auf die Lichter der Stadt. Der Mond steht hoch über den Feldern. Mit den Fingern vor den Augen umfasse ich seinen Rand. Soviel Zeit ist vergangen. Sie schaut noch immer dem Flugzeug nach. Der Zug ist fort. Der nächste geht am frühen Morgen. Noch fünf Stunden Mondanstarren. Oh weh. Und dann. Bleibe ich im Wagen sitzen oder komme ich mit? Warten auf den Zug. Ein Kuss vielleicht zum Abschied. Mehr bestimmt nicht. Warum auch.
Die Stadt, sagt sie. Eine solche Stadt war es. Auch auf einem Berg. Und es ist Sommer. Ihre Familie hat da oft Urlaub gemacht. Sie haben ein schönes Haus auf der anderen Seite des Berges. Manchmal gehen sie alle abends in der Stadt essen. Das war schön, sagt sie. Ab und zu darf sie auch schon allein nach Hause laufen.
Das ist ein Weg! Der führt rund um den Berg, und von überall sieht man ganz weit auf die Ebenen. Vielleicht ist es eine Nacht wie diese. Sie bleibt oft stehen und sieht hinab auf die Wiesen und Felder, die vertrauten Lichter, den schwachen Abglanz des Mondes über dem nachtblauen Himmel.
Da merkt sie irgendwann einmal, dass ihr jemand folgt. Leise, aber beharrlich. Sie läuft schneller. Sie dreht sich um, aber sie sieht niemanden. Sie weiß, es ist noch weit. Vor ihr liegt nur der Wald, auf der anderen Seite der Abhang. Dann bleibt sie einfach stehen. Vor Erschöpfung ist ihr ganz schwindlig.
Ein schmaler, dunkelhaariger Junge tritt auf sie zu. Er grinst. Hast ganz schön Puste, keucht er. Er hat sie in der Stadt gesehen. Will einfach nur mit ihr reden. Sagt er. Jetzt, im Sommer, fliegt er Drachen auf den Hügeln unterhalb ihres Hauses. Ja, sie hat die Drachenflieger oft beobachtet. Auch ihr Vater ist einer von ihnen. Ob sie nicht mitkommen wolle.
Jetzt, in der Nacht? Ja, jetzt gleich. Nachts ist es, obwohl verboten, am schönsten. Gemeinsam laufen sie den Weg zum Ferienhaus. Nun hat sie keine Angst mehr. Der Hügel ist ein runder, glänzender Kegel. Das Drachensegel knattert im Wind. Die Silhouetten der Drachen leuchten unwirklich gegen die Nacht. Startvorbereitungen. Gut verschnürt und verzurrt laufen sie auf den Abhang zu… Und dann?
Sie schüttelt den Kopf. Es ist nicht wahr, sagt sie. Es ist alles ganz anders. Sie ist ruhig, als sie weitererzählt.
Der Weg wird schmaler und schmaler. Der Junge schielt nach allen Seiten. Dabei glotzt er ihr auf die Beine, dass sie wieder Angst bekommt. Sie geht langsamer. Sagt, dass sie müde sei. Der Junge nickt. Er erzählt von den Drachen. Sie dreht sich um. Der Weg ist dunkel und leer. Sie bindet sich die Schuhe zu. Sie bleibt stehen, fragt nach Flughöhe, Fallwinden, Unwettern. Der Junge wird ungeduldig. Komm, sagt er. Sie laufen weiter. Plötzlich fällt er sie an, zieht sie ein Stück weit in den Wald. Sie kratzt ihn blutig, er ist stärker. Er reißt ihr das Kleid entzwei. Mit einem Messer ritzt er ihr die Haut quer über dem Bauch. Sie sieht das Blut. Jetzt liegt sie ganz still. Der Junge wirft sich auf sie.
Da stürzt ein Schatten zwischen den Bäumen hervor. Noch ehe der Junge reagiert, liegt er wimmernd im Gras. Ruhig und gezielt prasseln die Schläge und Tritte auf seinen Körper. Es dauert nicht lange. Ihr Vater nimmt sie auf die Arme und trägt sie nach Hause. Wie im Film, lacht sie. Und keinen Moment später. Hier. Sie zeigt auf einen dünnen Strich vernarbter Haut über dem Nabel. Ich lege meine Hand darauf. Das ist schlimm, sage ich.
Vielleicht.
Meine Finger tasten über ihre Haut. Ich rede Unsinn dabei. Aber das ist ihr egal. Sie legt sich zurück ins Gras und schließt die Augen.
Ein fremdes, unerwartetes Erwachen. Es ist kühl. Wir wissen nicht, was wir miteinander sollen. Ich halte die Hand wieder vor Augen. Zwischen meinen Fingern klebt der Mond. Eine Stunde ist vergangen. Sie steht auf und zieht sich an. Ich sehe sie auf das Auto zugehen. Also. Ich werde noch warten, bis sie im Bahnhof verschwunden ist. Vielleicht reden wir noch. Ganz sicher werden wir uns küssen. Das wäre schön. Nicht nur wegen der Erinnerung. Ich ziehe mich an und laufe zu ihr. Dann stelle ich mich neben sie und nehme ihre Hand. Die halte ich vor den Mond. Wir steigen jetzt in unser Mondauto, fahren zur Station und fliegen mit einem Drachen zur Erde. Sag doch was. Nathalie dreht sich um. Sie weint.
Papa ist tot, sagt sie leise. ■
.
____________________________________
Geb. 1964 in Stuttgart, Studium der Neueren Deutschen Literatur, Psychologie und Philosophie, Lehrerausbildung in Kassel, nach Tätigkeiten als freier Verlagslektor von 2004 bis 2009 Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Hof, Poesie-Pädagoge für Kreatives Schreiben, verschiedene Kurzprosa-Publikationen in Büchern und Zeitschriften, lebt in Hof/D
.
.
Parabel von Georges Raillard
.
Der richtige König
Georges Raillard
.
Wieder werden die breitesten Straßen der Hauptstadt gesperrt, werden Abschrankungen aufgestellt, wird der Verkehr weiträumig umgeleitet. Wieder postieren sich an allen strategischen Punkten Sicherheitskräfte in Uniform und Zivil. Wieder strömt das Volk herzu, staut sich hinter den Schranken, säumt dunkel die helle Asphaltstrecke wie Ungeziefer einen befallenen Pflanzenstiel. Stundenlang harrt es, ob in Hitze, Regen oder Kälte, geduldig und unbeirrbar und immer wieder voller Erwartung, des Vorbeizugs.
«Wozu brauchen Sie denn einen König?» fragt der Reporter eine ältere Frau, die sich mit verschränkten Armen auf die Abzäunung stützt.
Die Frau starrt ihn verständnislos an, zuckt schließlich mit den Schultern und wendet sich rasch ab, als müsste sie sich schämen.
Thronanwärter ziehen mehrmals in der Woche vorbei, auf geschmückten Elefanten reitend, auf bunten Streitwagen stehend, von einer Herde schäumender Pferde gefolgt, im Cockpit eines ultramodernen Düsenjets sitzend, einen Trupp im Tarnanzug kommandierend oder von einem Dutzend leichtbekleideter Mädchen umschwärmt. Mit solch exorbitantem Aufwand buhlen sie um das Volk, denn das Volk ist ihr Richter: Es allein bestimmt, wer der richtige König sei.
Das Volk ist nicht leicht zu gewinnen. Eine einzige ungeschickte Handbewegung, ein Kopfnicken zur falschen Zeit, eine unpassende Gewandung, und das Volk buht und wendet sich enttäuscht weg. Seit Monaten, ja Jahren konnte kein König das Volk überzeugen.
Die Spannung ist groß. Manche halten ein Transistorradio ans Ohr geklemmt. Vor der Stadt fänden blutige Gefechte statt, hört man. Von einem Duell wird berichtet, bei dem der Sieger dem Besiegten den Kopf abschneide, um sich damit für den Vorbeizug zu schmücken. Der heutige Anwärter komme als Piratenhäuptling auf einem großen Segelschiff, heißt es, das in einem riesigen, von Sattelschleppern gezogenen Wasserbecken schwimme. Gerüchte laufen aus wie Flüssigkeit aus lecken Tanks, fließen zusammen, schwellen an, rauschen durch die Menschenmenge und heben sie empor. Stimmen überschlagen sich, überschreien einander, zetern. Aber noch immer ist die ganze Strecke lang nichts zu sehen.
«Wozu brauchen denn Sie einen König?» fragt der Reporter nun einen jüngeren Mann, auf dessen Schultern ein kleines Mädchen sitzt und ein Fähnchen schwenkt.
Der Mann denkt nach, sagt dann: «Sobald ich ihn sehe, weiß ich’s vielleicht.»
«Aber wie wissen Sie denn, welches der richtige König ist?» hakt der Reporter rasch nach.
Der Mann antwortet nicht. Niemand spricht plötzlich mehr. Das Stimmengewirr, wie durchgeschnitten. Alle Blicke in eine Richtung, nach links die Straße entlang. Recken tausender Hälse, Scharren tausender Füße, Drängen und Drücken. Der Reporter spürt fremden, warmen Atem in den Haaren, im Nacken, an den Schultern, an den Armen. Jetzt wird ein Schritt hörbar, deutlich und gemessen, der Schritt eines Einzelnen, der Schritt eines Einzigen, näher und näher. Wer ist es? Wie ist er? Noch ist nichts entschieden!
Der Mann mittlerer Größe, mittleren Alters schreitet ohne Eile seines Wegs. Sein Blick ist in die Ferne gerichtet: Seines Zieles und seiner Ankunft ist er sich gewiss. Gekleidet ist er schlicht, beige Hosen, hellblaues Hemd. Er geht ganz allein und scheint nichts zu brauchen.
«Ein Schwächling, hat niemanden», ruft jemand.
«Im Gegenteil», widerspricht jemand anders, «noch nie war einer so stark, allein und mittellos zu kommen.»
Andere Stimmen erheben sich, erhitzen sich im Dafür und Dawider. Worte gellen hin und her. Ratlos steht der Reporter mitten im Streit und sieht dem Anwärter nach, der ruhig weiterschreitet und sich entfernt. Da wendet sich der jüngere Mann mit vor Erregung gerötetem Gesicht um und schreit dem Reporter durch den Lärm hindurch zu:
«Sehen Sie’s? Dies ist der richtige König! Er stiftet die Zwietracht, in der wir uns selbst finden. Jetzt können wir aufbegehren. Ohne König sind wir nichts als ein einziger harter Körper und nicht imstande, uns gegen uns selbst zu wenden.» ■
.
__________________________________
Geb. 1957 in Basel/CH, Schriftsteller und Komponist (Gitarrenmusik), lebte 18 Jahre als Übersetzer und Sprachlehrer in Madrid, seit 2001 wieder in Basel
.
.
.
.
Vier «Berg-Storys» von René Oberholzer
..
Der Berg
Kenia ist in Afrika. Der Kenianer ist in der Schweiz. Die Schweiz ist in der Schweiz. Der Kenianer kennt einen Appenzeller. Der Appenzeller schaut jeden Tag den Säntis an. Der Kenianer schaut jeden Tag den Appenzeller Gürtel an. Appenzell ist nicht das Heimatland des Kenianers. Appenzell ist das Heimatland des Säntis. Der Kenianer trägt ein Glöcklein an seinem Gürtel. Manchmal fährt er auf den Säntis und sagt den Touristen: «Der Säntis ist ein heiliger Berg.» Das sagt er auch dem Appenzeller. «Der Säntis ist ein hoher Berg», sagt der Appenzeller. Der Kenianer wird nie Appenzeller werden. Der Appenzeller wird nie Kenianer werden. Aber der Säntis könnte ein heiliger Berg werden.
.
Der Kompromiss
Ich bin ein taktiler Mensch. Wenn ich in die Berge gehe, fasse ich alle Blumen und Steine an. Die Berge machen mich euphorisch, dann fasse ich auch meine Frau die ganze Zeit an. Ich könnte sie beim Anblick des Säntis, des Kronbergs oder des Stockbergs ständig berühren. Meiner Frau ist das dann oft zu viel. Sie möchte dann einfach wandern und die Aussicht geniessen. Sie ist ein visueller Mensch. Irgendwie treffen wir uns beim Wandern wie auch im sonstigen Leben nie so richtig. Wir haben deshalb beschlossen, als Kompromiss die Wanderung wie auch das Leben auditiv in Angriff zu nehmen.
.
Die Überstunden
Neulich war ich dem Bergpolizisten begegnet. Mitten in der Wand stieg er mir hinterher und fragte mich im Seil, ob ich die Ruhezeiten in der Bergkarte eingetragen hätte. Ich verneinte, worauf er mir zu verstehen gab, dass ich jetzt zwei Stunden Schlaf nachholen müsse, bevor ich weiterklettern dürfe. Der Bergpolizist drängte mich an einen Felsvorsprung ab, und ich versuchte zwei Stunden im Stehen zu schlafen. Der Bergpolizist stand neben mir und rührte sich nicht von der Stelle. Zwei Stunden später hatte das Wetter umgeschlagen, ich durfte weiterklettern, der Polizist stieg ab und suchte einen weiteren Ruhezeitensünder am Berg. Völlig ausgeruht kam ich in der SAC-Hütte an. Der Polizist stürzte etwas später am Berg aus Unvorsichtigkeit ab. Weil an diesem Tag viele Kletterer am Berg unterwegs gewesen waren, hatte der Bergpolizist Überstunden schieben müssen.
.
Das Interview
Ich möchte die Geschichte eines Wanderes erzählen, der immer auf denselben Berg hinaufstieg. «Ich liebe diesen Berg», sagte der Mann einem Journalisten, «keiner ist so schön wie dieser.» Als er weiters gefragt wurde, warum er nicht auch noch auf andere Berge steige, sagte der Mann: «Ich bin schon seit 40 Jahren mit derselben Frau verheiratet. Verstehen Sie?» Der Journalist schaute den Mann lange an, sagte dann: «Ja, ich verstehe Sie.» Dann rief der Journalist seine Lebensgefährtin an und sagte: «Ich möchte mit Dir wieder einmal aufs Hörnli wandern.»
.
______________________
Geb. 1963 in St. Gallen/Schweiz, schreibt seit 1986 Lyrik, seit 1991 auch Prosa, lebt und arbeitet als Sekundarlehrer, Autor und Performer in Wil/Schweiz
.
.
.
Kurzprosa von Peter Fahr
.
Begegnung
Peter Fahr
.
Sie lernten sich am Hochzeitsfest eines gemeinsamen Freundes kennen. Bei Tisch saßen sie sich gegenüber und kamen miteinander ins Gespräch. Sie redeten über das Ereignis des Tages. Für Paul war die kirchliche Trauung der Höhepunkt eines komischen Theaters, in dem sich zwei Menschen aus Furcht vor fließender Veränderung für ewig aneinanderzuketten versuchen. Er war gekommen, sich zu unterhalten. Und was hatte er vorgefunden? Eine reizende Frau, die ihm gegenübersaß.
Sie war ihm schon in der Kirche aufgefallen: Blass, verträumte Augen, blondes Haar, sinnlicher Mund. Er betrachtete sie beim Sprechen und hörte kaum, was sie sagte. Für Karin war die Ehe ein heiliges Sakrament. Zwei Menschen entschieden sich füreinander und gelobten sich Treue und Beistand. Das war das Ziel ihrer Sehnsucht nach Glück, die Vollendung menschlichen Daseins. Das war das Tor zu Gott, dem Endziel allen Strebens.
Karin sprach mit flammendem Blick, denn sie spürte, dass der Mann an ihren Auffassungen zweifelte. Sie wollte ihn schon überzeugen, diesen haltlosen Skeptiker, der sich mit der täglichen Wirklichkeit begnügte und alle geistigen Kräfte leugnete! Sie fühlte tief in ihrem Innern, dass es eine höhere Macht, ein höheres Wesen gab. Sie war durchdrungen von ihm.
Als die Gesellschaft gegen Abend auseinanderging, lud sie den Mann zu sich nach Hause ein. Paul ließ sich nicht zweimal bitten und sagte sofort zu. Ihre Wohnung war einfach eingerichtet. In jedem der Zimmer hing ein Kreuz. Sie ließen sich im Wohnzimmer nieder. Sie machte Kaffee, er entzündete drei weiße Kerzen.
Im flackernden Schein ihres Lichts wurde das Gespräch da fortgesetzt, wo es abgebrochen worden war, beim Glauben an Gott.
Paul war verliebt. Liebe auf den ersten Blick, darüber hatte er bisher nur gelacht. Er spürte das schmerzliche Verlangen, die junge Frau in die Arme zu nehmen. Während sie über ein fantastisches Geschöpf referierte, genoss er ganz einfach ihre Anwesenheit, genoss es, mit einer so aufregenden Frau zusammen zu sein. Gott war für ihn nur ein Begriff. Gott war die ungewisse Zuflucht vom Schicksal Gezeichneter. Mit dem Gedanken an Gott trösteten sich die Sterbenden. Gott war eine Erfindung verängstigter Seelen. Paul glaubte an den Menschen. Er liebte den Menschen mit all seinen Schwächen und Stärken. Sein Bemühen war es, sich am Leben zu freuen, die ihm gegebene Zeit fröhlich auszukosten und die Existenz in ihrer Unergründlichkeit anzunehmen.
Karin war vertieft in ihre Ausführungen: «Der Mensch war erst nur Lebewesen. Er ist es nicht mehr nur, denn der göttliche Funke Geist hat sein Ich in Brand gesetzt. Nun ist er dem bloßen Lebewesen durch diese Dimension überlegen. Und dennoch bleibt er ein Wurm, nur sein Schöpfer zählt, der in ihm lebt. Der Mensch ist die Hülle des Zusammenklanges von Gotteseigenschaften.»
Paul konnte sich nicht länger zurückhalten. Mit einer heftigen Bewegung umarmte er Karin, die entsetzt aufschrie. Er versuchte sie zu küssen, doch sie stieß ihn von sich, so dass er rücklings hinfiel. Er fühlte, wie sein Kopf hart aufschlug. Als das Genick brach, knackte es leise. ■
.
_____________________________
Geb. 1958 in Bern/CH, Studium der Germanistik an der Universität Bern, zahlreiche Lyrik- und Prosa-Veröffentlichungen in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Autor von Hörspielen, politischen Gedichten und zeitkritischen Essays, Träger verschiedener Literaturpreise, lebt in Bern
.
.
Kurzprosa von Norbert Sternmut
.
Die Auferstehung
Norbert Sternmut
.
Plötzlich fiel ihm alles aus, wie das Licht der Welt. Gleichzeitig fiel ihm nichts Neues ein. Er spürte einen Schmerz, war sich aber nicht ganz sicher. Hatte er einen Schlag auf den Kopf bekommen? Was war geschehen, wenn etwas geschehen war? War etwas geschehen? Und wenn etwas geschehen war, wo und weshalb war es geschehen?
Er lag in einer Art Kiste, fühlte sich nicht ganz behaglich und spürte vielleicht einen Schmerz. Er tastete sich ab: einen Körper mit Beinen, Armen, einen üblichen menschlichen Körper. Er konnte sich entsinnen, dass der Körper in dieser Ausprägung für ihn üblich war, er selbst dieser Rasse angehörte. Etwas anderes wußte er nicht.
Er lag in einer Holzkiste, die allerdings keinen Deckel trug, denn nach oben war ihm die Sicht nicht versperrt. Er spürte keinen Luftzug, befand sich nicht auf freiem Gelände. Wo befand er sich? In einem Raum, doch war es ein Kellerraum, ein Wohnraum, oder die Zelle einer Haftanstalt? Es war ruhig, ganz ruhig. Niemand sprach, keuchte, sang. Kein Atem! Er war sicher alleine, alleine mit sich. Mit wem? Er überlegte, versuchte auf einen Namen zu kommen, einen eigenen Namen, seinen Namen. Walter, Wastel, Wenzel? Nichts!
Er tastete die Seitenwände der Kiste ab, bewegte den Kopf hin, her. Es ist sehr unangenehm, wenn einem alles ausfällt und nichts Neues dazukommt. Wastel? Der Name war ihm eine Art Begriff. Er mußte ihn schon einmal benutzt haben, doch fiel ihm der Zusammenhang nicht ein, weder Ort noch Zeit.
Welcher Tag wurde geschrieben, Mittwoch, Freitag? Er wußte es nicht. Wastel? Er sagte den Namen mehrmals vor sich hin, Wastel, Wastel, schien er doch etwas in Bewegung zu setzen, innerlich. Er bewegte die Beine, stemmte sich mit einiger Anstrengung ein paar Zentimeter in die Höhe, so dass er über die Kiste hinaussehen konnte. Es war ein feierlicher Raum, ein andächtiger, besinnlicher Raum. Ein ganzes Blumenmeer war um seine Kiste herum angelegt. Kerzen säumten sie, Kränze, Schleier, die mit Namen versehen waren. Er las alle. In stiller Trauer: Fritz. Wir nehmen Abschied: Familie Abendrot mit Silke und Herbert. Neben einigen Vereinen, die er nicht weiter kannte, war von weiteren Namen die Rede, doch trat kein Wastel auf. Es traten auf in dieser Reihenfolge: Ein Hans, ein Dieter, Reinhold, ein Klaus, ein anderer Herbert. Namen, die alle nichts in ihm bewegten. Oder nichts mehr? Wastel?!
Kruzifix nochmal, hörte er sich fluchen, dann fiel es ihm ein: Wastel. Er hatte gesagt: «Ich will Wastel heißen, wenn es einen Wonnebald gibt.»
Vielleicht war es um eine Wette gegangen. Jedenfalls wußte er nicht, zu wem er diesen Satz gesagt hatte, und in welchem Zusammenhang. Aber der Satz mußte gefallen sein. Er hatte ihn nun deutlich im Ohr. Ort und Zeit der Aussage ließen sich auch nicht festmachen. Immerhin waren die zwei Namen gefallen. Er wollte nach diesem Satz Wastel heißen, wenn es einen Wonnebald gäbe, doch wer konnte dieser Wonnebald sein, um den es hier ging? Er versuchte sich über den Zusammenhang klar zu werden.
Es ging um «einen Wonnebald» – nicht um «den Wonnebald». Es war also von nichts Bestimmtem die Rede, immerhin von etwas, das es vielleicht geben konnte und vielleicht nicht. Es ging wohl eher um einen sächlichen Zusammenhang, der mit dem Namen umschrieben wurde, vielleicht auch nur um die Vorstellung davon, die allein schon ungenau sein konnte. Keine genaue Umschreibung. Wie sollte er sich also an etwas erinnern können, was den Namen «Wonnebald» trug? Dieser eine Satz wurde gesagt, wurde von ihm gesagt, an etwas anderes konnte er sich nicht erinnern.
Er winkelte die Knie an, hielt sich mit den Händen an den Seitenwänden der Kiste fest und zog sich hoch. Er stand, was von einem leichten Schwindelgefühl begleitet wurde, aber er stand und konnte nun den Raum genau betrachten. Kein kleiner Raum. Neben seiner Kiste lag zunächst ein Deckel, der sicher für seine Kiste bestimmt war. Was aber wichtiger war: es befanden sich noch zehn weitere Kisten im Raume. Jede einzelne war ebenso wie seine eigene von Blumengebinden, Kränzen und Schleiern gesäumt, und auch hier war von einigen Namen die Rede. Er stand, konnte aber in keine der Kisten hineinsehen. Immerhin, soviel war jetzt klar: es handelte sich nicht um ein Wohnzimmer, denn für ein wohliges Wohnzimmer schien der Raum ungeeignet. Lag nicht auch ein etwas ungesunder, abgestandener Geruch in der Luft?
Er konnte sich nicht entsinnen, diesen Raum in dieser Weise eingerichtet zu haben, wußte auch nicht, wie er hierher gekommen war. Noch immer stand er kerzengerade in seiner Kiste, zog aber schon mal ein Knie etwas an. Es ging. Immerhin schien dies nicht selbstverständlich zu sein. Er hatte noch immer ein ungutes Gefühl, eine Art Schmerzempfinden, doch war er sich nicht sicher.
Wastel? Er sagte den Namen vor sich hin, begann sogar kurz zu pfeifen, hörte aber gleich wieder auf. Es half nichts. Er wollte seinen Namen erfahren und hatte nur diesen einen Satz: «Ich will Wastel heißen, wenn es einen Wonnebald gibt». Nun, der Satz konnte auch lauten: «Wenn es einen Wonnebald gibt, will ich Wastel heißen.» Er konnte auch dies gesagt haben, was seine Lage nicht grundsätzlich verändert hätte.
Er versuchte weiter an den Zusammenhang, vielleicht an den Inhalt heranzukommen, um sich auf diese Weise seinem Namen zu nähern. Er überlegte. Wollte er Wastel heißen auch ohne Bedingungen? Eigentlich nicht. Er fand, dass er freiwillig lieber einen anderen Namen tragen wollte. Wastel wollte er eigentlich als Namen ausschließen, konnte an ihm keinen Gefallen finden. Er ging davon aus, dass dies zur Zeit seiner Aussage ebenso war. Somit wollte er schon damals nicht Wastel heißen, heißt: um nicht Wastel heißen zu müssen, ging er davon aus, dass es «einen Wonnebald» nicht gibt. Im Grunde wollte er auf keinen Fall Wastel heißen und mußte sich seiner Sache also sicher gewesen sein, jener, die eine Existenz eines Wonnebalds ausschließt.
Er trat aus seiner Kiste. Er konnte gehen, das war gut. Dort war eine Tür, und er ging vorsichtig darauf zu. Noch immer spürte er ein Schwindelgefühl, aber er konnte gehen, immerhin. Die Tür war verschlossen. Es steckte kein Schlüssel. Es gab nicht einmal ein Schlüsselloch. Es mußte sich um eine spezielle Tür handeln. Wenigstens war er sich sicher, dass es eine Tür war. Es war aber nichts zu machen. Er hatte auch nicht gehofft, dass er einfach aus diesem Raum gehen könnte. Und wenn er selbst Wonnebald war? Die Frage schoß ihm durch den Kopf. Er überlegte. Dann hätte er damals sinngemäß gesagt: «Wenn es mich gibt, will ich Wastel heißen». Dabei hätte er erschwerend angenommen, dass es ihn überhaupt nicht gäbe. Obwohl es ihn aber nicht gäbe, wollte er Wastel heißen, wenn es ihn gegeben hätte, obwohl er dann eindeutig Wonnebald geheißen hätte. Da konnte etwas nicht stimmen. Gut, er hätte sagen können: «Wenn ich Wonnebald bin, will ich Wastel heißen». Oder: «Wenn ich Wastel bin, will ich Wonnebald heißen». Oder: «Wenn ich Wastel heiße, will ich Wonnebald sein». Oder: «Ich habe den Hund nicht erschossen». Aber so!?
Wenn er als Person oder sonst in einer Weise nicht präsent ist, nicht einmal im Ansatz erkennbar, dann kann er auch nicht Wastel heißen wollen.
Er wollte seinem Geisteszustand vertrauen und somit weder Wonnebald noch Wastel heißen. Oder doch? Wie gut kannte er sich selbst? Er kannte nicht einmal seinen Namen! Woher sollte er dann wissen, was er wollte?
Er ging an eine Kiste, nahm eine Kerze und leuchtete hinein. Ein weiterer Körper lag darin, bewegte sich aber nicht. Scheinbar noch ein Mensch, der ihm ziemlich blaß vorkam. Er wollte ihn mit seinem Namen ansprechen, doch er kannte weder den Menschen noch seinen Namen. Er neigte sich über ihn und sprach ihn mit einem «Hallo!» an. Nichts rührte sich. Er hob den blaßen Schädel etwas in die Höhe und ließ ihn auf das Kissen zurückplumpsen, mehrmals. Er rührte sich von selbst nicht.
In dieser Weise klapperte er alle zehn Kisten ab. Es war nichts zu machen.
Keiner wollte mehr seinen Namen wissen, geschweige denn nennen. Da ging auch er zu seiner Kiste zurück, stieg wieder hinein und wartete darauf, dass ihn jemand bei seinem Namen aufwecken würde. ■
.
__________________________
 Norbert Sternmut (alias Norbert Schmid)
Norbert Sternmut (alias Norbert Schmid)
Geb. 1958 in Stuttgart, Abitur, Ausbildung zum Altenpfleger, Studium der Sozialpädagogik, seit 1993 innerhalb der Bildungsarbeit beim Bildungszentrum Stuttgart, zahlreiche Roman- und Lyrik-Publikationen, lebt in Ludwigsburg
.
.
Kurzprosa von Matthias Berger
.
Die Luft, die wir atmeten, ließen wir dort
Es war eine Zeit der Kornblumen. Eine Inselzeit, mit lauter Menschen, die ich nie wieder sehen würde, die mich auf nichts behafteten, da sie mich zum ersten Mal trafen.
Und es wurde die Zeit ihres blauen, weiten Blicks, ihrer rotblonden Locken, durch die meine Finger fuhren und an denen sie sich hielten in seltener Entschlossenheit.
Es wurde die Zeit der klaren Worte – romantisch, aber ohne Kitsch – die geschichtslos waren und blieben, die keine Rücksicht kannten und trafen. Worte, die würzig waren wie die Luft, in die sie gesprochen wurden.
Es war auch die Zeit der Zigarettenküsse, der schamlosen Verlegenheiten, der verwegenen Schüchternheit.
„Morgen kommt erst Übermorgen“, sprayten die Götter an den blauen Himmel, und der Wind der Ostsee verblies das nicht.
Die Luft, die wir atmeten ließen wir dort. Das Foto von dir nahm ich mit.
.
.
Kürzlich traf ich einen
Kürzlich traf ich einen. Nun hatte ich zufällig gerade Theologie studiert und kam mit den Unwegsamkeiten des Lebens gut zurecht.
So fragte ich den, ob ich ihn zu einer Partie Dogmatik herausfordern dürfe.
Er willigte ein. Ich schlug ihn, weil ich meine Allmacht lang genug geschützt hielt. Im entscheidenden Moment erst brachte ich sie aktiv ins Spiel. Dagegen war er ohnmächtig.
Ich schlug seinen Sohn an mein Kreuz. Da gab er auf.
Er reichte mir die Hand, verabschiedete sich freundlich und zog seines Wegs.
Hab’ ihn dann nicht mehr gesehen. Netter Typ. Keine Ahnung, wer das war.
.
.
________________________________
Geb. 1961, aufgewachsen bei Bern, Studium der evang.-ref. Theologie in Bern und Nairobi, acht Jahre Gemeinde-Pfarramt, 4 Jahre Psychiatrieseelsorge, seit 4,5 Jahren Gefängnisseelsorger in Pfäffikon / Kt.ZH, lebt als Spitalseelsorger in Zürich
.
.
Musik-Satire von Nils Günther
.
Der gemeine Orchesterdirigent
Nils Günther
.
Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer!
In unserer musikzoologischen Vortragsreihe «Die Unterwelt der Musik» wollen wir uns heute einer besonders verbreiteten, aber auch sehr interessanten und in weiten Teilen noch unerforschten Spezies zuwenden: dem gemeinen Orchesterdirigenten.
Zunächst sollten wir den Gegenstand unserer Betrachtungen einmal definieren, denn obwohl den gemeinen Orchesterdirigenten jeder kennt, ja wahrscheinlich viele von Ihnen selber den einen oder anderen davon im Plattenregal stehen hat, stellen wir uns mal ganz dumm und fragen: Was ist ein Dirigent?
Hierzu muss man in der Historie recht weit zurückgehen, eigentlich in die graue Vorzeit, an jenen Punkt, wo einer aus der Herde das Maul besonders weit aufriß und sich dadurch zum Leithammel machte. Dass dafür das Maulaufreißen allerdings nicht lange reichte, kann man sich vorstellen; Argumente allein hatten noch selten ewig Bestand. Daher war es nützlich, sich durchaus physischer Gewalt zu bedienen, etwa indem man einen großen Knüppel nahm und alles, was aufmüpfig war einfach niederschlug.
Aus eben dieser Figur des Leithammels entwickelten sich mehrere bis in die heutige Zeit existente Tätigkeiten, die alle mit Machtpositionen zu tun haben. Der Politiker, der Boxer, der Zahnarzt und der Dirigent: sie alle haben ihre Wurzeln im prähistorischen Knüppelschwinger, nur dass die Knüppel im Laufe der Evolution extrem verkümmert oder überhaupt zu rein geistigen geworden sind. Beim Dirigenten ist dieser letzte Rest des Knüppels aber in Form eines kleinen Stäbchens noch gut zu erkennen, auch wenn sich die Funktion seiner Keule ein wenig gewandelt hat. Sie wird nicht mehr zum direkten Prügeln benutzt, letzteres wird vielmehr bloß noch angedeutet; der Dirigent «gibt den Takt an», wie man sagt. (Ob er viel mehr tut, ist von der Wissenschaft noch nicht endgültig geklärt).
Diverse Sagen ranken sich um einige besonders heroische Dirigenten der Vergangenheit. So erzählt man sich heute noch voller Erschauern die Geschichte von Lully, der sich mit seinem (damals noch durchaus knüppelhaften) Stab den Fuß rammte und kurz darauf verschied. Ein Suizid der besonderen Art!
Doch diese heroischen Zeiten sind eigentlich vorbei, heute scheuen die meisten Dirigenten das Risiko, und kaum einer würde mehr selbst ein solches Opfer für die Kunst bringen. Nein, heute geht es dem Dirigenten in erster Linie darum, dem Komponisten zu zeigen, was eine Harke ist. Wedelnd steht der Dirigent an seinem Pult und fuchtelt alle ihm untergebenen Musiker in die Knie. Selbst bei Messen und anderen geistlichen Werken hat der Dirigent keine Skrupel, statt Andacht das blanke Stäbchen walten zu lassen. Das Werk hat vor dem Maestro zu erzittern, nicht etwa umgekehrt! Was man hört ist nicht Mozart oder Beethoven, sondern Bernstein oder Celibidache.
Der Dirigent muss nur die Auf- und Abwärtsbewegung des Stabes erlernen, nichts weiter. Zählen kann das Orchester allein, und zwar gut genug, um sich nicht durch das unrhythmische Gefuchtel aus der Ruhe bringen zu lassen. Gewiefte Dirigenten bringen es zustande, mit der freien Hand ebenfalls Bewegungen auszuführen. Solche Wunderknaben sind rar, und der tosende Applaus ist ihnen gewiss. Schließlich ist das so, als ob ein dressierter Affe gleichzeitig eine Banane isst und sich mit dem linken Fuß am Kopf kratzt. Vor solcherlei Launen der Natur hatte der Pöbel schon seit jeher Respekt. Zu Recht.
Der Weg zum Dirigentendasein führt also über mehrere Stationen. Zunächst muss man einiges an Feinmotorik mitbringen, um überhaupt ein Stäbchen koordiniert bewegen zu können. Nicht nur muss das Holzstück auf und ab bewegt, nein, es muss dabei auch fest genug gehalten werden, so dass es nicht versehentlich aus der Hand fällt. Einem angehenden Maestro werden in der ersten Probephase denn auch diverse Unfälle nicht erspart bleiben, von ausgestochenen Augen über tote Haustiere und zerstörte Porzellansammlungen bis hin zu unabsichtlich kastrierten Schulfreunden. Ist diese Klippe nach Jahren zermürbernden Trainings umschifft, muss sich der Dirigent einige feinere Eigenschaften antrainieren wie Arroganz, Geldgier, Oberflächlichkeit und Narzissmus. Manche haben darüber hinaus eine rudimentäre musikalische Grundausbildung, doch darauf kann man sich nicht verlassen.
In aller Regel muss man zufrieden sein, wenn der Dirigent weiß, in welche Richtung er zu blicken hat. (Für gewöhnlich hat er ja einen Handlanger, der sich Konzertmeister nennt. Dieser schüttelt dem Dirigenten immer wieder die Hand, damit der Maestro seine Position wieder richtig einnimmt, und auch, damit sich die um das Stäbchen gekrampfte Hand wieder etwas entspannen kann). Intelligentere Exemplare der Spezies sind zudem in der Lage, blitzschnell ihre Position durch eine Drehung um 180 Grad zu verändern, um sich gekonnt zum Publikum hin zu verbeugen. Einigen von ihnen gelingt es sogar, sich anschließend wieder mit katzenartiger Behendigkeit in die Ausgangslage zurück zu bewegen. Doch das ist angeborenes Genie, welches sich dem Normalsterblichen nur schwer erschließt.
Ein weiteres bedeutungsvolles Moment kommt hinzu: die Mimik. Sie ist die wahre Kunst des Dirigenten. So kann man es etwa bei Lorin Maazel beobachten, der mit seinem Blick unmissverständlich zu verstehen gibt, dass er nicht nur alle Musiker und das Publikum, sondern auch die Musik selbst abgrundtief verachtet und nur dort droben auf dem Podest steht, weil der Taxameter tickt und ihm den neuen Swimmingpool als sicher finanziert verspricht.
Der Dirigent ist in der glücklichen Lage, das meiste Geld zu verdienen und dafür am wenigsten tun zu müssen. Er muss in der Regel nur einen Auftakt schlagen, danach läuft die Sache quasi von selbst. Üben kann der Dirigent in seinem Sessel zu Hause mit einem feinen Glas Cognac in der einen Hand und der Partitur in der anderen. Lesen kann er sie größtenteils nicht, und so verbringt er die Zeit damit, die schwarzen Punkte mit einem Buntstift zu verbinden und sich von den entstehenden Bildern überraschen zu lassen.
Es ist natürlich nicht verkehrt, wenn der Dirigent den Schluss der Komposition nicht verpasst. Danach weiterzuschlagen wäre nicht von Vorteil. Denn der gebildete Dirigent weiß, dass der Schluss in 90 Prozent aller Fälle laut und immer von Stille gefolgt ist. Diese Stille muss schnell genug wahrgenommen werden, was schon schwieriger ist, da es zur verbindlichen Natur eines Dirigenten gehört, maximal zehn Prozent Hörfähigkeit zu besitzen. Aber der wahre Künstler hat es halt im Blut und wird blitzschnell reagieren, den Atem anhalten und erstarren, sich kurz darauf mit einem Nicken umdrehen und erleichtert sein, wenn tatsächlich geklatscht wird und er nicht doch einfach bei der Generalpause aufgehört hat. Aber da stehen die Chancen fity-fifty, da kennt die wahre Spielernatur gar nichts.
Ansonsten muss der Dirigent noch ein Autogramm geben können und einen Plattenvertrag unterschreiben, den Rest macht sein Assistent.
Derzeit wird die Dirigententätigkeit für sehr viele arbeitslose Fleischer und Polizisten interessant, doch nur wenige wagen einen solchen beruflichen Abstieg tatsächlich, viele werden wegen Überqualifikation auch gar nicht von den Orchestern angenommen. – Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen einen Einblick in die so faszinierende Welt des auf allen Kontinenten heimischen, aber immer noch rätselhaften gemeinen Orchesterdirigenten gegeben zu haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! ■
.
______________________
Geb. 1973 in Scherzingen/CH, Klavier- und Kompositions-Studium in Berlin und Winterthur, zahlreiche kompositorische Veröffentlichungen und Radio-Aufnahmen, lebt seit 1999 als Komponist in Berlin
.
.
Groteske von Susanne Albrecht
.
Aufruhr im Niemandsland
Susanne Ulrike Maria Albrecht
.
«Willst du nicht mein Freund werden?» fragte einer, der aussah wie George Clooney, und sich als Wolfgang vorstellte.
Peter wirkte verwirrt.
«Na, dann eben nicht!» knurrte der Hungrige. Und aus dem schönen Wolfgang wurde der böse Wolf.
«Wir suchen Schneewittchen!» Lautstark probten sich sieben kleine Zipfelmützenträger, die wie die Ölgötzen dastanden, im Protestieren.
«Du bist der Meisterdetektiv, den wir per Brieftaube angefordert haben, um das verschwundene Schneewittchen zu finden!» fasste einer der Ölgötze seine Gedanken in Worte, und trat mutig vor die Gruppe. «Können wir dann gehen?» fragte er.
«Nein!» der schöne Wolfgang fletschte die Zähne. «Verzieht euch schleunigst hinter die sieben Berge, oder jeder erfährt, was für kleine Perverslinge ihr seid! Dann werden die sieben Zwerge aus jedem Märchenbuch gestrichen!» knurrte er. Und wie ein geölter Blitz sausten die Ölgötze davon.
Der böse Wolf wandte sich an Peter. «Da vorne steht das allseits bekannte Knusperhäuschen von Hänsel und Gretel. – Die sind zwei Satansbraten, und ein Fall für die Supergranny! Die beiden haben zuviel kriminelle Energie im Kopf. Bei denen geht alles so schnell, dass es schon vorüber ist, bevor es überhaupt angefangen hat! Der Hänsel und die Gretel schießen nur auf jemand, um ihn durch die Luft fliegen zu sehen. Keinerlei Respekt, diese Jugend von heute! Aber nicht mit mir! Ich hab da meine eigene Methode… Ich sag nur: Knüppel aus dem Sack…» Er machte eine anschauliche Geste.
«Tja! Du bist in der Tat ein toller böser Wolf!» meldete sich Peter zu Wort, während er überall Fabelwesen sah.
Der schöne Wolfgang stieß drohende Kehllaute aus. «Waldsterben mal anders!» brummte er. «Ein mörderisches Märchen, im wahrsten Sinne! – So etwas wie Ganovenehre gibt es nicht, das ist ein Mythos! – Allerdings brauchen wir keine von der Kripo, um einen Mordfall im Forst zu klären! Vor allem können wir keinen Burschen gebrauchen, der hier in Niemandsland für Aufruhr sorgt! Und um noch mehr Licht in deine Wissensdunkelheit zu bringen, sage ich es frei heraus: Fremde sind hier nicht gern gesehen! Fremde bringen nur schlechte Nachrichten! Nichts für ungut … Aber Misstrauen ist mein zweiter Name und hält mich am Leben. Ich vermute schon eine Verschwörung, wenn ich den gestiefelten Kater an einer Würstchenbude stehen sehe! Ganz zu schweigen von Hans im Glück, der ist zwar ein Idiot, aber wenigstens ein glücklicher! Und ich… Ein verschütteter Bergwerkarbeiter hat mehr Glücksgefühle… Aber das ist eine andere Geschichte… Und schließlich will ich nicht zum Märchenonkel mutieren!» Er fletschte die Zähne.
In dem Augenblick trat Schneewittchen, das hinter den sieben Bergen die Schönste war, neben ihren schönen Wolfgang, der aussah wie George Clooney, und schmiegte sich an ihn. Nach der geglückten Flucht vor den lüsternen sieben Zwergen und dem Märchenprinzen hatte sie in ihm endlich ihren Traummann gefunden. Peter war verlegen und gab Zeichen wie beim Pokern. Er war so geblendet von dem Antlitz Schneewittchens, dass er wie angewurzelt dastand und mit den Augen rollte, bis er Sterne sah. «Dann will ich nicht länger stören!» stammelte er.
«Jederzeit gerne!» hauchte Schneewittchen und warf ihm Kälbchenaugen zu. Dann verschwand sie mit ihrem Wolfgang in der Bretterbude.
Peter zog einen Flunsch. Mit den Augen Blitze schießend murmelte er:»Ich könnt’ ihn auf den Mond schießen!» –
«He! Dich kenne ich doch!» rief Peter verblüfft.
«Das halte ich für ein Gerücht!» konterte der kleine Antipathieträger.
«Dein Name liegt mir auf der Zunge… wie nennt man dich gleich…» Peter hatte Blut geleckt.
«Manchmal nennt man mich so, oder so!» Das Männlein ließ sich nicht aus der Reserve locken.
«Und wie nennt man dich meistens?» ereiferte sich Peter Pan.
«In der Märchenstunde, oder in der Menschenwelt?» entgegnete der Kleine schnodderig.
«Hier! Hier… hinter den sieben Bergen, meine ich!» Peter wurde zum Berserker.
«Errate meinen Namen und du bist frei – fällt mir da nur ein!» der Zwerg war nicht zu beeindrucken. «Außerdem sind Namen Schall und Rauch! Ich bin inkognito unterwegs!»
«Müller-Wolkenscheid, Hasenfratz, Schneider?» Peter überlegte angestrengt.
«So heiß ich nicht!» triumphierte der kleine Antipathieträger.
«Vielleicht bist du das tapfere Schneiderlein… Sieben auf einen Streich!» warf Peter Pan ein und rollte mit den Augen, als hätte er sich den Mund verbrannt an viel zu heißer und viel zu scharfer Chilisauce.
«Du bist doch wirklich der Abschaum der Menschheit!» schrie das Männlein hysterisch und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. «Von dem vielen Herumsitzen in der Dunkelheit fühle ich mich schon wie ein Maulwurf!» protestierte es lautstark.
«Ah! Jetzt weiß ich es!» war die kernige Reaktion von Peter Pan. «Ich weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt!»
Das Männlein sah ihn gelangweilt an:»Ja, und?»
«Ich habe deinen Namen erraten!» antwortete Peter unerbittlich.
Es wiederholte:»Ja, und?»
«Du musst in deiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen packen und dich selbst mitten entzwei reißen!» forderte Peter begierig. «Und mir das Gold lassen!»
Das war der Punkt, an dem das gar zu lächerliche Männchen aufgab. «Verdammt nochmal!» stöhnte es genervt. «Wieder der selbe Mist!»
Es riss sich selbst entzwei und verschwand in einer Schwefelwolke.
Peter trat den Nachhauseweg an, mit einer Schubkarre voll Gold.
Und wenn er nicht gestorben ist – ist jemand anderes tot… ■
.
____________________________________
Geb. 1967 in Zweibrücken/D; Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing; Private Schauspiel-Ausbildung; Kurzprosa in Anthologien und Literaturzeitschriften
.
.
Kurzprosa von Jutta Miller-Waldner
Sowat von süß
Jutta Miller-Waldner
Kutte mümmelte seine Grobe-Leberwurst-Schrippe, trank einen Schluck Red Bull, noch einen Schluck Red Bull. Red Bull mochte er, das machte munter, war schön süß, fast so wie Kaugummi. Den mochte er nämlich nicht, weil er immer an seinem Gebiss kleben blieb, und der Zahnarzt damals war nicht der beste. Und Kukident konnte er sich auch nicht oft leisten.
Er guckte in die Dose: «Mist, schon wieder alle», blinzelte in die Morgensonne: «Und nu, wat mach ick nu? Ne Lulle hätt ick jerne. Am liebsten ne Pall Mall. Die schmeckt so schön nach Menthol. Aba wer roocht schon sowat. Na ja, ne Lucky tät’s ooch. Mal sehn, ob ick eene schnorren kann.» Er leckte die letzten Krümel von seiner Groben-Leberwurst-Schrippe aus der Alufolie ab, knüllte sie zusammen, wanderte zum Papierkorb und schmiss die Red-Bull-Dose und die Folie rein.
Marschierte los.
Sah die Frau schon von weitem, vergaß die Lulle.
«Mensch, sieht die jut aus. Jenau det, von wat ick imma träume. Kleen, schnuckelich, allet dranne, kann man nich meckan. Schwarzer Bubikopp. Man, da steh ich druff. Jenau meen Typ. Ob ick die anquatsche? Nee, jeht nicht, wat icke schon wieda denke. Ick bin nischt, hab nischt, werd nischt.
Wat mach ick nur. Die sieht aba ooch zu süß aus. Ich muss die anquatschen. Nee, nachher schreit die um Hülfe. Oda, noch schlimma, kiekt ma vaächtlich an. Det vertrach ich nicht. Schon ja nich von sona Süßen. Oda sie drückt ma nen Heiamann in de Hand. Det wär det Ende. Det überleb ick nich.
O Mann, wie die so den Weg langstakst in ihren roten Lackledaschuhchens. Bestimmt is det ‘n Zehn-Zentimeter-Absatz. Mindestens. Könnt ick stundenlang zukieken.
Eijentlich seh ick doch janich so übel aus. Filleicht merkt die ja nich, det ick keen festen Wohnsitz hab. Wie det so scheen in Beamtendeutsch heeßt. Beamten. Nee, mit denen will icke nischte zu tun ham. Det ick ‘n Penna bin. Bin keen Penna, bin ‘n Berba. Det is ‘n jewaltija Unterschied. Weeß die aba nich.
Jotte nee, die is ja sowat von süß.
Bisken zaknittat meene Jeans. Na und. Na ja, peinlich is det schon, det der Knopp von det Hemde ab is. Det kann doch aba jedem passiern. Nee, ‘nem Bankdirekta natürlich nich. Der hat sowieso ‘ne Haushälterin oda sowat. Uff jeden Fall ‘ne Frau. Eben. Ick muss die anquatschen. Aba sonste bin ick doch janz schnieke. Muss bloß jerade jehen und den Bauch einziehen. So, jut, det jeht.
Mensch hat die tolle Beene. Sowat von schnuckelich. Det is meen Jlückstach heute.
Hat die Oojen, kann ick ja nich rinkieken. Da kriech ick jlatt weeche Knie.
Jleich jeht se vorbei. Wat saach ick nur zu ihr? ‘Kenn wa uns nich?’ Quatsch. ‘Scheener Tach heute.’ Nee. Jeht ooch nich.
Mensch, det is keen Leben nich, ick bin total aus de Übung. Na ja, bin sowieso janz schön schüchtan. Hab ma nie jetraut, ‘ne Frau anzuquatschen. Da bin ick imma sowat von rot jewordn. Denn ha ick ooch noch imma jestottat.
Wat is’n det, hey, wat soll det. Wat will denn der Macka da von der Kleenen? Wo kommt der denn her? Ha ick ja janich jesehen. Mensch, wenn der der Süßen bloß nischt tut. Da muss ick sofort die Bullen holen. Wat denn, der umarmt sie? Wat, die küsst ihn? Meene Kleene?
Und nu, wat mich ich nun den janzen Tach? Ne Lulle hätt ick jerne. Mal sehen, ob ick eene schnorren kann.»
 Jutta Miller-Waldner
Jutta Miller-Waldner
Geb. 1942 in Berlin, zahlreiche Lyrik- und Kurzprosa-Publikationen in Zeitschriften und Anthologien, Lesungen in Deutschland, Spanien, Österreich und Ungarn, verschiedene literarische Würdigungen, Vorsitzende der IGdA, lebt als Autorin, Lektorin und Chefredakteurin von «IGdA-aktuell: Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik» in Berlin
Fabeln von Horst-Dieter Radke
.
Drei Fabeln
Horst-Dieter Radke
.
.
Schlange und Flöte
«Du musst tanzen, wenn ich erklinge!» sprach die Flöte zur Schlange. «Du bist meine Sklavin.»
Die Schlange wiegte sich hin und her. «Was ist schlimm daran, wenn ich deine Musik in Bewegung verwandele und so nicht nur dem Ohr, sondern auch dem Auge etwas biete?»
«Du musst, wenn ich will» lästerte hämisch die Flöte.
Am Abend kroch die Schlange zur Flöte, die der Spieler achtlos auf die Decke gelegt hatte, und richtete sich auf.
«Siehst du?» sprach sie. «Ich kann auch tanzen ohne deine Musik. Wer will es mir verwehren?»
Die Flöte schaute die Schlange nur verächtlich an.
«Aber kannst du erklingen», zischte die Schlange, «wenn der Spieler dich nicht bläst?»
Hilflos und stumm schaute die Flöte der tanzenden Schlange zu.
.
.
.
Storch und Frosch
«Schau», sagte der Storch zum Frosch, «es ist ja nur etwas mehr als ein halbes Jahr, dass ich deinesgleichen belästige. Im Herbst gehen wir auf Reisen und im Winter sind wir in Ländern, die euch gar nicht gefallen würden.»
«Was haben wir davon?» jammerte der Frosch. «Im Winter liegen wir starr und steif im Schlamm, erwarten das Frühjahr und fürchten eure Rückkehr.»
«Dafür kann ich nichts!» sagte der Storch. «Außerdem seid ihr uns zahlenmäßig überlegen.» Er schnappte den Frosch mit dem Schnabel, schlang ihn herunter und stapfte auf seinen langen Beinen weiter durch die Wiese, auf der Suche nach einem neuen Gesprächspartner.
.
.
.
Mücke und Fliege
«Du ernährst dich nur von den Resten der Menschen.» lästert eine Mücke arrogant, als sie sich an der Wand neben der Fliege niederlässt. «Ich nehme das Beste was sie haben, ihr Blut, wann immer ich es will.»
Beleidigt summt die Fliege davon. Ein heftiger Klatsch verstreicht das frische Blut mit der Mücke über die Wand zu einem hässlichen Fleck.
«Siehst du wohl!» sagt die Fliege, als sie sich auf den gut nach Honig riechenden Klebestreifen setzt. ■
.
_____________________________________
Geb. 1953, aufgewachsen in Hamm/D, Ausbildung zum Industriekaufmann; Wirtschaftsinformatiker, Studium der Betriebspädagogik, fast zwei Jahrzehnte in der Geschäftsführung eines Betriebes der Naturkostbranche tätig; arbeitet heute als Autor, Lektor und Journalist
.
.
.
Kurzprosa von Jutta Miller-Waldner
Und Kutte lachte
Jutta Miller-Waldner
.
Kutte plinkerte mit den Augen, klatschte mit der linken Hand eine Fliege fort, die sich auf sein rechtes Lid gesetzt hatte, verzog das Gesicht vor Schmerz, wälzte sich auf die andere Seite, fiel fast von der Parkbank, zuckte zusammen.
Kutte war wach.
Und Kutte hatte Hunger.
Er erhob sich ächzend, blieb eine Weile sitzen, den Rücken gebeugt, den Kopf tief zwischen den Schultern. Schließlich erhob er sich und faltete die FAZ-Sonntagsausgabe zusammen, die ihm als Unterlage und Kopfkissen und Zudecke gedient hatte, warf sie in den Abfallkorb.
«Heute muss ick mir wieda zwee Zeitungen orjanisiern. Muss ick wieda mit de S-Bahn fahren. Oder nee, besser is et mit die U-Bahn. Da lassen die Leute öfta mal ne TAZ liejen.»
Kutte las möglichst jeden Tag die TAZ. Das hatte er von früher beibehalten. Da war er eigen. Soviel Würde musste sein.
Er spritzte sich am Springbrunnen Wasser ins Gesicht, wischte den Schmutz von seinen Schuhen, seinen Jeans, zog den Kamm aus der linken Gesäßtasche, fuhr sich über die Haare, spuckte in die Hände und strich sie glatt, erblickte sein Gesicht im Wasser, guckte schnell wieder weg.
Sein Magen knurrte.
«Als erstet werd ick die Abfallkörbe abklappern. Am besten drüben beim Jymnasium. Wenn nich schon ein andrer dajewesen is. Aba die Jören schmeißen ja soville wech, da werd ick bestimmt noch wat finden. Filleicht ha ick ja Glück und find ne Stulle mit Katenrauchschinken.»
Kutte aß gerne Kartenrauchschinken. Am liebsten aß er Räucherlachs, aber welche Mutter gab seinem Kind schon ein Lachsbrot mit in die Schule.
Er schlurfte hinüber, wühlte. Nichts. «Mist», dachte er. «Det is nich mein Tach heute. Da steht man am besten jar nich erst uff. Aber denn kommen die Bullen un verjagen einen. Na jut, werd ick zur Realschule marschieren.»
Kuttes Magen knurrte lauter.
«Sei ruhich», befahl er. «Krichst ja jleich wat.»
Er wühlte. Fand zwei in Alufolie gewickelte Schrippen – «is doch meen Jlückstach heute» -, wühlte weiter, zog eine viertelvolle Einliterflasche Cola heraus, eine halbleere Dose Red Bull, ein Überraschungsei, eine Sonnenbrille, deren linkes Glas verschrammt war, drei Sammelbilder für das Fußball-EM-Album mit René Adler – «wieso denn der», schoss es ihm durch den Kopf -, Miroslav Klose und Bastian Schweinsteiger. «Na nu», wunderte er sich. «Wat schmeißen die denn sowat wech?!»
Kutte mochte Schweini.
Des Weiteren fand er eine Barbiepuppe mit nur einem Bein, warf sie angewidert zurück.
Fand eine Tarotkarte.
«Wat is ‘n det? So’n Quatsch», stellte er fest. Warf sie wieder in den Abfallkorb.
Er steckte das eine Brötchen in die Jackentasche – «Wer weeß, wenn ick wieda wat finde» -, wickelte das andere aus, knüllte die Alufolie zusammen, warf sie zur Tarotkarte. Klappte das Brötchen auf, begutachtete die Jagdwurstscheibe, roch daran. «Na ja, jeht ooch» -, klappte es zu, biss hinein, schlurfte weiter.
Schlurfte zurück, griff in den Abfallkorb, holte die Tarotkarte heraus. Starrte sie an, steckte sie in die Hosentasche, wanderte zu seiner Parkbank. Aß seine Schrippe auf, schlenderte zum Springbrunnen, wusch sich die Hände, setzte die Sonnenbrille mit dem zerkratzten linken Glas auf, marschierte zurück, setzte sich, schlug das rechte Bein über das linke, zog die Tarotkarte aus der Hosentasche, betrachtete sie, die blauen Kugeln, die geschweiften Linien, die Ketten, die Frau, die das Schwert mit beiden Händen hielt …
«Uff wat für Einfälle die Leute kommen», wunderte er sich. «Wer kooft denn sowat? Und wozu?»
Er las die Zahl, die da in römischen Ziffern geschrieben stand, las das Wort am unteren Rand: Ausgleichung.
«Ausgleichung. Kenn ick nich. Ha ick ja noch nie jehört. Det jibt Jleichungen, Jleichberechtigung haha, Anjleichung, Ausjleich, Jleichheit, na ja, Jleichjüligkeit. Die kenn wa zu jenüje.»
Kutte saß auf seiner Parkbank, er rutschte hin und her, starrte auf die Karte, stand auf, setzte sich wieder, starrte auf die Karte, schaute hinüber zum Springbrunnen, auf die Karte in seiner Hand. Sah die neunundneunzig Luftballons, die in der Fontäne tanzten – hellblaue, babyblaue, südseehimmelblaue, blau wie Vergissmeinnicht, Gletschereis, Saphire, gestreift, gepunktet, kariert -, ging hinüber, ergriff die Strippe eines weißblauen, hob ab und schwebte. Er schwebte über das ICC, den Funkturm, über Fürstenfeldbruck und New York, die Wüste Gobi und den Angelfall, über den Atlantischen Ozean, über Vulkane und Eis, und er schwebte, und der Mond war sein Kumpel und die Sonne seine Braut, und die Planeten spielten um ihn her Ringelreihen, er kickte einen Satelliten gegen die Venus und schrie «Toooor», und rief zur ISS ein «Nasdarowje» hinüber; er spazierte mittenmang auf der Milchstraße, die Strippe des Luftballons fest in seiner rechten Hand, und sah die Galaxien Walzer tanzen, die Quasare Rock ‘n Roll, er fuhr auf einem Kometen Achterbahn und rodelte mit einer Sternschnuppe zurück zu Erde. –
Kutte plinkerte mit den Augen, klatschte mit der linken Hand eine Fliege fort, die sich auf sein rechtes Lid gesetzt hatte, verzog das Gesicht vor Schmerz, wälzte sich auf die andere Seite, fiel fast von der Parkbank, zuckte zusammen, erhob sich ächzend und starrte auf seine rechte Hand.
Und Kutte lachte. ■
.
_____________________________
Geb. 1942 in Berlin, zahlreiche Lyrik- und Kurzprosa-Publikationen in Zeitschriften und Anthologien, Lesungen in Deutschland, Spanien, Österreich und Ungarn, verschiedene literarische Würdigungen, Vorsitzende der IGdA, lebt als Autorin, Lektorin und Chefredakteurin von «IGdA-aktuell: Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik» in Berlin
.
.
Kurzprosa von Franz Felix Züsli
.
Taksi!
Franz Felix Züsli
.
Ha, ha -; nein: nicht vollgeladen wie ein überlaufendes Whiskyschiff… nein; so ein bisschen gefüllt – ein kleines Schmugglerboot, ja; angeheitert, das ist richtig: stark angeheitert ist heute Walter Zwyssig, ha… ich – Angestellter, kaufmännischer: Gorps. ‘tschuldigung, Miriam: prost – meinen Rest im Glas zu deinem Vergnügen. Miriam… nein – keinen Schluck Whisky mehr: ich wechsle die Flagge; bitte einen Einer, ‘tschuldigung, einen Zweier, natürlich: Roten, ja, französischen, also: Beaujolais, Miriam… ein kleines Festchen für Walter Zwyssig heute -. Geburtstag? Du, Miriam? Nein, du… ich? Nein, überhaupt nicht Geburtstag. Miriam. du…!Prosit! Zum Wohl! Mmhmm, Rotwein auf Whisky. Freude am Freitagabend… danke, Miriam… das darf ich nur denken, Miriam, das kann ich dir nicht, nein, will ich dir, Gorps, ‘tschuldigung, Gesundheit! nicht sagen: wenn du dich bückst, diese Übersicht, bitte noch einmal -.
Miriam!
Walter Zwyssig stand an der «Falter»-Bar: sein Auge wanderte mit etwas erweiterter Pupille über die Flaschenpracht: Sandemamn mit schwarzem Mann Dow’s Port Fernet Branca die Bilder an der Wand Appenzeller sixty-nine nein: diese sonnenbraune Hand, Miriam. Tippen an der Kasse, klingeln, für die Garderobe wird nicht gehaftet, aber ich möchte den Kopf auf die Theke legen, dieses Drücken auf die Augenlider, Miriam trägt eine grüne Jacke… Wiese, um auszuruhen, und ihr Sternzeichen ist die Waage, wenigstens den Ellenbogen auf die Theke legen, diese antiken Messinggriffe an den Schubladen abschrauben, verkaufen, klingeln, die Kasse. Im Spiegel dein schlanker Hals, Miriam! Prosit! Miriam, ich: ja, Beaujolais… du…
So ein schmaler Freitagabend, ha, ha -. Zurückhaltendes Lachen, bereit zum Gelächter: Miriam lachte überrascht, erschrocken zurück – doch, Feuer habe ich! Bitte! deine Augenwimpern… da lehnt ja noch einer an der Bar: schüttet sich auch so ein bisschen mit Schnaps voll? Hallo, Kamerad – out! In, Miriam: mit deinem Lächeln allein sein… darf ich dir auch ein Glas anbieten: niesen — Gesundheit! -, anbieten? Also. dann nicht: Prost Walter!
Woher der gekommen ist? die Flügeltüre schwingt noch: ah, ein Hotelgast – «Guten Abend….» Im halbleeren Rotweinglas blitzt das Kronleuchtergefunkel: der Mensch neigt den Kopf in meine Richtung, abweisende Ahnung eines Lächelns, und Miriam nimmt den Whisky an, den er ihr angeboten hat:
Miriam!
Dieser hergelaufene Mensch; durch die Flügeltüre: «Rechnung auf Zimmer 32, bitte» -, Abendanzug mit Siegelring und silbernem Zigarettenetui: «Bitte!» und Miriam nimmt die Zigarette an: «Prosit!» – nein, die Gläser klirren beim Anstoßen nicht, sie… klingelnder Wohllaut: küssendes Glas; tatsächlich, was fällt dem Abendanzug denn ein: er küsst Miriam die Hand – ihr Lächeln flattert hin und her, und wie klug er sich in ihre Gefühle drängt: Gorps, ‘tschuldigung, noch einen Zweier, ja, Beaujolais, danke -.
Aus dem Abendanzug strömt mir Gleichgültigkeit entgegen – dafür trinkt ihm Miriam zu, diese Musik… zum Verrückt…
Ich, Walter Zwyssig! nur einen Whisky, einen Zweier, ja, zwei Zweier und abgefüllt wie eine gestopfte Gans? Mein Körper schwankt um mich selber – zwei Stück Rückenmark? Nein, das Hirn rutscht nach hinten, wenn ich an die Decke schaue: unmöglich; nur Wellen im Kopf. Muss der Föhn sein, ja: der Föhn.
Bitte Miriam: Feuer! Danke! Nicht bücken? Schade; vom Bücken lebt man – dem Abendanzug möchte ich eine gefüllte Fritteuse in den Kragen leeren. Linke Hand in der Hosentasche, hat er; zutrinken, leises Geflüster mit Miriam, lächeln, dreht sich, nicht bücken, nur für kleine Leute: strecken, deine Zunge:
Miriam! Du bist ein…
Bist du? bin ich? Einen Zweier, nein, Dreier – bin ich? Hinaus mit Walter Zwyssig, sage ich: zahlen bitte! Eins, zwei… viel. Miriam… Danke! Meine Zunge lispelt draußen haben sie die Schirme geöffnet hier hat es am Boden Zigarettenasche klingeln nicht die Kasse das Telefon am Kleiderständer hängt ein Regenmantel vergessen nicht abgeholt am der Bar Walter Zwyssig Trinkgeld inbegriffen. Weiß schon, Miriam. Ciaò.
Flügeltüre, auf: zu! Ich spüre die kühle regenschwere Nachtluft; fast wäre ich gestolpert, diese heiße Stirne: Walter hat einen sitzen, hat er wirklich? Föhn. Kurzweil an der Bar; Freitagabend. Der linke Fuß kribbelt: eingeschlafen, Miriam… und immer, wenn man nach Hause fahren will, stehen die Trams in den Depots. «Taxi!» Und dabei ist Mitternacht noch keine halbe Stunde vorbei.
«Taxi!»
Diese kühle Nachtluft; nein, wirklich: es regnet, meine Schuhe sind schon ganz nass; dies ist aber Schweiß, was mir in den Mundwinkel rinnt: salzig und regennass.. auch regnen lassen, wenn ich zuhause bin. Ha -: zuhause bin. Ruth schläft unruhig, wenn ich nicht zuhause bin. Ruth sagt: «Ich schlafe immer unruhig. wenn du nicht zuhause bist!»
Und heute?
Miriam, was… Schläft immer unruhig, wenn ich nicht… tatsächlich, schon Samstag; immer unruhig wenn
«Taksi!» ■
.
_________________________________
Geb. 1932 in Zürich, Schriftsetzer-Lehre, dann Maturität und rechtshistorisches Studium an der Universität Zürich, Promotion, zahlreiche Lyrik- und Prosa-Publikationen in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, lebt in Witikon/CH
.
.
Kurzprosa von Wendel Schäfer
.
Über den Kopf
Wendel Schäfer
.
Es war schon dunkel, als Tobias die Haustür öffnete – und auch schon von einem Mann mit vorgehaltener Pistole zurück ins Haus gedrängt wurde. Rückwärts bis in sein Arbeits-zimmer.
«Hinsetzen und schön die Hände auf den Tisch!» herrschte ihn der Eindringling an. Fischte einen Stuhl aus der Ecke und platzierte sich gegenüber. Tobias konzentrierte seine Augen ins Gesicht des Fremden, dann runter auf den Revolver und wieder hoch zum Gesicht und wieder zur Waffe. Ein seltsames Ding. Eine Mischung aus Wasser- und phantastischer Raumpistole mit Flügelchen an den Seiten. Sah aus wie eine kampfbereite Kragenechse. Tobias kannte sich aus. Beim Militär hatte er es mit allerlei Waffen zu tun gehabt. Auch mit der schweren Pistole, die ihm bei jedem Schuss den Arm hoch warf. Hier war er sich nicht sicher. Das Rohr jedenfalls war aus Metall, und in der halb geöffneten Spiegelschranktür glänzte das Messing der Patronenmäntel in der Trommel.
«Hier, lies», fuhr ihn der Fremde an, «Seite 44», und schob ihm eine Zeitschrift hin. «Da, das Gedicht. Das mit der Krähe.»
Tobias war die Zeitschrift vertraut. Hatte dort hin und wieder kleinere Texte veröffentlicht.
«Das Gedicht kenne ich, gefällt mir.» Und drückte das Heft zurück.
«Schön die Hände zusammen auf der Platte lassen! ‘Gefällt mir’. Fein! Gefällt mir auch. Na klar, gefällt es dir! Mir aber noch mehr. Das ist mein Gedicht, verstehst du, mein Gedicht. Meine Idee.» Zog ein vergilbtes Blatt aus der Zeitschrift und schubste es Tobias hin.
«Vor zwei Jahren geschrieben. Und schon geklaut. Alles hat man mir geklaut. Meine besten Ideen haben sie mir gestohlen. Ich hab nämlich einen sehr erfinderischen Kopf. Alles mache ich über meinen Kopf. Die verrücktesten Dinge. Wenn es sein muss. Ich war schon nahe daran, Fische ohne Gräten zu züchten. Da hat man mir die Idee gestohlen. Ich sage nur Fischstäbchen. Kapierst du, was ich damit meine?»
Tobias verstand und wusste, dass seine Lage viel prekärer war als anfangs angenommen. Auch war ihm klar, dass er den Fremden reden lassen musste.
«Da haben Sie bestimmt noch andere tollen Sachen ausgedacht», ermunterte Tobias sein Gegenüber.
«Aber ja doch, das mit den Bäumen.»
«Was ist mit den Bäumen?»
«Es ist wegen der Überbevölkerung. Die Menschen werden sich noch tottreten auf dem Planeten. Wenn nur jeder zweite Baum gefällt wird, hätten alle für ein paar 100 Jahre Platz genug. Ich hab sogar schon ausgetüftelt, wie viel Quadratmeter angefallen wären. Eine ganz schön knifflige Rechnerei.»
«Genial», witzelte Tobias mit todernster Miene.
«Und dann haben sie die Regenwälder abgeholzt. Am Äquator, wo sowieso keiner bleiben will wegen der unheimlichen Schwüle. So war mein Plan futsch. Meine Idee geklaut.»
«Weiter», drängte Tobias und ließ das Revolverding nicht aus den Augen.
«In jeder Ecke der Erde ist Zank und Streit und Krieg. So kam ich auf die Idee, ganz spezielle Brieftauben zu ziehen.»
«Brieftauben gegen den Krieg, einfach genial», pflichtete Tobias eifrig bei.
«Keine gewöhnlichen Brieftauben. Friedenstauben mit Palmwedeln als Flügel. Ich ließ sie mit Friedensideen in alle Krisenherde aufsteigen. Keine kam zurück.
Haben sie mir alle eingefangen und umdressiert. Fliegen nun als Drohnen und spionieren herum. Und meine Idee ist wieder gestohlen. Man kriegt die Diebe nie zu fassen. Leben alle im Verborgenen. Bilden geheime Gesellschaften. Jetzt bin ich endlich am Ziel. Ich hab dich festgesetzt. Nun wird abgerechnet.»
Der Eindringling wurde forscher und verschärfte den Ton. Die Waffe fester gegriffen.
«So ein geniales Gedicht lasse ich mir nicht stehlen. Die Krähe war aus Stein, verstehst du. Genial. Kann natürlich nicht sprechen. Und wollte so viel sagen. Krähen wissen viel. Kommen weit herum und werden alt. Sie hat auf mich gewartet. Und dann kann sie nicht sprechen. Die Krähe war aus Stein. Genial, einfach genial…»
«Das Gedicht ist so alt wie deine Krähe», gab Tobias trotzig zurück. Ich habe es schon vor 20 Jahren geschrieben. Hier neben mir im Regal, das Lyrikbändchen, Herbstspuren.»
Tobias wollte sich zu den Büchern wenden, als der Fremde ihn anfuhr: «Mit einer Hand. Die andere bleibt auf dem Tisch!»
Endlich gelang es Tobias, das dünne Bändchen zu greifen.
«Ganz vorne das Erscheinungsjahr und hinten das letzte Gedicht. Das mit der Krähe aus Stein. Du wirst staunen.» Und schob es ihm hin.
Der schlug es auf, stützte den Ellenbogen drauf, in der Faust den Revolver. Mit der anderen blätterte er unbeholfen um. «1984. In der Tat schon etwas länger her. Und noch mühevoller gelangte er endlich zum letzten Gedicht. Dabei ließ er Tobias nie aus den Augen. Und begann zu lesen:
‘Steinzeit. In einer Feldfurche…eine Krähe…ich fragte sie…keine Antwort…aus Stein.’
Die letzten Worte verebbten in Gemurmel. Eine verlöschende Stimme ganz am Schluss. Das Gesicht hatte ein Grau angenommen. Die Wangen blutleer, die Augen dunkle Höhlen. Der Oberkörper fiel in sich zusammen. Die Waffe war mit zittriger Hand auf die Tischplatte abgelegt. Das Rohr aber nach vorne gerichtet.
«Dann muss ich das mit der Krähe irgendwo aufgeschnappt haben. Mir kommt im Leben so vieles über den Kopf. Man könnte irr davon werden. Verstehen Sie. Und dann die anderen. Alle wollen was von mir. Verfolgen mich Tag und Nacht. Bestehlen mich. Bestimmen einfach über den Kopf. Sie benutzen mich wie ein Spielzeug.»
«Spielzeug, wie das komische Schießding hier», wagte sich Tobias vor.
«Spielzeug. Wir alle sind Spielzeug. — Entschuldigen Sie.»
Der Fremde hielt sich den Revolver an die Schläfe – und drückte ab. Sofort kippte er zur Seite und schlug auf dem Boden auf.
Tobias wählte die Nummer der Polizei. Ein Auto draußen und drängelndes Klingeln löste die Starre.
Er stand auf, um den Polizisten zu öffnen. Und machte einen großen Schritt über den Kopf eines toten Dichters und genialen Denkers. ■
.
______________________________
Geb. 1940 in Bundenbach/D, Studium der Grund-, Haupt- und Sonderschul-Pädagogik in Koblenz und Mainz, langjährige Unterrichtstätigkeit in der Lehrerbildung, zahlreiche Buch- und Zeitschriften-Publikationen, umfangreiche Verbands- und herausgeberische Aktivitäten, lebt als Schriftsteller in Boppard/D
.
.
Satire von Ernst-Edmund Keil
.
Milch und Blut
Ernst-Edmund Keil
.
Stadtrandsiedlung der Bayerisch-Königlichen Metropole. Im Postamt auf der Rückseite des Balkan-Grills, wo er sich an den Schalter stellt, in eine Schlange, nachdem er zu Hause, hoch im Norden und also für ihn unerreichbar, sein Telefonbüchlein hatte liegen lassen, vergesslicherweise, die begehrte Nummer auch hier, am Ständer, nirgendwo entdecken konnte, denn der war vielfach freistaatlich besetzt und hatte keinen Raum mehr für den Rest der Republik.
Also schlängelt er sich geduldig, hoffnungsvoll an den Schalter heran. Vor ihm ein Mann in einer «Lederhosen» mit Gamsbart und bajuwarischem Äußeren. Wer sagt’s denn! Gestern war er noch in der Innenstadt gewesen, hin mit S und retour mit U, und hatte den Eindruck gewonnen, die Römer seien als Sieger an den Limes zurückgekehrt und hätten die Bajuwaren endgültig zu einem museal-archäologischen Thema deklariert. Dem, denkt er, ist also nicht ganz so oder so ganz. Im Gegenteil. Nachdem der Lederbehoste postalisch bedient war, erscheint jetzt vor ihm im offenen Schalteroval, nicht anders als in einer frühromanischen Mandorla, ein Gesichtchen, ein weibliches, aus Milch und Blut, das ihn an altbayerische Frömmigkeit erinnert – auch sie, denkt er, gibt es also noch -, und das richtet nun mit Madonnenblick und autochthonem Zungenschlag die frühchristlichen Augen auf bzw. gegen ihn, dass er geradezu ins Stottern gerät.
Auf dem Ständer, versucht er ihr missverständlich klarzumachen, habe er eine Nummer begehrt leider völlig vergeblich, worauf sie mit verschämter Unschuld (oder Neugier?) ihre mandelbraunen Madonnenaugen niederschlägt. Ja, und ob sie ihm vielleicht, hinter dem Schalter, seine Nummer geben könne – nein? – oder doch sein Buch, und nennt schließlich die Stadt, die er sucht und die hoch im Norden seines Vaterlandes liegt. Worauf sie, durchatmend, aufsieht, mit dem Engelsköpfchen nickt und, nachdem sie ihn versöhnlich um Geduld gebeten, aus seinem Gesichtskreis verschwindet, oder sollte er besser sagen: entschwebt? Wohin wohl und hoffentlich nicht für immer?
Doch kehrt sie nach einem Weilchen, leis’ und mit leerer Hand, zurück, das holde Haupt diesmal in der Horizontalen bewegend, mit christlichem Bedauern. Sie habe nur bayerische Bücher, und die Stadt, die er suche, liege augenscheinlich nicht im Freistaat, sondern außerhalb. Das Ausland aber, bittschön, würd’ er nur finden auf der Hauptpost, in Mosach, wissen s, da herunten bei der U-Bahn. Und bescheidet ihn, hold lächelnd wie der Isarhimmel, mit einem seligen «Grüß Gott!» Er verspricht, als Glaubensbruder, ihn zu grüßen, obwohl er, wegen der Nummer, diese Bayernpost im Herzen tief zum Teufel wünscht.
Draußen ist es, obgleich erst Anfang Juni, heiß wie in Afrika. An der Ecke steht ein Araber mit einem Obststand unter freiem Sommerhimmel und preist singend seine Früchte an. Er kauft ein Schälchen, das kostet so viel oder so wenig wie in seiner 600 Kilometer entfernten Heimatstadt am Rhein. Auf dem Preisschildchen ist – nicht bajuwarisch, nicht semitisch. sondern lutherisch-national – zu lesen: «Deutsche Erdbeeren». Na, wer sagt’s denn! Das reißt die Grenzen, die diese bayerische Madonna ihm lieblich-streng gezogen, hernieder bis auf den mütterlichen Grund und lässt ihn, als Staats- und Bundesbürger, wieder freier atmen. Oh einig-süßes Vaterland, denkt er, wie lieb ich dich, und schiebt mit diesen Worten sich eine dicke, deutsche Erdbeere ungewaschen in den Mund. ■
.
__________________________________________
Geb. 1938 in Duisburg-Huckingen/D, Studium der Germanistik und Anglistik in Bonn, Studienassessor in Oberhausen&Mülheim, anschließend Professur für Deutsche Literatur a. d. Universität Valencia/ESP; zahlreiche belletristische, lyrische, theatralische und essayistische Buch-Publikationen sowie herausgeberische Tätigkeit, Träger verschiedener Literaturpreise, lebt in Sinzig-BadBodendorf/D
.
.
Satire von Helmut Haberkamm
.
Anschaffungen
Helmut Haberkamm
.
Eigentlich wollten wir schon vor drei Jahren uns ein Baby anschaffen. Doch dann hab ich meine Frau aber noch einmal rumgekriegt und wir haben uns einen schönen neuen aus der Dreierreihe von BMW zugelegt. Hat sich rentiert, kann ich Ihnen sagen. Laufkultur, sparsam, wenn man aufs Gas geht, zieht er ab, des glaubens net! Und vor allem halt: umweltfreundlich! Steuerbegünstigt! Das genaue Gegenteil von einem Baby halt, könnte man sagen.
Das erinnert mich an den Ausspruch eines alten Schulfreundes. Der hat immer gesagt: Kinder sind laut, stinken und kosten Geld. Das hat der oft gesagt. Sonst wüßt ichs ja auch nimmer. Naja. jetzt wird ers wohl auch nimmer sagen. Oder erst recht wieder, wer weiß. Obwohl es natürlich schon stimmt irgendwie, oder etwa nicht? Genau.
Also der BMW hat sich rentiert, glaums mer des! Der Motor astrein, wie ein Rasierer! Bremsen wie Watte, der Abzug wie beim Starfighter. Spitze!
Naja, meine Frau gibt keine Ruhe net. Will sich jetzt halt partout so ein Baby anschaffen. Ich mein, ich hab eigentlich nix dagegen. Leisten können wir uns des spielend! Und wie! Es ist ja heutzutage auch steuerlich interessant geworden, muss ich schon sagen. Doch, doch. Na, und meine Frau ist beim Staat, verstenners, da bleibts daheim und kann später getrost wieder zurück auf ihren Posten. So Frauen brauchen halt immer irgendwas, das sie ablenken tut und ihnen Freude macht und so. Naja, und im Grunde geht mir ja auch gar net so viel drunter ab, sagt meine Frau. Und des muss ich schon auch sagen. Irgendeinmal muss es halt doch sein. Was solls? Irgendwann kommt jeder einmal dran. Und jetzert sind halt wir an der Reihe. Ich mein ja auch, wir sind alt genug, meine Frau weiß schon, was wir wollen. Und ich sag Ihnen ganz ehrlich, auch wenn das Fernsehprogramm besser geworden ist, ja, wir ham eine Schüssel droben, prima Sache, rund um die Uhr, jaja, auch an Video, klar, da such ich mir immer aus, was mir gefällt, das Beste ist ja gerade gut genug, sag ich immer. Warum denn auch nicht, Menschenskind?
Urlaub ist ja auch nix mehr! Alle fahrn ja in Urlaub heutzutage, also, wo wolln Sie denn noch hin? Und wenn Sie ständig Deutsche treffen, da vergeht Ihnen der schönste Urlaub, das sag ich Ihnen. Und das Meiste haben die ja eh verschandelt und verdreckt. Das Ursprüngliche könnens doch längst vergessen.
Also jetzt probiern wir halt mal was anderes. So ein Dingsbums, ein Baby. Steuerlich nicht zu verachten, wirklich, hätt ich nicht gedacht, auch muttermäßig und rentenhalber. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Sonst schenkt man ja alles dem Staat, und der den ganzen Ostbrüdern, den rübergelaufenen!
Obwohl, ich hab bald TÜV und da macht mer sich so seine Gedanken, und ich sags Ihnen ganz ehrlich, also, der neue BMW, der große, der Fünfer, der tät mir schon raushängen. Vielleicht nimmt meine Frau den alten fürs Baby zum Einkaufen und fürn Doktor, und ich nehm einen neuen. Ja, so könnten wirs machen. Das tät mir schmecken. So ham wir alle was davon, stimmts? ■
.
_________________________________
Geb. 1961 in Dachsbach/D, Studium der Anglistik, Amerikanistik und Germanistik in Erlangen und Swansea/Wales, Promotion; zahlreiche Mundart-Prosa-Publikationen in Büchern und Zeitschriften, Träger verschiedener Literaturpreise, lebt als Gymnasiallehrer in Spardorf/D
.
.
Satire von Georg Schwikart
.
Dichtersorgen
Georg Schwikart
..
Es ist doch immer das Gleiche. Wenn ich in der Badewanne sitze, kommen mir die besten Gedanken für einen Roman. In der U-Bahn liegen mir die zartesten Gedichte auf der Zunge. Hundemüde im Bett ruhend, schreibt mein Geist spritzige Kurzgeschichten. Ich könnte die Reihe beliebig fortsetzen. So fällt mir beim Spülen ein, dass man zu bestimmten Sachverhalten unbedingt Untersuchungen anstellen müsste, oder in ein interessantes Gespräch vertieft, überfällt mich die lang gesuchte, treffende Formulierung für einen Essay.
Auf den Punkt gebracht lautet also die Grundregel: Immer genau dann, wenn weder Papier noch Schreibgerät zur Hand sind, immer genau dann küsst mich die Muse.
Habe ich aber voller Tatendrang an meinem Schreibtisch Platz genommen, um die Welt mit meinen geistigen Ergüssen zu beglücken, dann ist mir, als beherrschte ich nicht einmal das Schreiben. Mit den nun reichlich vorhandenen Füllern, Bleistiften und Kugelschreibern traktiere ich abwechselnd stapelweise Papier. Ich kritzle und male, schreibe das eine oder andere Wort, streiche es wieder durch – leer, das Papier bleibt leer. Weil der Kopf leer ist. Nichts, gar nichts will mir gelingen.
Nun, ich will mich inspirieren, schaue zum Fenster raus. Es ist schmutzig. Schnell blicke ich wieder aufs Papier. Es ist leer.
Ich gieße die Blumen, die Ärmsten waren schon ganz vertrocknet. Ich begebe mich zurück zum Schreibtisch, dieser Folterstätte. Ich male einen Kreis auf das Blatt. Einen Punkt in die Mitte. Ich zerknülle das Blatt und werfe es weg.
Einen Kaffee trinke ich, esse ein paar Plätzchen. Mir geht es schon viel besser. Meinen Schreibtisch mag ich nicht mehr ansehen. Ich setze mich zwar hin, doch eigentlich ignoriere ich dieses Möbel. Auch den Stift in meiner Hand verachte ich, ebenso die eigenartige Wortkonstellation, die er gerade zu Papier gebracht hat. Ich bin dafür verantwortlich.
Ich lese. Erst eine Zeitung, dann in einem Buch. Durst habe ich, ach nein, Kaffee habe ich gerade erst getrunken. Die Blumen sind auch schon gegossen, schade.
Ich betrachte meinen Schreibtisch und tue so, als ginge ich zum ersten Male zu ihm. Hallo, alter Junge, begrüße ich ihn. Doch er mag mich nicht. Er bleibt stumm, wie mein Stift und das Papier. Ich hasse Papier.
Ich gehe zu Bett, gestresst, müde, depressiv, zerfallen mit Gott und der Welt. Meine geschwächten Glieder genießen das ruhige Liegen auf der Matratze.
Da, als ich gerade froh bin, dass dieser grausame Tag ein Ende gefunden hat – mir fallen die Augen zu, ich weiß nicht mehr, in welcher Lage ich mich befinde -, da kommen sie: Einfälle über Einfälle.
Ich bin über mich selbst begeistert. Phantastisch! Gelungen! Ich schlafe ein.
Aus mir hätte ein großer Schriftsteller werden können. Sei’s drum. ■
.
_______________________________
Geb. 1964 in Düsseldorf, Studium der Religionswissenschaft, Theologie und Volkskunde, Promotion; zahlreiche belletristische und essayistische Veröffentlichungen für Erwachsene und Kinder in Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien, verschiedene Beiträge für Radio und Fernsehen, Leiter von Literarischen Werkstätten, lebt als freier Schriftsteller und Publizist in St. Augustin/BRD
.
.
Kurzprosa von Rainer Wedler
.
mein Kopf ist schwer
Rainer Wedler
.
schwer ist schwer ich muß mich lösen wasserlöslich warum nicht im Meer der Wörter Wörtermeer salzig tränenreich die Sonne scheint das Meer trocken Trockenmeer Meersalz Salz und Pfeffer Pfeffersäcke Sackpfeifen was solls der Vater hat es geliebt das Pfeffer und Salz englische Stoffe hat verarbeitet dann ist er arbeitslos geworden ist sie einfach losgeworden die Arbeit ist alles losgeworden die Eltern die Freunde mein Kopf ist schwer der Stift kratzt dabei ist er weich versteh ich nicht er soll fließend fließend schreibenim Schreibfluß der Hand in Hand handüber gibts das kopfüber ja mein Kopf ist schwer der Magen leer ich bin zu schnell schnell wozu der Tisch kommt meinem Kopf entgegen wie schwer er ist ohne Mut Schwermut Wermut Vermouth Absintsäufer haben einen schweren Kopf ich muß mir ein paar Tabletten reinschieben Max du hast den Schieber raus Schieber raus heißt das nicht schiebn raus er heißt Max du hast das Schieben raus schiebn raus bloß nicht kleinschreiben sonst ist alles zu spät oral geht das in Ordnung da bleibt die Zweideutigkeit aber auf dem Papier ist alles zu spät die Unwiderruflichkeit geschrieben ist geschrieben ein Stück trotzdem flüchtiges Papier Papiersterben Waldsterben ist Papiersterben es ist gerade umgekehrt mein Arm tut weh mein Kopf ist schwer mein Herz ich kann sie finden nimmermehr und nimmermehr was oder wen Faust nachschlagen schlag nach bei Shakespeare denn da ist alles drin drin ist nicht dran sagte die Jungfrau und entzog sich dem drängenden Jüngling im lockigen Haar mein Haar ist licht mein Hirn ist hin Lichtung sich ausweitend alternd Amen Amero Amaretti Espresso tutto negro negroide Lippen damit kann ich leben oder sterben das ist nicht die Frage lebenslängliche lang lang ists her mit den kleinen Engländerinnen Engelland ist abgebrannt Maikäfer flieg Quatsch Pommer(y)land ist abgebrannt Vor- und Hinterpommern (auch Meck Po ?) Vorder- und Hinterpo-Schinken ist vom Schwein schweinisch Engelland ist BSELand noch nicht abgebrannt Anderland Müsliland an die Hand wau an die Hand hat Ihr Hund aber einen schönen Namen so ja an die Hand Idiot Vorsicht Idioten sind gefährlich wo aber Gefahr ist wächst das Rettende auch oder so ähnlich Hölderlin war ja auch verrückt
________________________________
 Rainer Wedler
Rainer Wedler
Geb. 1942, nach dem Abitur als Schiffsjunge in die Türkei, nach Algerien und Westafrika; Studium der Germanistik, Geschichte, Politik, Philosophie, Promotion über Burleys «Liber de vita», zahlreiche Lyrik-, Kurzprosa- und Roman-Veröffentlichungen
.
.
Zum 100. Geburtsjahr von Astrid Lindgren
.
Drei Gedichte für Astrid
Humoreske
Christian Futscher
.

Astrid Lindgren mit der Pippi-Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson
.Astrid Lindgren hat schöne Bücher geschrieben. Unvergessen ist zum Beispiel «Pippi Langstrumpf», das auch verfilmt worden ist. Auch andere Bücher von Astrid Lindgren sind verfilmt worden, ich denke nur an die «Kinder von Bullerbü» und andere. Um auf Pippi Langstrumpf zurückzukommen: Ich glaube, es gibt wenige Mädchen in der gesamten Literatur, die so stark und gewitzt sind wie sie. Unvergessen auch ihr Pferd, ihr Affe und ihr Haus, die Villa Kunterbunt, von ihren Rechenkünsten ganz zu schweigen. Ich mache mir die Welt, wie es mir gefällt… oder heißt es: wie sie mir gefällt? Jedenfalls ist das wohl einer der schönsten Sätze der Weltliteratur, da fährt die Eisenbahn drüber!
Astrid Lindgren ist sehr alt geworden, das hat sie sich auch verdient. Ich glaube, man kann sogar sagen, sie ist unsterblich geworden durch das, was sie geschrieben hat. Hätte sie nicht geschrieben, sondern nur erzählt, ich meine, hätte sie ihre Phantasie und ihre Erfindungsgabe nur mündlich in den Dienst der Unterhaltung ihrer Kinder, Enkelinnen, Enkel oder Nichten und Neffen gestellt, wäre sie nicht unsterblich geworden. Aber was ist das schon, Unsterblichkeit? Wer kann denn wirklich garantieren, dass in sagen wir 500 Jahren noch ein Hahn nach Astrid Lindgren krähen wird? Ich muss jedoch sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass in 500 Jahren noch ein Hahn nach ihr krähen wird! Ja, ich bin sogar zuversichtlich, dass auch in 1000 Jahren noch etliche Hähne nach ihr krähen werden! Dank solcher Ausnahmetalente oder soll ich sagen: überragender Schriftstellerinnen wie ihr ist der Fortbestand der Literatur gesichert. Ich habe keine Angst vor einer Vernichtung der Erzählkunst, weil die Erzählkunst gehört zum Menschen wie der Busen zur Frau und das Glied zum Mann, um es drastisch und deutlich zu formulieren.

Michel aus Lönneberga alias Jan Ohlsson
Astrid Lindgren war eine Schwedin, sie wäre am 14. November 2007 hundert Jahre alt geworden. Ich bin noch nicht einmal 50, aber das tut nichts zur Sache. Wer jemals etwas von Astrid Lindgren gelesen hat, der weiß, dass sie eine große Schriftstellerin war und ist. Ihre Literatur lebt nach wie vor, sie erfreut sich bester Gesundheit.
Schon sehr viel Mist ist über Astrid Lindgren geschrieben worden, ich will ihr heute ein Gedicht widmen – ein sehr einfaches, wie es ihrer persönlichen Bescheidenheit entsprochen hätte, denn sie hat sich zeitlebens nie aufgeplustert wie so viele zweit- und drittklassige Autoren, die glauben, sie seien weiß Gott was und dabei sind sie nichts weiter als ein Fliegenschiss auf einem Kuhfladen oder Rossapfel. Es ist unglaublich, wie viele aufgeblasene Wichtigtuer, die keine Ahnung von nichts haben, sich Schriftsteller schimpfen! Astrid Lindgren war da anders, ganz anders, nicht zu vergleichen mit diesen Hohlköpfen, die glauben, sie seien was besseres als ein Furz im Wind oder ein geschmackloser Witz.
Hier jetzt aber das Gedicht für Astrid Lindgren, ein einfaches Gedicht ihr zu Ehren, und das geht so:
Astrid Lindgren
Astrid Lindgren
Astrid Lindgren
Astrid Lindgren
Der Titel des Gedichtes wäre nachzutragen, er lautet ganz einfach: «Astrid Lindgren».
Und ich will ihr noch ein zweites Gedicht schreiben, wieder ihr zu Ehren, eine kleine Spielerei, denn auch sie war verspielt, das sieht man an ihren verspielten Texten, wo Sprachspiele eine große Rolle spielen:
Astrid Lindkren
Arschtritt Lindcreme
Ast im Lindbrenn
Ast im Lindgrün
Ich schreibe ihren Namen
Wie es mir gefällt
Ich hoffe, die Gedichte hätten ihr gefallen! Die zweite Zeile in dem Gedicht ohne Titel ist übrigens in keiner Weise despektierlich gemeint, sondern übermütig, lebensfroh und pippifrech, um es so zu sagen! Und weil aller guten Dinge drei sind, hier noch ein drittes Gedicht für Astrid Lindgren, diesmal ein etwas anders gestricktes als die vorherigen, auch einfach gehalten, aber mit eindeutig mehr Tiefgang. Es drückt sich darin, mehr als in den vorigen beiden, das lyrische Ich aus, das empfindende, möchte ich hinzufügen, ja, ich möchte sogar in aller Bescheidenheit ergänzen: das tief empfindende! Der normale Prosafluss der normalen Alltagssprache ist verabschiedet worden, es heißt jetzt: Grüß Gott, Sprache des Gedichts, zur Lyrik gehörend, ergieße dich über uns armselige Stammler, Stotterer, Stümper…
Ich will Sie aber nicht länger auf die Folter spannen. Das dritte Gedicht für die von mir hoch geschätzte und verehrte Astrid Lindgren hat den Titel «Wie das Leben so spielt» und geht so:
Astrid Lingren wurde sehr alt
Sie starb mit 96
Ihr Bruder hieß Gunnar
Ihre Schwestern Stina und Ingegerd
Auch alle schon tot
Gunnar wurde 68 Jahre alt
Stina 91 und Ingegerd 81
(Wenn ich mich nicht verrechnet habe)
Ob die Schauspielerin
Die Pippi Langstrumpf gespielt hat
Noch lebt?
Schon möglich
Bzw. keine Ahnung
Astrid Lindgren hatte einen Sohn
Der hieß Lars, genannt Lasse
Der wurde nur 60
Sie hat ihn deutlich überlebt
Ach, ach, ach!
Ich hätte Astrid Lindgren gern kennen gelernt, aber das hat nicht sollen sein. Na ja.
Ich hoffe, mit diesem Essay und den drei Gedichten den einen oder anderen aufgerüttelt zu haben. So wie Astrid Lindgren immer alle aufgerüttelt hat, vor allem die Kinder. Mögen die Bücher von Astrid Lindgren noch in 10’000 Jahren die Herzen und Köpfe der Leserinnen und Leser erfreuen.
Danke für die Aufmerksamkeit.
.
.
Geb. 1960 in Feldkirch/A, Studium der Germanistik und Romanistik in Salzburg, Prosa- und Lyrik-Publikationen in Büchern und Zeitschriften, Träger verschiedener Literatur-Preise und -Stipendiate, lebt in Wien
.
.
.
.
.
.
.
Schach-Satire von Karl Gross
.
Das Drama des unbegabten Schachlehrers
Karl Gross
.
Seit einigen Wochen schlich ich um die Einlösung eines vermaledeiten Versprechens herum: Meine Schwägerin hatte mir im Rahmen einer Großfamilienzusammenführung (Mutters 79. Geburtstag) stolz berichtet, daß ihr Jüngster (7) angefangen habe, Schach zu spielen und auch die Schach AG der hiesigen Grundschule fleißig besuche.  Sie bat mich, doch mal in Kürze gegen den Kleinen eine Partie zu spielen. Er würde sich sehr darauf freuen, und sie habe ihm auch fest versprochen., dass ich dies gerne machen würde…
Sie bat mich, doch mal in Kürze gegen den Kleinen eine Partie zu spielen. Er würde sich sehr darauf freuen, und sie habe ihm auch fest versprochen., dass ich dies gerne machen würde…
Ich hatte vage – verlegen lächelnd – zugestimmt, da ich dies als meine Onkelpflicht erachtete. «Ja, ja, wenn ich mal Zeit habe, gerne, na klar, das freut mich sehr, dass der Kleine tatsächlich Schach lernen will, da kann ich ihm vielleicht ein wenig helfen» usw. Und ich fügte mit kräftiger Betonung hinzu: «Das Wichtigste beim Schach ist, dass man das Verlieren lernt!» – Damit hatte ich – eher unbewusst – einen Kontrapunkt zu der immens verwöhnenden Erziehungspraxis des Neffenhaushalts markiert.
Nach einigen Wochen des Hinhaltens, Ausweichens, Ignorierens, erfolgreichen Verdrängens fuhr ich unbeschwert zu meiner Mutter, die gerade aus dem Urlaub heimgekehrt war. Ich lauschte eben ihren sonnendurchtränkten Erinnerungen, als plötzlich die Haus-Sirene schrillte. Ein Kind stand vor der Tür, das aus der Nachbarwohnung geeilt war, um den Onkel zu begrüßen. Der Kleine trug ein zusammengeklapptes Holzschachbrett in Schulterhöhe triumphierend vor sich.
«Heute spielen wir Schach!» tönte entschlossen das helle Stimmchen, und schon knallte das Brett auf den Kaffeetisch.
«Wir spielen nebenan am großen Tisch», sagte ich kapitulierend und packte die Utensilien unter den Arm. Schon öffnete sich erneut die Tür, und die Mutter des Eleven und auch mein Bruder eskortierten das Schachkind in den Spielsaal. Ich nahm im butterweichen Sessel Platz, so dass mein Gegner mir tatsächlich in Augenhöhe gegenüber saß.
Das gescheit(elt)e kleine Köpfchen mit den braunen Rehaugen hatte die Figuren regelgerecht aufgestellt – ich bekam ungefragt die schwarzen Steine – und eröffnete mit 1. e4. «Das spielen die meisten», schob er nach, bevor ich mein weiteres Vorgehen strukturieren konnte. Nachdem ich artig 1. – e5 entgegnete, folgte spontan 2. a4.
Stolz äugten die Eltern auf weitere Armbewegungen des Schachschülers, die ich in bester Onkel-Manier mit netten Lobesworten begleitete. Er hatte alle Bauern hintereinander gezogen, und ich war gespannt, ob er auch die Offiziere ins Feld führen könne. Tatsächlich, mit leichter Hilfe des Vaters, der das Pferdchen aus dem Stall führte, und weiteren Hilfsaktionen standen irgendwann die Figuren auf dem Schachbrett herum.
Ich bewegte meine Figuren nur bis zur Mittellinie, um keinen Schaden anzurichten. Die beiden Heere standen sich irgendwann gefahrlos gegenüber, und ich wußte plötzlich nicht mehr, wie ich die Harmonie auf dem Brett beibehalten konnte. Mein Bruder schaute mich etwas verwundert an, da ich eine Springer-Gabel mit Damengewinn «übersehen» hatte.
Rehauge hüpfte vor Freude, die Zug-begleitenden Lobesworte der Eltern zeigten ihre Wirkung, und auch ich kratzte mir sorgenvoll die Stirn, staunte und frohlockte ob der «tollen» Züge des Eleven.
‹Das Wichtigste beim Schach ist das Verlieren-Können›, schoss es mir plötzlich durch den Kopf, und schon entlud sich in mir ungeschützt der gesamte Hass auf die verwöhnten Kinder, auf die Eltern, die sich zum Personal ihrer kleinen Herrscher degradieren lassen, auf die gesamte Kindergarten-und Grundschul-Pädagogik, die jahrelang schon für das bloße Ein-und Ausatmen der Kinder Bestnoten verteilte…
Ich spielte auf einmal rücksichtlos auf Gewinn, kommentarlos. Die Eltern fingerten unbeholfen im weißen Lager herum. Der Kleine konnte keinen einzigen Zug mehr ausführen, ohne dass ihm der Arm, dann die Hand geführt wurden. Diese Eltern würden ihr Leben geben, wenn sie dem Kind eine Niederlage ersparen könnten.
Ich kapitulierte innerlich: Mit Inbrunst führten die Eltern die kindliche Zug-Hand, um mir nachaneinder alle verbliebenen Leicht-, dann Schwerfiguren abzuluchsen. Beide Elternteile durften dann gemeinsam das Mattnetz, das wir alle zusammen für mich geknüpft hatten, zuziehen:
«Und, was ist der Onkel jetzt?» krähte der Vater.
«Matt!!» schrie das Kind. ■
.
___________________________
 Karl Gross
Karl Gross
Geb. 1951 am Niederrhein, Magisterstudium in Düsseldorf (Anglistik,Germanistik), einige Jahre als freier Übersetzer und Turnier-Schachspieler unterwegs, seit 14 Jahren selbständiger Buchhändler in Grefrath/BRD
.
.
Kurzprosa von Martin Stauder
.
Mordverdacht
Martin Stauder
.
Es soll ja Leute geben, die lachen sich zu Tode, und dann kommt die Polizei und verhaftet den Ehemann wegen Mordverdacht. Dabei war doch alles ganz anders. Die Sache mit Herrn Bleidewin z.B, der ließ beim Frühstück mit seiner Vroni sein Abenteuer mit der Nachbarin Rosmarie los. Seine Zunge zappelte nervös. So schilderte er freimütig, wie er der Frau durchs Schlafzimmerfenster gestiegen ist, und wie er, als er sich übers Fensterbrett beugte, mit seiner Rechten in einen Kaktus gegrabscht hat. Natürlich hat er seinem Weibe nicht erzählt, wie laut er aufgeschrieen und sein Gleichgewicht verloren hat, aber korrekt angemerkt, wie die Rosmarie sich damals über ihn totgelacht hat. «Deswegen ist es ja nicht zum Verkehr gekommen», sagte Herr Bleidewin zur Vroni, und unerwartet heulte sie drauflos, und der Bleidewin sah verwundert, dass ihr offensichtlich irgendwas im Halse steckengeblieben war. Schließlich schwieg sie. ■
.
_____________________
 Martin Stauder
Martin Stauder
Geb.1958 in Göttingen/D, zunächst Musikalienhändler, seit 1990 in der Krankenpflege tätig, schreibt Kurzprosa und Lyrik, veröffentlicht Buchrezensionen im Internet, lebt in Regensburg
.
.
Kurzprosa von Beatrice Nunold
.
Deep-Darkness 6
Dr. Beatrice Nunold
.
Dunkelheit, nichts als zähe, undurchdringliche Dunkelheit. Oft, vielleicht zu oft habe ich die leeren Weiten des Universums durchschifft. Mir war klar, dass die Dunkelheit nicht zäh war, und undurchdringlich bloß für die Blicke. Doch stets, wenn ich diesen Gott verlassenen Sektor des bekannten Universums durchkreuzte, überkam mich das Gefühl, dass sich die Finsternis wie eine klebrige kosmische Riesenqualle um meinen alten, soliden Frachter stülpte. Nicht die Gute Hoffnung schiffte durch die dunklen Ecken des Universums, sondern die Finsternis verschlang sie. Mit dem Verlust des Blicks in lichtere kosmische Gefilde, verdunkelte sich mein Gemüt. Ich werde mich nie an die interstellare Nacht gewöhnen, aber ich hatte meine Methoden mit der Tiefenraumdepression umzugehen. Andere nahmen Space-Drugs.
Ich fluchte vor mich hin. «Finsternis», dachte ich, «ein biblischer Begriff. Und das Licht fiel in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. — Oder ergriffen? Verdammt, jedes Mal werde ich zur trübsinnigen Philosophin oder zur düsteren Mystikerin. Wie war das doch gleich? Fürchte den Tag des Herrn, denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht, oder so ähnlich. Amos, irgendwas. Zum Teufel! Die Düsternis gebiert düstere Gedanken. Denk an etwas anderes. Wie war das doch gleich in der letzten Raumstation. In der Kantine hat ein recht ansehnlicher Handelsvertreter für Schönheitsprodukte aus Meeresalgen und -mineralien von Thetis tüchtig gebaggert. Ob er seine Pflegepräparate selbst verwendet. Hübsches Kerlchen, ein Vendianer mit Knackarsch. Er hatte eine echte Chance. Dann hat er dir dieses sicher gut gemeinte Kompliment gemacht. Er schwärmte von deinen Sternenaugen. Das brachte dich wieder ins Grübeln. Hättest du doch geschwiegen, ich hatte dich zwar nicht für einen Weisen gehalten, aber doch für Wert befunden, mit mir ein paar nette Stunden in meiner Kabine zu verbringen. Sternenaugen, — haben sie wirklich den kalten, abweisenden Glanz, der verlorenen Sonnen, die nur mit ihrer Kälte drohen, damit niemand ihren Höllengluten zu nahe kommt? Was gäbe ich darum, ein paar dieser verlorenen Sterne in diesem nicht enden wollenden Dunkel zu sehen.»
Ich schloss die Augen. «Dunkelheit auch hinter meinen Lidern. Wie undifferenziert die Weite doch ist, wie homogen. Als wären die Augenlieder weg geschnitten. So gab Kleist bei der Betrachtung des Gemäldes Mönch am Meer seiner Verzweiflung Ausdruck, angesichts der differenzlosen düsteren Weite auf dem Bild Caspar David Friedrichs. Der Mönch war die einzige Senkrechte in dieser Unendlichkeit. Ich, Esther Morgenglanz, die einsame Eremitin in ihrem kleinen Frachter mitten in der Unendlichkeit des Universums. Bin ich nicht auch die einzige Senkrechte, meine einzige Senkrechte, mein einziger Bezugspunkt und einzige Orientierungsmarke, von dem aus ich mein Koordinatennetz auswerfe wie eine Spinne? Im Netz der Spinne verfangen sich kleine Insekten, die ihr als Nahrung dienen. In meinem geistigen Netz verfangen sich Bilder, Töne, Gerüche, Tastsensationen, mir zur geistigen Nahrung. Aus ihr webt sich mir Welt und Sinn. Aber hier und jetzt, ist mir als wären mir die Augenlider weg geschnitten. — Diese zähe undurchdringliche Düsternis. Hier gibt es keine Bilder, keine Welt, keinen Sinn. Was macht es für einen Unterschied, ob die Augenlider fehlen oder die Dunkelheit, dir die Augen mit Finsternis verklebt? Dunkelheit von Augenblick zu Augenblick. Oder gibt es keine Augenblicke mehr, die sich aneinander reihen und ein aktuelles Hier und Jetzt verschenken? Verdammt noch mal! Aktualität ist das unsinnlich winzige, gequantelte, Intervall von 10-43 Sekunden, das unbemerkt die Zeit gebiert, selbst die Dunkelheit zwischen den Blitzen der Leuchtbojen im Tiefenraum, den Bruch zwischen Vergangenheit und Zukunft, die Leere zwischen den Ereignissen. Was, wenn diese Leere sich ewig dehnt? Wenn nie mehr ein Augenblitz auf den andern folgt? Wenn kein diskretes Intervall mehr aus dem Quantennirwana springt und im Nu eines Augenblicks Ewigkeit aufblitzt? Wenn die Leere zum Tag des Herrn expandiert, zu Dunkelheit, zu verfluchter niemals endender Dunkelheit?» — Lost in the dark emptyness! — Oh, Verflucht!
Mit weit aufgerissenen Augen ich in die Finsternis. Ein jäher Lichtblitz verursachte ein ebenso plötzliches Blinzeln. Von einem Augenblick auf den anderen heiterte sich das Universum auf, formte sich zum wohlgeordneten Kosmos, spannte sich Welt aus mit einem dichten Netz von Koordinaten. Wieder blitzte es.
«Ja!!! — Ich bin bald da! Raumstation Deep Darkness 6 ich komme. Mädels haltet Eure Männer fest! Denn diesmal lass ich mir durch kein wohlmeinendes Kompliment die Laune verderben.»
Einem Gedanken wuchsen hinter meiner Stirn Worte zu: «Hoffnung keimt nicht einfach auf. Hoffnung überkommt uns wie Angst und Traurigkeit.»
Und ich war guter Hoffnung, sehr guter. Jetzt hatte ich es gar nicht mehr eilig.
«Die Vorfreude» schoss es mir durch den Kopf, «will ausgekostet sein. Bis zum Andockmanöver bleibt noch etwas Zeit, wie wunderbar.»
Ich klappte einen Spiegel vor der Panoramascheibe herunter, ähnlich denen in den Sonnenblenden auf der Beifahrerseite in den Autos auf der guten alten Erde der Vergangenheit. Unter der Konsole zog ich ein Kosmetiktäschchen hervor. Ausgiebig betrachtete ich mein halblanges schwarzes Haar, das blasse, viel zu scharf geschnittene Gesicht und die hellen blauen Augen.
«Sternenaugen», dachte ich und lachte, zog den Lidstrich nach und das Rot der Lippen.
«Deep Darkness 6, ich bin im Anflug! Nur noch wenige Augenblicke und ich bin bei Euch!» ■
.
__________________
Geb. 1957 in Hannover, Studium der Philosophie, Kunstgeschichte, Volkskunde und Sprache und Kultur Vietnams an der Universität Hamburg, diverse journalistische und wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie Lyrik in Anthologien, lebt als Philosophin und freie Autorin in Goslar/BRD
.
.
Kurzprosa von Christa Degen
.
Isla de Los Lobos
Christa Degen
.
Ein bleigrauer Morgen. Ich suche einen Parkplatz auf dem riesigen Bürogelände, stelle meinen Firmenwagen ab, eile an all den Menschen vorbei, die pflichtbewußt zur Arbeit schreiten, grüße aus der Ferne bekannte Gesichter und verliere für Sekundenbruchteile das Bewußtsein.
Wo bin ich? Ach so, ja. Auf dem Weg zum Flughafen, in den Urlaub. Und das hier ist meine Firma. Nein, Ex-Firma – und das meine Ex-Kollegen, die ich gerade gegrüßt habe. Alles wirkt so unwirklich wie ein Film, den ich nur noch aus den Augenwinkeln wahrnehme, während ich mich schon etwas anderem zuwende. Die Verbindung zu diesen Bürogebäuden, der Firma, den Menschen, mit denen ich fünf Jahre zusammengearbeitet habe, ist nicht mehr. Auf einen Schlag, mit meiner Unterschrift unter die Kündigung, sind alle Fäden durchgeschnitten. Schwerelos und ohne Verankerung eile ich zur U-Bahn.
Am Flughafen Tegel herrscht morgens um halb zehn Hochbetrieb. In der Mitte der langen Schlange vor Schalter 12 wartet Eva schon, begrüßt mich mit ihrem warmen Lächeln. Sie sieht müde aus. Ihr linkes Auge hinter der Brille ist entzündet, ihre Haare erscheinen mir grauer als sonst. Wahrscheinlich sehe ich so ähnlich aus.
Sie lächelt tapfer in mein sorgenvolles Gesicht: «Das wird schon wieder. Einfach mal zwei Tage durchschlafen, dann bin ich wieder fit».
«Nur Sonne und Nichtstun. Das wird uns gut tun», kalauere ich.
Der Rest der Schlange ist schnell abgefertigt. Wir geben unser Gepäck ab, bekommen unsere Bordkarten und laufen durch den langen, kreisförmigen Gang. Rauchend und Kaffee trinkend sitzen wir an einem der Bistro-Tischchen in der Vorhalle. Ich erzähle, daß ich seit einer Woche arbeitslos bin.
«Ja, das kam überraschend. Ich habe die Kündigung akzeptiert, weil ich die Zusage für einen neuen Job hatte. Aber dann wurde sie plötzlich zurückgenommen… Mal sehen, was jetzt kommt. Vielleicht habe ich es so gewollt. Ein Sabbatjahr, eine Auszeit, die Karten neu mischen.»
Eva sieht mich mitleidig an, nicht überzeugt von meinem Optimismus. Das wird mir jetzt noch öfter so gehen. Ich werde mir Worte, glaubhafte Sätze für meine Situation zurechtlegen müssen, damit ich Fragen wie: «Was treibst du so? Was machen Sie beruflich?» schnell und problemlos beantworten kann.
Im Flugzeug überlässt mir Eva großzügig den Fensterplatz. Wir bekommen zu essen, trinken Sekt und stoßen auf unseren Urlaub an, während der Flugkapitän die Route auf Sächsisch erläutert: «Zürich – Lyon – die Pyrenäen – Gibraltar – Cassablanca – Agadir…» Ich lehne mich zurück. Endlich alles hinter mir lassen. Das ganze letzte Jahr, den Terror in der Firma, das «Stahlbad kollektiven Männermobbings», wie es eine «Spiegel»-Redakteurin nennt, die rigiden Verhaltensregeln im Vertrieb. Von Ferne höre ich die Sicherheitserläuterungen der Stewardess: «Sauerstoffmaske über Ihnen, Schwimmweste unter Ihrem Sitz.»
Als ich die Augen wieder öffne, sehe ich durch die Fensterluke die Meerenge von Gibraltar. Tiefblaues Meer, steif wie ein Brett, Schiffchen, die im Zeitlupentempo ihre zarten Spuren ziehen. Dann die riesigen, khakibraunen Gebirgsketten des Hohen Atlas, und wieder Meer, endloses Meer…
Plötzlich redet jemand aufgeregt auf mich ein: «Sauerstoffmaske, Schwimmweste!» Eva zieht heftig an den Schnüren ihrer orangeroten Plastikweste.
«Was ist denn los?»
«Keine Ahnung. Sie sagen, nur eine Vorsichtsmaßnahme.»
Ein Knall betäubt mein Trommelfell, ein ungeheurer Druck schleudert mich gegen etwas Hartes, ich sehe Flammen, und falle in ein schwarzes Loch. Dann ist es kalt, eiskalt. –
Als ich wieder zu mir komme, treibe ich allein in einer blauen Weite. Ich sehe mich um. Das Meer. Ich scheine zu leben. Meine Glieder hängen wie leblos im Wasser. Ich hebe den rechten Arm. Er lässt sich trotz des schweren, naßen Kostümstoffes bewegen. Auch der andere Arm rührt sich. Meine Zähne klappern. Die aufgeblasene Schwimmweste ist fest um meine Brust gezurrt. Ich muss die schweren Kleiderfetzen loswerden, sonst kann ich nicht schwimmen. Der linke, zerissene Ärmel hängt nur noch an ein paar Fäden und lässt sich leicht lösen. Oh, mein Gott! Was mache ich eigentlich? Wohin will ich denn schwimmen? Weit und breit ist nichts zu sehen. Ich treibe wie ein winziger Kork im Ozean.
Werde ich je irgendwo landen, bevor ich vor Kälte, Durst, Hunger…? Ich schließe die Augen. Es hat keinen Zweck. Ich kann auch gleich auf das Ende warten. Meine Tochter fällt mir ein, mein Ex-Mann, den ich immer noch liebe.
Da bewegt sich ein braunes Etwas am Rand meiner Netzhaut. Eine Fata Morgana? Ein großer Fisch? Es wird größer, scheint auf mich zuzusteuern. Ein Boot? Mein Herz hämmert in meinem erstarrten Körper. Ich erkenne Ruder. Rettung? Kann man mich denn sehen?
Ich reiße den anderen Ärmelfetzen ab und versuche das triefende Ding in die Höhe zu halten. Aber mein Arm sinkt kraftlos ins Wasser zurück. Ich will rufen. Aber aus meiner Kehle kommt nur ein Keuchen, meine Stimme gehorcht mir nicht mehr. Ich kann nur abwarten. Noch nie bin ich dem Schicksalsengel so direkt gegenübergestanden. Was hat er oder sie mit mir vor? Ich spüre nur noch einen Wunsch: Dieser unendlichen Verlassenheit, diesem vernichtenden Gefühl von Winzigkeit zu entkommen.
Das Boot wird größer. Jetzt erkenne ich eine Gestalt, die mit kräftigen Schlägen in meine Richtung rudert.
«Hola?»
Eine Männerstimme schallt über das Meer. Wo bin ich? Ist das Spanisch oder Arabisch?
«Hola, hola!» Meine Stimme funktioniert wieder. Ich schreie vor Freude, kann gar nicht mehr aufhören:
«Hola, Ola, Ola…»
Ein Lachen quillt aus meiner vereisten Brust. Habe ich den Verstand verloren? Das Boot ist jetzt fast in Reichweite. Ich paddle darauf zu.
«Venga, venga!»
Ein dunkelhäutiger Mann beugt sich über den Bootsrand und streckt mir die Hand entgegen. Als ich sie ergreifen will, fühle ich mich schwer wie ein Mühlstein.
«Dé me una mano!»
Er deutet mit dem Kinn auf meine andere Hand und zerrt mich aller Kraft über den Bootsrand. Ich plumpse auf den Holzboden und bleibe liegen wie ein Fisch, der aus seinem Element gezogen wurde und in seinen letzten Zuckungen liegt. Der Mann legt eine Art Burnus um mich, kramt eine Flasche hervor und hält sie mir an den Mund.
«Beba!»
Mein Gehirn gibt mir den Befehl zuzugreifen. Aber mein Arm bewegt sich nicht. Hilflos blicke ihn an. In seinen dunklen Augen blitzt es auf. Er schiebt einen Arm unter meinen Nacken, richtet mich auf und hält mir die Flasche an die Lippen. Frisches, klares, salzloses Wasser rinnt in meine Kehle. Als die Flasche leer ist, schenke ich ihm mit meinen rissigen Lippen ein mühsames Lächeln und sinke zurück auf den Boden. Beim Wegdämmern spüre ich, wie er mir die naßkalten Kleiderreste vom Leib schält. Die Berührung seiner Hände verwandelt meine körnige Fischhaut wieder in glattes Fleisch. Ich atme, lebe, habe überlebt. Eingehüllt in seinen Umhang aus Ziegenhaar schlafe ich ein.
Als ich wieder aufwache, sehe ich einen Oberschenkel. Meine Augen folgen seinen muskulösen Linien, den in der Sonne schimmernden Härchen auf der braunen Haut. Der Mann spürt meinen Blick, dreht sich um, sieht meine vergrößerten Pupillen und lächelt. Ich lasse den Umhang von meinen Schultern gleiten. Er legt die Ruder auf die Bootsplanken und streckt mir die Arme entgegen. Boot und Meer schaukeln in einem gleichmäßigem Rhythmus. Wind über unseren Körpern. Wir sind Teil der Elemente, Sonne, Wasser und… Ist Liebe ein Element?
Wieder eingehüllt in den Ziegenumhang sehe ich Guancho (ich habe ihm einen Namen gegeben) zu, der jetzt ein Ziel ansteuert.
«Isla de Los Lobos.»
Er zeigt nach vorn.
.

«Die Insel sieht aus wie eine Mondlandschaft. Schwarzbraune Berge, deren gezackte Hänge nur aus Steinen bestehen. Das Licht auf dem Geröll wirkt überklar wie unter Wasser. Davor goldgelbe Dünen, die in hellgrüne Wellen übergehen.»
.
Die Insel sieht aus wie eine Mondlandschaft. Schwarzbraune Berge, deren gezackte Hänge nur aus Steinen bestehen. Das Licht auf dem Geröll wirkt überklar wie unter Wasser. Davor goldgelbe Dünen, die in hellgrüne Wellen übergehen. Im Innern der Insel Palmen und ein paar weiße Würfel, deren Mauern vor dem tiefblauen Himmel vibrieren, als schwebten sie im milchigen Licht.
Guancho steuert das Boot an den Strand. Wir waten durch kniehohes Wasser in Richtung Oase. Ich ziehe den Umhang fester um mich, als wir das kühle Dunkel eines Hauses betreten, erkenne Holztische, Männer, die herumsitzen. Guancho schiebt mich in den hinteren Teil des Raumes und bedeutet mir, Platz zu nehmen. Er streift flüchtig mit der Hand meine Wange und verschwindet hinter einer Tür. Die Männer starren mich an.
Nach einer Weile kommt eine Frau mit einem Teller und einem Glas Wasser.
«Sopa de Marisco. Coma!»
Gierig löffle ich die dampfende Fischsuppe, schlürfe das Muschelfleisch, nage an den Krabbenbeinen. Meine letzte Mahlzeit war in einem andern Zeitalter.
Als ich das Glas Wasser hinunterkippe, setzt sie sich zu mir:
«El barco a Fuerteventura viene dentro de poco.»
Ich verstehe. Das Schiff nach Fuerteventura. Ich sehe mich um. Der niedrige Raum ist leer geworden. Guancho ist verschwunden und die Männer sind zur Arbeit gegangen. Die Frau nickt mir aufmunternd zu und geht hinter einem bunten Tuch ins Freie. Ich folge ihr. Blind von dem strahlenden Licht lehne ich mich an die Hauswand, schließe die Augen.
Als ich sie wieder öffne, ist kein Mensch mehr zu sehen. Ich laufe in Richtung Strand. Zu meiner Rechten und Linken die Wüste, vor mir das grüne Meer, das am Horizont mit dem Blau des Himmel verschmilzt. Durchsichtige Wellen umspielen meine nackten Füße.
Nein, nein, nein. Ich will nicht mit dem Schiff zurück in die Zivilisation! Das Meer hat mich geschluckt und wieder ausgespuckt, Wind und Liebe mich gewärmt und getrocknet. Meine Fußspuren verlieren sich im Sand.
«Puerto del Rosario!»
Eva lächelt mich an: «Wir sind da.» ■
.
_________________________
Geb. 1951 in Karlsruhe, Studium der Germanistik und des Creative Writing; langjährige Tätigkeit als Lehrerin und im EDV-Vertrieb, Kurzprosa in Zeitungen und Anthologien, arbeitet heute als freie Autorin und Anleiterin literarischer Schreibwerkstätten in Tübingen, Berlin und Italien
.
.
.
.
Satire von Joschi Anzinger
.
Die Königin von Zasta
Eine Elegie
Joschi Anzinger
Es ist in dieser Geschichte von einem wunderschönen Land namens Autrischia die Rede, welches, am Rande des großen Sumpfes Konkursien gelegen, vom allmächtigen Geldfluss Euroinoco durchflossen wird. Dieser Fluss entzieht dem Kontinent Teuropa viele viele kleine Geldquellen und fließt schließlich nach wuchernden Zinsenkraftwerken und Börsenstromschnellen zu den Anlegerklippen. Zuletzt mündet der Eurinoco hinter den Aktienbergen und den Abkeschteichen in den Kapitalistischen Ozean.
In Autrischia leben viele fleißige Bürger und Handwerker, Bauern und Geschäftsleute, und alle kommen sie miteinander ganz gut zurecht. Nun trug es sich zu, dass durch geschickte Täuschung der Einwohner über Nacht das Land jäh von der hartherzigen Königin von Zasta eingenommen wurde. Sie ist gnadenlos berechnend in ihrem Handeln, sie ist äußerst korrupt, käuflich und bestechlich, und es eilt ihr der Ruf voraus, überall wo sie herrsche, rolle der Jubel.
Sie kam in ihrem goldenen Schiff über den Eurinoco nach Autrischia, um bis in die entlegensten Winkel des Landes zu walten. Kein Geschäft floriert nun mehr ohne ihr, kein Mensch tut einen Handgriff ohne Aussicht auf ihre Gunst, und jeder Mensch, der einmal ihre Nähe gespürt hat, will nicht nur für immer in ihrer Umgebung bleiben, sondern er möchte immer mehr von ihrer Zuneigung haben.
Die Königin von Zasta befehligt aber nicht alleine, sondern ihrem Tross folgen jede Menge Ritterfräuleins im Nadelstreif, und ein ganzes Heer von Spesenrittern reiten auf ihren Amtschimmeln einher, und unzählige Gaukler, Quacksalber und Zauberer, welche alle von Ihrer Majestät versorgt sein wollten, bilden ihr Gefolge. Gezüchtet werden die Amtsschimmel im Flippizanergestüt Schöntrum, wo sie auch zu Amtsschimmeln zugeritten und ausgebildet werden.
Jeder Bürger begehrt die Königin von Zasta und wünscht sich, auf Gedeih und Verderben, sie zur Gänze für sich zu beanspruchen. Besonders ergeben sind ihr die Zauberin Krampfadria und die hartherzige Prinzessin Hammaned. Eine Getreue ist auch Lady Von Nuttingham, die Gauklerin Promilla und die manchmal etwas indisponierte Frau von Huscher. Schier Tag und Nacht gepriesen wird die unwiderstehliche Königin von Zasta von der Spesenritterin Fräulein Po-Vor und der nach außen ehrwürdigen, aber zu den Untertanen geizigen Baronin von Trug und Lug.
Eines Tages befiehlt die Königin von Zasta ihrem Gefolge, die zwei großen Speicherseen Schillingsweiher und Groschenlora anzuzapfen und auszupumpen, um damit den Geldfluss Eurinoco zu speisen, damit der Kontinent Teuropa nicht austrockne.
Und siehe da, die Bewohner von Autrischia taten was ihnen befohlen, da sie befürchteten, die Königin von Zasta könnte es sich wieder anders überlegen und ihre unerschöpflichen Quellen erneut versiegen lassen. Sie schenkten ihre Speicherseen Schillingsweiher und Groschenlora der Königin von Zasta und bekamen ihr Wasser fortan aus dem Geldfluss Eurinoco.
Doch sein Wasser schmeckte vielen Menschen nicht wirklich und sie fanden plötzlich mit der ihnen zugewiesenen Ration nicht mehr das Auslangen. Dafür sicherten sich die zahlreichen Spesenritter die schönsten Uferzonen des Eurinoco und verbauten diese mit ihren monströsen Ministerienburgen. Da sind allen voran Spesenritter Von der Ädsch Bädsch mit seinem mächtigen Firlefanzministerium, nebst Spesenritter Von Klamm und Heimlich in seiner Burg, dem Veräußerungsministerium. Bei diesen beiden Spesenrittern laufen alle Fäden zusammen, und sie sind der Königin von Zasta in Treue ergeben. Unweit davon befindet sich die Burg Flausenstein des Spesenritters Van den Andern, zuständig für kulturelle Belange. Das Spesenritterfräulein Van Soll und Haben regiert von der Flaxenburg aus das Ungesundheitsministerium, und die Spesenritterin Van Palawa dirigiert das Einbildungsministerium. Die Spesenritterin Van der Bausch und Bogen herrscht in der Burg Justizewitz über alles was Recht ist, und in der Veteranenburg, von schwarzen Krähen beschützt und verteidigt, streichelt Spesenritter Van der Vorn und Hinten, Tag und Nacht seinen Zapfen.
Alle Bewohner sind von der Schönheit und Grazie der Königin von Zasta angetan, und es gilt als Zeichen von Macht, Stärke und Intelligenz, zu ihren Auserwählten zu gehören. Aber besonders dreist treiben es ihre Spesenritter. Wöchentlich treffen sie sich in der Burg Wahnsiedel im Penedrant zu ihren theatralischen Sitzungen und Zusammenkünften, um nebenbei ihre Taschen im burgeigenen Selbstbedienungsladen nach Herzenslust zu füllen.
In der Burg Wahnsiedel ist das Wort Sparen im Penedrant verpönt, und die Spesenritter reden mit gespaltener Zunge und schufen sich eine Eurokratie, in der es für Privilegierte eine Schande ist, mit den vorhandenen Reserven des Eurinoco sorgsam umzugehen. Jeder Spesenritter lebt auf großem Fuß und Sparen wird nur von den minder privilegierten Untertanen gefordert.
Viele Privilegierte, Angehörige des so genannten Geldadels, wurden auf Grund ihrer Abstammung in den Dunstkreis der Königin von Zasta hineingeboren. Für sie ist es nicht weiter schwierig, an den Rocksaum Ihrer Majestät, an das Goldene Kesch, heran zu kommen, welcher ewige Jugend, Klugheit und Schönheit verleiht, denn es hat sich über die Jahrhunderte der unsinnige Aberglaube zum Mythos gefestigt, dass Kesch zugleich fesch macht. Aber die meisten Untertanen müssen ohne üppige Gönnerschaft Ihrer Majestät ihr Leben meistern. Ihnen bleibt nur das Wissen, dass es die Königin von Zasta irgendwo gibt und dass sie zwar wunderschön sei, und jedem dem sie ihr Wohlwollen schenkt, ist er auch noch so einfältig und hässlich, Macht und Geltung, Ansehen und Ehre verleiht.
Doch sie ist auch gefährlich und berechnend, denn sie macht das Herz der Menschen steinhart, und wer mit ihr einmal ins Bett durfte, der ist zu jeder Tat bereit, selbst wenn es gilt, für Ihre Majestät über Leichen zu gehen. Sie ist mächtig und begehrt, weil sie Türen öffnet, die sonst niemand zu öffnen vermag, und sie macht aus Bettlern Regenten, welche in ihrem Namen herrschen.
Die Königin von Zasta macht aus Narren Führer und aus Herrschern Narren. Sie macht aus Damen Huren und sie macht aus Vätern Mörder, sie macht aus Menschen Tiere und aus Sehenden Blinde. Sie macht die Reichen im Grunde arm und sie macht die Guten schlecht, sie macht die Hässlichen schön und sie lässt die Unwissenden klug erscheinen. Sie macht die Ehrlichen falsch, die Aufrechten beugt sie, die Schwachen kauft sie und die Habgierigen verhungern neben ihrer gefüllten Schüssel.
Lang ist ihr Register und ungebrochen ist ihre Macht. Die Königin von Zasta beherrscht unsere Welt bis ans Ende aller Zeit. ■
___________________
 Joschi Anzinger
Joschi Anzinger
Geb. 1958 in Altlichtenberg/A, zahlreiche Publikationen von Dialekt-Lyrik und Kurzprosa in Anthologien, verschiedene Beiträge in Rundfunk und Fernsehen, Mitglied der Grazer AutorInnen Versammlung und der Österreichischen Dialekt-AutorInnen, lebt in Linz/A
.
.
.
.
Kurzprosa von Göri Klainguti
.
Komm, alte Kiste
Göri Klainguti
.
…ich hab die Entsorgungstaxe für dich bezahlt. – Schade, dass du nicht sprichst… Vielleicht würdest du mir von den berühmten Pianisten erzählen, deren Finger mit Leichtigkeit über deine Tasten flogen, wobei sie aus deinem Resonanzkasten brillante Sonaten von Clementi und Kuhlau klingen ließen… Oder von den Zeiten danach, als die liebliche Tochter des Bankdirektors «Für Elise» spielte und aufwühlende Stücke von Schumann, auch die Préludes von Chopin, versteht sich, und sogar den ultramodernen Debussy und Satie… bis sich die Zeiten änderten, der erste Weltkrieg warf alles untereinander. Wie kamst du eigentlich in die Bar? He? Warum sprichst du nicht, altes Miststück? – Du, ich bewahre dich vor dem Kehrichtpersonal, wenn du mir von deinem Leben erzählst…. Was? Du willst nicht einmal bewahrt werden? Du bist froh endlich abfahren zu dürfen, soll dies dein dumpfes Dröhnen bedeuten? Ach, dein Pedal, die Feder ist ausgehängt, die Töne vermischen sich, schon wenn man dich nur berührt… Aber lass mich den Deckel öffnen: Die Tasten sehen noch verdammt gut aus! Die weißen sind etwas gelblich und dem C da in der Mitte fehlt das Elfenbein, ausgetrockneter Leim auf Holz ist, was man da sieht; und die schwarzen sind vielleicht ein wenig grau – vor allem die paar da oben. Ja, die da oben, was zitterst du plötzlich? Hast du Angst vor dem Titidongdata, vor dem Flohwalzer? Beruhige dich. Wenn ich in deine Tasten drücke, dann mit Sicherheit nicht dieses verfluchte Stück, das ich letzthin sogar im Radio hören musste, auf Orgel sogar! Kannst also getrost sein, nicht nur verlotterte Klaviere, sogar noble Kirchenorgeln müssen ihre Rippen herhalten. Im Radio waren übrigens noch die «Ramseyers wey go grase» als Haupt- oder als Begleitmelodie eingesät, wenigstens dies!
Wo waren wir stecken geblieben? In der Bar warst du angelangt, nicht? Tangos spielte man weich in deine Tasten und Strauß, viel Strauß, hie und da ein Schubertwälzerchen, auch Schlager, «Avev‘una casetta piccolin‘in Canada», und in den Zwischensaisons, bei klirrender Kälte, drückten klamme Klavierschülerfinger unendlich langweilige Übungen in die Tasten und vielleicht eine Invenzione a due voci von Johan Sebastian, holperig und vollbespickt mit Hindernissen. Bitte entschuldige mich, das wird grauenhaft gewesen sein. Ach, du sagst es sei noch schlimmer geworden? Seit 30 Jahren wirklich nur noch Flohwalzer? Die Bar: zu einem Aufenthaltslokal verkommen, und du: immer noch da. Schreckliche Erinnerungen… Du bist mir dankbar, dass ich dich verrotten lasse, alte Kiste! Horch! Bald wirst du erlöst sein. Die Abfuhrleute kommen. – – –
«Guten Tag. Das ist also das Klavier, das wir zum Kehricht abholen sollen? Lass mich mal sehen»: Ti ti dong da ta, ti ti dong da…
«Halt! Sie haben kein Recht zu spielen… Ich habe die Abfuhrtaxe reglementsgemäß bezahlt. Ihre Aufgabe ist es das Klavier fachgerecht zu entsorgen. Wenn Sie spielen wollen, müssen Sie mir die Entsorgungstaxe rückerstatten und das Klavier abkaufen. Es ist sehr teuer, ich möchte Sie gewarnt haben!» ■
.
_________________________________________
 Göri Klainguti
Göri Klainguti
Geb. 1945 in Pontresina/Graubünden, Sekundarlehrer-Studium an der Universität Zürich, zahlreiche Lyrik- und Prosa-Publikationen in Anthologien und Zeitschriften, Träger des Schiller-Preises 2005, lebt als Landwirt (Mutterkühe, Ziegen und Pferde) in Samedan
.
.
.
Humoreske
.
Wienerli in kultureller Schräglage
Franz Trachsel
Jim hatte im Schulaufsatz ein Mittagessen zu beschreiben. Es hatte Wienerli*) gegeben. Weil an sich eine familiäre Angelegenheit, wollte auch Papa wissen, was dazu schließlich im Aufsatz stand.
«Aber Jimmy», hatte er einzuwenden, «wie kann man nur aus Wienerli ‘Wienerlein’ machen?!»
«Wenn schon schriftdeutsch, dann auch das längst fällige Wienerlein, nichts anderes als ein Zugeständnis an die Sprachkultur, Papa» gab sein Sohn fast schnippisch zu bedenken.
«Aber», fand Papa, «eine – sollte dem kulturell wirklich so sein – meines Erachtens am total falschen Objekt in Schräglage geratene Kultur. Dass Du dann nicht etwa gleich noch Wienerchen draus machst! Vor allem aber ist Dein Aufsatz, wo doch Dein Verhalten noch keineswegs vorbildlich ist, nicht etwa der Ort, Vorbehalte an unserer Tisch-, will sagen Esskultur anzubringen..!» –
Den Aufsatz zu beurteilen war letztlich aber auch hier dann die Sache des Lehrers. Dieser traute seinen Augen kaum:
«Weinerchen… Weinerchen… ich buchstabiere: W……..n für Wienerli – was soll das, Jim?»
«Ja, Vater war dann auch der Meinung, daran dass wir es mit Weinerchen statt mit Wienerli zu tun haben, müsse der Metzgermeister, weil er offenbar ein Problem hatte sie richtig anzuschreiben, in kulturelle Schräglage geraten und schuld sein!»
«Hmm, und dann erst..» der Lehrer plötzlich nachdenklich: «…all die Ihretwegen in kulturelle Rückenlage geratenen… Schweinerchen!»
*) Wienerli = Schweizer Schweinswürstchen
________________________________
Franz Trachsel
Geb. 1933, langjähriger Lokal- und Kulturjournalist bei verschiedenen Printmedien, Kurzprosa in Zeitungen und Zeitschriften, lebt in Emmenbrücke/CH





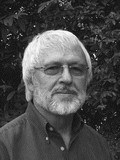

 Beatrix Maria Kramlovsky
Beatrix Maria Kramlovsky Daniel Mylow
Daniel Mylow




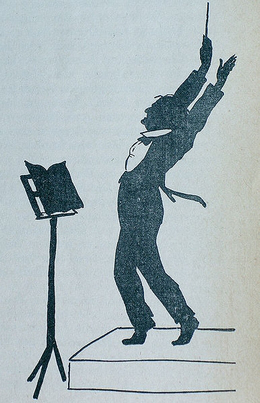


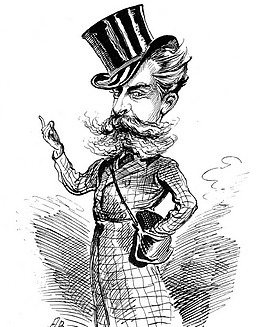


 Horst-Dieter Radke
Horst-Dieter Radke








 Beatrice Nunold
Beatrice Nunold






leave a comment