Thomas O. H. Kaiser: «Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit»
.
Gute Recherche – in schlechte Form gegossen
Bernd Giehl
.
 Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.
Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.
Dass Klaus Manns Leben es wert ist, nacherzählt zu werden, zeigt Autor Dr. Thomas O.H. Kaiser auf fast jeder Seite. Geboren als ältester Sohn des berühmten Schriftstellers Thomas Mann – nur seine Schwester Erika war ein Jahr älter – wächst Klaus Mann in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Der Vater darf nicht gestört werden – er ist schließlich ein wichtiger Mann, der ein «Werk» schafft –; die Mutter ist oft leidend und einmal für mehrere Monate in einem Lungensanatorium in der Schweiz.

Originär, schwul, genial: Klaus Mann (1906-1949)
Und so wachsen Klaus Mann und seine fünf Geschwister in der Obhut von allerlei Dienstmädchen auf. Seine Distanz zum Vater ist entsprechend groß; wo Thomas Mann durch und durch bürgerlich ist, gibt Klaus Mann den Bohemien. Wo der Vater versucht, seine Homosexualität zu verbergen, lebt der Sohn sie offen aus. Er wird Schriftsteller wie sein Vater und tritt so in offene Konkurrenz zu einem, der sich selbst in der Nachfolge Goethes sieht und schon mit 54 Jahren den Nobelpreis bekommt. Er will alles vom Leben und legt sich dabei – anders als der Vater – keine Zügel an. In vielem, auch in seiner Drogensucht ist er maßlos. Grenzen existieren nicht für ihn. Das hat er spätestens in dem halben Jahr an der Odenwaldschule ausgetestet, wo er – vom Unterricht freigestellt – tun und lassen konnte, was er wollte (1922/23). Und dann kommen, als Klaus Mann gerade mal 27 Jahre alt ist, die Nazis an die Macht und die haben für einen bekennenden Schwulen und eher links orientierten Schriftsteller, der in seinen Werken tabuisierte Themen wie Homosexualität und Inzest behandelte, natürlich keine besonderen Sympathien, so dass Klaus Mann, ebenso wie sein Vater Thomas und sein Onkel Heinrich Mann – auch dieser ein berühmter Schriftsteller – im Frühjahr 1933 ins Exil geht.
Es ist ein spannendes Leben, das Kaiser sich zum Thema genommen hat. Wie schon gesagt: Es hätte etwas werden können. Nur hätte Thomas Kaiser in dem Fall seinem Hang zur Ausschweifung Zügel anlegen müssen. Natürlich kann man im Vorwort das Interesse an seinem Forschungsgegenstand begründen, nur sollte man dann nicht bei der Suche nach den verschwiegenen Außenstellen der Konzentrationslager in Südniedersachsen, der Heimat des Autors beginnen. Von dort ist es ein weiter Weg bis zum Schriftsteller Klaus Mann. Womöglich wäre das ja nicht der Erwähnung wert, wenn es nicht symptomatisch wäre für dieses Buch. Der Autor findet kein tragendes Prinzip, um seinen Stoff zu gliedern. 800 Fußnoten auf 380 Seiten Text – das ist zumindest ein Indiz, dass hier etwas nicht in Ordnung sein kann. Und wenn man dann noch sieht, dass die Fußnoten um ein Mehrfaches länger sind als der Text, sollte man sich vielleicht doch einmal überlegen, ob hier das Verhältnis noch stimmt.

Es ist schade um den Stoff, den sich Klaus-Mann-Biograph Thomas O.H. Kaiser vorgenommen hat. Denn Autor Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält.
Diese Fußnoten haben etwas Eigenartiges. Manchmal sind es Nebengedanken, die dem Autor ebenfalls noch wichtig sind (wie das auch sonst bei Fußnoten oft der Fall ist), oft jedoch fächern sie einen Gedanken des Haupttextes noch einmal auf. Man fragt sich dann, warum der Autor ihren Inhalt nicht einfach in den Haupttext übernommen hat. Manches hätte er sich auch einfach sparen können, so z.B. die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Nazis, die er erwähnt, die aber keine besondere Rolle im Leben von Klaus Mann spielen, anderes dagegen ist für das Verständnis der Hauptpersonen wichtig. Und so macht er es dem Leser schwer, der keine allzu große Lust hat, einen halben Satz des Haupttextes zu lesen, dann zur Fußnote zu springen, dann wieder einen Halbsatz zu lesen, ehe er sich mit der nächsten Fußnote auseinandersetzen muss. Auf diese Weise vergrault man auch gutwillige Leser.
Es ist schade um diesen Stoff. Thomas O. H. Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält. ■
Thomas O. H. Kaiser: Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit, 500 Seiten, Books on Demand, ISBN 978-3738611410
.
.
Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Tomas Liska: «Bercheros Odyssee» / Jaromir Honzak: «Uncertainty» (CD’s)
.
Auf Linie gebracht –
2 neue Alben von Bassisten als Bandleader
Michael Magercord
.
 Ein Komponist für Filmmusik, der seine Wurzeln im Jazz verortet, gestand mir einmal, dass er, wenn er partout keinen Einfall für eine Melodie-Linie bekomme, zunächst entsprechend der filmischen Vorgaben eine Bass-Linie einspielt, auf der sich dann alles weitere finden lässt.
Ein Komponist für Filmmusik, der seine Wurzeln im Jazz verortet, gestand mir einmal, dass er, wenn er partout keinen Einfall für eine Melodie-Linie bekomme, zunächst entsprechend der filmischen Vorgaben eine Bass-Linie einspielt, auf der sich dann alles weitere finden lässt.
Musik, die bewegten Bildern unterlegt wird, folgt einer zuvor festgelegten Dramaturgie. Und ein wenig wirken die beiden vorliegenden Alben, in denen die Bassisten jeweils den Ton angeben, auch wie Filmmusik. Obwohl es keine Platten mit Filmmusik sind, sondern eher das, was man einmal «Konzeptalben» nannte: eine dreiviertel Stunde zusammenhängende Klanggebilde – das kann entweder großartig werden oder ganz besonders repetitiv enden.
Mit Tomas Liska und Jaromir Honzak, haben sich zwei versierte Jazz-Bassisten und ihre jeweiligen Formationen in ihren neuen Einspielungen – beide bei Supraphon – auf genau diese Gratwanderung begeben. «Bercheros Odyssee» nennt Tomas Liska, der jüngere von beiden, seine Komposition, die der Absolvent des Berliner Jazz-Instituts zusammen mit seinen Kommilitonen Fabiana Striffler (Geige), Simon Marek (Cello), Markus Ehrlich (Klarinette) und Natalie Hausmann (Tenorsaxophon) unter dem Bandnamen Pente eingespielt hat. Das Album folgt ganz und gar der Konzeptidee. Die sechs einzelnen Passagen heißen auch konsequenterweise «Parts», die ein zusammenhängendes Ganzes bilden sollen.
Liska war zuvor eher in der Weltmusik und im Bluegrass unterwegs. Mit dem Studium begann wohl die Reise durch philosophische und ästhetische Tiefen seines Faches. Seine CD gewordene Odyssey mit einem Titel, der aus den Namen seines Studienortes und dem des Indianerstammes der Cherokee zusammengesetzt wurde, kommt zunächst etwas intellektuell und ernst daher, verliert sich ab und zu im Free Jazz, um dann doch immer wieder kürzere Aufenthalte an bekannten Orten einzulegen: wenn nämlich die Geige oder das Cello folkloristisch ertönen, die Klarinette einen Gospel andeutet oder uns das Saxophon auf dem Balkan Station machen lässt – und trotzdem findet es zu einer lyrischen, unprätentiösen Einheit.
 Etwas traditioneller erscheint aufs erste Hören das Album des versierten Altjazzers Jaromir Honzak zu sein. Auch er hatte einst studiert, nur liegt das schon bald 30 Jahre zurück. Zehn Jahre zuvor hatte er seinen Militärdienst in einer Armeeband in Prag absolviert, und danach begann seine Laufbahn in der Jazzszene der Stadt. Sein Studienort war dann Boston. Nach dem USA-Aufenthalt begann seine internationale Karriere als Bassist, Bandleader – und Komponist.
Etwas traditioneller erscheint aufs erste Hören das Album des versierten Altjazzers Jaromir Honzak zu sein. Auch er hatte einst studiert, nur liegt das schon bald 30 Jahre zurück. Zehn Jahre zuvor hatte er seinen Militärdienst in einer Armeeband in Prag absolviert, und danach begann seine Laufbahn in der Jazzszene der Stadt. Sein Studienort war dann Boston. Nach dem USA-Aufenthalt begann seine internationale Karriere als Bassist, Bandleader – und Komponist.
«Uncertainty» heißt die Zusammenstellung von acht eigenen Titeln, die er mit den wesentlich jüngeren E-Gitarristen David Doruzka, Pianisten Vit Kristan, dem französischen Saxophonisten Antonin-Tri Hoang und schwedischen Schlagzeuger Jon Fält eingespielt hat. Jedes Stück steht für sich, hat eine andere instrumentale Zusammensetzung. Und ist das erste Stück mit dem deklamatorischen Titel «Smell of change» noch flotter E-Gitarren-Jazz, so ist im zweiten der Wandel da und im dritten schließlich vollzogen: hin zu einer meditativen und lyrischen Dichte, die sich weitgehend der Instrumenten-Akrobatik enthält, und die man durchaus als Ausflug in die «Ungewissheit» erleben kann.

In ihren jüngsten Aufnahmen folgen Altjazzer Jaromir Honzak («Uncertainty») und Neujazzer Tomas Liska («Bercheros Odyssey») weiterhin den Vorgaben der Bass-Linien. Dass diese Wahrung einer guten Musik-Tradition dem Treiben der doch so freiheitsliebenden Improvisations-Musiker erst die Form gibt, in der sich dann ihre sprühenden Ideen oder – im Gegenteil – ihre Hingabe in tiefe Gefühlswelten ergießen können, beweisen einmal mehr diese beiden lyrischen, ja meditativen Alben.
Beide Alben haben – bei allen Unterschieden – schließlich doch eines gemeinsam: Es sind ihre klaren bass-lines, die ihre musikalische Fantasien auf Linie halten. Sie erst machen aus der Gratwanderung zwischen Klängen und Atmosphären, aus den Stückchen und den Teilen ein zusammenhängendes Ganzes. Vielleicht ist dies ja auch das höchste an der hohen Kunst des Bass-Spiels. Und sollte den beiden Bassisten darum gegangen sein: mission accompli. ■
Tomas Liska & Pente: Bercheros-Odyssey, Audio-CD, Supraphon
Jaromir Honzak & Band: Uncertainty, Audio-CD, Supraphon
.
.
.
.
Arthur van de Oudeweetering: «Mustererkennung im Mittelspiel» (Schach)
.
Hervorragende Verdeutlichung
strategischer Zusammenhänge
Thomas Binder
.
 Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!
Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!
Erfahrene Trainer werden die These bestätigen, dass Erfolg im Schachspiel zu einem großen Teil an das Erkennen typischer Stellungsmuster und das Umsetzen der passenden Manöver gebunden ist. Sind diese Aspekte bei rein taktischen Stellungen sowie im Endspiel seit langem gut erforscht und auch trainingsmethodisch aufgearbeitet, halten komplexe Stellungen mit vorwiegend strategischem Gehalt noch viel Arbeit bereit. In letzter Zeit sind hierzu einige wichtige Bücher erschienen, so Bronzniks «Techniken des Positionsspiels im Schach» und Nunns «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach». Einen etwas anderen Zugang – über die Bauernstrukturen – wählt Flores Rios in «Chess Structures». Das vorliegende Buch ergänzt und bereichert diese Palette wesentlich.
Oudeweetering hat sein Buch in 4 größere Abschnitte mit insgesamt 40 Kapiteln gegliedert. Jedes einzelne bespricht eine typische Stellungskonstellation ausführlich in allen Aspekten.
Im 1. Teil geht es um «Figuren auf typischen Posten». Da kommen alte Bekannte vor, wie Springer auf f5 oder d6 (im Buch «Der Riesenkrake» genannt), Läufer auf langen Diagonalen oder eingesperrt auf h2, wie seinerzeit bei Spasski gegen Fischer.
Der 2. Teil widmet sich «kontraintuitiven Zügen». Dabei erliegt der Autor nicht der Versuchung, spektakuläre Wendungen vorzuführen, sondern bleibt auch hier seriös – fast wissenschaftlich. So lernen wir, unter welchen Umständen z.B. überraschende Rückzüge, Doppelbauern oder Bauernschläge «zum Rand» ihre Stärke ausspielen können.
Teil 3 ist typischen Opferwendungen gewidmet – aber eben nicht jenen, die man aus Taktikbüchern kennt und an deren Ende ein Matt oder Materialgewinn stehen. Hier geht es um positionelle Opfer mit Langfristwirkung. Aus dieser Materie die Gesetzmäßigkeiten heraus zu arbeiten und verständlich zu analysieren, ist für ihren Rezensenten die größte Stärke des ganzen Buches gewesen. Als Beispiel sei der Bauern-Vorstoß e5-e6 genannt. Mit dem Bauernopfer und dem verbleibenden Doppelbauern teilt Weiß die gegnerischen Kräfte in zwei Hälften, zwischen denen zumindest kurzfristig keine Koordination besteht.
Der 4. Teil schließlich betrachtet kurzzügige Manöver mit strategischem Gehalt, die zum Teil so konzentriert auch noch nicht vorgestellt wurden, etwa die Turmverdoppelung auf dem Umweg über die 2. Reihe.

Der internationale Meister und Schach-Autor Arthur van de Oudeweetering (*1966)
Jedes einzelne Kapitel beginnt mit einem ganz kurzen Einführungstext und endet mit einer ebenso knappen Zusammenfassung. In diesem Rahmen folgen dann pro Kapitel 6 bis 7 sorgfältig ausgewählte Partien. Der niederländische IM konzentriert sich dezidiert auf das jeweils besprochene Thema. Die Eröffnung wird entweder ganz ausgelassen oder unkommentiert wiedergegeben – was auf das gleiche hinausläuft, denn ein Diagramm ermöglicht in jedem Fall den Einstieg an der passenden Stelle. So konsequent ist der Autor auch am anderen Ende der Partie: Mündet das betreffende Motiv nicht direkt in den Partieschluss, wird der weitere Verlauf nur noch in Worten angedeutet.
Der relevante Ausschnitt hingegen wird in kurzen, gut gefassten Anmerkungen treffend erläutert. Abweichende Varianten sind auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt. Die Kommentare fokussieren sehr gut auf das konkret besprochene Thema. Sie sind zudem angenehm lesbar – vermutlich gleichermaßen das Verdienst des Autors und des Übersetzers Harald Keilhack.
Schachliche Schwächen sind aus Sicht des Rezensenten nicht auszumachen. Die inhaltliche und didaktische Aufbereitung setzen Maßstäbe. Ich sehe nur wenige Verbesserungsansätze: Die Kapitelüberschriften könnten manchmal etwas weniger blumig formuliert sein. Sie machen zwar neugierig, helfen aber nicht bei der Orientierung. Außerdem wäre ein zusätzlicher Mehrwert zu erreichen, wenn man die schon im Titel angesprochenen Muster auch optisch auf den Diagrammen hervorhebt. Dieses Element – heute in der computergestützten Schachpräsentation eine Selbstverständlichkeit – ist in der gedruckten Schachliteratur noch nicht so recht angekommen. Generell kämpft ja gerade bei solch komplexen Themen das Schachbuch einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen moderne Trainingsmittel und interaktive Medien. Bücher wie dieses zeigen, wie schade es wäre, wenn dieser Kampf auf Dauer verloren ginge.

Arthur van de Oudeweetering legt mit «Mustererkennung im Mittelspiel» ein vorzügliches Buch zu einem komplizierten Thema vor. Es gelingt ihm, dem Leser das Erkennen und Bewerten typischer Mittelspielstellungen nahe zu bringen. Neben fortgeschrittenen Schachspielern dürften vor allem Schachtrainer sehr von dieser Arbeit profitieren.
Fragen wir uns schließlich nach der Zielgruppe, die van de Oudeweetering mit seinem Buch erreicht. Mir fallen zuerst Schachtrainer ein. Sie finden hervorragende Ideen zur Verdeutlichung strategischer Zusammenhänge und zum Schulen des Blickes für typische Stellungsmuster – und das mit überlegt zusammengestellten Beispielpartien.
Wer als Spieler von diesem Werk profitieren möchte, wird sich auf eine anstrengende Arbeit einlassen müssen. Es geht eben nicht ohne konzentriertes Durcharbeiten der einzelnen Beispiele. Immerhin erleichtert die Aufteilung in übersichtliche Kapitel auch dieses Unterfangen. Freilich setzt das selbständige Arbeiten mit dem Buch ein schachliches Grundniveau voraus, das ich nicht unter einer Elo-Spielstärke von 1800 ansetzen würde – aufstrebende Jugendspieler einmal ausgenommen, denen «Mustererkennung im Mittelspiel» hiermit ausdrücklich empfohlen sei. ■
Arthur van de Oudeweetering: Mustererkennung im Mittelspiel – Schärfen Sie Ihren Blick für Schlüsselzüge im Schach, 300 Seiten, New in Chess, ISBN 978-90-5691-615-2
.
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Frank Schuster: «Das Haus hinter dem Spiegel» (Roman)
.
Ein Schach-Roman für Carroll-Liebhaber
Sabine & Mario Ziegler
.
 Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)
Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)
Der Klappentext verspricht einen «fantastischen Roman für Jung und Alt», und die ersten Kapitel lassen an ein Jugendbuch denken: Kurze, überschaubare Kapitel, die Handlung entführt den Leser in die Welt der beiden zehnjährigen Schwestern Lorina und Eliza. Zum Leitmotiv der Geschichte wird eine Schachfigur aus dem Spiel des Vaters. Diese Figur, eine schwarze Dame, wird von einer Elster entwendet. Was zunächst lediglich wie ein kleines Missgeschick anmutet, wegen dem der Vater seine angefangene Fernschachpartie mit einem Freund nicht wird fortsetzen können, entpuppt sich bald als viel größeres Problem: Es existiert eine parallele Welt «hinter dem Spiegel», in der Elizas «Zwilling» Alice mit ihrer Familie lebt. Aus einem nicht näher bezeichneten Grund vertauschen Alice und Eliza ihre Plätze in der jeweils anderen Welt. Als Medium dieser Verwandlung dient ein großer Spiegel, den die Familie vor Jahren in England erstanden hatte, und der aus dem Viktorianischen Zeitalter stammt – just aus der Zeit, in der Carroll den Roman von «Alice hinter den Spiegeln» verfasste. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfährt der Leser nach und nach immer mehr Details der unglaublichen Verwandlung von Eliza zu Alice. Für die Rückverwandlung am Ende ist – ähnlich wie bei Carroll – das Schachspiel von großer Bedeutung, das aber erst wieder in seinen Originalzustand zurückversetzt werden muss. Hier kommen der im gleichen Haus wie die Kinder wohnende Erfinder Herr Ritter, der Lehrer Herr Hundsen und der Psychologe Herr König ins Spiel. Nach vielen Schwierigkeiten gelingt es, eine Ersatzfigur für die schwarze Dame herzustellen, schließlich taucht auch das Original wieder auf, und zum guten Schluss kann die Rückverwandlung durchgeführt werden.

Lewis Carroll (Fotografie von 1863)
Zu diesem Zeitpunkt hat der Roman jedoch schon lange den Charakter eines Kinderbuchs verloren. Nicht nur werden die Kapitel zunehmend länger, auch die Wortwahl verändert sich. Wird zu Beginn auf Augenhöhe der Kinder berichtet, was etwa im Belauschen der Eltern (Kapitel 4) zum Ausdruck kommt, treten im Laufe der Erzählung zunehmend Wortspiele auf, die an die literarische Gattung des Nonsens erinnern, für den Carroll berühmt war. Das zentrale Kapitel ist das achte, in dem Eliza zur Verblüffung ihrer Mitschüler in Spiegelschrift folgendes Gedicht schreibt:
Verdaustig war’s, und glasse Wieben
rotterten gorkicht im Gemank.
Gar elump war der Pluckerwank,
und die gabben Schweisel frieben.
Es handelt sich hierbei um die erste Strophe des Gedichts «Der Zipferlake» («Jabberwocky») aus der Feder von Lewis Carroll, wie dem Vertretungslehrer Hundsen sofort klar ist. Frank Schuberts «Das Haus hinter den Spiegeln» ist voll von solchen Anspielungen: Der Goggelmoggel (im Original Humpty Dumpty) wird ebenso bemüht wie der Hutmacher aus Alice im Wunderland (in Gestalt der Deutschlehrerin «Frau Hutmacher» oder der weiße Ritter (in Gestalt des rettend eingreifenden Erfinders Herr Ritter). Neben solchen textimmanenten Andeutungen wird auf die historische Figur Carroll selbst verwiesen: Nicht zufällig ist «Karl-Ludwig Hundsen» die exakte Übersetzung seines bürgerlichen Namens Charles Lutwidge Dodgson (dieser Bezug wird auf S. 70 ausdrücklich hergestellt). Die Hinweise erschließen sich natürlich nur demjenigen, der Carrolls Biographie und seine Werke kennt. Für alle anderen bleibt vieles unverständlich und sogar verwirrend, etwa wenn in Kapitel 15 seitenlang Nonsenspoesie zitiert wird, die die Geschichte nicht voranbringt. Skurril wirkt, wenn Eliza als Gutenachtgeschichte eine weitere Nonsensballade aus der Feder von Carroll, «Die Jagd auf den Snark», vorgelesen wird.
Bisweilen verschwimmen die Ebenen: Eliza, das Ebenbild der Carroll’schen Alice, liest selbst Carrolls Roman (S. 79) – im Grunde also ihre eigene Geschichte.
Wie in der literarischen Vorlage so begegnen auch in Schusters Roman zahlreiche Schachbezüge, besonders in den letzten Kapiteln. Hierbei greift der Autor eine Stellung auf, die Carroll selbst zur Grundlage der Handlung in «Alice hinter den Spiegeln» machte. Folgendes Diagramm findet sich in der Ausgabe von «Through the Looking-Glass» aus dem Jahre 1871:

Dem Leser des Romans leuchten die Bezüge zu den Abenteuern der Alice sofort ein, wozu auch die Farbe «Rot» (statt «Schwarz») für den Nachziehenden passt; hier wird das Motiv der «roten Königin» wiederaufgegriffen, das sich bereits in «Alice im Wunderland» findet. Verwirrend ist allerdings – gerade für schachspielende Leser – dass diese Position aus der Fernpartie des Vaters stammen soll. Dies wird bereits auf S. 7 verdeutlicht, wo ausdrücklich zwei Elemente der Stellung genannt sind: «So konnte Papa einfach eine E-Mail an den Freund schicken, in der er zum Beispiel schrieb: ‚Weißer Bauer auf d2.‘ Und sein Freund mailte dann zurück: ‚Schwarze Königin von e2 auf h5.‘» Carroll selbst allerdings folgt bei den oben angegebenen Zügen bis zum Matt zwar den Schachregeln, nicht aber der Regel, beide Spieler abwesend ziehen zu lassen. Vielmehr stehen die Figuren auf dem Brett für die handelnden Personen in Carrolls Roman.
So würde der vollständige Ablauf bis zum Matt nach Carroll in heutiger Notation lauten:
1…Dh5 2.d4 und Dc4 3.Dc5 4.d5 und Df8 5.d6 und Dc8 6.d7 Se7+ 7.Sxe7 und Sf5 8.d8/D De8+ 10.Da6 (dieser Zug ist – schachlich betrachtet – illegal, da der weiße König im Schach der schwarzen Dame steht) 11.Dxe8#
Bei Schuster wird die Zugfolge nicht komplett wiedergegeben, aber durch die vorhandenen Anspielungen wird dem Carroll-kundigen Leser klar, dass für die Rückverwandlung von Alice in Eliza eben jene «Schachpartie» zu Ende gespielt werden muss.

Frank Schusters Schach-Roman «Das Haus hinter dem Spiegel» ist nicht ein eigentliches Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Für Lewis Carroll-Fans öffnet der Schusters Roman aber eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs.
Für wen ist also «Das Haus hinter dem Spiegel» geschrieben? Offensichtlich handelt es sich nicht um ein Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Es bleiben die Fans und Liebhaber der literarischen Vorlagen von Lewis Carroll. Für solche Liebhaber öffnet «Das Haus hinter den Spiegeln» eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs. ■
Frank Schuster: Das Haus hinter dem Spiegel, Roman, MainBook Verlag, 180 Seiten, ISBN 978-3944124728
.
.
.
__________________________________
Sabine Ziegler-Staub
Geb. 1982 im Saarland, Lehramtsstudium, Mitarbeit an einem Forschungsprojekt im Bereich Fachdidaktik der Mathematik, seit mehreren Jahren im Schuldienst und aktive Schachspielerin sowie Trainerin einer Schach-AG
Mario Ziegler
Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach
.
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Kent Nagano (Inge Kloepfer): «Erwarten Sie Wunder»
.
Die Rettung der Klassik
Christian Busch
.
.
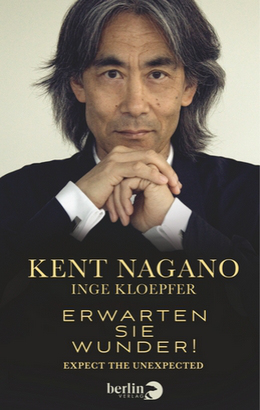 «Expect the Unextpected»
«Expect the Unextpected»
Die Klänge der Eröffnungskonzerte der neuen Pariser Philharmonie via ARTE noch im Ohr, weiß man in der Welt der Klassischen Musik schon lange, welche Töne angeschlagen werden müssen. Längst ist die Zeit der eitlen und sich um sich selbst und die Gründung immer neuer Plattenfirmen und Vermarktungsstrategien drehenden Stardirigenten vorbei. Boomte die Klassik in den 80er und 90er Jahren noch dank der neuen digitalen CD-Scheiben mit ihrem viel transparenteren und hörfreundlichen Klangbild, gehen die Nachfahren von Beethoven & Co. an vielen Orten längst am Stock. In den Zeiten knapper Kassen und allgegenwärtigem Multimedia-Rausch müssen die Liebhaber komplexer filigraner Orchesterkultur mitunter gesucht werden wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen. Das Durchschnittsalter in den Konzertsälen steigt bedrohlich und degeneriert zur exklusiven Matinée für Betagte und Betuchte. Da wird ein fast 400 Millionen schweres Projekt wie das der Pariser Philharmonie, welches das städtische Orchester von seiner angestammten – nahe dem Arc de Triomphe gelegenen – Salle Pleyel vertreibt, auch schon mal in die suburbane Zone des Parc de la Villette verlagert, in die schon fast prekär zu nennende soziale Randzone, wo jüngst die Attentäter von «Charlie Hebdo» ihr Fluchtauto wechselten. Und statt der VIP-Zone legt man jetzt Wert auf ein Lernzentrum «Abteilung Education», in der kulturelle Brücken zu Schulen und bildungsfernen Schichten geschlagen werden sollen. Ist die Lage wirklich so ernst?

Stardirigent Nagano bei der Arbeit
Wirtschafts- und Sinnkrise
In dem jüngst erschienenen Buch «Expect the unexpected!» («Erwarten Sie Wunder») behandelt der amerikanische Dirigent Kent Nagano, unterstützt von der Koautorin Inge Kloepfer, mit soziologischen Sachverstand genau dieses Problem der schwindenden Stellung der klassischen Musik im Kulturleben. Aus unmittelbarer Nähe berichtet er am Beispiel von Detroit vom Niedergang der nordamerikanischen Orchesterlandschaft und den fatalen Folgen für die kulturelle Entwicklung in den Städten. Er empört sich gegen die schonungslose Ausbreitung von Materialismus, Konsumismus und reinem Utilitarismus in der westlichen Zivilisation, welche in der PISA-Studie ihren deutlichsten bildungspolitischen Niederschlag findet: Was zählt, sind Fähigkeiten, die den Menschen auf ihren funktionalen Nutzen reduzieren. Fächer wie Kunst und Musik, welche Kreativität, Vorstellungsvermögen und Inspiration fördern, kommen dort nicht vor. Dabei steht schon im Matthäus-Evangelium: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Plädoyer für die Rückbesinnung auf die Klassik
Er zeigt an vielen Beispielen seiner langjährigen, intensiven und fruchtbaren Auseinander-setzung mit den unsterblichen Werken auf, dass die schönen Künste vor dem Hintergrund eines generellen Wertewandels in den westlichen Industrieländern eine Antwort auf die Sinnkrise darstellen: «Sie […] machen den Alltag mehr als nur erträglich. Sie inspirieren uns, öffnen den Geist. Sie helfen uns, Unbegreifliches und Unerträgliches anzunehmen und als Teil unseres Lebens zu akzeptieren, daraus Kraft zu schöpfen und nicht daran zu verzweifeln.» Dabei erweist er sich als energischer und nimmermüder Verfechter der Quellen menschlicher Inspiration., der längst begriffen hat, dass heute die wichtigste Aufgabe der Dirigenten und Intendanten nicht in der Selbstverwirklichung egoistischer Eitelkeiten besteht, sondern in der Vermittlung zwischen Kunstwerk und Publikum: «Nennen Sie mich jetzt einen Träumer, einen Utopisten, wenn ich mir wünsche, dass ein jeder in seinem Leben unabhängig von Bildungsstand und Herkunft die sinnstiftende Kraft der Kunst erfahren können soll.»

Zweifellos ist Kent Naganos Klassik-Plädoyer «Erwarten Sie Wunder» das richtige Buch zur rechten Zeit – in seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung weitreichend, in seinen Zielsetzungen ehrgeizig. Den Autoren gebühren Dank und Beachtung!
Kindheit ohne neue Medien – dafür mit Klavier und Klarinette
So beginnt Nagano seine Ausführungen in seiner Kindheit an und erzählt von den Anfängen in Morro Bay, einem in den 50er Jahren multikulturell besiedelten Fischerdorf an der kalifornischen Pazifikküste, und von seinem ersten musikalischen Erzieher, dem Professor Korisheli. Im Vordergrund stehen dabei von Beginn an nie persönliche Erfolge, öffentliche Anerkennungen oder gar Preisverleihungen, sondern stets die ungetrübte Freude am gemeinschaftlichen Musizieren, am Gemeinsinn stiftenden Konzert- oder Probenerlebnis, bei dem Konflikte und Unterschiede an Bedeutung verloren: «Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt». Welche Zeit hätte dessen nicht bedurft, so könnte man fragen – liefert Nagano hier doch einen entschiedenen Gegenentwurf zu den stets von manipulativer Sprache der Medien und leicht konsumierbarer Unterhaltungselektronik geprägten aktuellen Kultur-Landschaft. Hier und da blitzen die Erfahrungen aus seinen vielen Stationen (Lyon, Manchester, Los Angeles, Berlin, München, Montreal, Hamburg) auf, offenbart er den Lesern in eingestreuten Intermezzi seinen eigenen Zugang zu den großen Komponisten, von Bach, Beethoven und Bruckner bis zu Schönberg, Messiaen, Ives und Bernstein. Wenn er über das Rätselhafte in Beethovens achter Symphonie spricht, enthüllt sich nebenbei: Der Weg ist das Ziel, das auch ungewöhnliche Wege rechtfertigt, indem Nagano mit seinem OSM (Orchestre symphonique de Montreal) volksnah in der Eishockey-Arena Richard Strauss’ «Heldenleben» präsentiert. Abgerundet wird sein Aufruf durch die Gespräche mit Zeitgenossen wie Helmut Schmidt (Politik), Kardinal R. Marx (Kirche), Yann Matei (Literatur), Julie Payette (Wissenschaft) und William Friedkin (Film). Was letzterer über Beethovens Symphonien sagt, gilt für die ganze Klassik: «Wer einmal […] die Tiefe der Musik erahnen konnte, wird sich ein Leben lang nach dieser Erfahrung sehnen. Es wird ihn immer wieder dorthin zurückziehen.»
Zweifellos ist Kent Naganos Klassik-Plädoyer «Erwarten Sie Wunder» das richtige Buch zur rechten Zeit – in seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung weitreichend, in seinen Zielsetzungen ehrgeizig. Den Autoren gebühren Dank und Beachtung! ■
Kent Nagano (Inge Kloepfer): Erwarten Sie Wunder – Expect the Unexpected, Berlin Verlag, 320 Seiten, ISBN 978-3827012333
.
.
.
.
«Kingdom of Heaven» – Lieder von Heinrich Laufenberg u.a.
.
«Stand vf, stand vf, du sele min»
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.
Der große Mediävist Ferdinand Seibt hat zu Beginn seines bedeutenden Buches «Glanz und Elend des Mittelalters» aus dem Jahre 1999 die denkwürdige Aussage getätigt, dass er nicht hätte im Mittelalter leben wollen, wüsste man doch heute sehr genau, dass Krankheiten, Seuchen, Armut, Krieg, religiöser Wahn, Unterdrückung und menschliches Leiden die großen Konstanten jenes Zeitraumes waren, den man heute – je nach Schule – zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert nach Christus verortet.
Und doch ist die Romantisierung des Mittelalters, die einst im 19. Jahrhundert begann, auch heute noch in vollem Schwange. Die Bilder vom edlen Recken, der schönen Jungfrau, der trutzigen Feste, vom bunten Turnier, dem weltvergessenen Kloster, dem rauen und dennoch guten Leben sind tief ins kollektive Bewusstsein der Populärkultur eingebrannt und werden in Belletristik, Musik, Film und Parallelgesellschaften wie der «Society of Creative Anachronism» immer wieder wohlfeil bedient.
Nicht, dass die vorliegende CD romantisierender Mittelalter-Kitsch wäre. Die Produktion – die sicher nur zufällig den Titel mit einer Kreuzfahrerschmonzette von Ridley Scott aus dem Jahre 2005 teilt – ist durch und durch hochklassig und akademisch im besten Sinne, besteht das Ensemble Dragma mit Agnieska Budzińska-Bennett (Gesang, Harfe, Drehleier), Jane Achtmann (Vielle, Glocken) und Marc Lewon (Gesang, Plektrumlaute, Vielle) doch aus drei arrivierten Spezialisten für mittelalterliche Musik. Sie konzentriert sich thematisch auf das Werk von Heinrich Laufenberg, jenes alemannischen Mönches, der wohl um das Jahr 1390 in Freiburg im Breisgau geboren wurde und am 31. März 1460 in Johanniterkloster zu Straßburg verstorben ist. Hinzu treten Werke zeitgenössischer Liederdichter.

Heinrich von Laufenberg (aus der Handschrift des Buchs der Figuren, die 1870 in Straßburg verbrannt ist)
Dass wir heute überhaupt Lieder von Heinrich Laufenberg hören können, grenzt an ein Wunder, sind die mittelalterlichen Codices, die seine Lieder ursprünglich enthielten (es waren wohl um die 120 Stück), doch beim Angriff auf Straßburg im Deutsch-Französischen Krieg 1870 zerstört worden. Kurz vorher jedoch hatte der Kirchenliedforscher Philipp Wackernagel in einer umfangreichen Edition Laufenbergs Texte herausgegeben. Auch sind über viele unterschiedliche Wege Melodien zu 17 Texten auf uns gekommen, sodass es heute möglich ist, Laufenberg in Text und Musik zu erleben. Allerdings wissen wir – und darauf weist Marc Lewon in seinem höchst informativen Booklet-Text ganz deutlich hin – nicht, wie die Noten dem Text tatsächlich zuzuordnen sind, und zwar weil nur Noten ohne jegliche Strukturierung oder Textbezug überliefert worden sind. Zudem ist nicht klar, ob die Noten komplett überliefert wurden oder ob manch eine nicht von einem Forscher des 19. Jahrhunderts – eine damals durchweg gängige Praxis – «nachempfunden» wurde. Die vorliegende nun Rekonstruktion kann sich durchweg hören lassen. So tönt Agnieska Budzińska-Bennett in den der Christusminne zugehörigen Liedern wie «Es taget minnencliche“ oder im berühmten «Benedicite» des Mönchs von Salzburg förmlich wie vom Himmel her, so glatt, gleißend hell und dennoch mit einer gewissen Grundwärme timbriert klingt ihr Stimme. Ausgesprochen anregend und abwechslungsreich gestaltet auch Mark Lewon seine Lieder, beispielsweise «Ein lerer rúft vil lut », einem Diskurs über das rechte Leben und den rechten Glauben.

Ausschnitt der Wolfenbütteler Lautentabulatur
Aber auch die Instrumentalstücke, die sich auf dieser CD finden, werden von den drei Musikern des Ensemble Dragma (die in drei Tracks von Hanna Marti und Elizabeth Ramsey unterstützt werden) auf technisch und gestalterisch höchstem Niveau musiziert. Auf ein besonderes Schmankerl, die diese CD dem Alte-Musik-Aficionado bietet, muss hier gesondert hingewiesen werden. Denn neben den Liedern und Instrumentalstücken Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen bringt diese Produktion erstmals komplett jene Stücke, die der sogenannten «Wolfenbütteler Lautentabulatur» entstammen, einer fragmentarischen Quelle aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die erst vor ein paar Jahren entdeckt wurde und die älteste bisher bekannte Lautentabulatur überhaupt darstellt. Marc Lewon präsentiert seine auf seiner intensiven Beschäftigung mit der Tabulatur basierende Rekonstruktion. Und auch dies ist ein echter Ohrenschmaus.

Das Ensemble Drama präsentiert mit seiner Produktion «Kingdom of Heaven» Lieder Heinrich Laufenbergs und seiner Zeitgenossen sowie das komplette Material der Wolfenbütteler Lautentabulatur. Die atmosphärisch ausgesprochen dichte, hervorragend musizierte und philologisch exquisit gearbeitete Produktion kann rundum und ohne Abstriche empfohlen werden.
Und so ist das, was dem Hörer hier 78 Minuten lang entgegentönt, so derartig perfekt musiziert, dass man am Ende den Eindruck hat, hier eben doch idealen Klängen aus einem idealisierten Mittelalter zu lauschen. Ob die Stimmen und Instrumente eines Mönches im kalten und zugigen Kloster oder die des über schlammige und schlechte Wege von Weiler zu Weiler ziehenden Spielmannes so geschniegelt geklungen haben mögen? Der Realität näher mögen wohl René Clemencics Aufnahmen mittelalterlicher Musik sein, doch die vorliegende CD ermöglicht es dem Hörer, einen Blick ins «Kingdom of Heaven» zu erhaschen.■
Kingdom of Heaven – Musik von Heinrich Laufenberg und seinen Zeitgenossen, Ensemble Dragma, Label Ramee (RAM 1402), Audio-CD
.
.
.
.
Szilárd Rubin: «Der Eisengel» (Roman)
.
Die Vampirin von Törökszentmiklós
Günter Nawe
.
 Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.
Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.
Wovon ist die Rede? Vom Roman «Eisengel». In Törökszentmiklós, einem ungarischen Provinznest, sorgt ein fünffacher Mord an jungen Mädchen für großes Aufsehen. Eine mehr als merkwürdige Geschichte – geschehen in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in Zeiten des ungarischen Poststalinismus.
Lange, so weiß es das ausführliche Nachwort zu diesem Roman, hat sich Szilárd Rubin mit diesem authentischen Fall befasst, der weit über das kriminelle Geschehen hinaus auch eine politische Dimension hat. Aufmerksam geworden ist Rubin auf den «Fall» durch die Fotografie einer jungen Frau, die einige Jahre zuvor hingerichtet worden ist. Piroska Janscó ist / war eine anmutige, schöne junge Frau und war doch die «Vampirin von Törökszentmiklós». Ihr wird dieses grausige Verbrechen zugeschrieben.
Unser Autor, als Schriftsteller und Journalist auftretend, will jedoch mehr wissen, als die Aktenlage ausweist, will die Hintergründe einer Mordserie, die zwischen Oktober 1953 und August 1954 geschah, kennenlernen. Bizarre Morde, ein unvorstellbares Verbrechen, das seinerzeit hohe Wellen geschlagen hat – In Törökszentmiklós und darüber hinaus. Verdächtigt der Morde wurden erst einmal sowjetischen Soldaten, die in Ortsnähe in Garnison lagen. Auch tauchten plötzlich die uralten Verdächtigungen auf von Ritualmorden, begangen von – natürlich – den Juden auf. Oder waren es Fremde? Es kam sogar zu Massendemonstrationen gegen die vermeintlichen Täter. Wir kennen ganz aktuell die Mechanismen von Verdrängung, Verdächtigungen und Verleumdungen. Bis endlich klar wurde: Gemordet «aus niederträchtigen Gründen», hat Piroska. Und so wurde sie für fünffachen Mord und einmaligem Mordversuch zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Rubin Szilárd (1927-2010)
So beginnt der Schriftsteller zu recherchieren. Er sucht die Tatorte auf, spricht mit den Familien, mit der Mutter der Mörderin, den Eltern der ermordeten Kinder und mit der Leiterin des Gefängnisses, in dem Piroska die letzten Stunden ihres Lebens verbracht hat. Nicht alle waren sehr auskunftsfreudig. Schon gar nicht die Polizei, die damals recht schlampig ermittelt hat, und sich immer noch nicht sehr auskunftsfreudig zeigt; genauso wenig wie die unantastbaren Russen.
Vieles in der Schilderung der «Zeugen» ist widersprüchlich. Der ermittelnde Schriftsteller entdeckt das Böse, das Grausige und Obsessive – gerade auch in der Bevölkerung. Ja, Piroska Janscó war eine Prostituierte, die bei den sowjetischen Soldaten ein- und ausging, sie kannte ebenso wie die Menschen um sie herum keine Moral. Wirklich nicht? Von der «Metaphysik der Sünde» spricht József Keresztesi und Freund des Autors in seinem klugen Nachwort. Und Szilard Rubin: « Und ich möchte nicht die existenzialistische These über die Unergründbarkeit der Welt darstellen, keine kafkaeske Parabel verfassen, sondern einen dem sozialistischen Geist verbundene, künstlerisch gut gelösten und authentischen Tatsachenroman schreiben.» Das ist Rubin unzweifelhaft gelungen, auch wenn manche Szene sich sehr kafkaesk liest und die «Unergründbarkeit der Welt» zweifelsfrei zu erahnen ist.

Der Roman «Der Eisengel» des ungarischen Autors Szilárd Rubin ist eine wunderbare und spannende Neuentdeckung. Die Geschichte der fünffachen Mörderin von Törökszentmiklós ist ein Krimi und doch mehr als das: eine faszinierende kleine literarische Sensation. Absolut lesenswert!”
Zurück zum «Fall» und zu Piroska, diesem «Eisengel», «kalt bis ans Herz hinan», liebende Mutter und gnadenlosen Mörderin, zu dieser Protagonistin eines außergewöhnlichen Romans. Mörderin und Heilige, der Engel und das Biest? Charakteristika, die stimmen und doch nicht stimmen. Folgen wir also dem Autor, der von seiner Heldin sagt: «Ich betrachte die Fotografie des Mädchens, unruhig und ratlos. Darüber stand: Die Täterin. Und unter dem Bild der Name Piroska Janscó. Dieses Bild vor mir erweckte zugleich Mitleid, Lust und Angst. In der Tiefe des trotzigen Blicks glühten die Falschheit und der Hochmut der Verführerin, in den katzenartigen Umrissen des Gesichts etwas, das sie auf rätselhafte und unheilverkündende Weise begehrenswert mache, und das konnte selbst durch die in ihren Zügen liegende Furcht eines in die Ecke gedrängten Raubtiers nicht gebannt werden.»
Gerade das also macht diesen Roman, bei dem so vieles im Ungefähren bleibt, trotz aller Brüche und Unschärfen, so einzigartig und lesenswert.
Der Leser, der einen Krimi erwartet hat, wird vielleicht enttäuscht sein. Der Leser, der sich auf das Abenteuer dieses Buches einlässt, hält einen brillanten, einen faszinierenden Roman in Händen, eine kleine literarische Sensation. ■
Szilárd Rubin: Der Eisengel, Roman, aus dem Ungarischen von Timea Tankó, Rowohlt Verlag, ISBN 978 3 87134 789 4
.
.
.
.
Die Schach-Datenbank «Chessbase 13»
.
Schach auf Wolke 7 ?
Dr. Mario Ziegler
.
 29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?
29 Jahre dauert mittlerweile die Geschichte der Hamburger Softwarefirma ChessBase (gegründet 1985) an, die sich in dieser Zeit zum Marktführer für elektronische Schachprogramme entwickelt hat. Das bekannteste Produkt des Hauses ist neben dem Programm «Fritz» das namengebende «ChessBase» – im Gegensatz zu Fritz nicht zum Spielen konzipiert, sondern zur Verwaltung und Bearbeitung von Partien. ChessBase liegt nun in der Version 13 vor, und für den Nutzer stellt sich die Frage, wie umfangreich die Verbesserungen zur 2012 erschienenen Vorgängerversion ausgefallen sind. Lohnt sich die Neuanschaffung, die selbst in der günstigsten Download-Version immerhin noch stolze 99,90 € kostet?
Ich werde mich im Folgenden auf die Neuerungen von ChessBase 13 konzentrieren und daher die unzähligen nützlichen Funktionen, die bereits in früheren Versionen enthalten sind, übergehen. Dem Nutzer von ChessBase 12 wird der Einstieg in die aktuelle Version leicht fallen, da an der Menügestaltung kaum Änderungen vorgenommen wurden. Mitgeliefert wird in den günstigeren Programmpaketen die Datenbank «Big Database 2014» mit knapp 5,8 Millionen unkommentierten Partien (im Megapaket alternativ die «Mega Database» mit zusätzlich ca. 68000 kommentierten Partien). Das sollte hinsichtlich des Umfangs des Partiematerials keine Wünsche offen lassen, zumal aus ChessBase heraus ein Zugriff auf die noch umfangreichere Online-Datenbank von ChessBase möglich ist. Hier sei aber doch ein kleiner Kritikpunkt angebracht: Wieso endet eigentlich eine «Big Database 2014» mit Partien aus dem November 2013 (mit der ersten Weltmeisterschaft Anand-Carlsen)? Und wieso sind alle Datenbanktexte in der Big Database leer? Natürlich sind das Kleinigkeiten, aber andererseits wäre es ja sicher kein Problem gewesen, noch ein paar Tausend Partien aus 2014 aufzunehmen oder eben darauf zu achten, dass die Texte auch wirklich Texte sind und nicht nur aus Überschriften bestehen.
Nun aber zu den wirklich wichtigen Dingen. Hervorstechendes Merkmal der neuen Version ist die ChessBase-Cloud. Ein Verfahren, das bereits in vielen anderen Programmen umgesetzt wurde, hält damit auch ins Schach Einzug: Es wird möglich, Daten nicht nur lokal, sondern auch auf einem Server zu speichern. Bei der Installation des Programms werden drei leere Datenbanken angelegt: «Repertoire Weiß», «Repertoire Schwarz» sowie «Meine Partien». Darüberhinaus kann der Nutzer nach Belieben zusätzliche Datenbanken erstellen, solange die maximale Größe von 200 MB nicht überschritten wird.

Diese Cloud-Datenbanken befinden sich sowohl auf dem lokalen Computer als auch in der «Wolke». Das Programm prüft bei jeder Verbindung mit der ChessBase-Cloud, welche der beiden Datenbanken aktueller ist und synchronisiert selbständig die Versionen.
Die Vorteile dieser neuen Technik liegen auf der Hand. Von jedem beliebigen Computer kann man durch Aufruf der URL http://mygames.chessbase.com und Eingabe der Login-Daten auf die Cloud-Datenbanken zugreifen, auch wenn auf diesem Rechner kein ChessBase installiert ist. So kann man schnell und unkompliziert das eigene Repertoire durchsehen, Analysen studieren und bearbeiten oder trainieren. A propos Training: Für Trainer ist die Cloud ein nützliches Hilfsmittel, um den Schülern Material zur Verfügung zu stellen oder mit ihnen zu interagieren, ohne sich persönlich oder auf einem Server treffen zu müssen. Der Trainer kann Materialien vorbereiten, in die Cloud einstellen und den jeweiligen Schüler einladen, was diesem die Möglichkeit gibt, auf die Datenbank zuzugreifen.
 Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.
Falls gewünscht, kann man dem Schüler erlauben, die Datenbank zu verändern, so dass er Aufgaben bearbeiten und diese dann abspeichern kann. Auch die Möglichkeit, eine Datenbank als Download über die Cloud anzubieten, besteht. Da wie beschrieben eine Cloud-Datenbank, die auf dem lokalen Rechner verändert wird, auch auf dem Server angepasst wird, besteht sogar die Möglichkeit, Partien im Internet live zu übertragen, ohne auf aufwändige und kostspielige Technik zurückgreifen zu müssen. Für größere Übertragungen wäre es allerdings günstig, wenn man nicht jeden User einzeln zur Einsicht in die Datenbank einladen müsste, sondern eine Datenbank generell freigeben könnte.
Neben der Cloud bietet das neue ChessBase verschiedene Detailveränderungen, die das Leben des Benutzers erleichtern. So muss man zur Kommentierung von Partien nicht mehr auf die rechte Maustaste zurückgreifen, da nun eine Leiste unter der Notation die wichtigsten Funktionen und Symbole bereitstellt. Nur am Rande sei die Frage gestellt, wieso nicht gleich alle Symbole, die ChessBase zur Kommentierung einer Partie anbietet, implementiert wurden.

Diese Leiste erleichtert die Eingabe deutlich. Für die im Screenshot dargestellte Variante samt Text und Symbolen benötigte ich mit der Leiste 5 Klicks, mit der alten Methode deren 9. Und auch eine zweite kleine Neuerung spart Zeit: Gibt man einen von der Partiefortsetzung abweichenden Zug ein, legt ChessBase nun sofort eine Variante an, statt wie früher ein Kontextmenü mit den Optionen «Neue Variante – Neue Hauptvariante – Überschreiben – Einfügen» zu öffnen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich dann nacharbeiten, wenn man ausnahmsweise wirklich die Partiefortsetzung überschreiben möchte.
Der obige Screenshot zeigt eine weitere Neuerung: Neben den Spielernamen werden nun die Bilder der Spieler angezeigt, und zwar die zeitlich am besten passenden aus der Spielerdatenbank. Klickt man die Fotos an, sieht man eine größere Version. Ein Klick auf die Spielernamen öffnet den Personalausweis, ein Klick auf den Turniernamen die Turniertabelle.
Ein nettes neues Feature ist die Möglichkeit, verschiedene Wertungszahlen zu speichern. Gerade die Unterteilung zwischen nationalen und internationalen Wertungszahlen halte ich für sehr sinnvoll, divergieren diese beiden Zahlen doch gerade bei Amateuren, die nicht regelmäßig Turniere mit Eloauswertung bestreiten, erheblich. Daneben kann man auch Blitz-, Schnellschach- und Fernschach-Wertungszahlen speichern.
Eine neue Analysemöglichkeit besteht darin, gezielt eine oder mehrere Positionen einer Partien vertieft bewerten zu lassen. Dazu werden Analyseaufträge angelegt, die das Programm abarbeitet. Dies ist sehr nützlich, um Schlüsselmomente der Partie auszuloten.
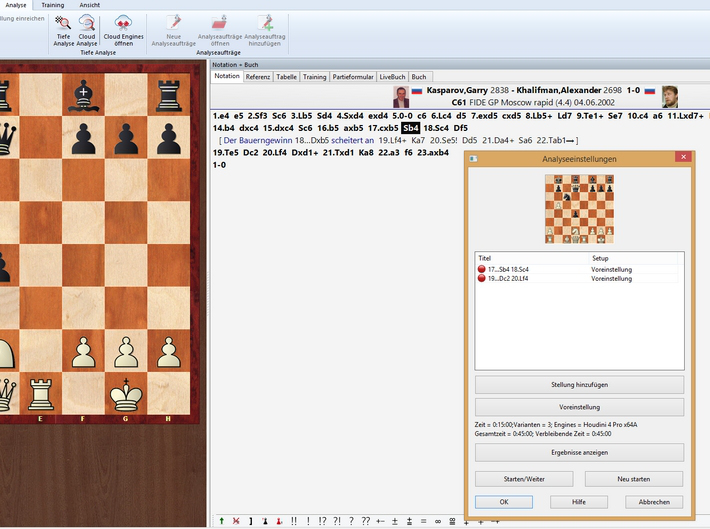
Zuletzt die technischen Mindestvoraussetzungen, wie sie der Hersteller selbst angibt:
Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM, DVD-ROM Laufwerk, Windows Media Player 9 und Internetverbindung (Aktivieren des Programms, Playchess.com, Let’s Check, Engine Cloud und Updates).

Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück der neuen Schachdatenbank ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg.
Fazit: Die Cloud-Technologie ist in jedem Fall das Kernstück von ChessBase 13. Wie in vielen anderen Bereichen, in denen die «Wolke» kaum noch wegzudenken ist, wird diese Technik zweifellos auch den Datenaustausch und die Analysemöglichkeiten im Schach verändern. In diesem Punkt weist ChessBase 13 einen neuen Weg. Weitere Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion sind eher dem Bereich der Feinjustierung zuzuordnen; sie sind nützlich, jedoch nicht bahnbrechend. Um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen: Wer auf die Möglichkeiten der Cloud verzichten kann und bereits ChessBase 12 besitzt, für den stellt das neue ChessBase keinen Pflichtkauf dar. Für den Trainer oder Turnierspieler jedoch, der schnell auf wichtige Datenbanken zugreifen oder diese mit anderen teilen möchte, bietet ChessBase 13 durch die Cloud eine großartige Neuerung. ■
Chessbase GmbH: Chessbase 13 – Software-Schach-Datenbank, DVD, ISBN 978-3-86681-448-6
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Guillaume Connesson: «Lucifer», Cellokonzert (Jérôme Pernoo, Jean-Christophe Spinosi)
.
Infernalisches Klangspektakel
Wolfgang-Armin Rittmeier
.
 Schlägt man das Booklet zu dieser Neuveröffentlichung aus dem Hause Deutsche Grammophon auf, so ist dort über den 1970 in einem Vorort von Paris geborenen Komponisten Guillaume Connesson folgendes zu lesen: «Der 1970 geborene Guillaume Connesson ist zu jung, um sich jenem ideologischen und ästhetischen Diktat beugen zu müssen, das die vorangegangene Generation von Komponisten eingeengt hat. Seine Musik, immer wohlklingend und oft spektakulär hat eine Vielzahl von Einflüssen in sich aufgesogen. Seine ganze persönliche Welt ist das ‚Work in Progress’, welches aus jener Mischung von Pragmatismus und Naivität erwächst, die das Markenzeichen aller großen Schöpfer von Musik ist.»
Schlägt man das Booklet zu dieser Neuveröffentlichung aus dem Hause Deutsche Grammophon auf, so ist dort über den 1970 in einem Vorort von Paris geborenen Komponisten Guillaume Connesson folgendes zu lesen: «Der 1970 geborene Guillaume Connesson ist zu jung, um sich jenem ideologischen und ästhetischen Diktat beugen zu müssen, das die vorangegangene Generation von Komponisten eingeengt hat. Seine Musik, immer wohlklingend und oft spektakulär hat eine Vielzahl von Einflüssen in sich aufgesogen. Seine ganze persönliche Welt ist das ‚Work in Progress’, welches aus jener Mischung von Pragmatismus und Naivität erwächst, die das Markenzeichen aller großen Schöpfer von Musik ist.»
Obwohl man Elogen wie diese von Bertrand Dermontcourt nicht sonderlich lieben muss, so ist an diesen Worten schon etwas dran. Connesson, der heute eine Professur für Orchestration am Conservatoire National de Région d’Aubervilliers bekleidet, schöpft definitiv und vollkommen sorglos aus dem Vollen. Da beste Beispiel ist da das hier eingespielte Ballet en deux actes sur un livret du compositeur «Lucifer», das 2011 uraufgeführt wurde. Die enorm farbenreiche, geradezu glitzernde Partitur des «Lucifer» deckt stilistisch so ziemlich alles zwischen dem Sacre, Sandalenfilmmusik aus dem Hause Metro Goldwyn Mayer und groovigem Jazz ab. Ein buntes, wildes, ziemlich ungehemmtes Treiben, das in seiner gewissen Prinzipienlosigkeit rundum höchst unterhaltsam und darum auch – im Gegensatz zu so vielen, vielen Kompositionen der Moderne und Postmoderne – in jedem Falle massenkompatibel ist. Massenkompatibel sind übrigens auch die Thematik der Ballettmusik und auch das von der Deutschen Grammophon gestaltete Cover, das einen düsteren Wasserspeier an der Kathedrale Notre Dame in Paris zeigt. Frakturähnliche rote Buchstaben präsentieren den Namen «Lucifer». Es ist das Dunkle, Gothicmäßige, Gruselig-Abgründige, das hier mit Werk und Aufmachung bemüht, bedient und schlussendlich verkauft werden. Nicht umsonst wird das Konzert für Violoncello und Orchester, das ebenfalls auf der CD enthalten ist, verschwiegen. Die CD kommt also daher als böte sie eine Art Soundtrack für das Wave-Gothic-Festival Leipzig. Trifft die Phrase «Classic goes Pop» irgendwo zu, dann sicher hier. Das dürfte auch im Sinne Connessons sein, der mit seiner Musik (nicht nur) in Frankreich bestens ankommt und eine Reihe unterschiedlichster Preise, beispielsweise den vom Institut de France vergebenen Cardin-Preis (1998), den Nadia und Lili Boulanger-Preis (1999) oder – im Jahre 2006 – den Grand Prix Lycéen des Compositeurs erhalten hat. Guillaume Connesson hat von Beginn seiner Karriere an Elemente des Pop zu Themen seines Werkes gemacht hat, etwa in «Techno Parade», «Disco-Toccata» oder «Night Club». Warum also nicht auch hier?

Komponist Guillaume Connesson (links) und Dirigent Jean-Christophe Spinosi während der Aufnahmearbeiten zu “Lucifer”
Tritt man nun einen Schritt vom Marketing zurück und hört der Musik aufmerksam zu, dann präsentiert sich «Lucifer» als durchaus packende neue Musik, als eine neue Musik, die in der Lage ist, auch den der arrivierten «Klassik» nicht ganz so nahe stehenden Hörer zu fesseln. Das Werk, im Prinzip zwar eine Ballettmusik, aber laut Connesson gleichzeitig eine «große Symphonie», ist in sieben Abschnitte unterteilt, denen der Komponist einen Titel und jeweils einen kleinen Text voranstellt. Es wird – die Überraschung ist nicht groß – von «Le Couronnement du Porteur de Lumière» bis zum «Épilogue» der Fall Luzifers vom größten aller Engel zum verstoßenen König der Hölle «erzählt», allerdings verquickt mit Elementen der Prometheus-Sage. Es ist die Liebe zu einer Menschenfrau, die seine Verurteilung und seinen Fall herbeiführt. Im Épilogue tritt schließlich der Mensch «an sich» auf, der die Krone des Luzifer findet und sich – hier hat die Symbolik etwas unschön Gewolltes – von dieser dunklen Macht enorm fasziniert zeigt.
Zur Musik: Das Werk eröffnet mit der Krönungsszene Lucifers («Le Couronnement du Porteur de Lumière»). Musikalisch ist das zunächst schon ziemlich packend. Wilde Skalen in allen Instrumentengruppen, entfernt orientalische Klänge und starke Betonung des rhythmischen. Dann ein plötzlicher Stimmungswechsel. Streicherglissandi leiten einen nach Science Fiction klingen Abschnitt ein, eine liebliche Oboenmelodie schleicht sich ein, der Gesang wird von Celli ausgenommen. Das Orchester wird satter und baut einen Höhepunkt von düsterer Größe im üppigsten Cinemascope-Sound auf. Zu dieser Musik hätte Cecil B. DeMilles Moses problemlos das Rote Meer teilen können. Dann Rückkehr zum Bacchanal. Der zweite Satz «Le voyage de Lucifer» ist als Scherzo angelegt. Streicher, Holzbläser und der üppig bestückte Percussionsapparat rasen in wilder Jagd jazzig dahin. «La Recontre», die Begegnung Lucifers mit der Menschenfrau, sieht Connesson als das «Herz» des Werkes. Tatsächlich ist auch dies ein höchst hörenswertes Stück Musik. Geheimnisvoll tastend der Beginn, langsam etabliert sich – um Verdi zu zitieren – eine «melodie lunghe, lunghe, lunghe» in den Violinen. Der Satz gewinnt zusehends an Fülle, an Körper und entwickelt sich zu einer rauschhaft-orgiastischen Liebesmusik, die sich erneut auf eine wuchtige Metro-Goldwyn-Mayer Klimax hinwälzt, die nicht nur von fern an den frühen Mahler erinnert. Nach «La Recontre» ist es dann aber mit dem Einfallsreichtum vorbei. Sicher, auch die sich anschließenden Sätze «Le Procès», «La Chute», «L’Ailleurs» und «Épilogue» klingen gut, aber sie bringen nichts Neues. Immer und immer wieder rasende Skalen, Jazzrhythmen, Breitwandklänge. Hinzu kommt, dass der Eklektizismus überhand nimmt. Immer wieder fühlt man sich erinnert. Mal klingt Connesson nach Howard Shore (Le Procès) und mal nach Vaughan Williams’ «Sinfonia antartica» und dem «Sacre» (L’Ailleurs). Schließlich scheint der Épilogue des «Lucifer» klanglich und atmosphärisch fast den «Epilogue» der «London Symphony» (ebenfalls Vaughan Williams) imitieren zu wollen. Nach knapp 40 Minuten, die den Hörer angesichts des durchaus ansprechenden Klangspektakels wohl bei Laune halten, stellt man sich dennoch unweigerlich die Frage, ob das nun Musik ist, die über ihren knallbunten Eventcharakter hinaus etwas aussagt, etwas trägt oder ob sie das überhaupt will. Das etwas aufgepfropft wirkende «Programm» legt es zwar nahe, zurück bleibt aber der schale Geschmack einer eigentümlichen Leere.
Uneingeschränkt zu loben ist das atemberaubende Spiel des Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi, das sich mit Elan auf diese musikalische Spielwiese wirft und sich mit rechtem Gusto austobt, sodass die Funken nur so fliegen. Wenn Connessons «Lucifer» lediglich den Anspruch hätte, ein Werk sein zu wollen, das zeigen möchte, was an Klang und Virtuosität aus einem großen Orchester herausgekitzelt werden kann, dann wäre dieses als Plädoyer für die Möglichkeiten des Orchester bestens gelungen.

«Irrsinnige Spielfreude»: Solo-Cellist Jérôme Pernoo
Viel Klangzauber bietet auch das 2008 entstandene Cellokonzert in fünf Sätzen, die – so Connesson wiederum auf «zwei Akte» aufzuteilen sind. Auch hier finden sich im Beiheft allerlei Erklärungen dazu, wie das Werk zu verstehen sei und das, obwohl das Stück durchaus ohne Verstehenshinweise auskommt. Auch das Cellokonzert ist im Wesentlichen ein virtuoses Stück, das nicht nur den Cellisten, sondern auch das Orchester vor recht heikle Aufgaben stellt, und zwar nicht nur die nackte Spieltechnik betreffend, sondern ganz besonders, was die Vielfältigkeit und rasante Wechselhaftigkeit im Audruck angeht. Kaum sind die blockhaft-vehementen ersten Minuten des ersten Satzes «Gratinique» (hier sollen kalbende Eisberge inspirierend Pate gestanden haben) vorbei, schon gilt es eine zauberhaft klagende Atmosphäre im Mittelteil zu erschaffen. Das sich direkt anschließende «Vif» bringt Atemlosigkeit und unglaubliche Rasanz. Dann eine große «naturmagische» Musik im «Paradisiaque», in der das Cello zu einem großen Gesang anhebt, der nostalgischer, sentimentaler und bittersüßer kaum daher kommen könnte. Die «Cadence» fordert dem Solocellisten alles ab, was menschenmöglich ist, rausgeschmissen wird im letzten Satz «Orgiaque» mit Bacchanal-Stimmung, Jazz und Dixiland-Reminiszenzen.

Das Cellokonzert und die Balletmusik «Lucifer» von Guillaume Connesson sind packende, glitzernde, virtuose Musikstücke, deren spektakulärer Charakter jedoch nicht unbedingt einen lang anhaltenden Eindruck hinterlässt. Die Ausführung durch den Cellisten Jérôme Pernoo und dem unter Jean-Christophe Spinosi spielenden Orchestre Philharmonique de Monte ist tadellos.
Cellist Jérôme Pernoo leistet hier spielerische und gestalterische Schwerstarbeit und wird dieser ausufernden, mäandernden, ja schon bald überladenen Cellopartie mit einer schon fast irrsinnigen Spielfreude gerecht. Das Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi stehen dem in nichts nach.
Und doch stellt sich im Anschluss die Frage: Was bleibt? ■
Guillaume Connesson: Lucifer & Cellokonzert, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Jean-Christophe Spinosi, Jérôme Pernoo, Deutsche Grammophon 481 1166. 1, Audio-CD
.
.
.
.
Michel Bergmann: «Alles was war» (Erzählung)
.
«Ins Leben. Unbeschwert»
Günter Nawe
.
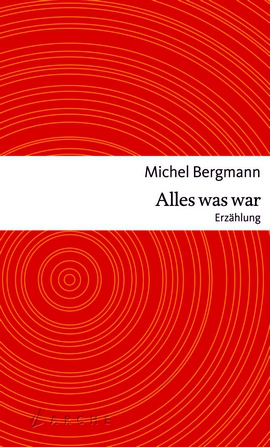 «Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.
«Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.
Von einem solchen Kind schreibt Michel Bergmann in seiner berührenden Erzählung «Alles was war». Es ist ein kleines großes Buch des Erinnerns – voller Trauer und voller Witz, melancholisch und heiter. Und er schreibt sicher von eigenem Erleben, denn dieser Michel Bergmann wurde 1945 als Kind jüdischer Eltern in einem Internierungslager geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Paris und Frankfurt/Main. Es waren seine Jahre als jüdisches Kind, als jüdischer Junge, die er in den 50er Jahren im Nachkriegsdeutschland verbrachte. In einem Land, das einerseits vom schrecklichen Geschehen während der Naziherrschaft und des Krieges traumatisiert war; andererseits aber auch noch längst nicht «entnazifiziert» war.
Bergmann ist bereits durch drei wunderbare Bücher literarisch auffällig geworden. Und das im besten Sinne. Mit seinen Romanen «Die Teilacher», «Machloikes» und «Herr Klee und Herr Feld» hat er von den Erlebnissen der Juden erzählt, die sich wieder in Frankfurt niedergelassen habe. Sie alle tragen schwer an dem Schicksal, das ihnen die Geschichte, das ihnen die Deutschen angetan haben.
Und nun also die Erzählung eines alten Mannes, der auf seine Kindheit zurückblickt. Er erinnert sich an die Schulzeit, daran, das er, den Ranzen auf dem Rücken, losrennt: «Ins Leben. Unbeschwert. Es ist sein Tag! Wie jeder Tag sein Tag ist!» Arzt soll er werden, stellt sich jedenfalls die Mutter vor, die mühsam wieder ein annähernd normales Leben zurückgefunden hat als Geschäftsfrau.
Dass das nicht einfach würde – alle wussten es, die den Weg des Jungen begleiteten. Erst aber einmal wird «gelebt». So stromert das Kind durch die Trümmergrundstücke. Er hat Freunde und später Freundinnen. Oft allerdings nur solange, bis herauskommt, dass er Jude ist. Freunde und Freude hat er in und mit der Familie, der Mischpacha, mit Freunden, den Chaverim. Er feiert unter etwas Weihnukka – eine Mischung aus Weihnachten und Chanukka. Er gerät in den einen und anderen Schlamassel. Voller Witz auch die Schilderung der Bar Mizwa, die der Junge trotz erster religiöser Zweifel über sich ergehen lassen muss.
In dreizehn wundervoll erzählten Kapiteln, teilweise im leicht jiddisch eingefärbten Deutsch, schreibt der alte Mann, hinter dem wir getrost Bergmann vermuten dürfen, sein kleine, seine exemplarische Geschichte, die für den Leser auch eine Art Geschichtsunterricht wird. Nicht dröge und keinesfalls belehrend, aber einfühlsam und bei aller Schwere leicht und mit Witz und einem gehörigen Schuss Melancholie. Und immer gegenwärtig in diesem jungen Leben sind die, die nicht mehr sind. Schließlich ist er «am Rande eines Massengrabs» aufgewachsen.
Der Junge wird älter. Er verliebt sich, wird betrogen, schafft gerade mal so das Abitur, genießt seine Freiheit und verachtet alles Angepasstheit und – auch sie gibt es wieder – die saturierte Bürgerlichkeit. Was aber steht hinter all dem? Kasches, Fragen, werden gestellt – und bleiben oft unbeantwortet. Die jüdisch-deutsche Problematik, die Geschichte der Juden in Deutschland sollte für den Ich-Erzähler später einmal von existenzieller Bedeutung werden.
Erst einmal aber wird er Volontär bei den «Frankfurter Rundschau». Auch kein Traumjob, aber… Hier lernt er den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer kennen. Dessen unermüdliches Engagement um den und im Auschwitz-Prozess ist beispielhaft gewesen. Mit großer Leidenschaft und großer Anteilnahme wird der junge Journalist.
Ein alter Mann erinnert sich. Auch daran, dass im Laufe der Jahre die Verbindung zur Mutter abgebrochen ist. Er erinnert sich an die Menschen, denen er in den Jahren seines Lebens begegnet ist. So trifft er bei der Beerdigung der Mutter einen alten Freund Marian wieder – und es war «wie am ersten Tag». Ihm wird er dieses kleine wundervolle Buch, diese auf ihrer Weise einzigartige Biografie widmen.

Die Geschichte einer jüdischen Kindheit im Deutschland der Nachkriegszeit – Michel Bergmann hat sie aufgeschrieben. Auch sie ein Kapitel deutscher Geschichte – wunderbar erzählt, heiter und witzig und voller Melancholie und Nachdenklichkeit. Ein kleines großes Buch, das traurig und zugleich glücklich macht.
Im letzte Kapitel, das bezeichnenderweise die Überschrift «Chaim – Leben» trägt, zitiert Michel Bergmann Søren Kierkegaard: «Das Leben kann nur nach rückwärts schauend verstanden, aber nur nach vorwärts schauend gelebt werden». In diesem Sinne hat Michel Bergmann dieses Buch geschrieben – und uns, seine Leser, auf wunderbare Weise beschenkt. ■
Michel Bergmann: Alles was war, Erzählung, Arche Verlag, ISBN 978-3-7160-2716-5
.
.
.
.
Klaus Merz: «Unerwarteter Verlauf» (Gedichte)
.
Lyrik vom Feinsten
Susanne Rasser
.
 In wenigen Worten alles sagen, aufs Wesentliche konzentriert. Fokussiert. Unaufgeregt. Nah bei sich. Nah an den Menschen. Doch dabei immer auf jenen Abstand bedacht, der Freiraum bietet, der ein Miteinander erst möglich macht.
In wenigen Worten alles sagen, aufs Wesentliche konzentriert. Fokussiert. Unaufgeregt. Nah bei sich. Nah an den Menschen. Doch dabei immer auf jenen Abstand bedacht, der Freiraum bietet, der ein Miteinander erst möglich macht.
Dem Schweizer Autor Klaus Merz gelingt genau das. Seit vielen Jahren schon. Und er stellt es mit seinem Lyrikband «Unerwarteter Verlauf» erneut unter Beweis, dass er ein Meister der punktgenauen Schnörkellosigkeit ist.
Der aus dem schweizerische Aarau stammende und in Unterkulm lebende Lyriker und Prosaschriftsteller gehört zu den Längst-Etablierten, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Basler Lyrikpreis und den Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012). Zudem ehrt der Innsbrucker Haymon Verlag seinen Hausautor mit einer Werkausgabe, die seit 2011 im Halbjahresrhythmus erscheint und insgesamt sieben Bände umfassen soll.

Der Schweizer Autor Klaus Merz stellt es mit seinem Lyrikband «Unerwarteter Verlauf» erneut unter Beweis, dass er ein Meister der punktgenauen Schnörkellosigkeit ist.
Klaus Merz gehört zu den bedächtigen, sehr gesetzten Autoren. Das Laute, Aufgebauschte ist seine Sache nicht. Und weil das Sich-Vergewissern etwas mit Gewissen zu tun hat, schaut er sehr genau hin, sortiert mit Bedacht und setzt auf ein menschliches Maß.
Merz gewährt uns mit seiner Lyrik Einblick in eine Welt, die frei ist von Trubel, Kraftmeierei und Trendgeschrei:
Wir drücken die Stirn / ans Fensterglas und / spenden leise Applaus. ■
Klaus Merz: Unerwarteter Verlauf – Gedichte, mit Vignetten von Heinz Egger, 80 Seiten, Haymon Verlag, ISBN 978-3-7099-7093-5
.
____________________________
Geb. 1965, lebt als Autorin von Lyrik, Erzählungen und Drehbüchern in Rauris/A
.
.
.
.
.
.
.
.
Eleni Torossi: «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» (Roman)
.
Sehnsucht nach griechischer Hühnersuppe
Günter Nawe
.
 Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.
Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.
Soviel zur Person, weil Eleni Torossi – wie man zu Recht vermuten darf – mit ihrem neuen Buch «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» einen autobiografischen Roman geschrieben hat. Damit erhält die Geschichte, die sie erzählt, ein hohes Maß an Authentizität. Denn sie ist die Tochter, die in Athen in Zeiten der Militärdiktatur aufwächst; deren Mutter, eine Hutmacherin, taub ist. Wie es sich lebt in diesen unruhigen Zeiten und warum beide Athen und eine Reise ins Ungewisse – nach Deutschland – antreten. Und wie es sich in Deutschland leben lässt.
Im Vordergrund ihrer Geschichte steht die Beziehung zwischen der tauben Mutter und der Tochter. Eine Beziehung, die sozusagen «wortlos» ist. Denn Eleni verständigt sich mit ihrer eleganten Mutter durch Gesten und Zeichen und mit Augen und Händen. Ein schwieriges Verfahren, das viel Geduld von beiden Seiten und große Vertrautheit miteinander erfordert. Und das dennoch weitestgehend gelingt. Auch wenn es Schwierigkeiten, immer wieder Verständigungsprobleme, Ängste und Schuldgefühle zu überwinden gilt – die Liebe zueinander widersteht allem. Es ist ein symbiotisch anmutendes Verhältnis, das Mutter und Tochter miteinander verbindet.

Der Roman «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» von Eleni Torossi erzählt über die außergewöhnliche Beziehung eines Kindes und einer jungen Frau zu ihrer tauben Mutter. Und erzählt von einer Reise ins Ungewisse in den 60iger Jahren – von Athen nach München. Doch er zeigt dem Leser – das Buch hat doch einige Schwächen – kaum überzeugend, «wie die Welt klingt». Tiefenschärfe und Nachhaltigkeit gehören nicht zu den Stärken dieses Romans.
Eleni Torossi erzählt diese Geschichte mit sehr viel Einfühlungsvermögen und sehr einem sehr persönlichen und psychologischen Feingefühl. Das allerdings ist nur die eine Erzählebene des Romans. Die andere behandelt das «historische» Geschehen. Spielt sich doch die Lebensgeschichte dieser beiden Frauen im Kontext der Zeit ab. Eleni erlebt den Widerstand gegen die politischen Verhältnisse in Athen, ist teilweise auch in diesen Widerstand eingebunden. Die Folge: Die als Hutmacherin erfolgreiche Mutter und ihre Tochter machen sich irgendwann auf die Reise ins Ungewisse – nach Deutschland, nach München.
Hier gibt es andere, gänzlich neue Probleme: Sprachkenntnisse, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis. Die Mutter arbeitet als Küchenhilfe, die Tochter beginnt ein Studium. Herausforderungen, mit denen in den 60-iger Jahre alle Gastarbeiter und Migranten zu tun hatten. Caruso, Freund des Hauses, hilft, wo er nur kann. Parallel dazu engagiert sich Eleni in einer linken Exilantengruppe, die sich dem Kampf gegen die griechische Diktatur verschrieben hat. Was die Integration in Deutschland nicht leichter macht. Beide, Mutter und Tochter, erfahren auf höchst unterschiedliche Weise, «wie die Welt klingt». Und das sind nicht immer harmonische Klänge.
Trotzdem führen Mutter und Tochter kein schlechtes Leben. Es öffnen sich neue Türen in dieses neue Leben, und bald sind sie – die Geschichte zieht sich bis in die 90-ger Jahre – wie man so sagt: integriert. Was aber bleibt, ist die Zerrissenheit zwischen alter und neuer Heimat, die stille Sehnsucht nach dem Zurück, die «Sehnsucht nach der griechischen Hühnersuppe».
Das ist alles sehr schön und interessant und von Eleni Torossi gut erzählt. Dennoch bleiben ihre Figuren seltsam blass. Vor allem die Tochter. So erfahren wir zwar von ihrer Mitgliedschaft in linken Gruppierungen sowohl in Athen als auch in München. Wenig aber von ihren eigentlichen Überzeugungen, von ihrer inneren Verfassung. Die politischen und sozialen Gegebenheiten für die Gastarbeiter in Deutschland werden recht einseitig-kritisch beleuchtet. Es fehlt die Tiefenschärfe. Und so überzeugt dieser Roman insgesamt nur bedingt, er lässt beim Leser Fragen offen und lässt Nachhaltigkeit vermissen. ■
Eleni Torossi: Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt, Verlag Langen Müller, ISBN 978-3-7844-3356-1
.
.
.
.
.
Jörg Schuster: «Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900»
.
Der Brief als artifizieller Schutzraum und schriftliche Selbststimulation
Dr. Karin Afshar
.
 1. Vorwort zu einer Besprechung
1. Vorwort zu einer Besprechung
Vor mir liegt eine Habilitationsschrift, ein Buch von 396 Seiten, ohne Literarturverzeichnis. «Kunstleben» heißt dieses Buch – der Untertitel lautet: Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes. Auf dem Einband: Rilke – schreibend.
Abgesehen davon, dass ich einen Vorteil habe (ich muss und werde nie eine Habil-Arbeit verfassen), habe ich ein Problem: ich kann das Thema und das Buch nicht auf einer Seite besprechen. Machen Sie sich auf ein längeres Verweilen-Müssen gefasst. Ferner hoffe ich, dass sowohl Jörg Schuster als auch der Wilhelm Fink Verlag Verständnis dafür haben, wenn ich die Rezension so gestalte, dass sie auch für Nicht-Wissenschaftler lesenswert und informativ wird. Deshalb werde ich meinen Text nicht als Literaturwissenschaftlerin oder auch nur annähernd als Germanistin verfassen, sondern als neugierige Leserin, die wissen will, was es mit dem Briefeschreiben um 1900 (zugegebenermaßen interessiert mich Rilke mehr als Hofmannsthal) auf sich hat.
Ich hoffe außerdem, dass auch jene meine Rezension lesen, die vielleicht niemals das Fachbuch – ein ausgezeichnetes Kompendium voller Details und Verknüpfungen – in die Hände bekommen.
Es geht also um Briefe, und um eine bestimmte Art von Briefen, die zu einem bestimmten Zweck und mit bestimmten Inhalten mit ganz bestimmten Mitteln geschrieben wurden. Die Aufgabe, dieses «bestimmt» zu beschreiben, hat sich Jörg Schuster gesetzt. Der Mann hat Neuere deutsche Literatur, Allgemeine Rhetorik und Philosophie studiert. Seine Dissertation hat er in Tübingen über die «Poetologie der Distanz – Die ‘klassische’ deutsche Elegie 1750-1800» verfasst. Das war 2001, 2012 legte er in Marburg, wo er an der Philipps-Universität als Wissenschaftlicher Mitarbeiter wirkte, seine Habilitationsschrift vor. Wie ich dem Netz entnehmen kann, lehrt er zur Zeit am Germanischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universtät in Münster.
2. Wer waren Hugo von Hofmansthal und Rainer Maria Rilke?
Sie lesen diese Rezension bestimmt deshalb, weil Sie einen der beiden Herren kennen? Bevor ich zu den Briefen komme, erlauben Sie mir, Ihnen einige Angaben zu Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke ins Gedächtnis zurückzurufen. Ersterer lebte von 1874 bis 1929, war österreichischer Schriftsteller, Dramatiker und Librettist. Er wird als der Repräsentant des fin de siècle und der Wiener Moderne schlechthin bezeichnet und hat – «Triumphpförtner» österreichischer Kunst – die Salzburger Festspiele (1918/1919) mitgegründet, die vielleicht nicht eine Gegenidee, so doch aber Entwurf zu einer Alternative zur Wiener Moderne sein wollte: klerikal, antidemokratisch, antiaufklärerisch.1)
Hugo von Hofmannsthal hatte bereits promoviert und habilitiert, als er um 1900 in eine persönliche Krise stürzte. Am 18. Oktober 1902 erschien Ein Brief («Chandos-Brief» – ein fiktiver Brief eines Lord Chandos, der seine Zweifel an den Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks niederschreibt) in der Berliner Literaturzeitschrift Der Tag. Der Chandos-Brief zeigt, aus welchen Gedanken heraus Hofmannsthal die Poetologie seiner Jugend ablegt, und markiert eine Zäsur in Hofmannsthals Kunstkonzept. Rückblickend erscheint ihm das bisherige Leben als bruchlose Einheit von Sprache, «Leben» und Ich. Nun aber kann das Leben nicht mehr durch Worte repräsentiert werden; es ist vielmehr direkt in den Dingen präsent… Neben lyrischen und theatralischen Werken ist eine umfangreiche Korrespondenz Hofmannsthals in Höhe von etwa 9’500 Briefen an nahezu 1’000 verschiedene Adressaten überliefert.
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) gilt als bedeutendster Lyriker Deutschlands. 1895 bestand er die Matura und begann Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie in Prag zu studieren, wechselte 1896 zur Rechtswissenschaft und studierte ab September 1896 in München weiter. Etwa von 1910 bis 1919 hatte Rilke eine ernste Schaffenskrise, der dann allerdings eine um so intensivere Schaffenszeit folgte. Er vollendete innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Duineser Elegien. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstanden auch die beiden Teile des Gedichtzyklus Sonette an Orpheus. Beide Dichtungen zählen zu den Höhepunkten in Rilkes Werk. Sein umfangreicher Briefwechsel – wird mit mehr als 10’000 Briefen angegeben – bildet einen wichtigen Teil seines Schaffens. Es wurden mittlerweile 70 Bände mit Rilke-Briefen herausgegeben. Allein eine Ausgabe von 2009 umfasst 1134 «Briefe an die Mutter», darin enthalten sind die Briefe aus der Kinder- und Jugendzeit. Es hat den Anschein, als hätte Rilke in seinen Briefen gelebt. Hofmannsthal wie Rilke waren «manische» Briefeschreiber.
3. Warum Briefe untersuchen?
Bevor ich weiter auf ausgewählte Themen eingehe, die Schuster in seiner Arbeit herausarbeitet, wende ich mich an Sie. – Schreiben Sie (noch) Briefe? – Würde ich gefragt werden, würde ich antworten: ich habe früher viel geschrieben, heute greife ich kaum noch zu Papier und Stift und schreibe einen Brief von 10 oder 12 Seiten. Meine heutigen Briefe beschränken sich auf in die Tastatur geschlagene Buchstaben in Mails, die ausgedruckt allerhöchstens die Länge einer halben DIN A 4-Seite erreichen.
Briefe sind ein Medium, das uns zur Verfügung steht, um zu Papier zu bringen, was an Gedanken mehr oder weniger geordnet in uns herumschwirrt. Briefe schreiben wir, weil und wenn unser Gegenüber abwesend ist. Der Gesprächspartner, mit dem wir uns im Dialog befinden, ist räumlich oder zeitlich von uns getrennt – wir möchten ihm etwas mitteilen. In diesem Wunsch, mitzuteilen, schreiben wir von uns, von dem, was uns zugestoßen ist, was wir gedacht, gefühlt und getan haben. Im Schreiben erwachen Empfindungskräfte – wir empfinden uns als uns, wir finden unsere Identität und – auch das ist möglich, unsere Individualität. Tagebuchschreiben und das Schreiben von Briefen haben diese identitätssteigernde Kraft.
Briefe zeugen vom Schreiber und seiner Autobiographie; sie entstehen nie in einem Vakuum. Manche Briefe sind als Liebesbriefe exklusiv, und zwei Menschen und deren Beziehung zueinander vorbehalten, andere sind Abbildungen der Alltäglichkeit, vielleicht Beschreibungen der Lebens- und Gedankenwelt, andere Briefe gehen über Schreiber und Leser hinaus und sind Abbilder der Zeit und Umstände, Abbilder der Problemlösungsfindungen dieser Menschen, noch andere sind Korrespondenzen zwischen Lehrer und Schüler, Ratgeber und Ratsuchender.
Und manchmal sind die Umstände, unter denen man schreibt, kritisch – dann sind die Briefe «Krisensymptome» (vgl. Angelika Ebrecht 2000) des Selbst wie auch der Zeitepoche.
Briefe können inspirieren, d.h. der Gedanke, jemandem darüber zu schreiben, woran man gerade arbeitet, kann neue Ideen freisetzen, zu Höhenflügen bringen. Je nach Briefpartner stachelt man sich gegenseitig an, oder zieht sich herunter.
Das Gros der Literaturwissenschaftler hat jedenfalls die Korrespondenzen von um 1900 als Spiegel von «Krisensymptomen» gelesen und bezeichnet: Als Ausdruck der Unsicherheit, die «das Bürgerliche» erfasst hatte. Die Modernisierungsprozesse sind eine nächste Interpretationssicht auf die Bedeutung der Briefe: Was machte die Urbanisierung, Industrialisierung, die Steigerung der Mobilität und die Beschleunigung mit den Menschen überhaupt? Jörg Schuster jedenfalls fragt in seinem Buch nach einer noch «anderen» Funktion der Briefe – nach der produktiven kulturpoetischen, und er hat sich zur Beantwortung seiner Frage der Briefwechsel jeweils von Hofmannsthal und Rilke angenommen.
Was findet er? – Analog zum Jugendstil in der Bildenden Kunst und Architektur findet er Briefe als Form der «Gebrauchskunst». Diese Art von Kunst reagiert auf anstehende Modernisierung. Inwieweit es sich um die Konstruktion einer Text- und Lebenswelt, die nur als ästhetische zu ertragen ist, handelt, ist Gegenstand von Schusters Buch. Er studiert und analysiert genauer hin, er nimmt «Versuche literarischer Kreisbildung» und Experimente «ästhetischer Erziehung» ebenso unter die Lupe wie die Ökonomie des Briefs und – im Kontext einer Kulturpoetik des (Innen-)Raums um 1900 – Konzepte des «epistolaren Interieurs». (Zugegeben, das habe ich dem Ankündigungstext entnommen.)
Das Buch ist, wie bereits gesagt, umfangreich. Ich greife deshalb nur einzelne Kapitel heraus und stelle Sie Ihnen genauer vor.
4. Hofmannsthals bitterer Briefwechsel mit Stefan George –
symbolisches Experiment am Vorübergehenden
Schuster beginnt mit einem Gedicht Hofmannsthals2) – George nach einem Treffen überbracht –, in dem es zunächst unverfänglich um eine poetische Standortbestimmung geht, bei der George vom Jüngeren die Rolle des Lehrers zugewiesen bekommt. Hofmannsthal ist 17, George 23 Jahre alt. Dem Gedicht ist ein Geschenk vorangegangen: George hat Hofmannsthal seinen ersten, im Vorjahr erschienenen Gedichtband Hymnen geschenkt und ihm vermutlich auch Einblick in seine Übersetzungen aus dem Französischen gegeben. Der Ältere erläutert dem Jüngeren das Pariser Vorbild einer «poésie pure», die mit der Tradition der Weltabbildung in der Literatur radikal gebrochen hat: das Gedicht ist nunmehr subtiles Gewebe von bildlichen Übergängen, von Klängen und rhythmischen Einheiten, ein autonomes Gebilde, das die Möglichkeiten der Sprache und nicht die Zwänge der Wirklichkeit offenbart. Hofmannsthal lernt schnell. Schon wenige Tage später, am 21. Dezember 1891, schickt er George dann sein Gedicht, das von Anspielungen auf die ausgetauschten und besprochenen Texte durchsetzt ist.
Das Gedicht ist eine klingende Antwort auf ein Vorübergehen, das steht fest, und es gleicht einem Gedicht Baudelaires «À une passante», das George übersetzt hatte. Was ist die Absicht Hofmannsthals? Meint er mit dem Vorübergehenden George, oder sich selbst? – Viele Andeutungen, über die sich zu lesen lohnt, und ein flüchtiges Erlebnis als Inspiration zur Kunst. – Interessanterweise gibt es dieses Gedicht in zwei Versionen. Eine in deutscher Schrift, mit großen Anfangsbuchstaben und Interpunktion auf Papier mit dem Wappen Hofmannsthals. Das andere in lateinischer Schrift, mit kleinen Anfangsbuchstaben, ohne Interpunktion. Diese Version zitiert Georges Schriftstil und dieses ist es, was Hofmannsthal ihm überreicht.
Gedicht an einen Vorübergehenden ist ein Widerspruch an sich, aber er wirkt. Hofmannsthal selbst gibt an, dass es ein persönliches Bekenntnis sei – er selbst sei der Vorübergehende, der Inspirierte. George allerdings fasst das Gedicht als Ausblick auf eine festere, dauerhaftere Zusammenarbeit auf – als ein Angebot zu Nähe. Es kommt zu einem Missverständnis, das die beiden Männer anschließend immer weiter bearbeiten. Jörg Schuster geht nun dem darauf folgenden Briefwechsel nach und findet «den Haken» in der Beziehung zwischen den beiden Männern und spannt einen Bogen zur Funktion des Briefes.
Auch der Briefwechsel hat den Charakter eines Gesprächs zwischen Meister (George) und Jünger (Hofmannsthal): der Meister ist in Besitz des Geheimnisses des mit der künstlerischen Produktion verbundenen Leidens (S. 49), das er nach und nach lüften wird, indem er Andeutungen macht. Die Briefe nun atmen die Sehnsucht nach poetischer Inspiration auf beiden Seiten, für George noch essentieller als für Hofmannsthal. Im Verlaufe des Briefwechsels kehrt George von der «verletzbaren Gewalt» (ein Bekenntnis, das er abgelegt hat) zu einem vornehmen Pathos der Distanz zurück, woraufhin Hofmannsthal ratlos nachfragt, was geschehen sei. Dazu verweigert George die weitere Kommunikation und bricht in ein Schweigen ab.
Hofmannsthal schreibt einen nächsten Brief an George: «Ich kann auch das lieben, was mich ärgert», bekennt er. George findet diesen Brief zu diplomatisch, zu glatt und neutral. Hofmannsthal halte sich bedeckt. Die Korrespondenz eskaliert, und mündet in Georges Androhung zum Duell. Wie nun rettet sich Hofmannsthal? – Er beruft sich auf seine Nerven («Verzeihen Sie meinen Nerven […] jede vergangene Unart»). Die Nerven erlauben dem reizbar-sensitiven Künstler alles. George hat allerdings mit der Androhung übertrieben, und versucht in der Folge abzuwiegeln. Dabei wirkt er beinahe «komisch» (S. 53), Hofmannsthal kann das nicht einordnen – der Bruch in der Beziehung ist nicht zu vermeiden.
Hofmannsthal und George ringen in ihrem Briefwechsel um Distanz und Nähe. Sie kennen sich aus Briefen, haben sich aber nur selten getroffen, in ihrer distanzierten Nähe sind Briefe ihr Medium zum Austausch von Lebenszeichen. – Nun ist George aber der, der die Regeln vorgibt. Der Jüngere entzieht sich, bleibt auf «orientalisch» (S. 55) und auf einschmeichelnde Art konsequent und virtuos. Hofmannsthal beherrscht schon hier die Kunst der «epistolaren insinuatio» (rhethorisches Mittel, das jemand verwendet, wenn er von vorneherein davon ausgeht, dass sein Zuhörer gegen ihn ist): er entzieht sich, macht sich klein, gibt vor, dem Gegner nicht gewachsen zu sein.
Alles in allem betrachtet, ist dieser Briefwechsel das Land, in dem die Krise (die je eigene der beiden und die ihrer Beziehung) in gegenseitigem Bekennen, Fordern, Ausweichen, Vereinnahmungsversuchen als Krisenbriefwechsel ausgetragen wird.
5. Die einsame Imagination, Lebensverdächtigung und ein
verfehlter Geburtstagsbrief – Der Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann
In den vorangehenden Kapiteln hat Schuster bereits eine «Brüchigkeit» in Hofmannsthals Briefen herausgearbeitet. Im Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann tritt eine neue Qualität hinzu.
Mit Beer-Hofmann verbindet Hofmannsthal «große menschliche Vertrautheit» (S. 118), die beiden kennen einander gut und treffen sich häufig. Auch sie sind junge Männer, als sie sich (um 1896/97) kennenlernen: Beer-Hofmann ist etwa 31 und Hofmannsthal 23 Jahre alt. Ihre Begegnungen haben für beide einen hohen Stellenwert, es gibt viele Gespäche über Machtverhältnisse und die Rollenverteilung. In diesem (im Vergleich zu dem mit George) Briefwechsel ist Hofmannsthal der Zudringlichere und Beer-Hofmann der Zurückhaltende. Ausgerechnet der Ästhet Hofmannsthal lässt sich hinreißen und schreibt «Hässliches, ja Ekelhaftes» (S. 119). Hofmannsthal sucht die Konfrontation und provoziert. «Epistolares Imponiergehabe», heißt es bei Schuster, lege er an den Tag. Er trifft auf einen, der sich nicht zwingen lässt: «Ich weiß, Sie nehmen es mit mir nicht genau; Briefe «schuldig sein» ist ja auch nur ein Bourgois-Begriff.» (S. 120). Doch Hofmannsthal nimmt es sehr genau, und ärgert sich. «Warum schreiben Sie mir nicht?» – Beer-Hofmann verweigert sich. Er will nicht als «Inspirationsmittel» für die poetische Produktion jüngerer Kollegen fungieren. Er identifiziert sich mit der Rolle des «Hemmschuhs». Hofmannsthal wiederum fühlt sich nicht geachtet genug. Es deprimiert ihn, dass die Beziehung sich nicht als ideale poetische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entwickelt bzw. gestaltet. Es gelingt ihm nicht, Beer-Hofmann aus dem Leben hinein in seine Briefwelt zu ziehen (S. 124), schreibt in einer Mischung aus Zudringlichkeit und Ich-Bezogenheit.
In einem Geburtstagsbrief (vom 6. Juli 1899) an Beer-Hofmann bricht – völlig deplaziert und verfehlt – die Erwartung aus Hofmannsthal heraus. Hier liegt ein Konflikt, so schreibt Schuster, zwischen dem Menschlichen (dem Leben) und der produktiven Fähigkeit (bzw. der Poesie) vor. Das Leben kann sich uns im Brief nur in Form von Schrift und Imagination nähern, wobei die Imagination eine emphatische ist. Einfühlung ist hier das Stichwort – paradoxerweise fühlt sich Hofmannsthal so sehr in Beer-Hofmann ein, dass er ihm mit seiner Kritik und den Vorwürfen zu nahe tritt und die Grenze des guten Anstands überschreitet. Beer-Hofmann antwortet lakonisch: «Lieber Hugo, Sie haben Recht, nur […] an einen Arzt oder Medikamente glaube ich bei diesen Dingen nicht.» – Bündiger, so Schuster, könne die eigene Resignation, aber auch das Zurückweisen der selbstbezogenen Zudringlichkeit Hofmannsthals nicht ausgedrückt werden (S. 126). Briefe – so sehen wir hier – können und werden im Sinne einer «Distanzmedizin» geschrieben (S. 181).
«Medizinbriefe» wie die an Beer-Hofmann sind einseitig – sie sind und bleiben Hofmannthals «Welt in der Welt». Anders als der Poet Hofmannsthal beherrscht der Briefschreiber Hofmannsthal etliches nicht: souveränes, prägnant-wirkungssicheres sprachliches Übertragen und Hervorrufen von Stimmungen. – Dass und wie es im Briefwechsel zu einer Wende kam, ist im Buch nachzulesen – die Auflösung auf Seite 147. In dieser Art, ausführlicher und noch mehr Hintergründe heranziehend, geht Schuster die Briefe durch, die er in größere und kleinere Kategorien zusammenfasst.
6. Rilkes transportable Welt und sein fein verteiltes Irgendwo-Sein
Wussten Sie, dass Rilke täglich durchschnittlich an die zehn Briefe schrieb? – Stellen Sie sich vor, Sie schrieben heutzutage täglich an 10 Personen aus Ihrem Bekanntenkreis 10 Seiten!? An manche dieser Personen zweimal pro Woche.
Rilke produziert in guten Zeiten Briefe «mit Dampf» – und vermerkt außerdem noch alle Daten rund um die Briefe. Ist er ein Maniker? Ist er nicht – schon einmal vorweggenommen. Hätte es damals facebook oder überhaupt das Internet gegeben – Rilke hätte es genutzt: um ein Netzwerk aufzubauen, um seine Werke vorzubereiten und sich selbst zu vermarkten. Er war ein Öffentlichkeitsarbeiter.
Wir erfahren, dass Rilke Wert auf das Aussehen seiner Briefe legte: Briefpapier wird von ihm speziell ausgewählt, er schreibt in einer besonderen Handschrift («th» und «y» schreibt er auf unverwechselbare Weise und lädt sie mit einer besonderen Bedeutung auf). Rilkes Briefe sind Gesamtkunstwerke, die gleichzeitig den Alltag poetisieren und entpragmatisieren – und die doch wieder nützlich werden. Im Kreis des literarischen Betriebs Fuß zu fassen, ist Rilkes Absicht. Die Briefe dienen ihm als Ersatz für noch nicht erlangten Erfolg vor größerem Publikum. Er schafft sich einen Kreis, in dem die Briefe einen Heimatersatz für ihn, den Ortlosen, bilden. Doch das «Irgendwo», das er sich damit verschafft (dazu mehr weiter unten), ist nicht der letzte Aspekt dieser Briefe.
Für Rilke ist der Brief nicht Medium der Intimität, sondern Vorzeigeobjekt. Das epistolare Subjekt Rilke – so Schuster – bildet eine Funktionsstelle ähnlich einer Durchgangsstation, eines Relais (S. 222). Rilkes Briefe sind nämlich öffentlich: sie dürfen und sollen von den Adressaten anderen im Bekanntenkreis gezeigt werden. Auch das «Subjekt des Empfängers» wird somit zur Funktion: er soll multiplizieren.
Rilke, der Vielschreiber, versteht die an einem Tag geschriebenen Briefe als eine Einheit – und als Werk an sich, das erlaubt, das Leben ätherisch und literalisiert zu «rezipieren und zu modellieren» (S. 224).
Ganz abgesehen davon macht Rilke das, was auch heute die Selfpublisher mit ihren selbstveröffentlichten Werken tun: Sie probieren Entwürfe und Vorarbeiten im Netz aus. Sie achten auf ihre Wirkung und Rückmeldung, nehmen Anregungen auf, ändern ab. – Vorab in den Briefen Rilkes öffentlich gemachte Textabschnitte finden sich in seinen literarischen Werken wieder. Rilke inszeniert den Schaffensprozeß in seinen Briefen.
7. Esoterik der Briefe und die Exoterik der Konversation
Dass Rilke zwischen einem Gespräch und einem Brief einen großen Unterschied macht, ist bereits mehrfach durchgeschimmert. Das Konkurrenzverhältnis der beiden «Medien» zueinander ist über Jahrzehnte sein Thema (S. 224): Dem Draußen des Gesprächs steht das einsame Drinnen des Briefs entgegen. Briefe zu schreiben, ist ein Sich-Sammeln. «Als ob Du bei mir eintreten könntest» ist der Titel eines Abschnitts (S. 249ff), in dem Schuster sich mit einem Brief Rilkes an Lou Andreas-Salomé und dem nachfolgenden Briefwechsel beschäftigt. Der Brief, um den es gehen wird, ist vom 13. Mai 1897. Es ist Rilkes erster Brief an die 10 Jahre ältere Frau, die später 30 Jahre lang erst seine Geliebte, dann Vertraute und «Beichtmutter» sein wird. Ohne Lou Andreas-Salomé wäre Rainer Maria Rilkes Leben anders verlaufen, heißt es. Er lernt sie in München, wo er studiert und Kontakte zur literarischen Szene sucht, im Mai 1897 eher zufällig kennen. Er ist 26 Jahre alt, Lou Andreas-Salomé bereits renommierte Autorin. Man kennt ihre Erzählungen und Romane, ihr Buch über Ibsen. Sie hat gerade einen Heiratsantrag von Nietzsche abgewiesen. Der erste Brief, den Rilke schreibt, verrät eine geradezu religiöse Verehrung und er verfolgt eine deutliche Absicht: er möchte ein exklusives Verhältnis zu ihr haben, schreibt sie persönlich und sehr höflich an, versichert ihr, dass es eine «Auszeichnung» sei, sie kennenzulernen – und möchte ihr imponieren (S. 249). Was Rilke dabei schon damals «beherrscht» ist, was man heute «name-dropping» nennt.
Rilke hatte die Dame am Vortag getroffen und möchte – enttäuscht von der mündlichen Kommunikation – seine Bewunderung auf dem brieflichen Weg ausdrücken. Der Brief, so Schusters Hypothese, stiftet somit eine Beziehung zu Lou Andreas-Salomé im Sinne «eines der Exoterik des gesellschaftlichen Gesprächs entgegengesetzten esoterischen Mediums» (S. 250).
In diesem Fall sehen wir den Brief als «Medium der Nähe und der Intimität», wobei er dem Gespräch, der vollständigeren Form der Kommunikation, unterlegen ist. Die bereits angedeutete Thematik «Gespräch vs. Brief» bleibt während der Korrespondenz und im Verlauf der Liebesbeziehung zu Lou Andreas-Salomé bestehen. Nach Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehung gilt jeder Brief, den er ihr schreibt, dem Wunsch nach dem Gespräch. Da dieses zwischen beiden schwierig ist, sehnt sich Rilke alsbald nach an einem Ort, nach einer Wohnung, an dem und in der er das nötige «setting» findet, den Ruheort, um die nötigen Briefe schreiben zu können. Überhaupt fehlt Rilke eine «Stube», also erbaut er sich eine («ein Stück Stube […], die ich mir damals erbaut habe» (S. 257) – er arrangiert sich ein Stück Wirklichkeit. Der Nachteil dieser Wirklichkeit besteht darin, dass es sich nicht um Lebenswirklichkeit handelt, sondern um das Hervorbringen von Schrift und Poesie. Der Verfasser der Schriften jedoch ist nicht mehr als eine «zerbrochene Schneckenschale». Das Briefeschreiben wird nicht nur zum Ausweg aus der Suche nach dem (Schreib-) Ort sondern auch aus Rilkes Dilemma. Im Laufe des Briefwechsels mit Lou Andreas-Salomé wird der Brief immer mehr der Ort der Ruhe, die Schreibsituation des Briefes verwirklicht seine Sehnsucht – und das ersehnte Gespräch damit schließlich überflüssig (S. 264). Wie es nun im Einzelnen mit Rilke und AS endete, kann dem Buch entnommen werden. Soviel an dieser Stelle. Zusammenfassend kann gesagt werden: auch wenn zwar im Falle dieses Briefwechsels ein «Ausschluss der Öffentlichkeit» vorliegt, ordnet Schuster den Brief bzw. den Briefwechsel in letzter Konsequenz doch eher dem «Zweck einer Stimulation» zu.
8. Lebenspraxis + Briefpoesie = die kleine Lebenshilfe?
Die vorangegangenen Seiten haben lediglich einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtwerk gezeigt. Es gibt ungleich mehr zu entdecken. Der ältere Hofmannsthal schreibt in seinen Briefen anders und über anderes, ebenso der ältere Rilke, der viele Briefe von männlichen wie weiblichen Lesern erhält und «Lehrbriefe» schreibt. Schuster analysiert etliche dieser Briefwechsel. Zu kurz gekommen in der Rezension ist der Lebens- und Schaffenshintergrund der Beteiligten, der Briefe zu Ratgebern werden lässt. Dieses und eine akribische Untersuchung der dichterischen Sprache habe ich links liegen gelassen.
Zu Anfang hatte sich Schuster die Frage gestellt, inwieweit die Briefkultur um 1900 symptomatisch für die kulturgeschichtliche Situation des fin de siècle und des frühen 20. Jahrhunderts ist. Was leisten Briefe dieser Zeit, was bringen sie auf kommunikativem Weg hervor? (S. 388)
Die Funktion der Briefe ist – alles in allem und zusammenfassend – dass sie dem Zweck dienen, Distanz zu schaffen und zu wahren. In dieser Distanz werden sie zu Repräsentanten des «Jugendstils» und damit – Gebrauchskunst (S. 389), mit der die Autoren die «artifizielle Innen-Einrichtung ihrer sozialen Welt» gestalten.
Hoffmannsthal arrangiert sich die Wirklichkeit, wie man einen Ausstellungsgegenstand hinstellt und arrangiert (S. 388), und Rilke verwebt sich, mittels seiner Briefe kontinuierlich in den Kokon einer Einrichtung.
Die Briefe fungieren als zugleich «private» wie auch höchst artifizielle Schutzräume, statt eines tatsächlichen Zusammenwirkens herrschen einsame Imagination und schriftliche Selbst-Stimulation vor, bei denen die Adressaten als Vorwand dienen (S. 392). Bei Rilke haben wir noch den Eindruck, wir könnten jederzeit eintreten, dennoch hält er eine tatsächliche Begegnung in der Schwebe.
Zwei Repräsentanten ihrer Zeit – und es bleibt mir nach der Lektüre die traurige Frage (sie wird hoffentlich erlaubt sein): Was wohl, wenn wir unsere heutigen Briefwechsel ähnlich akribisch unter die Lupe nähmen und eine Anamnese vornehmen würden, die Diagnose ergäbe? Für mich ganz persönlich nehme ich mit, dass ich in puncto Rilke die richtige, hier bereits angedeutete, Vermutung hatte. Leider konnte ich nicht auf all die anderen Fragen eingehen, die im Buch aufgeworfen und beantwortet werden. Leider, auch das bereits angedeutet, bin ich zu wenig Literaturwissenschaftlerin, um Schusters Werk für die Literaturwissenschaft würdigen zu können. Es sei dennoch ans Herz gelegt: wenn wir unsere Geschichte verstehen, verstehen wir auch die Gegenwart! ■
Jörg Schuster: Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes, 428 Seiten, Wilhelm Fink Verlag, ISBN 978-3770556021
.
1) Norbert Christian Wolf: Eine Triumphpforte österreicherischer Kunst – Hugo von Hofmannsthals Gründung der Salzburger Festspiele, Jung und Jung (Salzburg)
2) Herrn Stefan George
einem, der vorübergeht
du hast mich an dinge gemahnet
die heimlich in mir sind
du warst für die saiten der seele
der nächtige flüsternde wind
und wie das rätselhafte
das rufen der athmenden nacht
wenn draussen die wolken gleiten
und man aus dem traum erwacht
zu weicher blauer weite
die enge nähe schwillt
durch pappeln vor dem monde
ein leises zittern quillt
.
Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Anne Carson: «Decreation» (Gedichte – Oper – Essays)
.
«Die Liebe ist immer du»
Günter Nawe
.
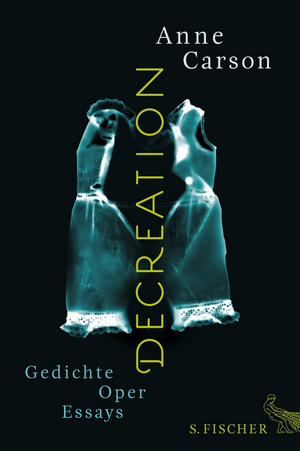 Den Titel ihres neuen Buches hat die kanadische Autorin Anne Carson von der französischen Philosophin Simone Weil übernommen. Für Weil – sie hat diesen Begriff geprägt –, von der sich die Carson stark beeinflusst sieht, bedeutet «décréation» einerseits Analyse der Selbstreflexion des Menschen und zugleich «Rückschöpfung», also eine «Ent-Schaffung»; anders: alles Erschaffene noch einmal ins Unerschaffene zu überführen.
Den Titel ihres neuen Buches hat die kanadische Autorin Anne Carson von der französischen Philosophin Simone Weil übernommen. Für Weil – sie hat diesen Begriff geprägt –, von der sich die Carson stark beeinflusst sieht, bedeutet «décréation» einerseits Analyse der Selbstreflexion des Menschen und zugleich «Rückschöpfung», also eine «Ent-Schaffung»; anders: alles Erschaffene noch einmal ins Unerschaffene zu überführen.
Aus diesem philosphisch-religiösen Gedankengut und in diesem Kontext der Simone Weil speist sich im Wesentlichen die Literatur der Anne Carson – vor allem, was das neue Buch «Décréation» betrifft. Es enthält Gedichte, Essays und ein Opernlibretto (nicht zu vergleichen mit einem herkömmlichen Libretto). Sehr unterschiedliche Spielarten der Literatur also, die jedoch bei Anne Carson in ihrem Innersten zusammenhängen. Auch der Lyrikerin geht es darum, eine Art «Rück-schöpfung» zu «inszenieren», indem sie ihre Vorstellung davon als Frage formuliert. Und dies Genre-übergreifend, sozusagen als Brückenschläge.
So in den Gedichten, die vor allem ihrer Mutter gewidmet sind. Sie ist «die Liebe meines Lebens». Mit ihr redet sie in ihren Versen: «Wenn ich mit meiner Muter spreche, mache ich es schön…». Von ihr hat die Dichterin gelernt: «Die letzte Lektion einer Mutter in einem Haus im letzten Licht / bringt den Ruin der Welt und den Handel zum Erliegen…». «Diese Stärke, Mutter: hervorgewühlt. Gehämmert, gekettet, / geschwärzt, gesprengt, heult, holt aus…».
Anne Carson, 1950 in Toronto geboren, ist im deutschen Sprachraum bisher durch die Bücher «Glas, Ironie und Gott» (Gedichte, 2000) und «Rot: Ein Roman in Versen» (2001) bekannt geworden Jetzt also «Décréation», und im Herbst wird der Band «Anthropologie des Wassers» erscheinen. Alle Bücher dieser Dichterin überzeugen durch die Klang- und Aussagekraft ihrer Poesie, durch die Intensität ihre Sprache, durch den Verzicht auf jegliches Pathos und die Bandbreite ihrer Themen. Großes Lob an dieser Stelle für Anja Utler, die «Decreation» aus dem Amerikanischen sehr feinfühlig ins Deutsche übersetzt hat. «Decreation» ist so eine weitere Möglichkeit, ein Versuch der Annäherung an eine der bedeutendsten Lyrikerinnen unserer Zeit.
Die lyrische Diktion dieser Autorin ist oft experimentell – auch von der formalen Struktur der Gedichte her. Ihr poetisches Credo: «Du kannst nie genug wissen, nie genug arbeiten, niemals die Infinitive und Partizipien auf genügend befremdliche Art verwenden, nie die Bewegung brüsk genug ausbremsen, nie den Geist schnell genug hinter dir lassen.» Das gilt – hervorragend umgesetzt – für die Verse, für ihre Essays und das Opernlibretto: zusammengefasst in diesem wunderschönen Band.
In dem kleinen Text «Jedes Abgehen ist ein Anfang» dekliniert Anne Carson zum Beispiel die verschiedenen Lesarten des Schlafs. Und bemüht dabei Aristoteles, Kant und Keats, um sich am Ende ausführlich Virginia Woolf zu widmen. Und so lesen wir «O zarter Salber stiller Mitternacht… Beschütz mich dann, dass nicht der Tag erneut / Aufs Kissen scheint, der mich so leiden ließ; …».

«Décréation» ist ein außergewöhnliches Buch einer außergewöhnlichen Dichterin. Klug, anregend und voller sublimer Erkenntnisse. Anne Carson gehört zweifellos zu den bedeutendsten zeitgenössischen Lyrikerinnen – und «Decreation» ist bis jetzt eines ihrer wichtigsten Werke.
Ihr großartiger Essay «Decreation – Wie Sappho, Marguerite Porete und Simone Weil Gott sagen» setzt die gelernte Gräzistin sich mit drei großen Frauen und ihren «spirituellen Erlebnissen» auseinander. Sappho, die die Liebe pries und diesen Lobpreis der Göttin Aphrodite weihte; Marguerite Porete hat über die Liebe Gottes geschrieben und wurde dafür 1310 als Ketzerin verbannt; Simone Weil, die «Erfinderin» des Begriffs der «décréation», Altphilologin und Philosophin hatte, wie die Carson schreibt, «ein Programm, mit dem sie ihr Selbst aus dem Weg schaffen wollte, um zu Gott zu gelangen. Um Liebe also geht es diesen drei Frauen, um Liebe auch geht es auch Anne Carson. Auch im Operntext, der ebenfalls den Titel «Decreation» trägt. So lässt sie Hephaistos singen: «Die Liebe ist immer du, / wenn sie frisch ist. / Wenn du da bist, wenn sie frisch ist, wenn sie frisch ist, wenn du da bist, / die Liebe ist immer, / immer / wenn du da bist.». Oder, wenn im 3. Teil des Librettos Simone die «Arie des Rückschöpfens» singt.
Und um «Erhabenes», einer Art Gedichtzyklus, in dem die Autorin in teilweise enigmatische «Versen» Kant eine Frage zu Monica Vitti stellen und Longinus von Antonioni träumen lässt.
Was aber ist dieses Erhabene, was ist die Seele und welcher Schlaf ist Befreiung vom Selbst? Zu erfahren vielleicht im Gespräch mit Gott, das wie Simone Weil auf andere Art auch Anne Carson führt. Es ist ein nahezu undurchdringliches Geflecht, das Anne Carson anbietet. Für den Leser aber, der sich lesend an die «Entflechtung» wagt, ein unendlicher Gewinn. ■
Anne Carson: Decreation – Gedichte, Oper, Essays, 250 Seiten, S. Fischer Verlag, ISBN 978-3-10-010243-0
.
.
.
.
.
Gerhard Josten: «Auf der Seidenstraße zur Quelle des Schachs»
.
Bereicherung des Diskurses über den Schach-Ursprung
Thomas Binder
.
 Die Frage nach dem Ursprung des königlichen Spiels gehört zu den ungelösten Problemen der Kulturgeschichte. Als sicher kann gelten, dass das Schachspiel aus südöstlicher Richtung zu uns gelangt ist. Alle weiteren Details bleiben bisher – und werden es möglicherweise immer bleiben – im Reiche der Mythen verborgen.
Die Frage nach dem Ursprung des königlichen Spiels gehört zu den ungelösten Problemen der Kulturgeschichte. Als sicher kann gelten, dass das Schachspiel aus südöstlicher Richtung zu uns gelangt ist. Alle weiteren Details bleiben bisher – und werden es möglicherweise immer bleiben – im Reiche der Mythen verborgen.
Gemeinhin wird der Ursprungsort in einem riesigen Gebiet vermutet, das mit «China, Indien oder Persien» zu umschreiben wäre. Oft wird sogar versucht, einen einzelnen Schöpfer des Spiels zu benennen. Selbst die berühmte Weizenkornlegende reiht sich in diese Überlegungen ein, ist doch die von Feld zu Feld verdoppelte Füllung des Schachbretts mit Weizenkörnern der Lohn für den «Erfinder des Schachspiels».
Zu den Forschern, die sich in jüngerer Zeit auf die Suche nach den Quellen des Schachs gemacht haben, zählt die Initiativgruppe Königstein. Von 1991 bis 2005 trafen sich namhafte internationale Schachhistoriker zu acht Konferenzen. Letztlich konnten auch sie keine schlüssige Antwort auf die eingangs gestellte Frage finden. Auf der Homepage http://www.schachquellen.de ist ihr Vermächtnis dokumentiert.
Eines der Mitglieder dieser Gruppe ist auch der deutsche Schachhistoriker, -komponist und -schriftsteller Gerhard Josten. Er legt nunmehr in Buchform seine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zum Thema vor.
In den Mittelpunkt der Überlegungen stellt er dabei die Seidenstraße – einen Oberbegriff für die Handelsrouten entlang derer schon um die Zeitenwende der Kontakt zwischen Europa und (Ost-)Asien seinen Anfang nahm. Dabei wurden nicht nur Handelsgüter ausgetauscht, sondern auch Wissen, Ideen, Techniken – sicher aber auch Geschichten, Kunst, Überzeugungen – und ganz gewiss auch Spiele und Spielideen.
In einem seiner einführenden Kapitel führt uns Josten in jene Zeit und räumt mit manchen falschen Vorstellungen über die Seidenstraße auf. So musste man keinesfalls den ganzen Weg vom Mittelmeer nach China auf sich nehmen, um von den Segnungen dieser Route zu profitieren. Vielmehr wurden Güter und Ideen über viele Zwischenstationen unter den Völkern weitergereicht, dabei immer wieder verändert und bereichert.
Den letztgenannten Prozess beschreibt Gerhard Josten nun für das Schachspiel, indem er verschiedene (Brett-)spiele ins Feld führt, die in den Ländern entlang der Seidenstraße und in deren weiterem Einflussgebiet verbreitet waren. Er wägt ab, welche Elemente dabei jeweils in das Schachspiel eingeflossen sind, wie sie sich zu einem Spiel vereinigten und ergänzten, das letztlich als Urform des Schachs angesehen werden kann. Hierfür verwendet er an zentraler Stelle und durchaus schlüssig den aus der Philosophie und Religionswissenschaft bekannten Begriff des Synkretismus.
Den Ort, an dem das Schachspiel entstanden sein könnte, bestimmt Josten im Kushanreich, welches innerhalb der Seidenstraße eine solch zentrale Position einnimmt, dass es sich als Schmelztiegel der Kulturen und ihrer Spiele offenbar anbietet.
Hat der Autor damit die Frage nach dem Ursprung des Schachs gelöst? Sicher nicht! Er bereichert aber den Diskurs um eine interessante Hypothese, die über den genannten Entstehungsort hinaus verschiedene neue Ideen einbringt. Ob sie dem Anspruch strenger Wissenschaft standhält, mag Ihr Rezensent nicht beurteilen. Das ist aber auch sekundär, solange keine eindeutig schlüssigeren Erklärungsansätze bekannt sind.
Die von Josten vorgelegte Arbeit ist eine in sich geschlossene Theorie – nicht besser und nicht schlechter als andere. Das Verdienst des Autors besteht darin, seine Ideen in eine auch dem Laien zugängliche Form gebracht und unsere Sinne für das nach wie vor ungelöste Problem geschärft zu haben.
Ob man seinen Gedankengängen in jedem Falle folgen möchte, bleibt dem Leser überlassen. An manchen Stellen konnte ich dies jedenfalls nicht bis ins letzte Detail tun – so als er zu einem unvollständig(!) gefundenen Satz von mehr als 4’000 Jahre alten Spielsteinen eine mögliche Anordnung auf einem 8×8-Brett ableitet, die natürlich der des heutigen Schachs sehr ähnlich ist.

Gerhard Josten bereichert mit seiner neuen Monographie die Forschung zum Ursprung des Schachs um eine interessante Hypothese. Seine Ideen werden schlüssig und gut lesbar vorgetragen, dabei passend illustriert. Die Kaufempfehlung für einschlägig interessierte Leser wird (trotz des recht hohen Preises) gerne ausgesprochen.
Jostens Buch ist angenehm lesbar geschrieben. Hier kommt ihm sein für einen Sachbuchautor überdurchschnittliches Schreibtalent zu Gute, welches ja schon in Romanen erprobt ist. Die Darstellung ist reich und zweckmäßig illustriert, überwiegend mit archäologischen Funden von Spielsteinen und –brettern sowie kartographischen Skizzen. Dabei gelingt Gerhard Josten auch der Spagat zwischen erfrischender Lesbarkeit und wissenschaftlicher Korrektheit im Umgang mit Quellen und Zitaten. Erstere stammen oft aus dem Internet. Der Autor hat, obwohl schon im achten Lebensjahrzehnt stehend, dieses Medium aktiv in seine Forschungsarbeit einbezogen. Zu den Zitaten ist anzumerken, dass englischsprachige in der Regel ohne Übersetzung stehen gelassen wurden.
Als Klammer des Buches dient der sogenannte Babson-Task – eine Aufgabe, die für Schachkomponisten lange Zeit ebenso unlösbar schien, wie für die Historiker die Frage nach den Quellen des Schachs. Auf dem Titelbild prangt (vielleicht nicht ganz zum Thema passend) die bisher beste Darstellung hierzu in einer Aufgabe des Russen Leonid Jarosch. Gegen Ende des Buches kommt Josten darauf zurück. Man mag den Zusammenhang zur Grundthematik etwas bemüht finden, als eine weitere Anregung zum Weiterforschen (z.B. im Internet) nimmt der Rezensent diesen Exkurs gerne auf.
Der Preis des Buches von knapp 30 Euro erscheint mir allerdings etwas zu hoch und wird ihm möglicherweise die verdiente Verbreitung unter Schachspielern, die gern etwas über den Brettrand hinausschauen, erschweren. ■
Gerhard Josten: Auf der Seidenstraße zur Quelle des Schachs, Diplomica Verlag Hamburg, 139 Seiten, ISBN 978-3842892194
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Michael Dartsch: «Musik lernen, Musik unterrichten»
.
Der aktuelle Stand der musikpädagogischen Dinge
Walter Eigenmann
.
 In der modernen Diskussion über Musikpädagogik hat der 1964 geborene Autor dieser neuen Einführung «Musik lernen, Musik unterrichten» eine einflußreiche Stimme. Denn als Mitglied der bundesrepublikanischen «Arbeitsgemeinschaft der Leitenden musikpädagogischen Studiengänge» sowie als Musikrat-Mitglied im «Bundesfachausschuss Musikalische Bildung» gestaltet Michael Dartsch massgeblich Inhalte und Strukturierungen der aktuellen akademischen Musiklehrer-Ausbildung mit und findet damit Beachtung im ganzen deutschsprachigen Raum.
In der modernen Diskussion über Musikpädagogik hat der 1964 geborene Autor dieser neuen Einführung «Musik lernen, Musik unterrichten» eine einflußreiche Stimme. Denn als Mitglied der bundesrepublikanischen «Arbeitsgemeinschaft der Leitenden musikpädagogischen Studiengänge» sowie als Musikrat-Mitglied im «Bundesfachausschuss Musikalische Bildung» gestaltet Michael Dartsch massgeblich Inhalte und Strukturierungen der aktuellen akademischen Musiklehrer-Ausbildung mit und findet damit Beachtung im ganzen deutschsprachigen Raum.
Die vorliegende Monographie unternimmt denn auch nicht nur den Versuch einer breiten theoretischen Einführung in praktisch alle wichtigen Disziplinen der Thematik inklusive ihre musikhistorischen Bezüge, sondern referiert teils sehr ausführlich ebenso die didaktisch-praktische Umsetzung der jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Der Band grundiert seinen Überblick zuerst mit einer Beleuchtung der zentralen psychologischen bzw. gesellschaftlichen Einflussfaktoren auf das Musiklernen: Begabung, Sozialisation, Übeeinsatz und Motivation heißen da die wesentlichen Stichworte. In der Folge werden eine Reihe von spezifischen Inhaltsfeldern behandelt: Elementare Musikpraxis, Erfinden von Musik, Musikverstehen, Interpretieren, Üben seien hier nur als die wichtigsten Themata angeführt. Der praxisorientierte Bezug ist außerdem vertreten in Abschnitten wie «Methoden» oder «Zielgruppen und Unterrichtsformen». Ein Blick auf die Institutionen der nicht-akademischen Musikerziehung in der BRD – Stichworte: Öffentliche Musikschulen, Selbstständige Musiklehrerschaft, Laienmusizieren u.a. – rundet den 248-seitigen Band ab.

Michael Dartschs «Musikpädagogik» ist eine sowohl hinsichtlich Strukturierung wie inhaltlicher Gewichtung überzeugende Gesamtschau auf den aktuellen Forschungsstand – eine Bereicherung der aktuell relevanten musikpädagogischen Literatur.
Dartschs «Musikpädagogik» ist eine sowohl hinsichtlich Strukturierung wie inhaltlicher Gewichtung überzeugende Gesamtschau auf den aktuellen Forschungsstand. Von der Systematik des musikpädagogigschen Begriffsapparates und seiner kulturhistorischen Fundamente über die lernpsychologischen bzw neurophysiologischen Grundlagen moderner wissenschaftlicher Untersuchungen bis hin zur konkreten didaktischen Umsetzung in der täglichen Instrumentalpraxis vermittelt der Autor seinen umfangreichen Stoff mit klarer thematischer Gliederung und in wohltuend «einfacher» Sprache, was dieses Einführungs- und Lehrwerk nicht nur für Musik-Studierende und -Lehrende, sondern durchaus auch für Pädagog/inn/en anderer, wenngleich involvierter Schulbereiche interessant macht. Eine Bereicherung der aktuell relevanten musikpädagogischen Literatur! ■
Michael Dartsch: Musik lernen, Musik unterrichten – Eine Einführung in die Musikpädagogik, 248 Seiten, Breitkopf & Härtel Verlag, ISBN 9783765103995
.
.
.
Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Emma Goldman: «Anarchismus» – Essays
.
«Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme»
Sigrid Grün
.
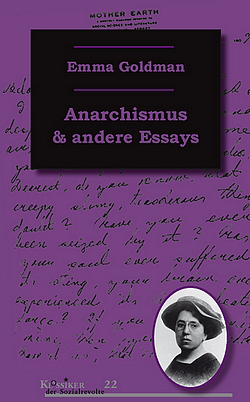 Emma Goldman gilt als Ikone der anarchistischen Bewegung. Sie wurde 1869 im damals russischen (heute litauischen) Kowno geboren und setzte sich Zeit ihres Lebens für Frieden und Gerechtigkeit ein. Im Alter von 16 Jahren floh sie aus Russland, um im «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» einer von ihren Eltern arrangierten Ehe zu entgehen. Doch in den USA fand sie ebenso unhaltbare politische Zustände vor, die anzuprangern sie nicht müde wurde. Von ihren Gegnern mehrfach als Aufrührerin und Unruhestifterin, die unter anderem auch für politisch motivierte Morde mitverantwortlich sein sollte, verurteilt, verbüßte sie in den USA mehrfach Gefängnisstrafen und wurde schließlich nach Russland deportiert. Nach Aufenthalten in England, Frankreich und Spanien verstarb sie 1940 im kanadischen Toronto.
Emma Goldman gilt als Ikone der anarchistischen Bewegung. Sie wurde 1869 im damals russischen (heute litauischen) Kowno geboren und setzte sich Zeit ihres Lebens für Frieden und Gerechtigkeit ein. Im Alter von 16 Jahren floh sie aus Russland, um im «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» einer von ihren Eltern arrangierten Ehe zu entgehen. Doch in den USA fand sie ebenso unhaltbare politische Zustände vor, die anzuprangern sie nicht müde wurde. Von ihren Gegnern mehrfach als Aufrührerin und Unruhestifterin, die unter anderem auch für politisch motivierte Morde mitverantwortlich sein sollte, verurteilt, verbüßte sie in den USA mehrfach Gefängnisstrafen und wurde schließlich nach Russland deportiert. Nach Aufenthalten in England, Frankreich und Spanien verstarb sie 1940 im kanadischen Toronto.
 Bereits in den 1890er Jahren hielt Emma Goldman glühende Reden in deutscher und englischer Sprache und erreichte mit diesen Vorträgen tausende Anhänger. Die in diesem Band vorliegenden Essays stammen überwiegend aus dem Jahr 1910. Bereits vier Jahre vor Ausbruch des 1. Weltkrieges analysierte die Vorreiterin der Friedensbewegung die stark um sich greifenden Phänomene des Patriotismus und Militarismus. Die Essays zeugen von einem messerscharfen Verstand und umfassender Bildung – einer Melange, die die Herrschenden verständlicherweise nervös machte. Sie versteht es hervorragend Zusammenhänge zu erklären und Rückschlüsse zu ziehen, die zum damaligen Zeitpunkt ganz klar auf die sich anbahnende Katastrophe mehrerer Kriege hindeuteten. Der Ton ist selbstbewusst, die Stimme laut, denn wie Goldman in ihrem Essay «Die Psychologie politischer Gewalt» konstatiert: «Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme.» Sie ruft zum radikalen Umsturz auf, zur absoluten Befreiung vom Joch der Herrschaft und Unterdrückung. Selbst nach ihren Haftstrafen investiert sie ihre gesamte Kraft in die agitatorische Arbeit.
Bereits in den 1890er Jahren hielt Emma Goldman glühende Reden in deutscher und englischer Sprache und erreichte mit diesen Vorträgen tausende Anhänger. Die in diesem Band vorliegenden Essays stammen überwiegend aus dem Jahr 1910. Bereits vier Jahre vor Ausbruch des 1. Weltkrieges analysierte die Vorreiterin der Friedensbewegung die stark um sich greifenden Phänomene des Patriotismus und Militarismus. Die Essays zeugen von einem messerscharfen Verstand und umfassender Bildung – einer Melange, die die Herrschenden verständlicherweise nervös machte. Sie versteht es hervorragend Zusammenhänge zu erklären und Rückschlüsse zu ziehen, die zum damaligen Zeitpunkt ganz klar auf die sich anbahnende Katastrophe mehrerer Kriege hindeuteten. Der Ton ist selbstbewusst, die Stimme laut, denn wie Goldman in ihrem Essay «Die Psychologie politischer Gewalt» konstatiert: «Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme.» Sie ruft zum radikalen Umsturz auf, zur absoluten Befreiung vom Joch der Herrschaft und Unterdrückung. Selbst nach ihren Haftstrafen investiert sie ihre gesamte Kraft in die agitatorische Arbeit.

Emma Goldmans Essay-Sammlung “Anarchismus” ist eine beeindruckende Lektüre. Es ist erschreckend, wie aktuell diese Texte heute noch sind – und wie wenig sich eigentlich geändert hat. Die Aufsätze sind auf alle Fälle Klassiker der Sozialrevolte, die man gelesen haben sollte.
Die zentralen Themen der Texte sind Eigentum, Regierung, Militarismus, Rede- und Pressefreiheit, Kirche, Liebe und Ehe sowie Gewalt. Im Mittelpunkt steht – wie sollte es im Anarchismus auch anders sein – stets der freie Mensch. Manche Essays mögen dem Leser zunächst befremdlich und gewagt erscheinen, etwa «Gefängnisse – Inbegriff gesellschaftlichen Verbrechens und Versagens», folgt man jedoch der Argumentationslinie, wird deutlich, wie kläglich ein System, das auf einer stetigen Negativspirale des Verbrechens basiert, versagt. Hier, wie in sämtlichen anderen Texten, wird schnell klar, welches Menschenbild hinter solchen Systemen steckt. Andererseits macht die Friedensaktivistin aber auch Mut, denn sie widmet sich in einigen Essays auch Vorreitern auf dem Gebiet der Friedensbewegung und des Anarchismus. Etwa dem katalanischen Reformpädagogen Francisco Ferrer, der wie viele andere Anarchisten zum Tode verurteilt wurde, weil ihm die Verwicklung in einen Aufstand unterstellt wurde. Entlastende Zeugenaussagen wurden nicht gehört und obwohl bereits seine Unschuld erwiesen war, wurde der Begründer der «Escuela Moderna» (Modernen Schule) hingerichtet. Von seinem und dem Tod vieler anderer Aktivisten berichtet Goldman in zahlreichen Essays und zeigt damit, welche Furcht die Herrschenden vor dem Anarchismus gehabt haben müssen.
Emma Goldmans Essays sind eine beeindruckende Lektüre. Es ist erschreckend, wie aktuell diese Texte heute noch sind – und wie wenig sich eigentlich geändert hat. Die Aufsätze sind auf alle Fälle Klassiker der Sozialrevolte, die man gelesen haben sollte. ■
Emma Goldman: Anarchismus & andere Essays – Klassiker der Sozialrevolte (22), 256 Seiten, Unrast Verlag, ISBN 978-3-89771-920-0
.
.
.
.
W. A. Mozart: Grandes Oeuvres à quatre mains (KV 497 & KV 501)
.
Mozart im Zwiegespräch
Christian Busch
.
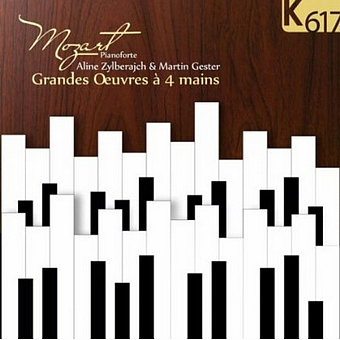 Das vierhändige Klavierspiel, die vielleicht intimste Form der Kammermusik, gehört zu den technisch heikelsten und interpretatorisch anspruchvollsten Herausforderungen, welche die Musik an die Ausführenden stellt. Zwei vermeintlich gleichberechtigte Partner treten auf engstem Raum – eine vollkommene Synthese suchend – in einen wirklichen Dialog. Ein Terrain für Geschwister, Paare und freundschaftlich verbundene Seelen – weniger für titanische Tastenlöwen mit ausgeprägtem Hang zur Selbstdarstellung.
Das vierhändige Klavierspiel, die vielleicht intimste Form der Kammermusik, gehört zu den technisch heikelsten und interpretatorisch anspruchvollsten Herausforderungen, welche die Musik an die Ausführenden stellt. Zwei vermeintlich gleichberechtigte Partner treten auf engstem Raum – eine vollkommene Synthese suchend – in einen wirklichen Dialog. Ein Terrain für Geschwister, Paare und freundschaftlich verbundene Seelen – weniger für titanische Tastenlöwen mit ausgeprägtem Hang zur Selbstdarstellung.
Schon von seinem geltungssüchtigen Vater Leopold etwas plakativ als «Erfinder der vierhändigen Klaviersonate» präsentiert, zählt Mozart unbestritten zu den Wegbereitern dieser Gattung der hohen Kunst mit überschaubarem Repertoire.
Was für den kleinen Wolferl auf dem Schoße eines Johann Christian Bach beginnt und sich in frühen Kompositionen für das geschwisterliche, durchaus auch publikumswirksame Zusammenspiel fortsetzt, findet in der F-Dur-Sonate KV 497 seine Krönung und Vollendung. Gerne als «Krone der Gattung» (Einstein) und «gewaltige Seelenlandschaft» bezeichnet, steht sie zeitlich und thematisch der «Prager» Symphonie (KV 504), aber auch dem «Don Giovanni» nahe. Als Mozart sie im August 1786 schreibt, verleiht er der subtilen Bespiegelung in Dur und Moll daher auch symphonische Dimensionen.
 Die Franziska von Jacquin, Tochter des befreundeten Wiener Botanikprofessors, gewidmete C-Dur-Sonate KV 521 übersendet er Ende Mai 1787 – am Todestag seines Vaters – an Gottfried von Jacquin mit den mahnenden Worten: «Die Sonate haben Sie die Güte ihrer frl: Schwester nebst meiner Empfehlung zu geben; – sie möchte sich aber gleich darüber machen, denn sie seye etwas schwer.» Das virtuose Werk, das den späten Wiener Klavierkonzerten verwandt ist, trumpft gleichfalls mit orchestralem Klang auf, ohne den dank der Solopassagen aller vier Hände – kammermusikalischen Rahmen zu verlassen. Ob er es mit ihr, einer seiner besten Schülerinnen, auf Schloss Waldenburg gespielt hat? Mit Sicherheit.
Die Franziska von Jacquin, Tochter des befreundeten Wiener Botanikprofessors, gewidmete C-Dur-Sonate KV 521 übersendet er Ende Mai 1787 – am Todestag seines Vaters – an Gottfried von Jacquin mit den mahnenden Worten: «Die Sonate haben Sie die Güte ihrer frl: Schwester nebst meiner Empfehlung zu geben; – sie möchte sich aber gleich darüber machen, denn sie seye etwas schwer.» Das virtuose Werk, das den späten Wiener Klavierkonzerten verwandt ist, trumpft gleichfalls mit orchestralem Klang auf, ohne den dank der Solopassagen aller vier Hände – kammermusikalischen Rahmen zu verlassen. Ob er es mit ihr, einer seiner besten Schülerinnen, auf Schloss Waldenburg gespielt hat? Mit Sicherheit.
Das Straßburger Musikerehepaar Aline Zylberajch & Martin Gester (Bild) hat sich nun in ihrer zweiten auf CD veröffentlichen Gemeinschaftsproduktion dieser beiden viel zu selten zu hörenden Sonaten Mozarts angenommen – zusammen mit dem Rondo in a-moll KV 511 (Martin Gester) und dem Andante und Variationen in G-Dur KV 501 (Label K 617).
Ihr Spiel lässt dabei keine Wünsche offen, ist geprägt von präziser Abstimmung, das den weiten Bogen von orchestraler Pracht symphonischen Ausmaßes bis zur privaten Intimität mühelos spannt. Das kraftvoll drängende Allegro, die galant singende Melodie, der leise, klagend-resignative Ton, all das spiegelt sich stimmig im blendend hellen Mozart-Sound. Da mag einer sagen, dies komme ihm bekannt vor, jedoch nicht in der Form des auf Salon-Frivolitäten verzichtenden, vertrauten Zwiegesprächs – im ständig wiederkehrenden Suchen und Finden – zweier ebenbürtiger Partner. Damit bietet die CD mit Werken aus der großen Schaffensperiode (zwischen «Figaro» und «Don Giovanni») einen weiteren Höhepunkt Mozart’schen Schaffens – für so manchen sicher eine Entdeckung. ■

Das Spiel des Pianisten-Ehepaares Aline Zylberajch & Martin Gester lässt bei Mozarts KV 479 & KV 511 keine Wünsche offen, ist geprägt von präziser Abstimmung, das den weiten Bogen von orchestraler Pracht symphonischen Ausmaßes bis zur privaten Intimität mühelos spannt.
Wolfgang Amadeus Mozart: Grandes Oeuvres à quatre mains (KV 497 & KV 501), Martin Gester and Aline Zylberajch, CD-Label K617 (Harmonia Mundi)
.
.
.
.
.
.
.
Elif Shafak: «Ehre» (Roman)
.
Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit
Günter Nawe
.
 Sie heißen Pembe Kader und Jamila Yeter – die Zwillingsschwestern. «Namen wie Zuckerwürfel», findet ihr Vater, «süß und geschmeidig und ohne scharfe Kanten». Übersetzt bedeuten die Namen Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit. Nomen est omen. Die Schwestern wurden 1945 «in einem Dorf an den Ufern des Euphrat», in Kurdistan, geboren. Ihre Geschichte erzählt die preisgekrönte türkische Autorin Elif Shafak in ihrem neuen Roman «Ehre». Und sie macht dies auf meisterhafte Weise.
Sie heißen Pembe Kader und Jamila Yeter – die Zwillingsschwestern. «Namen wie Zuckerwürfel», findet ihr Vater, «süß und geschmeidig und ohne scharfe Kanten». Übersetzt bedeuten die Namen Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit. Nomen est omen. Die Schwestern wurden 1945 «in einem Dorf an den Ufern des Euphrat», in Kurdistan, geboren. Ihre Geschichte erzählt die preisgekrönte türkische Autorin Elif Shafak in ihrem neuen Roman «Ehre». Und sie macht dies auf meisterhafte Weise.
Ehre! – «Männer besaßen Ehre… Frauen besaßen keine Ehre, sie besaßen Scham. Und ‚Scham’, das wusste jeder, wäre ein ziemlich schlechter Name». Und die Geschlechter haben eine Farbe: Männer sind schwarz, Frauen sind weiß. Und die weiße Fläche verzeiht keinen Schmutz. Jeder Fleck an fehlender Bescheidenheit und Unterwürfigkeit, jede Abweichung von der Keuschheit ist sofort für alle sichtbar. Das werden auch die beiden Schwestern erfahren. Pembe wird «aus Ehre» mit Adem verheiratet, verlässt ihre Heimat in Richtung Istanbul und geht dann endgültig mit ihrer Familie nach London. Ihre Schwester dagegen bleibt «ehrenhaft» in ihrer Heimat und lebt dort ein Leben als eine unverheiratete Frau, gefangen in den alten Traditionen.
Pembe versucht, im fernen London mit ihrem Mann und ihren drei Kindern ein erfülltes Leben in einem anderen, in einem modernen Kulturkreis zu leben. Dass dies nicht gelingt, macht die Tragik dieses Romans aus. Gescheiterte Hoffnungen, Verrat und Verlust – ein schöner Traum ist sehr schnell ausgeträumt. Da ist einmal die fremde Welt, die mit ihrem liberalen und freizügigen Lebensverständnis verstört. Da sind andererseits die Familie und die patriarchalischen Strukturen. Die Kinder werden «flügge», ihr Mann ist ein Zocker, der sich zudem noch in einer anderen Frau, einer Nackttänzerin, verfällt und die Familie verlässt. Und Pembe begegnet einem heimatlosen Koch, Sie verliebt sich in ihn, sie trifft sich heimlich mit ihm – und weiß, dass sie damit gegen den Ehrencodex ihrer Religion und Kultur verstößt. Kein «rosarotes Schicksal» also. Und am Ende steht ein unbegreiflicher Mord aus «Ehre» – begangen von dem Sohn Iskender an seiner Mutter. Eine «Ehrensache»!
 Elif Shafak (Bild) schreibt eine wunderbar klare, eine nahezu sinnliche Sprache, die den Leser sofort gefangen nimmt. Sehr sensibel und mit viel Empathie begleitet sie ihre Figuren durch das Romangeschehen. Und packend und ausdrucksstark schildert die wunderbare Autorin den Kontrast zwischen türkisch-islamischer Tradition und britisch-westlicher Lebenswelt.
Elif Shafak (Bild) schreibt eine wunderbar klare, eine nahezu sinnliche Sprache, die den Leser sofort gefangen nimmt. Sehr sensibel und mit viel Empathie begleitet sie ihre Figuren durch das Romangeschehen. Und packend und ausdrucksstark schildert die wunderbare Autorin den Kontrast zwischen türkisch-islamischer Tradition und britisch-westlicher Lebenswelt.
Im fernen Kurdistan lebt Jamila «Genug Schönheit» – auch sie gefangen in ihrer Lebenswelt – ein anderes Leben als Hebamme und Heilerin, fest verwurzelt in den Traditionen einer islamischen Männergesellschaft. Einst war sie verliebt in Adem und er in Jamila. Aber diese Verbindung durfte nicht sein, weil auch ihre Ehre «beschmutzt» war. So geht es in diesem Leben auch für sie nicht ohne Verletzungen ab.
Im ständigen Kontakt der Zwillingsschwestern weiß Jamila um das Leben von Pembe. Und so ahnt die sensible Jamila, dass sich in London, dass sich für Pembe Unheil anbahnt. Sie macht sich aus schwesterlicher Liebe auf nach London. Ob sie retten kann, was nicht zu retten ist, sei an dieser Stelle dahingestellt.
Elif Shafak erzählt diese Geschichte als ein Familienepos und einen Generationsroman, fast in Episodenform und wechselt häufig die Zeitebenen und die Sichtweisen auf das Geschehen. So hält sie den Spannungspegel hoch. Die Schilderung des Lebens der Protagonisten, alle durchweg sehr komplexe Charaktere, im Widerstreit zwischen Islam und westlichen Lebensstilen gelingt der erfolgsgewohnten türkischen, in Straßburg geborenen Schriftstellerin hervorragend. ■

Elif Shafak hat mit «Ehre» einen wunderbaren Roman geschrieben, in dem sie das Schicksal zweier Schwestern zwischen den Traditionen von islamischer Religion und moderner Lebenswelt auf unnachahmliche Weise thematisiert und zu einer spannenden und berührenden Familiengeschichte gestaltet. Lesenswert!
Elif Shafak: Ehre, Roman, Kein&Aber-Verlag, 528 Seiten, ISBN 978-3036956763
.
.
.
.
.
Martin Breutigam: «Himmlische Züge»
.
Jüngste Schach-Historie abwechslungsreich beleuchtet
Thomas Binder
.
 Gut drei Jahre nach dem Band «Todesküsse am Brett» legt der Göttinger Verlag «Die Werkstatt» eine zweite Sammlung der Kolumnen Martin Breutigams vor.
Gut drei Jahre nach dem Band «Todesküsse am Brett» legt der Göttinger Verlag «Die Werkstatt» eine zweite Sammlung der Kolumnen Martin Breutigams vor.
Den Rezensenten beeindruckt dabei zuallererst, dass ein nicht auf Schach spezialisierter Verlag das wirtschaftliche Risiko einzugehen bereit ist, sich auf diesem Markt zu platzieren. Ja – das Schachbuch lebt und ist von den modernen Medien mit ihren ureigensten Vorteilen nicht unterzukriegen.
Wir hatten das Vorgängerwerk vor drei Jahren an dieser Stelle rezensiert und könnten heute vieles aus jener Besprechung wiederholen. Erneut handelt es sich um die unveränderte Zusammenstellung von Breutigams Kolumnen in deutschen Tageszeitungen wie dem «Tagesspiegel» und der «Süddeutschen». Diesmal stammen die 140 Beiträge aus dem Zeitraum 2010 bis 2013, schließen also unmittelbar an das Vorgängerwerk an: «Todesküsse am Brett»
Der beleuchtete Zeitraum war schachhistorisch sehr ereignisreich. Zwei Weltmeisterschaften mit Vishy Anand als Hauptperson bilden die Klammer: Das Buch beginnt mit der 4. WM-Partie gegen Topalow in Sofia und endet mit dem spektakulären Finale der vorletzten Partie gegen Carlsen in Chennai. Parallel dazu können wir den Aufstieg des jungen Norwegers verfolgen, der zwar schon 2010 die Nummer 1 der Welt war, jedoch noch nicht mit der jetzigen Dominanz. So berichtet Breutigam etwa Anfang 2011, dass Carlsen gerade innerhalb von vier Monaten acht Partien verloren hatte – bei seiner heutigen Form kaum vorstellbar und längst vergessen.
Neben Carlsens Aufstieg verfolgt die Chronologie übrigens das Vorankommen der deutschen «Schachprinzen» um Rasmus Svane und Matthias Blübaum. Interessante Parallelen, aber gewiss auch Unterschiede werden deutlich.
Höhen und Tiefen bescherten die letzten drei Jahre auch dem deutschen Schach. Da steht der Gewinn der Europameisterschaft 2011 neben dem peinlichen Auftritt einer zweitklassigen Auswahl bei der Schacholympiade ein Jahr zuvor. Weitere Wettkampf-Highlights aufzuzählen, hieße einfach die Schachereignisse dieser Jahre zu wiederholen.
Die große Stärke von Breutigams Buch liegt im Abwechslungsreichtum der Kolumnen. Da stehen Kombinationen aus aktuellen Turnieren neben Porträts einzelner Spieler. Es gibt mehr oder weniger philosophische Betrachtungen und Blicke in die Vergangenheit – letztere allerdings meist mit einem aktuellen Anlass verknüpft. Eine gerade in ihrer Subjektivität starke Auswahl von Spielerporträts komplettiert den Reigen.
Die großen und kleinen Streitfragen der Schachpolitik bleiben nicht ausgespart. An das Konfliktpotential der deutschen Olympiamannschaft 2010 habe ich schon erinnert. Auch die Kandidatur der Herren Karpow und Weizsäcker für Führungspositionen in FIDE und ECU wird besprochen, ebenso wie das Finanzgebaren der türkischen Föderation und die Probleme etablierter Turnierveranstalter (am Beispiel der Chess Classics).
Die aktuellen Diskussionen der Schach-Community (Betrugs- und Verdachts-Fälle, das missratene Steinbrück-Buchcover, diverse Sportgerichts-Urteile und vieles mehr) werden nicht ausgespart.
Obwohl Martin Breutigam auf vordergründig wertende Kommentare weitgehend verzichtet, ist meist klar zu erkennen, wie er Position bezieht.

Schon das sensationelle Preis-Leistungs-Verhältnis macht dieses Kaleidoskop der letzten drei Schachjahre zu einer sicheren Kaufempfehlung. Martin Breutigam ist als unterhaltsamer Autor und kundiger Experte über jeden Zweifel erhaben. Gewisse Abstriche sind allenfalls dem Konzept geschuldet, Zeitungskolumnen unkommentiert und unredigiert zu übernehmen.
Doch im Blickpunkt steht auf jeder Seite eine tolle Schachkombination, bei der man alle Streitpotentiale und Skandälchen vergessen möchte! Gestaltung und Gliederung sind von «Todesküsse am Brett» unverändert übernommen. Jede Kombination wird auf einer Textseite präsentiert, die zu etwa einem Drittel vom Stellungsdiagramm eingenommen wird. Der Text leitet dann zur Aufgabenstellung über, mit der der Leser aufgefordert wird, den Geistesblitz des jeweiligen Schachmeisters aufzuspüren. Die Lösungen mit Angabe der Hauptvariante und der wichtigsten Abweichungen sowie sehr knappen Erläuterungen sind jeweils kopfstehend am unteren Rand der Seite angeführt. Dem kundigen Schachfreund genügt das allemal, dem interessierten Laien wird hingegen einiges zum Verständnis fehlen.
Etwa ein Dutzend ganzseitige Fotos lockern den Text auf, darunter einige selten gesehene Aufnahmen. Mein Favorit ist Aronjan, der einem Bildhauer Modell sitzt.
Die wortgetreue Übernahme der Zeitungs-Kolumnen hat natürlich ihre Grenzen. Das Buch wendet sich ausdrücklich auch an absolute Schach-Laien (wozu sonst die Erläuterungen zur Schach-Notation im Anhang?) – und diese werden sich mit manchem der knappen Texte doch etwas allein gelassen fühlen. Ergänzungen aus der zeitlichen Distanz hätten zumindest bei einigen Themen gut getan. Leider fehlen neben Hintergrundinformationen auch Datumsangaben zur jeweils originalen Veröffentlichung, es ist jeweils nur die Jahreszahl angegeben. ■
Martin Breutigam: Himmlische Züge – Neue Rätsel und Geschichten aus der Welt der Schachgenies, Verlag Die Werkstatt, 160 Seiten, 978-3730300877
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Clara Paul (Hrsg): «Gedichte, die glücklich machen»
.
Lyrik – von einer gewissen Leichtigkeit
Bernd Giehl
.
 Nein, ich werde jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, was «Glück» eigentlich ist. Und wie man es findet. Wenn ich mich darauf einließe, müsste ich entweder einen philosophischen Aufsatz von mindestens 20 Seiten schreiben, oder ich würde auf dem Niveau der Ratgeberliteratur landen.
Nein, ich werde jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, was «Glück» eigentlich ist. Und wie man es findet. Wenn ich mich darauf einließe, müsste ich entweder einen philosophischen Aufsatz von mindestens 20 Seiten schreiben, oder ich würde auf dem Niveau der Ratgeberliteratur landen.
Dennoch, die Frage ist nicht von der Hand zu weisen: Gibt es «Gedichte, die glücklich machen?» Der Titel des Buches erinnert mich an ein anderes Buch, ebenfalls aus dem Insel-Verlag mit dem schlichten Titel «Die Romantherapie – 253 Bücher für ein besseres Leben» (6. Auflage 2013) Dort kann der geneigte Leser Tipps zur Bekämpfung jeder Art von Leiden finden, die man sich zuziehen kann, seien es Zahnschmerzen oder eine unerwiderte Liebe. Das Buch enthält Kurzfassungen von Romanen, die angeblich einen besseren Umgang mit jeder Art von negativen Gefühlen ermöglichen sollen. Wenn’s hilft…
Womöglich muss man den Titel also mit einem Augenzwinkern lesen. Und im übrigen ist das Wort «Glück» natürlich auch ungemein verkaufsfördernd, denn wer, bitte, braucht schon «Anleitungen zum Unglücklich sein»? Das können wir doch ganz allein und ohne Anleitung durch einen anderen. Was ja noch nicht heißt, dass die anderen nicht gern das ihre dazu tun. – Mein Gott, sind wir heute wieder misanthropisch. Also schnell mal einen Blick in die «Gedichte, die glücklich machen» werfen.
Eingeleitet wird der Band von einem Gedicht von Joachim Ringelnatz: «Morgenwonne: Ich bin so knallvergnügt erwacht. / Ich klatsche meine Hüften. / Das Wasser lockt. Die Seife lacht, Es dürstet mich nach Lüften. // Ein schmuckes Laken macht einen Knicks / Und gratuliert mir zum Baden. / Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs / Betiteln mich ‚Euer Gnaden‘. // Aus meiner tiefsten Seele zieht / Mit Nasenflügelbeben / Ein ungeheurer Appetit / nach Frühstück und nach Leben.»
So einfach is das Glück also zu finden. Nur muss man dazu auch bereit sein. Ein gelungener Einstieg, wie ich finde. Leicht, frech, ironisch; warum nicht.
Einen anderen Ton, wenn auch ähnlich frech hat Wolf Biermanns «Lied vom donnernden Leben: Das kann doch nicht alles gewesen sein / Das bißchen Sonntag und Kinderschrein /das muß doch noch irgendwo hin gehn / hin gehn // Die Überstunden, das bißchen Kies / und aabns inner Glotze das Paradies / da in kann ich doch keinen Sinn sehn / Sinn sehn… / Das soll nun alles gewesn sein / Das bißchen Fußball und Führerschein / das war nun das donnernde Leebn / Leebn. // Ich will noch ‘n bißchen was Blaues sehn / und will noch paar eckige Runden drehn / und dann erst den Löffel abgebn / eebn.»
Das Gefühl kennt man. Nicht dass es glücklich macht. Aber vielleicht hilft’s ja, wenn man weiß, dass andere es teilen.
So könnte ich fortfahren. Viele Gedichte sind dabei, die ich kenne. Natürlich dürfen Hermann Hesses «Stufen» nicht fehlen, ebensowenig Joseph von Eichendorffs «Mondnacht» («…und meine Seele spannte / Weit ihre Flügel aus».) Ebensowenig Rilkes schönes Gedicht aus dem «Mönchischen Leben»: «Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen».
Natürlich vermisse ich auch das eine oder andere Gedicht, das ich – wäre ich der Herausgeber – ganz sicher mit in die Sammlung hineingepackt hätte (z.B. «Du Nachbar Gott» vom schon erwähnten Rainer Maria Rilke, oder das eine oder andere Gedicht von Sarah Kirsch – bei der nächsten Ausgabe bitte unbedingt an «Im Juni» denken, und der «Meropsvogel» darf auch auf keinen Fall noch einmal fehlen) – aber wie gesagt: Sie haben mich ja nicht gefragt, und das haben Sie jetzt davon!
Aber Scherz beiseite: Wahrscheinlich hat jeder, der Gedichte liebt, seine ganz eigenen Gedichte, die ihm (oder ihr – ich bitte um Verzeihung, wenn ich das nicht immer mitschreibe), die also der verehrten Leserin oder dem geschätzten Leser ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Nach längerem Lesen in Clara Pauls Buch “Gedichte, die glücklich machen” muss ich meiner Skepsis, ob es so etwas wie Gedichte gibt, die (mich) glücklich machen, also doch Lebewohl sagen. Und so sage auch ich «Vielen Dank» – an wen auch immer: Die Dichter, die diese schönen Gedichte geschrieben haben; die Situationen, aus denen heraus sie entstanden, die Umstände, die sie ermöglichten – oder die sonderbaren Gehirne, die vielleicht nicht immer alltagstauglich waren, dafür aber wunderschöne kleine und große Kunstwerke hervorgebracht haben.
Natürlich haben all die ausgewählten Gedichte eine gewisse Leichtigkeit. Und natürlich kann man von einen solchen Band keine schwer verrätselten oder hermetischen Gedichte erwarten. Manche Namen setzen einen aber dennoch – oder gerade deswegen – in Erstaunen: Paul Celan z.B. oder Rose Ausländer. Und manche Autoren, die man zwar dem Namen nach kannte, von denen man aber noch wenig gelesen hat, lassen den Wunsch aufkommen, sich noch einmal etwas intensiver mit ihnen zu beschäftigen. So jedenfalls ging es mir mit den Gedichten von Hans Magnus Enzensberger, die in diesem Band abgedruckt sind. Schön, wie er in «Empfänger unbekannt – Retour a l’expediteur» das Glück der einfachen Dinge beschreibt: «Vielen Dank für die Wolken. Vielen Dank für das Wohltemperierte Klavier / und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel. / Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn… Vielen Dank für die vier Jahreszeiten, / für die Zahl e und das Koffein, und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller, / gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf / für den Schlaf ganz besonders, / und, damit ich es nicht vergesse, für den Anfang und das Ende / und die paar Minuten dazwischen / inständigen Dank, / meinetwegen auch für die Wühlmäuse draußen im Garten.»
Nach längerem Lesen in diesem Buch muss ich meiner Skepsis, ob es so etwas wie Gedichte gibt, die (mich) glücklich machen, also doch Lebewohl sagen. Und so sage auch ich «Vielen Dank» an wen auch immer: Die Dichter, die diese schönen Gedichte geschrieben haben; die Situationen, aus denen heraus sie entstanden, die Umstände, die sie ermöglichten – oder die sonderbaren Gehirne, die vielleicht nicht immer alltagstauglich waren, dafür aber wunderschöne kleine und große Kunstwerke hervorgebracht haben. ■
Clara Paul (Hrsg): Gedichte, die glücklich machen, Lyrik-Anthologie, 186 Seiten, Insel-Suhrkamp-Verlag, ISBN 978-3-458-35997-5
.
.
Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Georges Perec: «Was für ein kleines Moped…» (Erzählung)
.
«Na schön, sagten wir, es ist gelaufen»
Dr. Rainer Wedler
.
 Wenn es nicht so abgedroschen wäre, würde der Rezensent jetzt schreiben: Nach dem zweiten Buch, spätestens, kann man süchtig werden nach Perec. Nun ist Georges Perec schon einige Jahre tot, also nichts Neues mehr von ihm zu erwarten. Jetzt also habe ich mir das kleine Moped reingezogen. Ein Text, nicht einmal 80 Seiten, im Grunde nicht übersetzbar, ist von Eugen Helmlé kongenial ins Deutsche übertragen worden. Dem Diaphanes-Verlag ist zu danken, dass er mit «Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof?» bereits den fünften Titel dieses unverwechselbaren Franzosen neu auflegt. Gerade in diesem schmalen Buch ist der Einfluss zu erkennen, den der Kreis Oulipo um Raymond Queneau auf Perec gehabt hat.
Wenn es nicht so abgedroschen wäre, würde der Rezensent jetzt schreiben: Nach dem zweiten Buch, spätestens, kann man süchtig werden nach Perec. Nun ist Georges Perec schon einige Jahre tot, also nichts Neues mehr von ihm zu erwarten. Jetzt also habe ich mir das kleine Moped reingezogen. Ein Text, nicht einmal 80 Seiten, im Grunde nicht übersetzbar, ist von Eugen Helmlé kongenial ins Deutsche übertragen worden. Dem Diaphanes-Verlag ist zu danken, dass er mit «Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof?» bereits den fünften Titel dieses unverwechselbaren Franzosen neu auflegt. Gerade in diesem schmalen Buch ist der Einfluss zu erkennen, den der Kreis Oulipo um Raymond Queneau auf Perec gehabt hat.
Worum aber geht es? Das ist schnell erzählt. Auf dem Montparnasse treffen sich Tag für Tag ein paar Spezis bei reichlich Rotwein zu tiefgründigen Gesprächen über Helicop, Hegell und andere Sonderlinge. Abends stößt der Unteroffizier Henri Pollak dazu, der mit seinem petit velo jeden Tag zwischen der Kaserne und seiner Montparnasse-Holden hin- und herpendelt. Und dann das: Der Spezi Karasonstwas soll in den Algerienkrieg, den die Franzosen erst seit einigen Jahren nicht mehr Konflikt nennen. Karamagnole aber will sich nicht dazu bequemen, in den Djebels Algeriens herumzutoben. Also tagt der schräge Verein und berät, wie man Karabambuli aus der Patsche helfen kann. Ihm den Arm brechen, ihn auf verrückt trimmen, ihn einen Selbstmord vortäuschen lassen? Alles wird mit verquerer Akribie durchdekliniert und am Ende der Pseudo-Suicid unternommen, allerdings ohne den erhofften Erfolg zu zeitigen. Am Ende sitzt Karawick im Zug zur Verschiffung an die algerische Front.
All das hätte man auf einer Seite sagen können. Aber was ist Inhalt gegen die ungezügelte Sprachfantasie eines Perec? Da wird schwadroniert, bis die Schwarte kracht, und sprachgespielt, bis die Zunge zittert. Das Banale zieht das Hochgestochene zu sich herunter, dass einem schwindlich wird. Da wird tautologisiert, was das Zeug hält. Da mag es weit hergeholt sein, aber irgendwo ganz hinten im Hinterhirn klopft Rabelais an und sagt, grüß euch, ihr logorrhöen Brüder.

Dem Diaphanes-Verlag ist zu danken, dass er mit «Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof?» von Georges Perec bereits den fünften Titel dieses unverwechselbaren Franzosen neu auflegt. Nach Perec kann man süchtig werden.
Darüber und dahinter aber steht der Algerienkrieg, der die französische Jugend in Konfrontation zum Staat brachte, speziell natürlich zum Militär. Der Rezensent hat 1961 einige Wochen in einer Familie in Burgund verbracht, um seine miserablen Kenntnisse der Landessprache zu verbessern, was tatsächlich gelang, jedenfalls hat er sich viel auf der Straße, in Bistros und in Kinos herumgetrieben und erlebt, wie beim Auftauchen einer Uniform unflätige Bemerkungen gemacht, auch gepfiffen und gebuht wurde. Der Pazifismus ist das Lebensgefühl der französischen Jugend gewesen. Man darf auch nicht vergessen, dass der Indochinakrieg kaum beendet war, als in Nordafrika das Blutvergießen weiterging. Kein Wunder deshalb, dass Perec im «Vorspann» seines Buches verkünden kann: Ein von verschiedenen Militärakademien preisgekröntes Werk. Dem will der Rezensent nichts mehr hinzufügen. ■
Georges Perec: Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof? – Erzählung, Diaphanes Verlag, 80 Seiten, ISBN 978-3-03734-231-2
.
.
Ivan Sokolov: «Gewinnen in d4-Bauernstrukturen»
.
Verständnis für die Bauern
Dr. Mario Ziegler
.
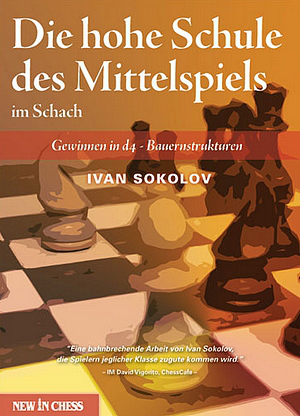 Nein, es geht in der folgenden Rezension nicht um die Agrarpolitik der EU, und auch nicht um die Situation des Dritten Standes in den Revolutionsjahren 1525 oder 1848. Vielmehr soll ein neues Strategiebuch besprochen werden, in dem die Bauern auf dem Schachbrett eine entscheidende Rolle spielen.
Nein, es geht in der folgenden Rezension nicht um die Agrarpolitik der EU, und auch nicht um die Situation des Dritten Standes in den Revolutionsjahren 1525 oder 1848. Vielmehr soll ein neues Strategiebuch besprochen werden, in dem die Bauern auf dem Schachbrett eine entscheidende Rolle spielen.
Sein Autor Ivan Sokolov ist in der Welt des Schachs eine bekannte Persönlichkeit. Der 1968 im bosnischen Jajce bei Banja Luka geborene Großmeister vertrat 1988 und 1990 Jugoslawien bei den Schacholympiaden in Thessaloniki und Novi Sad, wobei er 1988 mit seiner Mannschaft die Bronzemedaille erringen konnte. 1993 verließ er während des Bürgerkrieges seine Heimat und emigrierte in die Niederlande. Mit der niederländischen Auswahl errang er unter anderem den Sieg bei der Mannschafts-Europameisterschaft 2005 in Göteborg. Seit 2009 ist er für den bosnischen Schachverband spielberechtigt. Neben diesen Erfolgen und neben zahlreichen Siegen bei bedeutenden Turnieren trat er durch einige hochgelobte Schachbücher hervor. 2009 erschien sein Werk «Winning Chess Middlegames: An Essential Guide to Pawn Structures», das nun in deutscher Sprache vorliegt und Gegenstand der vorliegenden Besprechung sein soll.
Der Untertitel «Gewinnen in d4-Bauernstrukturen» könnte in die Irre führen. Sokolov will keineswegs alle d4-Eröffnungen oder auch nur einen repräsentativen Querschnitt beleuchten, sondern konzentriert sich auf die Nimzoindische Verteidigung 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4. Da der Autor ein Experte für diese Eröffnung ist und ihr kürzlich eine Monographie gewidmet hat («The strategic Nimzo-Indian. Vol. 1: A complete guide to the Rubinstein Variation», Alkmaar 2012), ist dies eine naheliegende Wahl. Zudem kann man Sokolov zustimmen, wenn er formuliert (S. 11): «Abgesehen davon, dass ein Verständnis dieser [der im Buch beleuchteten] Stellungen für alle, die mit Weiß 1.d2-d4 oder mit Schwarz Nimzoindisch spielen, von Nutzen ist, haben die nachstehenden kommentierten Partien den zusätzlichen praktischen Wert, dass sie definitiv das Eröffnungswissen des Lesers verbessern werden, was sich sofort in der Turnierpraxis niederschlagen kann.»
Das Zauberwort des Buches lautet «Bauernstruktur». Dass das Verständnis typischer Strukturen in einer bestimmten Eröffnung große Bedeutung besitzt, brachte bereits 1749 der große André Philidor in seinem berühmten Satz «Die Bauern sind die Seele des Schachspiels» («… les Pions. Ils sont l’âme des Echecs …») zum Ausdruck. Sokolov bedient sich jüngerer Beispiele, wenn er an das Schaffen der Weltmeister Karpow, Kasparow und Kramnik (S. 9) und seine eigene Praxis erinnert: «Über meine gesamte Karriere hinweg habe auch ich in den Stellungen, die ich gut verstand, eine ordentliche Punktausbeute erzielt und den Preis dafür bezahlt, dass ich in meiner Sturheit die Finger nicht von den Stellungstypen, die mir nicht lagen, lassen konnte.»
In seinem Werk konzentriert sich Sokolov auf die vier seiner Meinung nach (vgl. S. 9) wesentlichsten Bauernstrukturen: Doppelbauer, Isolani, Hängende Bauern und Bauernmajorität. Alle diese Formen sind noch weiter differenziert nach sogenannten Basisstrukturen. Dies sieht folgendermaßen aus (verdeutlicht am Beispiel der Hängenden Bauern, S. 179f.):
Beide Strukturen verdeutlichen einen weißen Standardplan: Abtausch auf e6, was fxe6 erzwingt, danach e3-e4, was Schwarz ein positionelles Zugeständnis abnötigt.
Weiß führt seinen Plan e3-e4 aus, ohne vorher auf e6 einen Figurentausch vorgenommen zu haben.
…demonstriert einen schwarzen Standardplan: …d5-d4, was die dynamischen Möglichkeiten der hängenden Bauern zur Geltung bringt.
Die einzelnen Basisstrukturen werden durch insgesamt 45 Partien beleuchtet, die den Zeitraum zwischen 1938 (Botwinnik-Tschechower, Leningrad) und 2008 (Topalow-Aronjan, Morelia/Linares) abdecken. Sokolov selbst ist mit 12 Partien vertreten. Dass er immer wieder seine eigenen Erfahrungen einfließen lässt, macht ein großes Plus des Werkes aus. Sokolov zeigt sehr eindrucksvoll, wie er selbst in einer bestimmten Position vorging, und spart dabei auch nicht mit Selbstkritik, wenn er falsche Wege beschritt. Hierzu ein Beispiel aus seiner Weißpartie gegen Darryl Johansen bei der Olympiade Manila 1992:
Hier setzte Sokolov mit 13.Tb1 fort, was er mit einem «?!» brandmarkt. In seinen Anmerkungen erläutert er diese Kritik am scheinbar naheliegenden Zug, der den Turm auf die halboffene Linie stellt (S. 15): «Für derartige Stellungen ist es typisch, dass Weiß seinen Raumvorteil und Entwicklungsvorsprung zur Entfaltung von Initiative nutzen muss, bevor seine strukturellen Mängel sich bemerkbar zu machen beginnen. 13.f4! war ein guter und energischer Anfang … In der Partie sah ich schon die mit 13.f4! assoziierten Möglichkeiten, dachte aber, dass ich mit Weiß gegen irgendeinen Australier mit einer Elo-Zahl von noch nicht einmal 2500 nur ‚reguläre‘ Züge zu machen brauchte und sich der Sieg ohne große Risiken wie von selbst einstellen sollte. Eine solche Denkweise ist vielleicht in einem Abspiel der Katalanischen Eröffnung mit Weiß vertretbar, aber nicht in diesem Typ von Nimzoinder.»
Neben solchen allgemeinen Überlegungen geht Sokolov jedoch auch in die Tiefe. Seine Analysen zu bestimmten Zügen können durchaus mehr als eine Spalte einnehmen, so dass der Leser bereit sein muss, einige Zeit und Mühe für die Arbeit mit dem Buch aufzuwenden. Der englische Großmeister Michael Adams weiß offensichtlich, wovon er spricht, wenn er in seinem Vorwort anmerkt (S. 8): «Vereinsspieler sollten sich nicht entmutigen lassen, wenn der Variantenwust mitunter etwas beängstigend erscheint.» Um einen Einblick in Sokolovs Analysen zu geben, bot sich ein Vergleich an. Auf S. 89ff. wird zum Thema «Das Spiel gegen einen isolierten Bauern» die Partie Iwantschuk-Aronjan, Morelia 2007, untersucht. Zu dieser Partie liegt neben der Analyse von Mihail Marin in der «MegaBase» der Firma ChessBase auch eine Untersuchung von Nikolai Kalinichenko in seiner kürzlich veröffentlichten Monographie über Iwantschuk vor («Vassily Ivanchuk. 100 Selected Games, Alkmaar 2013, S. 152ff.). Es war ein reizvolles Unternehmen, die Gedankengänge und Arbeitsweisen der drei Großmeister zu vergleichen.
Dies ist die Stellung nach dem 16. Zug von Schwarz. Iwantschuk spielte nun das überraschende 17. Tcc1
Sokolov erklärt – ebenso wie Marin – die Idee dieses Zuges: «Weiß behält die Türme auf dem Brett, um den schwachen Bauern d5 aufs Korn nehmen zu können. Schwarz kann seinerseits aus der Kontrolle der c-Linie kein Kapital schlagen.» Die drei Kommentatoren sind sich aber ansonsten über den Wert des Zuges und damit verbunden die Bewertung der Stellung nicht einig. Sokolov und Kalinichenko werten den Rückzug des Turms als sehr stark (!! bzw. !), während sich Marin mit !? begnügt. Im Vergleich zu seinen Kollegen kritisiert er in der Folge das schwarze Spiel deutlich stärker.
17…Tfc8
Dieser Zug bleibt von Sokolov unkommentiert, während Kalinichenko und Marin auf die Möglichkeit 17…Txc1+ verweisen. Kalinichenko hält diesen Abtausch, der die Stellung weiter vereinfacht, für eine ernstzunehmende Alternative, Marin sogar für die bessere Fortsetzung, weshalb er den Partiezug 17…Tfc8 mit einem ?! versieht.
18.Td1 Tc2 19.Lb5 Sf8 20.Tab1 T2c7 21.La4 Se6 22.Lb3 Kf8 23.h3
Sokolov: «Weiß will den Bauern d5 zu seinen eigenen Bedingungen nehmen. Das sofortige Schlagen dieses Bauern würde zu einem remislichen Endspiel führen: 23.¥xd5?! ¥xd5 24.¦xd5 ¦c1+ 25.¦d1 ¦xb1 26.¦xb1 ¦c2, und dank seines aktiven Turms sollte Schwarz die Stellung halten können.» Beide anderen Kommentatoren übergehen diese Variante.
23…Tc5 24.Kh2
Diesen Zug hebt Sokolov als einziger besonders hervor, indem er ihn mit !! schmückt und anmerkt: «Weicht dem Schach auf c1 aus, um auf der d-Linie die Türme zu verdoppeln. Es ist sehr wichtig für Weiß, alle vier Türme auf dem Brett zu behalten.»
24…Ke7 25.Td2 Tb5 26.La2 Tbc5 27.Se1 a5
Als einziger analysiert Sokolov die Fortsetzung 27…Tc1, die jedoch Schwarz nicht aus seinen Schwierigkeiten gerettet hätte.
28.Tbd1 Td8 29.Kg3 Tb5 30.f3 Tc8
Wird von allen Kommentatoren als Fehler gekennzeichnet, allenfalls in der Frage, ob 30…Sc5 (Sokolov) oder 30…Tc5 (Kalinichenko, Marin) hartnäckigeren Widerstand versprach, gibt es Diskrepanzen.
31.Sd3!
«Wegen der Drohung 32.a4 mit Turmfang muss Schwarz einen Bauern geben.» (Sokolov). Nicht eingegangen wird auf die (unzureichende) Verteidigung 31…a4, die Kalinichenko und Marin analysieren. Auch bei den restlichen Zügen der Partie hält sich Sokolov deutlich knapper als die beiden anderen Analytiker, was aber angesichts seiner Zielsetzung – Besprechung eines bestimmten Stellungstyps – verständlich ist. Für eine solche Erörterung sind die restlichen Züge nicht mehr relevant.
31…d4 32.Lxe6 Kxe6 33.Sf4+ Ke7 34.Txd4 Tc7 35.T1d2 Tbc5 36.e4 Tc4 37.Td6 T4c6 38.e5 Tc2 39.Txc2 Txc2 40.Txb6 Lc6 41.b4 g5 42.Sh5 axb4 43.axb4 Ld5 44.Sg7 Te2 45.Sf5+ Ke8 46.Sxh6 Le6 47.Tb5 Tb2 48.Tb8+ Kd7 49.Tg8 1–0

An wen richtet sich Sokolovs «Gewinnen in d4-Bauernstrukturen»? Zielgruppe sind die geübten Vereinsspieler, da sowohl das Thema der Basisstrukturen als auch die Tiefe der Analysen eine gehobene Spielstärke voraussetzen. Darüber hinaus ist das Buch für jeden Nimzoindisch-Spieler (mit Weiss und mit Schwarz) grundlegend. Überhaupt ist zu wünschen, dass der Aspekt der charakteristischen Bauernstrukturen in künftigen Lehrbüchern noch stärker Berücksichtigung finde.
An wen richtet sich Sokolovs Werk? Ganz offensichtlich ist die Zielgruppe diejenige der geübten Vereinsspieler, da sowohl das Thema der Basisstrukturen als auch die Tiefe der Analysen eine gehobene Spielstärke voraussetzen. Darüber hinaus sollte das Buch für jeden Nimzoindisch-Spieler grundlegend sein, ebenso für Weißspieler, die sich mit den untersuchten Strukturen des Nimzoinders herumschlagen müssen. Für diese Spieler wird «Die hohe Schule des Mittelspiels im Schach» ein hervorragendes Hilfsmittel zum besseren Verständnis der typischen Mittelspielpositionen sein. Es ist zu wünschen, dass der Aspekt der charakteristischen Bauernstrukturen in künftigen Lehrbüchern noch stärker Berücksichtigung finden wird. ■
Ivan Sokolov: Die hohe Kunst des Mittelspiels im Schach – Gewinnen in d4-Bauernstrukturen, New in Chess, 288 Seiten, ISBN 978-90-5691-432-5
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Interessante Musik-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Hans-Günter Heumann: «The Beatles – 50 Mega-Hits»
 Noch immer sorgen sie für üppig Sekundärliteratur, die vier innovativen Pop-Pilzköpfe aus Liverpool – The Beatles und kein Ende. Im Bosworth-Musik-Verlag wird unterm Label «Kult-Bands» jetzt eine Sammlung von «50 Mega-Hits der legendären britischen Beat-Band» vorgelegt. Herausgeber & Arrangeur H.G. Heumann nahm – chronologisch exakt aufgelistet von 1962 bis 1970 – praktisch alle Beatles-Songs auf, die in jenen Jahren weltweite Pop-Geschichte schrieben. Jedes Notenstück wird dabei garniert mit Anmerkungen des Musikjournalisten Ernst Hofacker zu Entstehung und Rezeption des jeweiligen Songs. Heumanns Bearbeitungen sind durchwegs stark vereinfacht und leicht spielbar, tragen aber doch der spezifischen Rhythmik und Harmonik der Stücke meist stilsicher Rechnung. Im Verbund mit den Akkordangaben und der traditionellen Hand-Verteilung («links = Begleitung / rechts = Melodie») sind die Songs auch problemlos für das Keyboard-Spiel verwendbar. Insgesamt eine auch buchbinderisch gediegene Edition, die ihren Weg in die Tasten-Unterrichtsstuben wohl finden dürfte. (we) ■
Noch immer sorgen sie für üppig Sekundärliteratur, die vier innovativen Pop-Pilzköpfe aus Liverpool – The Beatles und kein Ende. Im Bosworth-Musik-Verlag wird unterm Label «Kult-Bands» jetzt eine Sammlung von «50 Mega-Hits der legendären britischen Beat-Band» vorgelegt. Herausgeber & Arrangeur H.G. Heumann nahm – chronologisch exakt aufgelistet von 1962 bis 1970 – praktisch alle Beatles-Songs auf, die in jenen Jahren weltweite Pop-Geschichte schrieben. Jedes Notenstück wird dabei garniert mit Anmerkungen des Musikjournalisten Ernst Hofacker zu Entstehung und Rezeption des jeweiligen Songs. Heumanns Bearbeitungen sind durchwegs stark vereinfacht und leicht spielbar, tragen aber doch der spezifischen Rhythmik und Harmonik der Stücke meist stilsicher Rechnung. Im Verbund mit den Akkordangaben und der traditionellen Hand-Verteilung («links = Begleitung / rechts = Melodie») sind die Songs auch problemlos für das Keyboard-Spiel verwendbar. Insgesamt eine auch buchbinderisch gediegene Edition, die ihren Weg in die Tasten-Unterrichtsstuben wohl finden dürfte. (we) ■
Hans-Günter Heumann: The Beatles – 50 Mega-Hits, Leichte Arrangements für Klavier, 302 Seiten, Bosworth Music, ISBN 978-3865437945
.
.
.
.
.
Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Reinhard Wosniak: «Felonie» (Roman)
.
Das Motiv der Freiheit
Dr. Wolfgang Dalk
.
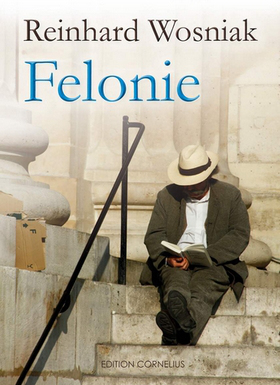 Der Frohburger Schriftsteller Reinhard Wosniak legt mit «Felonie» eine umfängliche Familiensaga vor. Doch 555 Seiten sind noch nicht genug. Er verweist darauf, dass «Felonie» das «erste Buch» sei. Das heißt auf eine Fortsetzung hoffen. Das ist auch gut so. Denn die Geschichte von Begegnung und Trennung, Entfremdung und Verlust, Treue und Verrat wirkt noch nicht vollendet. Es bleiben Fragen. Wenn die in einem weiteren Band angegangen werden, schlösse sich ein Kreis, den Wosniak sehr behutsam geöffnet hat, um seine Leser mit Worten und Sätzen in die Geschichte des Max Guttentag und seiner Familie hineinzuziehen und nicht gleich wieder zu entlassen. Da reflektiert der Leser wohl zu Recht auf ein weiteres Leseabenteuer. Ja, es ist ein Abenteuer. Wosniak präsentiert seine Saga in so ungewöhnlichen Bezügen, dass es abenteuerlich wird. Aber auch sein Sprachumgang lässt aufmerken. Es ist vor allem einer, der auf berückende Weise Sprache verdichtet, sie zum Klingen bringt, sie eben zu etwas immer Neuem macht.
Der Frohburger Schriftsteller Reinhard Wosniak legt mit «Felonie» eine umfängliche Familiensaga vor. Doch 555 Seiten sind noch nicht genug. Er verweist darauf, dass «Felonie» das «erste Buch» sei. Das heißt auf eine Fortsetzung hoffen. Das ist auch gut so. Denn die Geschichte von Begegnung und Trennung, Entfremdung und Verlust, Treue und Verrat wirkt noch nicht vollendet. Es bleiben Fragen. Wenn die in einem weiteren Band angegangen werden, schlösse sich ein Kreis, den Wosniak sehr behutsam geöffnet hat, um seine Leser mit Worten und Sätzen in die Geschichte des Max Guttentag und seiner Familie hineinzuziehen und nicht gleich wieder zu entlassen. Da reflektiert der Leser wohl zu Recht auf ein weiteres Leseabenteuer. Ja, es ist ein Abenteuer. Wosniak präsentiert seine Saga in so ungewöhnlichen Bezügen, dass es abenteuerlich wird. Aber auch sein Sprachumgang lässt aufmerken. Es ist vor allem einer, der auf berückende Weise Sprache verdichtet, sie zum Klingen bringt, sie eben zu etwas immer Neuem macht.
In herausgeputzten Sätzen und Wörtern, rätselhaftem Sprachmaterial erzählt er so, dass der Leser erstaunt die Augenbraue hisst und seine Aufmerksamkeit inhaltlich wie sprachlich befeuert wird. Schon mit dem Buchtitel versucht er, Interesse zu wecken und eine bestimmte Erwartungshaltung zu erzeugen: «Felonie». Ich gebe gern zu, dass ich nachschlagen musste, um auf die Erklärung «Untreue, Treuebruch, Verrat» zu kommen, auf einen Begriff also, der mit Bedacht auch noch «den Bruch des Lehnseides; die Verweigerung der mittelalterlichen Lehnsdienste» einschließt. Die Ergänzung ist insofern wichtig, als im Verlaufe des Romans viele Facetten gerade dieses begrifflichen Nachklangs in das klug durchdachte Erzählgerüst eingebracht werden, um die Tiefen und Höhen des Geschehens in einem eigentümlichen Verbund mittelalterlicher und neuzeitlicher Ehrbegriffe zu fixieren.
«Felonie» ist ein Zeitgeschichtsroman, der den Zug schlesischer Familien durch die jüngste Zeit aufnimmt und in den Mittelpunkt Max Guttentag und dessen unruhige Suche nachdem stellt, was er nicht «Freiheit» nennen, aber auch nicht das «Frei sein» heißen mag. Es ist etwas, das ihn treibt, ohne gleich Auskunft zu geben wohin, wozu, weshalb. Und so stürzt alles in ihm und um ihn herum auf ein Ende zu, dem Felonie innewohnt. Er weiß es. Er muss den Lehnseid brechen, den Lehnsdienst aufkündigen, um «die höchste Form von Freiheit» erreichen zu können, die mit dem Selbstbewusstsein der Offensive wünscht, «alles selbst in der Hand zu haben».

«Komplexe poetische Studien über Einsamkeit und verheerende Seelenzustände»: Schriftsteller Reinhard Wosniak (*1953)
Mit den Überlegungen, Freiheit wozu, Freiheitssehnsucht mit welchem Ziel, Freiheit-f-Moll wohin und warum, ist Max Guttentag keineswegs am Ende, als er seinen Verrat begeht an Ehefrau, Sohn, Stadt, Land, an Freunden und an sich. So schweigt er in einer stillen «Übereinkunft unter Schweigenden.» Doch eben nicht immer. Im Diesseits durch Krieg, Flucht und Nachkrieg entwurzelt, wirft er Fragen auf, die uns die Zeitläufte stellen, nach dem etwa, was die deutsche Vergangenheit an Ablagerungen in der Seele hinterlassen hat, Fragen auch, die das Leben an jeden immer und überall stellt, wie es denn zu leben sei, in diesem Deutschland, das sein Selbstvertrauen verloren hatte und noch unter Mühen dabei ist, es wiederzufinden.
Drei deutsche Welten zwischen denen sich die Handlung spannt. Einmal die schlesische Welt, eher als Abgesang vergangener Zeit, die ostdeutsche und DDR-Welt als Hoffnungsentwurf für die einen, als bloßer Abklatsch bekannter Diktatur für die anderen und die westdeutsche Welt, so als materiell bestimmter Gegenentwurf zu den brotarmen Idealen des Ostens. Dafür schafft Wosniak Standbilder, an denen sich der Leser festhalten kann. Das schlesische Heimatsehnen, das bröckelnde Ost-Schloss mit seinen möglichen Aus- und Einsichten und West-Klischees, die gut beobachtet und beschrieben sind. Dazu gehören auch eindringliche Menschenbilder, Landschaftsbeschreibungen, Naturschilderungen und Behausungen. Häuser werden in Gärten gebettet. Und immer mal wieder rücken Gartenarbeit, Gartenstücke, Gärtnereien ins Erzählzentrum in Sinne von «cultus» (Anbau und Pflege von Pflanzen), auch von «kultivieren» (bebauen, urbar machen). Ein guter Griff in die Sinnbilder.
Zimmer werden ausgestaltet, meist karg, aber funktionsgebunden. Räume erschließen sich in den Bewegungen der Menschen, die sie mit ihren Schritten und Erleben vermessen. Konkrete Orte also. Und doch sind sie auch Nicht-Orte, die wirken, als wären sie zu den Rändern hin undicht. Es sind nicht beheimatende Orte, es ist, als öffne sich unter ihnen ein Abgrund, es ist, als wäre die Wirklichkeit nur ein Raster – darunter drohendes Dunkel, auf dem auch überfallartig so etwas aufkommen kann wie der entsetzliche «Rotbart»-Mord gegen Ende des 1. Bandes.
Reinhard Wosniak erregte die Aufmerksamkeit einer historisch interessierten Leserschaft bereits mit dem Roman «Stilicho» (1989), mit der deutsch-deutschen Einheitsgeschichte «Sie saß in der Küche und rauchte» (1995) sowie dem Essay-Band «Morbis» – eine Krankheit in Europa (1998).
In «Felonie» ist es Max Guttentag, der in den Bann zieht. Zieht er auch Sympathie auf sich? Heute hieße die Antwort wohl so mancher Leser «nicht wirklich» und meint, dass die Zentralfigur des Romans kein Held in der Rolle des Sympathieträgers sei. Zu bekannt will dem Leser die Freiheitssehnsucht scheinen und zeitgleich so fremd. Erst recht die Konsequenz. Der Verrat. Zu schweigsam, zu verklemmt ist die Hauptfigur, um ein sympathischer Held zu sein. Max Guttentag wirkt wie eine Figur, die nie in der Gegenwart ankommen kann. Zu viel hat sie zu jung erlebt und nicht verarbeiten können. So ist er bei aller Straffheit und allem Geradeaus-Denken ein irrlichternder Mann mit seinen Unsicherheiten, die er auch wissentlich anderen auflädt. Natürlich seiner Frau. Diese toughe, praktisch orientierte und tätig zugreifende Hanna, die nicht nachzuvollziehen vermag, was diesen Mann an ihrer Seite so bodenlos schwebend hält. Von den Notwendigkeiten des Alltags fern. Auch als Vater eher ein Nehmender als ein Gebender. Abgehoben eben. Es scheint dem Leser schon etwas verwegen, mit diesem Typen eine Handlung zu weben, ja mit ihm eine fesselnde Familiensaga zu beginnen – doch das Erstaunliche gelingt Wosniak. Denn der Autor lässt in einer Art Suchbewegung durch die Biographie der Familien diesen Mann auf Suche sein. Daraus werden Studien über Einsamkeit und über verheerende Seelenzustände, wo Gemütsschäden scharf ausgeleuchtet werden. Max gerät dabei langsam, aber folgerichtig zu einem Menschen, der vor sich selber auf der Couch liegt und dem niemand zuhört, abgesehen von ihm selbst. Etwas in ihm beginnt, innere Tapeten abzugreifen, als sei er selber ein leerer Raum mit altmodischen Mustern der Vergangenheit beklebt. Die gilt es abzureißen, als könnte das einen Neuanfang basieren.

Reinhard Wosniaks poetische Verfahren in seinem neuen Roman “Felonie” sind komplex. Ein Buch aber auch, das zum Verweilen bei Formulierungen, Wortbezügen, Bildern einlädt, vor allem zum Sinnieren über das zentrale Motiv der Freiheit, des Frei-Seins, des Sich-Verweigerns, des angepassten Mit-Tuns und schließlich des Dazwischen-Seins.
Wosniaks poetische Verfahren sind komplex. Er lockt mit der Familie Wildenschwert und deren Sound des schlesischen Gemüts in die Alltäglichkeit, steigt mit Hieronymus Stamer in hochgeistige Sphären und mit Prof. Huldreich Webersinke gar in wissenschaftliche Dimensionen. Dazwischen finden sich herrliche Formulierungen wie «die unschlesische Schmallippigkeit ihres Mundes» oder «sich mit dem überschaubaren Erfolg seiner Bemühungen abfinden» oder «Wolkenfetzen von widerlicher Unentschlossenheit».
Ein Buch, das zum Verweilen bei Formulierungen, Wortbezügen, Bildern einlädt, vor allem natürlich zum Sinnieren über das zentrale Motiv der Freiheit, des Frei-Seins, des Sich-Verweigerns, des angepassten Mit-Tuns und schließlich das Dazwischen-Seins. Und (zum Schluss nochmals betont): ein Buch, das auf eine Fortsetzung hoffen lässt. ■
Reinhard Wosniak: Felonie – Roman, Edition Cornelius, 555 Seiten, ISBN 978-3954863679
______________________________________
 Dr. Wolfgang Dalk
Dr. Wolfgang Dalk
Geb. 1943, nach dem Abitur Armeezeit und Studium Germanistik/Geschichte in Rostock, Promotion zur Synonymie des Verbs, zahlreiche Veröffentlichungen zu Werken der darstellenden und bildenden Kunst sowie von Buchrezensionen, lebt in Rostock/D
.
.
.
.
.
.
Interessante Musik-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Hans-Günter Heumann: «Keyboard gefällt mir!»
 Nach seiner bekannt gewordenen Reihe «Piano gefällt mir!» legt Bosworth nun mit «Keyboard gefällt mir!» ein Analogon für das Keyboard auf. Als Herausgeber amtet dabei Musikpädagoge Hans-Günter Heumann, zweifellos einer der rührigsten deutschen Arrangeure von Popmusik für Tasteninstrumente. Die gediegen präsentierte, mit sauberem Notenbild und übersichtlichem Layout gestaltete Anthologie versammelt 50 ältere und neuere Hits & Songs aus den Pop-Charts und der Welt des Films. Von Adele bis Rihanna und von «Amélie» bis «Twilight» reicht dabei das Spektrum. Jedes der einstimmig gesetzten Stücke hat Heumann mit Angaben zu Lead-Sound (Voice) und Tempo sowie mit den Griffbildern der jeweils verwendeten Akkorde versehen. Die Schwierigkeitsgrade der Sammlung bewegen sich zwischen leicht bis mittelschwer, sie decken ungefähr die Levels ab zweitem bis fünftem Unterrichtsjahr ab.
Nach seiner bekannt gewordenen Reihe «Piano gefällt mir!» legt Bosworth nun mit «Keyboard gefällt mir!» ein Analogon für das Keyboard auf. Als Herausgeber amtet dabei Musikpädagoge Hans-Günter Heumann, zweifellos einer der rührigsten deutschen Arrangeure von Popmusik für Tasteninstrumente. Die gediegen präsentierte, mit sauberem Notenbild und übersichtlichem Layout gestaltete Anthologie versammelt 50 ältere und neuere Hits & Songs aus den Pop-Charts und der Welt des Films. Von Adele bis Rihanna und von «Amélie» bis «Twilight» reicht dabei das Spektrum. Jedes der einstimmig gesetzten Stücke hat Heumann mit Angaben zu Lead-Sound (Voice) und Tempo sowie mit den Griffbildern der jeweils verwendeten Akkorde versehen. Die Schwierigkeitsgrade der Sammlung bewegen sich zwischen leicht bis mittelschwer, sie decken ungefähr die Levels ab zweitem bis fünftem Unterrichtsjahr ab.
Wünschbar für den zeitsparenden Einsatz im Keyboardunterricht wären noch Fingersatz-Angaben gewesen – doch auch so eine attraktive Zusammenstellung und sicher eine Bereicherung der Keyboard-Literatur, die viele stilistische Geschmacksrichtungen abdeckt. ■
Hans-Günter Heumann: Keyboard gefällt mir / Von Adele bis Twilight, 168 Seiten, Bosworth Music, ISBN 978-3865438003
.
.
Jakob David Rattinger: «L’univers de Marin Marais»
 Der im österreichischen Graz geborene Gamben-Virtuose und Regensburger Hochschullehrer für Alte Musik Jakob David Rattinger, Schüler u.a. der berühmten Schola Cantorum Baseliensis, ist einer der profiliertesten Vertreter seines Faches. Bekannt als exquisiter Kenner, Herausgeber und Interpret musikhistorischer Aufführungspraxen ist er international unterwegs in Hör- und Konzertsäälen. Bereits vor einigen Jahren erschien Rattingers erste solistische CD mit dem Titel «L’univers de Marin Marais», jetzt legt er die gleiche Einspielung als New Remastered Edition im TYXart-Audio-Label neu auf. Ihm zur Seite musizieren der Theorbist Rosario Conte und der Clavecinist Ralf Waldner, versammelt sind auf der Platte eine Reihe von bedeutenden altfranzösischen Gamben-Komponisten rund um diverse Werke des Lully-Adepten Marin Marais (1656-1728): A. und J.-B. Forqueray, Sainte-Colombe, F. Couperin u.a.
Der im österreichischen Graz geborene Gamben-Virtuose und Regensburger Hochschullehrer für Alte Musik Jakob David Rattinger, Schüler u.a. der berühmten Schola Cantorum Baseliensis, ist einer der profiliertesten Vertreter seines Faches. Bekannt als exquisiter Kenner, Herausgeber und Interpret musikhistorischer Aufführungspraxen ist er international unterwegs in Hör- und Konzertsäälen. Bereits vor einigen Jahren erschien Rattingers erste solistische CD mit dem Titel «L’univers de Marin Marais», jetzt legt er die gleiche Einspielung als New Remastered Edition im TYXart-Audio-Label neu auf. Ihm zur Seite musizieren der Theorbist Rosario Conte und der Clavecinist Ralf Waldner, versammelt sind auf der Platte eine Reihe von bedeutenden altfranzösischen Gamben-Komponisten rund um diverse Werke des Lully-Adepten Marin Marais (1656-1728): A. und J.-B. Forqueray, Sainte-Colombe, F. Couperin u.a.
Eine ebenso musikgeschichtlich interessante wie klanglich und interpretatorisch referentielle Aufnahme – keineswegs nur für Liebhaber der ehrwürdigen Viola da gamba. ■
Jakob Rattinger / Rosario Conte / Ralf Waldner: L’univers de Marin Marais, Stücke für Gambe / Theorbe / Clavecin, Audio-CD 66:35 Min. TYXart
.
.
.
Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Interessante Buch-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Marion Bönsch-Kauke: «Schach im Kindergarten»
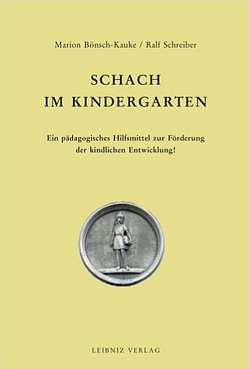 Die ostdeutsche (Schach-)Psychologin Dr. Marion Bönsch-Kauke hatte sich schon vor Jahren mit meta-schachlichen Studien zum Spiel der Könige beschäftigt: In ihrem Band «Klüger durch Schach» untersuchte sie grundsätzliche Aspekte der Schachpädagogik. Letztere steht auch im Zentrum ihrer jüngsten Publikation: In «Schach im Kindergarten» will sie mit Co-Autor Ralf Schreiber «eine Forschungsreportage mitten aus dem pulsierenden Leben im Alltag des Kindergartens» liefern, wobei die Monographie basiert auf umfangreichem Erfahrungsmaterial von schachspielenden 3- bis 6-jährigen Kindern. Das euphorische Fazit der Autorin: «Schüchterne Kinder wagten, den Mund aufzumachen. Tobende, lärmende, unruhestiftende Kinder wurden ruhiger beim Spiel. Entwicklungsauffällige, “gestörte”, kaum führbare, relativ schwierige Problemkinder besserten sich. Unterschätzte Kids zeigten ein neues Gesicht. Stille Begabungen wurden transparent.» Kurzum: das schachwissenschaftliche Projekt habe gezeigt, dass sich das Schachspiel im Kindergarten als hervorragendes pädagogisches Hilfsmittel bewährt habe und die Entwicklung der Kinder spürbar stimuliere. – Bemerkenswertes Experiment. (we) ■
Die ostdeutsche (Schach-)Psychologin Dr. Marion Bönsch-Kauke hatte sich schon vor Jahren mit meta-schachlichen Studien zum Spiel der Könige beschäftigt: In ihrem Band «Klüger durch Schach» untersuchte sie grundsätzliche Aspekte der Schachpädagogik. Letztere steht auch im Zentrum ihrer jüngsten Publikation: In «Schach im Kindergarten» will sie mit Co-Autor Ralf Schreiber «eine Forschungsreportage mitten aus dem pulsierenden Leben im Alltag des Kindergartens» liefern, wobei die Monographie basiert auf umfangreichem Erfahrungsmaterial von schachspielenden 3- bis 6-jährigen Kindern. Das euphorische Fazit der Autorin: «Schüchterne Kinder wagten, den Mund aufzumachen. Tobende, lärmende, unruhestiftende Kinder wurden ruhiger beim Spiel. Entwicklungsauffällige, “gestörte”, kaum führbare, relativ schwierige Problemkinder besserten sich. Unterschätzte Kids zeigten ein neues Gesicht. Stille Begabungen wurden transparent.» Kurzum: das schachwissenschaftliche Projekt habe gezeigt, dass sich das Schachspiel im Kindergarten als hervorragendes pädagogisches Hilfsmittel bewährt habe und die Entwicklung der Kinder spürbar stimuliere. – Bemerkenswertes Experiment. (we) ■
Marion Bönsch-Kauke / Ralf Schreiber: Schach im Kindergarten – Ein pädagogisches Hilfsmittel zur Förderung der kindlichen Entwicklung, 408 Seiten, Leibniz Verlag (St. Goar), ISBN 978-3931155056
.
.
Johanna Heutling: «Wörterbuch Musik / Dictionary of Music»
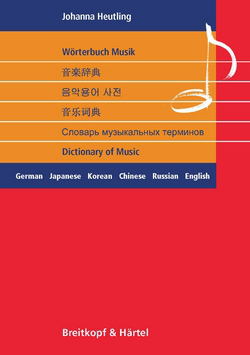 Mit ihrem «Wörterbuch Musik» in den sechs weltumspannenden Sprachen Englisch, Chinesisch, Russisch, Deutsch, Japanisch und Koreanisch offeriert die Autorin eine weitgehende Abdeckung des internationalen Grundwortschatzes Musik. Angesprochen fühlen von den Kompendium sollen sich vor allem ausländische Musikstudierende an Musikhochschulen, -akademien, -konservatorien und -universitäten, aber auch grundsätzlich die Institutionen, die sich mit der Vermittlung von Musik beschäftigen: «Um eine erfolgreiche Eingliederung in den Studien- und Berufsalltag zu ermöglichen, ist es erforderlich, auch die fachspezifische Terminologie zu vermitteln».
Mit ihrem «Wörterbuch Musik» in den sechs weltumspannenden Sprachen Englisch, Chinesisch, Russisch, Deutsch, Japanisch und Koreanisch offeriert die Autorin eine weitgehende Abdeckung des internationalen Grundwortschatzes Musik. Angesprochen fühlen von den Kompendium sollen sich vor allem ausländische Musikstudierende an Musikhochschulen, -akademien, -konservatorien und -universitäten, aber auch grundsätzlich die Institutionen, die sich mit der Vermittlung von Musik beschäftigen: «Um eine erfolgreiche Eingliederung in den Studien- und Berufsalltag zu ermöglichen, ist es erforderlich, auch die fachspezifische Terminologie zu vermitteln».
Aufgeteilt wurden die Musikthemata in die Kapitel Allgemeines (Musikleben, Studium, Institutionen etc.), Musiktheorie, Musikgeschichte/ Formenlehre, Musikpädagogik, Instrumental-/ Gesangsunterricht, Instrumentenkunde und Vortragsbezeichnungen.
Der Band ist lexikalisch-übersichtlich gegliedert, jeder Terminus wird 6-sprachig und 1-zeilig auf Doppelseiten hinweg übersetzt, ebenfalls in den sechs Sprachen wird schließlich der gesamte Begriffsapparat in die einzelnen Sprach-Register aufgeschlüsselt. – Nützlich. (we) ■
Johanna Heutling: Wörterbuch Musik, 388 Seiten, Breitkopf & Härtel Musikverlag, ISBN 978-3-7651-0397-1
.
.
Weitere Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
.
Interessante Musik-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Alexandra Fink: «20 Noten-Kreuzworträtsel für Fortgeschrittene»
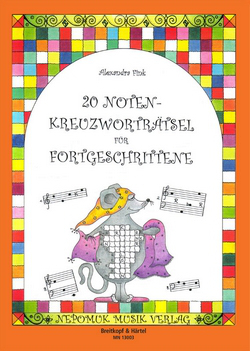 Bereits mit ihren «50 Notenwitzen» sowie ihren «20 Noten-Kreuzworträtsel / Heft 1» sorgte die Musikpädagogin und Autorin Alexandra Fink für schmunzelnde Lernmotivation in den Musikschulzimmern. Nun legt sie nach für eher fortgeschrittene Noten-Zöglinge: 20 Kreuzworträtsel enthält das neue Heft aus der Nepomuk-Edition des Breitkopf&Härtel-Verlages. Nach festem Muster (Linke Seite = Zahlengitter, rechte Seite = Linien & Noten) werden mit amüsanten Zeichnungen nach Notennamen und Lösungswörtern gesucht.
Bereits mit ihren «50 Notenwitzen» sowie ihren «20 Noten-Kreuzworträtsel / Heft 1» sorgte die Musikpädagogin und Autorin Alexandra Fink für schmunzelnde Lernmotivation in den Musikschulzimmern. Nun legt sie nach für eher fortgeschrittene Noten-Zöglinge: 20 Kreuzworträtsel enthält das neue Heft aus der Nepomuk-Edition des Breitkopf&Härtel-Verlages. Nach festem Muster (Linke Seite = Zahlengitter, rechte Seite = Linien & Noten) werden mit amüsanten Zeichnungen nach Notennamen und Lösungswörtern gesucht.
Eröffnet wird der Band mit einer kurzen Zusammenstellung aller abgefragten Noten sowohl im Violin- als auch im Bass-Schlüssel, danach wird systematisch ein recht weiter Tonraum vom Großen Des bis zum Zweigestrichenen C abgefragt. – Eine schöne Aufbereitung des bei vielen Kids verpönten Musiknoten-Paukens. ■
Alexandra Fink: 20 Noten-Kreuzworträtsel für Fortgeschrittene, 48 Seiten, Edition Nepomuk / Breitkopf&Härtel, MN 13003
.
.
Caroline Sanderson: «Someone like… Adele»
 Die ebenso rasante wie faszinierende Karriere der 1988 in London geborenen Pop-Sängerin und -Writerin Adele Atkins von der unbekannten Vorort-Altistin bis zum globalen Gesangs-Kultstar ist sogar für unsere schnelllebigen Pop-Zeiten beispiellos. Mittlerweile gibt der makellose, dabei sehr emotionale Livegesang dieser Künstlerin, begleitet nur von einem Flügel, auch der Musikkritiker-Presse einhellig Anlass zu Lob in den höchsten Tönen.
Die ebenso rasante wie faszinierende Karriere der 1988 in London geborenen Pop-Sängerin und -Writerin Adele Atkins von der unbekannten Vorort-Altistin bis zum globalen Gesangs-Kultstar ist sogar für unsere schnelllebigen Pop-Zeiten beispiellos. Mittlerweile gibt der makellose, dabei sehr emotionale Livegesang dieser Künstlerin, begleitet nur von einem Flügel, auch der Musikkritiker-Presse einhellig Anlass zu Lob in den höchsten Tönen.
Die englische Journalistin und Biographin Caroline Sanderson zeichnet mit großer Sympathie Adeles bisherigen Weg, legt neue Facetten ihrer noch jungen, aber starken Persönlichkeit und ihres internationalen Bezugsnetzes frei – und geht von verschiedenen Seiten her der Frage nach, warum das einzigartige Timbre und die Ausstrahlung dieser Stimme ein weltweites-Millionen-Publikum in den Bann zu schlagen und inzwischen sämtliche Chart-Listen zu erobern vermag. – Informativ geschrieben, mit einigen neueren Fotos. ■
Caroline Sanderson: Someone like… Adele, Biographie (Übersetzung aus dem Englischen), 208 Seiten, Bosworth Edition, ISBN 9783865437341
.
.
.
Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Joachim Zelter: «Einen Blick werfen» (Literaturnovelle)
.
Selim Hacopian hat ein Buch geschrieben
Dr. Rainer Wedler
.
 Dass die Usancen des Kunstbetriebs längst auch die Literatur erreicht haben, ist ein offenes Geheimnis. Selbstdarstellung als wichtiger Teil des Geschäfts, auch eine aufregende bis absonderliche Biografie kann sich als «karrierefördernd» erweisen, notfalls lässt sie sich auch erfinden, zwei Wohnsitze, Berlin und Barcelona z.B. sind längst Standard.
Dass die Usancen des Kunstbetriebs längst auch die Literatur erreicht haben, ist ein offenes Geheimnis. Selbstdarstellung als wichtiger Teil des Geschäfts, auch eine aufregende bis absonderliche Biografie kann sich als «karrierefördernd» erweisen, notfalls lässt sie sich auch erfinden, zwei Wohnsitze, Berlin und Barcelona z.B. sind längst Standard.
Darüber eine Novelle zu schreiben ist neu. Joachim Zelter hat es gemacht, und man glaubt seiner kurzen Bemerkung, die er der Geschichte voranstellt: «Was hier erzählt wird, ist keine Fiktion.»
«Selim Hacopian hat ein Buch geschrieben.» Er hat sich den «Herrn Schrieftsteller» ausgesucht, damit der sich für seinen «Roman» interessiere, der allerdings lediglich aus ein paar Blättern besteht. Das Deutsch ist exotisch. Der «Herr Schrieftsteller» möge doch bitte «einen kurzen Blieck» darauf werfen, bitte, bitte. Unterwürfig und anhänglich wie Klebstoff ist er, Selim Hacopian, aus Usbekistan gebürtig, über Ägypten und China und sonstwo, das wechselt und wird ständig ergänzt, schließlich im Traumland Schwaben angelangt. Überall lauert er dem «Herrn Schrieftsteller» auf, der sich schließlich kaum noch auf die Straße traut.
Trotzdem korrigiert und lektoriert er die wenigen Seiten, schreibt selbst immer mehr Passagen selber und beschleunigt damit seinen eigenen Niedergang als Autor. Das einzig Interessante ist aber der Lebenslauf, der mit jeder neuen Fassung spannender wird. Selim schickt an alle, die nur irgend mit Büchern zu tun haben, eine Kamelgeschichte und die gerade aktuelle Biografie, diese Kombination ist es schließlich, die einen Verlag dazu bringt, dass er ein Buch mit dem Exoten machen will, allerdings bedürfe es dazu weiterer Kamelgeschichten. Der geneigte Leser wird unschwer erraten, was geschieht: Der «Herr Schrieftsteller», der sich – erfolglos – diese Anrede verbietet, wird Ghostwriter in Sachen Kamele.
Hier brechen wir ab, weil wir nicht alles verraten wollen. Zelter ist eine Satire auf einen Aspekt des Literaturbetriebs gelungen, der zunehmend an Bedeutung zu gewinnen scheint.

Dass die Usancen des Kunstbetriebs längst auch die Literatur erreicht haben, ist ein offenes Geheimnis – Selbstdarstellung als wichtiger Teil des Geschäfts. Auch eine aufregende bis absonderliche Biografie kann sich als «karrierefördernd» erweisen, notfalls lässt sie sich auch erfinden… Joachim Zelter ist mit seiner neuen Literaturnovelle “Einen Blick werfen” eine Satire auf einen Aspekt des Literaturbetriebs gelungen, der zunehmend an Bedeutung zu gewinnen scheint.
Der Rezensent kann es sich nicht verkneifen, auf ein Stück unfreiwilliger Komik hinzuweisen. «Ich sah das Grauen all der Sätze, die er (i.e. Selim Hacopian) bereits geschrieben hatte und die er noch schreiben würde. Falscher Kasus. Falscher Genus.» Der Oberlehrer «Herr Schrieftsteller» wählt, wie schön, das falsche Genus ausgerechnet beim Genus. Dies kann indes den Genuss der Novelle nicht schmälern. ■
Joachim Zelter: Einen Blick werfen – Literaturnovelle, Klöpfer & Meyer Verlag, 106 Seiten, ISBN 978-3863510619
.
.
.
.
Interessante Musik-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Richard Wagner: «Sämtliche Briefe» Band 21
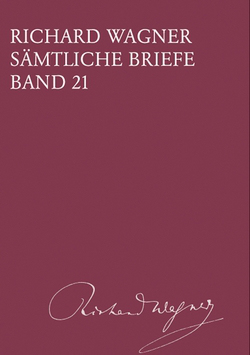 Eine musikeditorische Spitzenleistung des Leipziger Breitkopf&Härtel-Verlages stellt die Herausgabe sämtlicher Briefe Richard Wagners dar. Gestartet Ende 1999, ist Werner Breigs von Grund auf neu konzipierte Reihe auf 35 Ausgaben zuzüglich Supplements ausgelegt. Highlights aller Bände sind jeweils die wissenschaftlich hochwertige Kommentierung, Anreicherung durch zahlreiche Faksimiles sowie die Illustration durch wenig bekannte Photographien, aber vor allem auch die Aufnahme zahlreicher Erstpublikationen.
Eine musikeditorische Spitzenleistung des Leipziger Breitkopf&Härtel-Verlages stellt die Herausgabe sämtlicher Briefe Richard Wagners dar. Gestartet Ende 1999, ist Werner Breigs von Grund auf neu konzipierte Reihe auf 35 Ausgaben zuzüglich Supplements ausgelegt. Highlights aller Bände sind jeweils die wissenschaftlich hochwertige Kommentierung, Anreicherung durch zahlreiche Faksimiles sowie die Illustration durch wenig bekannte Photographien, aber vor allem auch die Aufnahme zahlreicher Erstpublikationen.
Der vorliegende 21. Band enthält die Briefe des sog. «Siegfried-Jahres» 1869: Die Schreiben drehen sich um entscheidende Arbeiten an der Partitur, um die intensivierten Kontakte zu Nietzsche, die Geburt seines Sohnes Siegfried und um grundsätzliche Zusammenhänge in der Verbindung Wagner-Ludwig-II. Eine für die Wagner-Rezeption referentielle Briefe-Sammlung dieses Jahres 1869. ■
Richard Wagner: Sämtliche Briefe / Band 21 – 1869, 844 Seiten, Breitkopf&Härtel, ISBN 978-3-7651-0421-3
.
.
T. Renner/S. Wächter: «Wir hatten Sex in den Trümmern und träumten»
 Mit Tim Renner als einem der bedeutendsten deutschen Popmanager sowie der bekannten Radio-Promotorin Sarah Wächter blicken zwei Insider hinter die Kulissen einer teils euphorischen, teils dreckigen, teils hochkreativen Musikindustrie, die in den letzten Jahrzehnten das digitale Zeitalter verschlafen hat, die aber inzwischen wieder allmählich Boden unter den Füßen kriegt. Neben der witzig-satirischen Schreibe und einer schonungslosen Analyse der katastrophalen Zustände in der Branche glänzt der Band nicht zuletzt mit zahlreichen Tipps für angehende Pop-Musiker – und einem positiven Ausblick: “Niemand muss mehr auf einen Plattenvertrag warten” (Renner und Wächter in einem Interview).
Mit Tim Renner als einem der bedeutendsten deutschen Popmanager sowie der bekannten Radio-Promotorin Sarah Wächter blicken zwei Insider hinter die Kulissen einer teils euphorischen, teils dreckigen, teils hochkreativen Musikindustrie, die in den letzten Jahrzehnten das digitale Zeitalter verschlafen hat, die aber inzwischen wieder allmählich Boden unter den Füßen kriegt. Neben der witzig-satirischen Schreibe und einer schonungslosen Analyse der katastrophalen Zustände in der Branche glänzt der Band nicht zuletzt mit zahlreichen Tipps für angehende Pop-Musiker – und einem positiven Ausblick: “Niemand muss mehr auf einen Plattenvertrag warten” (Renner und Wächter in einem Interview).
Insgesamt eine Untersuchung ohne musiksoziologische Ansprüche, aber ein entwaffnender, oft bissiger, teils auch durchaus liebevoller Blick auf eine Sehnsuchtsmaschinerie mit ihren Papp-Stars und Klischee-Produkten. Amüsant und aufschlussreich. ■
Tim Renner, Sarah Wächter: Wir hatten Sex in den Trümmern und träumten – Die Wahrheit über die Popindustrie, 336 Seiten, Berlin Verlag, ISBN 9783827011619
.
.
.
Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Nicole Zepter: «Kunst hassen – Eine enttäuschte Liebe»
.
Eine enttäuschte Erwartung
Dr. Rainer Wedler
.
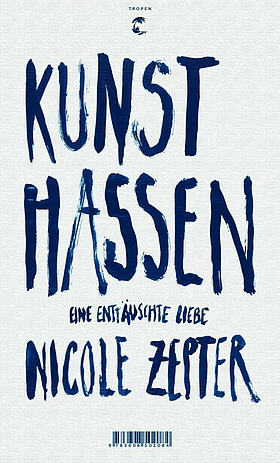 Eine enttäuschte Erwartung ist entschieden besser zu verkraften als eine «enttäuschte Liebe», so der etwas aufgeregte Untertitel des Buches von Nicole Zepter: «Wer Kunst liebt, darf Kunst hassen», das soeben in der zweiten Auflage im Tropen-Verlag erschienen ist, und das innerhalb weniger Monate – ein Zeichen für das großes Interesse des Kunstpublikums, ein Zeichen auch dafür, dass etwas nicht stimmt in der KunstWelt.
Eine enttäuschte Erwartung ist entschieden besser zu verkraften als eine «enttäuschte Liebe», so der etwas aufgeregte Untertitel des Buches von Nicole Zepter: «Wer Kunst liebt, darf Kunst hassen», das soeben in der zweiten Auflage im Tropen-Verlag erschienen ist, und das innerhalb weniger Monate – ein Zeichen für das großes Interesse des Kunstpublikums, ein Zeichen auch dafür, dass etwas nicht stimmt in der KunstWelt.
Dem Rezensenten sind starke Wörter/Worte schon immer verdächtig, weil sie das Problem nur sehr grob spalten können. Und dann wird gerne das Beil im Schuppen gelassen, so kommt es nicht zum Spächtele, dem feinen Anfeuerholz, das erst ein richtiges Feuer entfachen kann.
Vom Bild zum Buch: Zepter kritisiert den Kunstmarkt, zu Recht, vergisst dabei gerne, dass der Titel anderes insinuiert. Natürlich wissen wir, dass Markt und Kunst unter einer Decke heftig ungeschützt Unzucht treiben, so dass immer seltsamere Kreaturen/ionen das KunstLicht der KunstWelt erblicken, um gehätschelt zu werden für den Laufsteg des Marktes: Kunst wird von wenigen Einflussreichen über den Markt kanonisiert. Ein Satz, der Eulen nach Athen trägt. Der Leser möchte mehr, er vermisst den Hinweis auf ein Remedium, das das Leiden der Kunst und das Leiden an ihr lindern könnte. Zepter bringt als schönes Beispiel die Hüpfburg, die zum White Bouncy Castle semantisch aufgewertet, in den Deichtorhallen zu behüpfen ist.
Die Autorin beobachtet gut. Sie spricht dem Rezensenten aus dem Herzen: Wenn der Shop das Interessanteste an einem Ausstellungshaus ist, muss das nicht an der nicht vorhandenen Intelligenz des Publikums liegen. Oder zur Arroganz der Kuratoren: Wer Kunst versteht, ist intelligent. Im Umkehrschluss: Wer Kunst nicht versteht, setzt sich dem Verdacht aus, doof zu sein. Und wer kennt es nicht, dieses Gefühl der totalen Überforderung angesichts willkürlich erscheinender Installationen und ähnlichem? Das hat dazu geführt, dass die Besucher glauben, nicht über genügend Sachverstand und Kompetenz (wo ist da der Unterschied? R.W.) zu verfügen, die sie befähigen würde (sic!), die Ausstellung für sich selbst zu entdecken. Der Ausstellungstourist fährt von Event zu Event, übernachtet auch mal gerne auf der Straße dafür, dabei sein ist alles. Jeder denkt sich sein Teil, alle halten schön den Mund. Die KunstWelt scheint so äußerlich in Ordnung zu sein.

Das Buch ist leider nicht frei von Abundanzien, auch hätte man sich gelegentlich eine präzisere Sprache gewünscht, die Zwischentitel erscheinen ein wenig reißerisch – dennoch ein Buch, das das Unbehagen an der zeitgenössischen Kunst und Kunstszene mit Verve beschreibt.
Ab Seite 53 wird’s dann arg journalistisch – kann man verstehen, ist doch Nicole Zepter Gründerin und Chefredakteurin des im letzten Jahr gegründeten Magazins The Germans. Statt des 14 Seiten langen Interviews hätte man sich eine knappe Zusammenfassung der wesentlichen Punkte gewünscht.
Wie sehr Kunst und «Kunstkritik» verschwägert sind, weiß jeder aus Erfahrung. Die Folge ist schön reden, vorsichtig formulieren, ins Leere sprechen, Worthülsen. Gelegentlich kann es einer klugen, distanzierten und nicht wie üblich, «einfühlsamen» Interpretation gelingen, ein Kunstwerk zu erschließen. In der Regel aber wird das Vorgestellte erst durch Interpretation zu Kunst gemacht, eben zur «Interpretationskunst», wie der Rezensent sich angewöhnt hat, diese Art von Kunst zu benennen. Freunde hat er sich damit nicht gewonnen. Jeder mag, wenn er über das entsprechende Vokabular verfügt, den Versuch anstellen, einen beliebigen Gegenstand, besser eine willkürliche zusammengefundene Menge von Gegenständen mittels des erwähnten «Fachwortschatzes» zum KunstWerk zu transformieren. Spaß macht es allemal.
Desiderat ist ein Bildmaterial als optischer Beleg für Thesen und Beispiele, die die Autorin anführt.
Das Buch ist leider nicht frei von Abundanzien, auch hätte man sich gelegentlich eine präzisere Sprache gewünscht, die Zwischentitel erscheinen ein wenig reißerisch – dennoch ein Buch, das das Unbehagen an der zeitgenössischen Kunst und Kunstszene mit Verve beschreibt. ■
Nicole Zepter: Kunst hassen – Eine enttäuschte Liebe, 136 Seiten, Tropen Verlag / Klett-Cotta, ISBN 978-3608503074
.
.
.
.
Pierangelo Maset: «Wörterbuch des technokratischen Unmenschen»
.
Von «Beschulung» bis «Humankapital»
Dr. Rainer Wedler
.
 «Wörterbuch des technokratischen Unmenschen» – der Titel lässt aufhorchen. Ein Desiderat, denkt man, die längst fällige Fortschreibung der Tradition von Victor Klemperers «Lingua tertii imperii», Karl Korns «Die Sprache in der verwalteten Welt» und dem Gemeinschaftswerk «Aus dem Wörterbuch des Unmenschen» von Gerhard Storz, Wilhelm E. Süskind und Dolf Sternberger, den in Heidelberg zu hören der Rezensent das Glück hatte. Doch um es vorwegzunehmen: der Leser wird ein wenig enttäuscht.
«Wörterbuch des technokratischen Unmenschen» – der Titel lässt aufhorchen. Ein Desiderat, denkt man, die längst fällige Fortschreibung der Tradition von Victor Klemperers «Lingua tertii imperii», Karl Korns «Die Sprache in der verwalteten Welt» und dem Gemeinschaftswerk «Aus dem Wörterbuch des Unmenschen» von Gerhard Storz, Wilhelm E. Süskind und Dolf Sternberger, den in Heidelberg zu hören der Rezensent das Glück hatte. Doch um es vorwegzunehmen: der Leser wird ein wenig enttäuscht.
Dem Technokraten, ein generalisierender Begriff, wird Unmenschlichkeit unterstellt. Niemand wird bestreiten wollen, dass ungebremstes Gewinnstreben und oft unreflektierter technologischer Fortschritt eine sichtbare Gefahr für unsere Gesellschaft darstellen, aber daraus über den Titel eine Assoziation zum totalitären System des Nationalsozialismus herzustellen, geht über das Ziel hinaus.
Dazu einzelne Stichwörter.
– alternativlos: Das kann phantasielos sein, denkfaul, unmenschlich ist es gewiss nicht.
– Benchmarking: Am Anglizismus mag man sich stören, auch daran, dass Objektivität oft nur vorgetäuscht ist, überzogen die Schlussfolgerung: Für den technokratischen Unmenschen hingegen ist das «Benchmarking» ein wunderbares Instrument «zur Optimierung der von ihm erstrebten Herrschaftsform» (S. 35).
– Engagement: Es bedarf schon einiger Gedankenwindungen, um diesen Begriff ins Unmenschenwörterbuch zu befördern. Dass mit einiger Mühe jeder Begriff ins Negative gewendet werden kann, beweist der Autor auch hier. «Engagement» wird dann nämlich zu einem Instrument, das «Ausfallerscheinungen in Staat und Gesellschaft kostengünstig korrigieren soll». (S. 59) Über diesen Satz kann man diskutieren, man sollte es, dennoch gehört «Engagement» nicht in dieses Wörterbuch.
Die Liste ließe sich leicht fortsetzen, wir wollen aber nun zwei gelungene Beispiele vorstellen.
– Audit: Ein furchtbares Wort, das zu Recht dem Unmenschen zugeschrieben werden kann.
– Beratung/Consulting: Ein camouflierender Begriff, unmenschlich wäre auch hier zu stark. «McKinsey und Konsorten haben den Umbau der Gesellschaft mitbewirkt und sehr viel Geld aus Behörden und Unternehmen herausgezogen, die nicht selten nach einer ‘Beratung’ am Boden liegen» (S. 37). Dem ist nichts hinzuzufügen.

Wäre nicht der fatale «Unmensch» in den Titel geraten, man hätte Pierangelo Masets neues «Wörterbuch des technokratischen Unmenschen» mit ganz anderen Augen gelesen, denn den meisten kritischen Bemerkungen des Autors ist zuzustimmen. Ein schmales Buch, das manches erhellt, dem aber zu wünschen wäre, dass es für die zweite Auflage gründlich überarbeitet würde.
Wäre also nicht der fatale «Unmensch» in den Titel geraten, man hätte mit ganz anderen Augen gelesen, denn den meisten kritischen Bemerkungen des Autors ist zuzustimmen. Gelungene Beispiele sollen genannt werden:
Beschulung, Corporate Identity/Corporate Design, Eindringtiefe, Humankapital, Kreativität/Kreativwirtschaft, Philosophie, Update/Upgrade.
Trotz aller Kritik: Ein schmales Buch, das manches erhellt, dem aber zu wünschen wäre, dass es für die zweite Auflage gründlich überarbeitet würde. ■
Pierangelo Maset: Wörterbuch des technokratischen Unmenschen, Radius-Verlag Stuttgart, 144 Seiten, ISBN 978-3871739491
.
.
.
.
.
.
Sema Kaygusuz: «Schwarze Galle» (Kurzprosa)
.
Anstupsen, um aufzuwecken? – oder:
Von Hüzünlern und Gramerfüllten
Dr. Karin Afshar
.
 Das Wesen der Melancholie ist überaus schillernd, ihr Ausdruck nicht minder, und ihr Lockruf, sich im Ringen um den Platz und den Sinn des eigenen Ich im Weltengefüge, mit sich und der Welt auseinanderzusetzen, führt meistens zu Fluchttendenzen, namentlich zur Flucht nach innen. Dort finden der und die von Schwermut Heimgesuchte (von nicht wenigen ist sie nicht erworben, sondern als Anlage immer schon da) viel Leidvolles; Melancholiker leiden an der Welt, und wenn sie hernach aus sich heraustreten und in die Welt blicken, sich wieder in sie hineintrauen, um auf ein Neues aktiver Teil in ihr zu sein – sind sie noch fremder als jemals zuvor. Sie sind weit gegangen und dabei der «Welt abhanden gekommen» (Text Friedrich Rückert, in den «Rückert-Liedern» von Gustav Mahler vertont). Nur manchmal begegnen sie Gleichgesinnten, Gleich»gestimmten», und erkennen sich als Heimatlose und Suchende.
Das Wesen der Melancholie ist überaus schillernd, ihr Ausdruck nicht minder, und ihr Lockruf, sich im Ringen um den Platz und den Sinn des eigenen Ich im Weltengefüge, mit sich und der Welt auseinanderzusetzen, führt meistens zu Fluchttendenzen, namentlich zur Flucht nach innen. Dort finden der und die von Schwermut Heimgesuchte (von nicht wenigen ist sie nicht erworben, sondern als Anlage immer schon da) viel Leidvolles; Melancholiker leiden an der Welt, und wenn sie hernach aus sich heraustreten und in die Welt blicken, sich wieder in sie hineintrauen, um auf ein Neues aktiver Teil in ihr zu sein – sind sie noch fremder als jemals zuvor. Sie sind weit gegangen und dabei der «Welt abhanden gekommen» (Text Friedrich Rückert, in den «Rückert-Liedern» von Gustav Mahler vertont). Nur manchmal begegnen sie Gleichgesinnten, Gleich»gestimmten», und erkennen sich als Heimatlose und Suchende.
In Sema Kaygusuz‘ Buch «Die schwarze Galle» treffen wir auf Melancholiker, und dies u.a. in Gestalt von drei Frauen, die den Rahmen für noch andere Charaktere bilden: Birhan ist eine Istanbuler Dichterin, Sema ist die Ich-Erzählerin, und Yasemin wiederum eine Bekannte von Birhan. Alle drei hören Geräusche, und entlang dieser Geräusche steigen auch wir Leser von Anfang an in die Innenräume ihrer Seelen mit hinab.
Beim Gang durch die Unterwelten versteht es Sema Kaygusuz, den Leser ebenso mit eingebetteten Essays, z.B. über den Unterschied zwischen dem türkischen «hüzün» (das sie meint nicht mit der «Schwermut» gleichsetzen zu können) und der Gram, in der der Schwermütige haust, wie mit Intermezzi von Reflektionen über das Schreiben zu fesseln. Dann wieder erzählt sie parabelhaft die Begegnung eines jungen Mannes mit einer Schneiderin, in vorderorientalischer Erzähltradition von Ezel und Zühal, vom Gärtner und den Hunden, von Musa… Es erwartet die Leserin (und ich glaube, es ist ein Buch für Frauen mehr als für Männer) Schwermütiges, aber das satirisch, lustig, paradox, kurzweilig. Trotz allen zur Sprache kommenden Leides will mir scheinen, als schwebe ein Hauch von Selbstironie über dem Erzählten.
Sema Kaygusuz‘ Sprache trägt zu diesem von mir gefühlten Hauch bei. Wie sie auf Türkisch schreibt, kann ich nicht beurteilen (die deutsche Übersetzung ist in sich und im Ganzen stimmig). Die gewählten Bilder, die Art der Erzählanfänge und das Verweben, die Verweise auf weitere Ebenen, erinnert an – und das wiederum kann ich ein wenig beurteilen – die mündliche wie schriftliche Erzähltradition auch im Iran, in der persischen Literatur. Meister-Schüler-Geschichten, Derwisch-Lehr-Erzählungen, Nasreddin Hodscha. Ihre Sprache ist Empfindungssprache mehr denn Denksprache, und bringt gerade deshalb zum Denken. Leider fallen dann doch einige Formulierungen auf – viele sind es nicht – aber sie sind da, ob nun absichtlich oder unbeabsichtigterweise. Vielleicht sollen diese funktional-intellektuellen Seitenschritte den Bruch bekräftigen, nachgerade die Leserin darauf stoßen, dass wir in Zeiten leben, in denen sich gerade vieles auflöst. Denn in den Erzählungen geht es auch um die Auflösung der Illusion, dass Zeit linear verläuft. Diese Linearität war niemals gegeben, man hatte sie sich konstruiert, weil man meinte, die Vorstellung zu brauchen. Brüche jedweder Art werden erst spür- und anschließend auch sichtbar, wenn die Selbstverständlichkeit des einen auf die des anderen trifft und sich Unvereinbarkeit abzeichnet.

In der Kurzprosa-Sammlung «Schwarze Galle» von Sema Kaygusuz erwartet die Leserin (und ich glaube, es ist ein Buch für Frauen mehr als für Männer) Schwermütiges, aber das satirisch, lustig, paradox, kurzweilig. Trotz allen zur Sprache kommenden Leides schwebt aber ein Hauch von Selbstironie über dem Erzählten.
Jeder Text ist Spiegel seiner «Gegenwart»: Kaygusuz‘ Texte spiegeln das Hin- und Herwandern von Menschen, das Überqueren von Grenzen (was allerdings ein zeitloses Thema ist). Die Möglichkeit unserer Tage indes, Räume innerhalb kürzester Zeit durchqueren zu können und auch zu müssen, bleibt nicht ohne Effekt auf uns; die Schnelligkeit der Wechsel lässt das Empfinden kaum noch nachkommen. Real, fast körperlich, spüren inzwischen die meisten von uns, was es mit der Beschleunigung auf sich hat: sie lässt uns herausfallen.
«Feinstofflich» kann man Sema Kaygusuz‘ Sprache nennen, was Wortwahl und das Gespinst der Worte angeht, gleichzeitig ist der Text durchstrukturiert und doch fragil. Fragil sind natürlich auch die Figuren. Die Sonderlinge von Sema Kaygusuz heißen Yakup, Bora und Helin, Ruth, ja, selbst Gülayşe, die derb und übergriffig in den Lebensraum der Erzählerin einbricht, und sie erinnern mich unwillkürlich an die der deutschen Früh-/Spät-Romantik: Lenz (Georg Büchner), Eduard aus dem «Stopfkuchen» (Wilhelm Raabe), an den Nachtwächter (Bonaventura), an Friedrich Mergel (Annette von Droste-Hülshoff). Oh, wo waren denn da die Frauen?
Lassen Sie sich also auf eine Reise ganz anderer Art mitnehmen und legen Sie das Buch sachte weg, nachdem «Himmel und Erde aufgestöhnt haben». – Gestöhnt habe auch ich ein wenig, das muss ich hier noch anbringen. Ich hätte das Nachwort nicht lesen sollen/dürfen, denn es hat etwas zugebaut, was Sema Kayguzus so leichtfüßig offengehalten hat: Sie hatte Freiräume gelassen, und nicht zuviel angestupst. («Uns braucht niemand anzustupsen, nicht wahr, Birhan, wir wachen von allein auf.») Aber vielleicht brauchen ja andere Leserinnen eine Anleitung, und das Nachwort ist gut gemeint. ■
Sema Kaygusuz: Schwarze Galle, Geschichten, 140 Seiten, Matthes & Seitz Verlag, ISBN: 978-3-88221-049-1
.
Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Willi Sauberer: «Schach-Lang-Läufer» (Erinnerungen)
.
Liebe zum Spiel
Dr. Mario Ziegler
.
 Ein ungewöhnliches Werk ist dieses kleine, nur 131 Seiten umfassende Büchlein, das der LIT-Verlag aus Wien und Berlin kürzlich publizierte. Schon der Titel macht stutzig: «Schach-Lang-Läufer» – was ist das denn? Was hat ein Langläufer mit Schach zu tun? Oder geht es vielleicht um die Spielfigur Läufer? Aber wie passt das Adjektiv «lang» zu ihr? Und erst die Bibliographie! Neben Werken der bekannten Schachautoren Beyersdorf, Linder, Petzold und Pfleger finden sich Einträge wie «De brevitate vitae» des antiken römischen Philosophen Seneca, Homers Odyssee oder ein Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Und wer ist eigentlich Willi Sauberer, von dem ich, wie ich gestehen muss, zuvor noch nie gehört hatte, und der sich in den Datenbanken von ChessBase mit lediglich drei Partien findet?
Ein ungewöhnliches Werk ist dieses kleine, nur 131 Seiten umfassende Büchlein, das der LIT-Verlag aus Wien und Berlin kürzlich publizierte. Schon der Titel macht stutzig: «Schach-Lang-Läufer» – was ist das denn? Was hat ein Langläufer mit Schach zu tun? Oder geht es vielleicht um die Spielfigur Läufer? Aber wie passt das Adjektiv «lang» zu ihr? Und erst die Bibliographie! Neben Werken der bekannten Schachautoren Beyersdorf, Linder, Petzold und Pfleger finden sich Einträge wie «De brevitate vitae» des antiken römischen Philosophen Seneca, Homers Odyssee oder ein Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Und wer ist eigentlich Willi Sauberer, von dem ich, wie ich gestehen muss, zuvor noch nie gehört hatte, und der sich in den Datenbanken von ChessBase mit lediglich drei Partien findet?
Beginnen wir mit dem Autor. Professor Willi Sauberer, geboren 1933, wirkte ab 1961 als Journalist, ab 1967 im Generalsekretariat der Österreichischen Volkspartei und ab 1971 als Chefredakteur der Salzburger Volkszeitung. Sauberer, der 1979 für seine Verdienste um das Land Salzburg das Goldene Verdienstzeichen und 2005 die Goldene Ehrennadel erhielt, beschäftigte sich als Autor mit biographischen und lokalhistorischen Themen, und natürlich mit dem Schach, dem er Zeit seines Lebens verbunden war, wie das hier zu besprechende Buch eindrücklich beweist.
Auf den ersten Blick mag ungewöhnlich erscheinen, dass ein Schachamateur die Erinnerungen seines Lebens veröffentlicht. Doch gerade dies ist das Konzept der neuen Schriftenreihe «Spiel-Geschichten», die vom Institut für Spielforschung an der Universität Mozarteum Salzburg herausgegeben wird, und die der Institutsleiter Professor Rainer Buland wie folgt beschreibt: Nicht Spielanleitung und nicht Wissenschaft solle durch sie vermittelt werden, sondern die Biographie der Spieler in Zusammenhang mit dem Spiel: Wie kam es zu der ersten Begegnung mit dem Spiel? Wie veränderte sich das Spielen im Laufe des Lebens? Welche Erfahrungen wurden mit dem Spiel und mit anderen Spielern gemacht? Und zuletzt: Welches Wissen besitzen die Spieler über ihr Spiel?
Willi Sauberer ist wie kaum ein anderer dazu prädestiniert, diese Reihe zu eröffnen. Er beschreibt sich selbst als «Amateur, Vereinsspieler, Funktionär und Kursleiter», was bereits das weite Spektrum seiner schachlichen Beschäftigung andeutet. «Schach war oft mein Rückzugsgebiet, wenn es Schicksalsschläge hagelte». Und so beginnt das Buch mit den «Erinnerungen eines unverbesserlichen ‚Schächers‘», die den ersten Kontakt Sauberers mit dem Schach um das Jahr 1945 behandeln, seine Bemühungen um das Salzburger Schachleben und die Gründung des Schachvereins Salzburg-Süd 1979: «Ich wurde trotz aller von mir vorgebrachten Bedenken ausdrücklich ‚für ein Jahr‘ zum Obmann gewählt. Dieses Jahr dauerte 2012 noch immer an». Dieses Kapitel ist – wie sollte es anders sein – in einem sehr persönlichen Ton verfasst und enthält manche Anekdote, so etwa die folgende über eine Blitzpartie Sauberer mit der mehrmaligen Staatsmeisterin Inge Kattinger bei einem befreundeten Ehepaar: «Eines Tages stießen wir dabei ein Glas mit Rotwein um. Die Flüssigkeit lief über den Tisch und tropfte auf die Polstersessel. Dass wir rasch das Brett aus dem Gefahrenbereich schoben und ungerührt weiter spielten, wird mir von den sonst wirklich geduldigen Gastgebern noch heute vorgehalten».
Das folgende Kapitel «Begegnungen und Beobachtungen» wirft in mehreren Essays den Blick auf besondere Teilaspekte des königlichen Spiels, als dessen wichtigste Elemente Sauberer «Waffengleichheit bei minimaler Zufallsabhängigkeit», «Geschwindigkeit», «ästhetische Schönheit» und vor allem «geistige Herausforderung» nennt. Die Frage, warum sich immer weniger Schachenthusiasten als Funktionäre zur Verfügung stellen, wird ebenso behandelt wie die Spielertypen, also den Angstgegner, die Über- und die Unterschätzung des Gegners – jeder Partiespieler wird sofort vieles wiedererkennen! Die berichteten Begebenheiten auf und neben dem Brett, Sauberers gelegentliche Begegnungen mit der Weltspitze (in Gestalt von Beliavsky, Kramnik und Karpow, das ewig junge Thema «Schach und Frauen» und das mittlerweile obsolete Thema «Schach und Rauchen» runden dieses Kapitel ab, das zum Schmökern einlädt und gleichzeitig immer wieder durchblicken lässt, wie viele Gedanken sich Sauberer während seiner langen «Karriere» bereits über das Schachspiel gemacht hat.
In «Partien erzählen Geschichten» werden 21 Partien und Partiefragmente aus Sauberers praktischem Schaffen wiedergegeben. Es sind manche ansehnliche Kombinationen dabei, obwohl Sauberer bescheiden vermerkt, sie besäßen «angesichts der vielen großen Werke erlesener Schachgeister nicht einmal den Wert einer Fußnote». Besonders fiel mir – auch wegen der humorvollen Kommentierung, die ich im Wortlaut wiedergeben möchte, die folgende Partie auf:
Sauberer – Frischeisen
12. 10. 1968. Wiener Schachverein-Währing, 3. Klasse, Brett 3. Schwarz galt als Senkrechtstarter mit glänzenden Aussichten. Aber er unterschätzte Fridolin. Dieser war ein Kleinbauer auf b2, der mit seinem Los unzufrieden war und aufbegehrte (b3). Er arbeitete sich hoch und brachte es zum Großbauern (c4), wurde in zentraler Funktion geadelt (d5) und sogar in den Grafenstand erhoben (c6). Nach 29. Txd7 hätte Fridolin auf d7 sogar Fürst werden und auf c8 die Königstochter heiraten können, doch Schwarz gab auf.
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 0–0 7.0–0 d5 8.b3?! Bb2 zeigt auf: Er möchte gerne Freibauer werden. 8…Sa6 9.Lb2 dxc4 10.bxc4 Fridolin! 10…c5 11.e3 cxd4 12.exd4 Dc7 13.Da4 Tfc8 14.Se5 Lxg2 15.Kxg2 Db7+ 16.Kg1 Sb4 17.Tfd1 Sc6 18.Tac1 Sa5?? Schwarz unterschätzt Fridolin! 19.d5 exd5 Db8! 20.cxd5 Fridolin! 20…Db8 Zu spät. 21.Sc6! Sxc6 22.dxc6 Fridolin! 22…a6 Gegen Sb5. 23.Sd5! Sxd5 24.Txd5 Tc7? Besser Ta7. 25.Dg4!? Le5!? bringt Qualitätsgewinn, aber den wertlosen Ta8 ins Spiel, hingegen stellt die wD auf der Diagonale c8–h3 tödliche Drohungen auf. 25…f6 26.Td7 Kf7 27.Dh5+ Kg8 28.Dd5+ Witzig wäre auch La3! gewesen. 28…Kf8 29.De6!
Verdient ein Diagramm: Der letzte Triumph war dem Slalomspezialisten nicht mehr gegönnt. 1–0
Im dritten Abschnitt «Odysseus, Goethe und die Astronauten» werden frühere Beiträge Sauberers zum Thema Schach aus dem Zeitraum 1971-2012 erneut abgedruckt. Bereits der Titel lässt anklingen, welch breites Spektrum der Autor hier abdeckt, und in der Tat versteht er es, immer wieder Parallelen zwischen Schach und Geschichte, Literatur, Mythologie oder (damals) tagesaktuellen Themen zu ziehen.
Besonders spannend ist das letzte Kapitel «Die vergessene Schachweltmeisterschaft». Hier geht es um den Wettkampf zwischen Alexander Aljechin und Efim Bogoljubow, der 1934 in Deutschland ausgetragen wurde. Sauberer referiert zunächst über die Spieler und die Hintergründe des Matches, wobei er zu Recht die Auswirkung zeitgeschichtlicher Ereignisse wie der Weltwirtschaftskrise 1929 oder der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 auf die Weltmeisterschaft betont. So formuliert er: «Eine Schachweltmeisterschaft in Deutschland, noch dazu mit einem ‚deutschen‘ Teilnehmer [natürlich war Bogoljubow nur eingebürgert, Anm. Ziegler], kam den neuen Machthabern als Prestigeobjekt gerade recht – sie war ein kleines Steinchen des großen Mosaiks, das die Welt von der NS-Ideologie überzeugen sollte. (Die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin folgten.)». Diese Aspekte bedürfen einer noch wesentlich gründlicheren Aufarbeitung, bei der ein 2006 von Sauberer wiederentdecktes Dokument helfen kann: Ein Gästebuch der Weltmeisterschaft, das die Etappen des Matches und die anwesende Prominenz bis zum letzten Wettkampftag verzeichnet. Es wäre unbedingt wünschenswert, dieses Dokument wissenschaftlich auszuwerten.

Wird in den Monographien über Schachspieler gewöhnlich die Weltspitze in den Blick genommen, so wirft das Büchlein «Schach-Lang-Läufer» aus der Feder des Amateurs Willi Sauberer ein ganz neues Licht auf das Schachspiel und die Menschen, die es als Freizeitvergnügen betreiben. Hier stehen völlig andere Themen zur Debatte als bei Männern vom Schlage eines Carlsen, Anand oder Kramnik. Willi Sauberer will mit seinem Buch sicher nicht mustergültiges Schach demonstrieren, sondern das zeigen, was auf und neben den Brettern an Menschlichem und Allzumenschlichem geschieht.
Das Werk besticht durch ein schönes Cover, festen Einband und zahlreiche Abbildungen. Das Lektorat war ganz überwiegend gründlich, Druckfehler sind kaum zu finden. Lediglich über den Namen «Emit Özil (deutscher Fußball-Nationalspieler)» bin ich gestolpert – ist mit diesen Ballkünstler nicht vielleicht Mesut Özil – der jedenfalls gerne Schach spielt gemeint?
Ein Fazit: Wird in den (ohnehin wenig zahlreichen) Monographien über Schachspieler gewöhnlich die Weltspitze in den Blick genommen, so wirft dieses Büchlein aus der Feder eines Amateurs ein ganz neues Licht auf das Schachspiel und die Menschen, die es als Freizeitvergnügen betreiben. Hier stehen völlig andere Themen zur Debatte als bei Männern vom Schlage eines Carlsen, Anand oder Kramnik. Willi Sauberer will mit seinem Buch sicher nicht mustergültiges Schach demonstrieren, sondern das zeigen, was auf und neben den Brettern Menschliches und Allzumenschliches geschieht. Damit ist er Amateur im besten Sinne des Wortes: Liebhaber (amateur) des Schachs und der Menschen, die es spielen. Und dadurch wird deutlich, dass Schach eben doch unendlich viel mehr ist als das, was wir in den Datenbanken und Partiesammlungen vorfinden. ■
Willi Sauberer: Schach-Lang-Läufer – Erinnerungen eines Spielers, Funktionärs und Beobachters, Lit Verlag, 128 Seiten, ISBN 978-3643504845
.
Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
Sabine Ludwigs: «Meine Seele weiß von dir» (Roman)
.
Für ein paar sorgenfreie Stunden
Bernd Giehl
.
 «Und denken Sie daran: Alles wird gut.» An diesen Satz erinnere ich mich noch. Er scheint einem anderen Zeitalter entsprungen zu sein, und dennoch war er vor nicht allzu langer Zeit fast ein geflügeltes Wort: «Alles wird gut.» Ob der Satz am Ende des «heute-journals» stand? Oder ob der Moderator einer Talkshow mit ihm sein Publikum in die Nacht entließ? Ich weiß es nicht mehr.
«Und denken Sie daran: Alles wird gut.» An diesen Satz erinnere ich mich noch. Er scheint einem anderen Zeitalter entsprungen zu sein, und dennoch war er vor nicht allzu langer Zeit fast ein geflügeltes Wort: «Alles wird gut.» Ob der Satz am Ende des «heute-journals» stand? Oder ob der Moderator einer Talkshow mit ihm sein Publikum in die Nacht entließ? Ich weiß es nicht mehr.
«Meine Seele weiß von dir» von Sabine Ludwigs fängt mindestens so dramatisch an wie das «heute-journal». Er beginnt mit der Szene eines Ertrinkens: «Das Wasser war schwarz, kalt und schmeckte durchdringend nach Chlor. Ich versank darin. Ich versank und konnte nichts dagegen tun.»
Das klingt wirklich dramatisch. Aber man ahnt doch, dass das noch nicht das Letzte sein kann. Nicht, wenn der Roman mit «ich» anfängt. Würde dieses «Ich» jetzt tatsächlich sterben, dann hätte die Erzählung ihr Ende gefunden, ehe sie wirklich angefangen hat. Und außerdem: Wie könnte die Person jetzt weitererzählen, wenn sie doch tot ist?
Aber glücklicherweise ist es nur der Prolog. Obwohl es den strenggenommen gar nicht geben dürfte. Denn im nächsten Kapitel wird erzählt, dass dieses «Ich», das hier berichtet, eine Frau mit Namen Sina-Mareen, sich an nichts mehr erinnert. Auch nicht an den Badeunfall. Alles was sie weiß, weiß sie von anderen. Vor allem von einem Mann, der behauptet, er heiße Leander und sei mit ihr verheiratet – nur dass sie sich auch nicht an ihn erinnert. Und auch nicht daran, wie sie in die Wohnung geraten ist, in der sie sich jetzt beide aufhalten. Vor ihm hat sie sich in die Sicherheit eines begehbaren Kleiderschranks zurückgezogen, durch dessen geschlossene Tür sie mit dem Fremden spricht.
Auch wenn man von Psychotherapie nicht viel versteht, so ahnt man doch schnell, dass Sina-Mareen, die Ich-Erzählerin Angst hat. Ihre Welt ist zusammengeschrumpft auf die Größe eines Kleiderschranks. Dort wird sie zunächst einmal bleiben und sich anhören, was der Mann vor der Schiebetür ihr zu sagen hat. Zunächst ist unklar, ob sie sich vor diesem Mann fürchtet, vor der Welt, der sie nicht mehr anzugehören scheint oder vor der eigenen Vergangenheit, an die sie sich partout nicht erinnern kann. Das ist ja auch plausibel, denn zumindest kann man sich vorstellen, dass Menschen nach einem schweren Unfall das Gedächtnis verlieren.
In den ersten Kapiteln hört sie dem Mann vor dem Schrank zu, zunächst durch die geschlossene Tür. Später öffnet sie die Tür einen Spalt weit. Der Mann behauptet, mit ihr verheiratet zu sein. Die Ich-Erzählerin weiß davon nichts, aber schnell verliebt sie sich in den Klang seiner Stimme und später auch in sein gutes Aussehen. Da Sabine Ludwigs ihr Handwerk versteht, klärt sie den Leser so schnell nicht auf. So wie Sina-Mareen zunächst nur kleine Schritte in die Welt außerhalb ihres Schranks unternimmt, so wird sie auch nur Schritt für Schritt an die Wahrheit herangeführt. Sie erfährt, dass der Mann, der behauptet, mit ihr verheiratet zu sein, nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung lebt, dass er eine Freundin hat, und dass das Zerwürfnis wohl seinen Anfang in einer Abtreibung genommen hat, von der er erst hinterher erfahren hat. Es ist der Anblick von ein paar Sektflaschen in einem Lebensmittelladen, bei dem die Erinnerung plötzlich einsetzt und dann setzt sich diese Erinnerung wie ein Puzzle zusammen.

Themen, die die vielleicht Widerhaken in unser Denken schlagen, suchen wir in Sabine Ludwigs’ “Meine Seele weiss von dir” vergebens. Trotzdem, der Roman ist spannend, sehr unterhaltsam – ein Buch für sorgenfreie Stunden.
Das Buch ist spannend, keine Frage. Und dennoch weiß man von Anfang an: Es wird gut ausgehen. Menschen, die bei allen Fehlern, die sie machen, so sympathisch sind, so begabt, so erfolgreich und gut aussehend (zumindest über den männlichen Helden wird das dem Leser pausenlos eingehämmert) – also kurz und gut: da muss es einfach ein Happy End geben. Obwohl die Autorin ihren Figuren ja wirklich reichlich Hindernisse in den Weg stellt. Aber das, sowie das Nichtwissen, das der Leser mit Sina-Mareen teilt, erhöht ja nur die Spannung.
So ist das eben in Unterhaltungsromanen: Im Unterschied zum wahren Leben können wir uns darauf verlassen, dass sie gut ausgehen. Und uns dabei ein paar vergnügliche Stunden bereiten. Die Themen, die uns länger beschäftigen, die vielleicht Widerhaken in unser Denken einschlagen, die müssen wir uns eben in anderen Romanen suchen. ▀
Sabine Ludwigs: Meine Seele weiß von dir, Roman, 376 Seiten, Hansanord Verlag, ISBN 978-3940873439
.
.
Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Jürgen Fürkus: «Literarische Eigenblicke» (Lyrik & Kurzprosa)
.
Was Jürgen Fürkus mit Havergal Brian zu tun hat
Dr. Karin Afshar
.
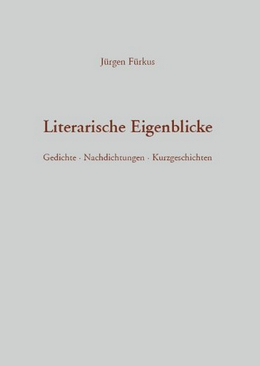 Schon vor Tagen war es angekommen – das Buch, um das es heute geht. Sein Verfasser hat es mir zur Besprechung persönlich zugeschickt. Im Briefkasten am selben Tag auch eine CD mit Kompositionen jenes in der Überschrift ebenfalls genannten Havergal Brian. William Havergal Brian lebte von 1876 (in Dresden, Staffordshire geboren) bis 1972 und war den Großteil seines Lebens als Komponist (hauptsächlich von Wiener Klassik inspiriert, mit Elementen dissonanter Harmonik und Atonalität) eher unbekannt, ja unbedeutend. Legendär indes ist, dass er 21 seiner insgesamt 32 Sinfonien jenseits seines 80. Geburtstags komponierte. 1961 – da war er bereits 85 Jahre alt, wurde seine 1. Sinfonie (die «Gothische») in Westminster aufgeführt. Ich höre sie, während ich dies schreibe, und habe gelesen, dass sie – was den Orchesterapparat angeht – sogar die Anforderungen von Gustav Mahler und Arnold Schönberg übertreffen soll. Nach dem Aufflackern in den 60ern verschwand Brians Werk wieder in den Kreisen seiner wenigen, aber sehr enthusiastischen Anhänger. William Brian, obwohl er sein Leben lang komponierte, erreichte nie die Popularität eines Ralph Vaughan Williams. Wohl aber wusste er sein Handwerkzeug, das er sich autodidaktisch angeeignet hatte, einzusetzen, und war darin alles andere als laienhaft.
Schon vor Tagen war es angekommen – das Buch, um das es heute geht. Sein Verfasser hat es mir zur Besprechung persönlich zugeschickt. Im Briefkasten am selben Tag auch eine CD mit Kompositionen jenes in der Überschrift ebenfalls genannten Havergal Brian. William Havergal Brian lebte von 1876 (in Dresden, Staffordshire geboren) bis 1972 und war den Großteil seines Lebens als Komponist (hauptsächlich von Wiener Klassik inspiriert, mit Elementen dissonanter Harmonik und Atonalität) eher unbekannt, ja unbedeutend. Legendär indes ist, dass er 21 seiner insgesamt 32 Sinfonien jenseits seines 80. Geburtstags komponierte. 1961 – da war er bereits 85 Jahre alt, wurde seine 1. Sinfonie (die «Gothische») in Westminster aufgeführt. Ich höre sie, während ich dies schreibe, und habe gelesen, dass sie – was den Orchesterapparat angeht – sogar die Anforderungen von Gustav Mahler und Arnold Schönberg übertreffen soll. Nach dem Aufflackern in den 60ern verschwand Brians Werk wieder in den Kreisen seiner wenigen, aber sehr enthusiastischen Anhänger. William Brian, obwohl er sein Leben lang komponierte, erreichte nie die Popularität eines Ralph Vaughan Williams. Wohl aber wusste er sein Handwerkzeug, das er sich autodidaktisch angeeignet hatte, einzusetzen, und war darin alles andere als laienhaft.
Während ich das Buch von Fürkus umdrehe und auf dem rückwärtigen Einband zu lesen beginne, geht mir die Koinzidenz der Ankunft durch den Kopf. «In den Gedichten», steht dort, « greift er [Fürkus] vielfältige Momente des Lebens auf und setzt mit dem Reiz von Lyrik Akzente zum Nachdenken und Verweilen.» Ich blättere nach vorne. Erstes Gedicht:
«Der Schatten»
In der Höhe nicht zu messen,
nur als Fläche existent.
Wie von Zauberei besessen,
Projektionen kongruent.
Abbild aller Dimensionen,
stets dem Lichte zugewandt,
plattgewalzt wie Druckschablonen,
auch als Schattenspiel bekannt.
…
Das liest sich gefällig, und ist gereimt. Die Seiten danach lesen sich nicht mehr ganz so gefällig. Da beginnt es zu holpern. Das liegt nicht an den Themen, sondern an der spürbaren Anstrengung, sie in Reimen und Versen bändigen zu wollen. Dabei bleibt die Tiefe auf der Strecke, die Essenz und der Fluss kommen abhanden. Es sind tagesaktuelle Themen wie auch philosophische Betrachtungen unter den Gedichten: Selbstfindung, Erinnerungen, Impressionen, Lebens- und Leidenserfahrung, sowie Reflektionen über Politik – auch Atomkraft – und: ein «lyrischer Exkurs zur deutschen Geschichte». Spätestens hier breche ich ab, überfliege die Nachdichtungen englischer Songtexte, blättere in die Kurzgeschichten (Der Tag in Hallstatt und Krippenstein, Beim Orthopäden, Die Fahrradtour) hinein, und lege dann das Buch weg. Schade. Das war eine verschenkte Stunde. Wenn ich eins mitnehme, dann bestenfalls: hier hat jemand geschrieben und das ist an und für sich nicht zu bewerten. Das Geschriebene kann für einen kleinen Kreis, vielleicht den der Familie, durchaus stimmig sein. Da ist er dann zuständig. Schreiben klärt, Schreiben bringt im Akt des Artikulierenmüssens und -wollens zum Hin- und Einsehen.
Die Absicht einer Publikation, sprich einer Veröffentlichung ist, einen größeren Leserkreis zu erreichen. Den Weg, damit dieser größere Kreis erreicht werde, ebnen Verlage, das ist – unter anderen – ihre Aufgabe. Für das Schreiben für eine Leserschaft außerhalb der Familie oder des weiteren Freundeskreises bedarf es allerdings noch einiger Dinge mehr. Und außerdem einer anderen, weiteren Zuständigkeit.
In dieser Zuständigkeit sollte der Schreibende das Werkzeug beherrschen; er muss es so einsetzen können, dass selbst in einem Anderen, den er nicht von Angesicht kennt, etwas angesprochen wird. Schreiben ist eben doch nicht nur das Herausschreiben dessen, was man in sich selbst findet, sondern auch das An- und Aussprechen der Welt für die Welt.

In Jürgen Fürkus’ «Literarischen Eigenblicken» fehlen nicht nur das Feuer und der Genius, sondern auch der professionelle Umgang mit Sprache. Dem Buch können Güte, Menschlichkeit und Zuversicht nicht abgesprochen werden – aber Literatur ist das nicht…
In Verlagen arbeiten Lektoren, Menschen, die sich der Sprache, des Werkzeugs des Dichters annehmen. Wenn er dieses selbst noch nicht virtuos an den Stoff anlegen kann, zeigen sie ihm zweierlei auf: entweder, wie es gehen könnte (Talent vorausgesetzt, und der Dichter findet im gegenseitigen Prozess seinen Ton, wird eigenständig und wiedererkennbar) oder dass «es» so nicht geht und alle Müh vergebens sein wird (weil ein anderes, nicht aber das Talent zum Schreiben vorliegt).
Bei Book-on-demand bzw. ProBusiness gibt es offenbar kein Lektorat, oder – eine Recherche diesbezüglich ist noch nachzuholen – man muss es extra bezahlen, wenn man sein Buch dort in Druck gibt. Ich habe etliche Schreibbegeisterte erlebt, die glaubten, ihre Texte seien bereits «druckreif» – und ein kostenspieliges Lektorat für überflüssig hielten. Jürgen Fürkus‘ Sprache ist durchsetzt mit Irrtümern über das Lyrische, seine Wortwahl nah am Umgangssprachlich-Funktionalen, mit dem nicht er spielt, sondern das mit ihm spielt. – Das Wesen des Lyrischen ist die Verdichtung. Auch das Genre Kurzgeschichte lebt vom Verdichten. Eine einzelne wahre (vielfach banale) Begebenheit «genügt» einfach nicht, daraus eine Geschichte zu machen.
Indem ich das Buch zuklappe, denke ich das Wort «schal». Es fehlen das Feuer und der Genius. Dass aus den «Eigenblicken» Güte, Menschlichkeit und Zuversicht sprechen, kann und soll ihnen nicht abgesprochen werden; dass sie «literarisch» seien, indes schon. Schreiben sollte man dann doch denen überlassen, die es können. Lesen kann auch etwas sehr Schönes sein. ■
Jürgen Fürkus: Literarische Eigenblicke – Gedichte, Nachdichtungen, Kurzgeschichten, 144 Seiten, ProBusiness GmbH, ISBN 978-3-86386-465-1
.
Weitere Rezensionen von Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Clemens Berger: «Ein Versprechen von Gegenwart» (Roman)
.
Entfremdete Tagleben
Dr. Karin Afshar
.
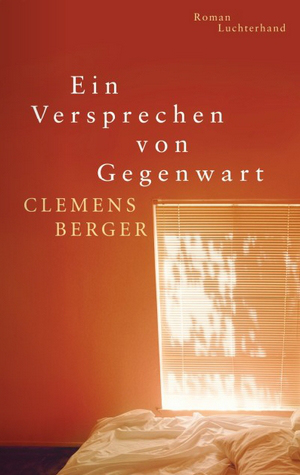 Wie ist es mit Ihnen: Suchen Sie sich Ihren Lesestoff nach Titeln aus? Oder nach Autoren, was heißt, Sie haben Lieblingsautoren und lesen deren Bücher, sobald sie auf dem Markt sind? Arbeiten Sie Bestsellerlisten ab, z.B. solche, die einem aus Illustrierten und Magazinen entgegenprangen? Oder lesen Sie ein Buch, weil Sie eine Besprechung dazu besonders anspricht?
Wie ist es mit Ihnen: Suchen Sie sich Ihren Lesestoff nach Titeln aus? Oder nach Autoren, was heißt, Sie haben Lieblingsautoren und lesen deren Bücher, sobald sie auf dem Markt sind? Arbeiten Sie Bestsellerlisten ab, z.B. solche, die einem aus Illustrierten und Magazinen entgegenprangen? Oder lesen Sie ein Buch, weil Sie eine Besprechung dazu besonders anspricht?
Für den Fall, dass Sie jemand aus der letzten Kategorie sind: hier ist mein Leseeindruck von Clemens Bergers Roman «Ein Versprechen von Gegenwart» für Sie. Kleinformat, 11,8 x 18,7 cm, Hardcover mit Schutzumschlag, terracottafarben, 160 Seiten so lesefreundlich formatiert, wie nur ein gedrucktes Buch zu sein vermag. Mal sehen, ob der Klappentext hält, was er verspricht.
Auf dem rückwärtigen Einband lesen Sie u.a. das Wort «Erotik»; ja – um es vorwegzunehmen – es gibt auch Sex in der Geschichte; die Erotik dieses Buches besteht allerdings in jener Art Erotik, die dem Unerreichbaren innewohnt. – Man kann die Erzählung unter diesem Gesichtspunkt lesen, oder unter noch anderem!
Dem Erzähler (erzählt in der Ich-Form), Kellner in einem Restaurant, fällt ein Paar auf, das in regelmäßigen Abständen zu später Stunde – in der Spanne von kurz vor und kurz nach Mitternacht – auftaucht. Das Paar: eine – und damit wir verstehen, wie es gemeint ist, mehrfach betont – schöne Frau namens Irina und ein Mann, der uns als «Löwe» vorgestellt wird. Was diese beiden verbindet, oder auch nicht verbindet, aber aneinanderhält, ahnen wir bald.
Der Kellner verfällt den beiden, sie beflügeln seine Phantasie, werfen ihn in eigene Erinnerungen; er lässt sich besetzen. Und er lässt den Leser an seinem vorgestellten und halb ausgelebten Voyeurismus, bei dem sich Grenzen verwischen, man nicht weiß: ist er es vielleicht doch selbst? Haben wir es mit einer Spaltung zu tun? – teilhaben. Erzählt wird die Geschichte dieser Liebesbeziehung, die keine ist, als Rückschau, aus der Perspektive von «Löwe» (Berger bedient sich dabei eines «Kniffs» – er spricht ihn als «du» an) und der der «Wildkatze» (ebenso), dann wieder vorgreifend… Der Leser wird in der Zeit umhergeworfen wie die beiden Protagonisten in der ersten und der zweiten Welt. Natürlich wird es eine Katastrophe geben. Sie wird mehrfach angedeutet. Das Wort Auflösung drängt sich mir beim Lesen auf. Ein Versprechen von Gegenwart wird nicht eingelöst und bleibt ein Versprechen. Am Ende dann mein Empfinden, nicht verstanden zu haben, worum es geht, und ich erschrecke. Ich lege das Buch irritiert weg.
Ich komme aus einer Gegenwart, die inzwischen Vergangenheit geworden ist, und das viel schneller als ich mir je hatte träumen lassen. Junge Autoren gehen ganz neu mit Sprache um, sie schreiben über Themen, die ich längst nicht mehr aufrollen muss, die ich hinter mir gelassen habe und über neue Themen, die sich mir nicht mehr stellen werden. Jetzt ist eine andere Gegenwart. Meine Vorlieben für eine bestimmte literarische Sprache ist von meiner gewesenen Gegenwart geprägt. Dass ich diese Vorlieben habe, hat u.a. mit mir zu tun. Schreibstil ist auch eine Charaktersache…
Abgesehen davon schreiben die Autoren von heute anders. Berger schreibt so anders. Daher kommt die Fremdheit. Er hat eine Sprache gefunden, die der aufgelösten (vormals konstruierten) Linearität unserer Moderne entspricht. Manche seiner Sätze fangen so an, wie ich es kenne, und bauen meine Erwartung auf, dann wird sie zerschlagen, endet in einer Sackgasse – der Satz, ein ganzer Absatz scheinen mir unverständlich. Noch einmal zurück, noch einmal von vorne lesen – und jetzt hab ich den Faden wieder. Klar, jetzt verstehe ich. Bis zum nächsten Ruck.
Neben Linearität bzw. deren Aufhebung verspüre ich die Abwesenheit von Kontinuität. An den Strand unserer Gegenwarten (jeder Mensch hat je eigene) schlagen heutzutage heftige Wellen. Sie kommen in kürzeren Abständen, sind stakkatohaft, alles ist beschleunigt. Die eine lange Welle, die aus den zusammengeschichteten Gegenwarten von einer in die andere übergeht, scheint es nicht mehr zu geben. Das Tagleben ist in Episoden zerlegt, die Menschen darin sich entfremdet. Das Tagleben ermöglicht vieles, verhindert aber auch anderes, und das ist dann allenfalls in der Nacht, kurz vor und kurz nach Mitternacht, möglich, in der Grauzone, in der die Grenze liegt, die man übertritt, übertreten kann. Sehe ich es so, verstehe ich durchaus.

Clemens Berger hat in seinem Roman «Ein Versprechen von Gegenwart» eine Sprache gefunden, die der aufgelösten (vormals konstruierten) Linearität unserer Moderne entspricht. Für eine flüchtige Lektüre zwischendurch ist das Büchlein fast zu schade. Auch wenn es sich schnell liest, hat es verdient, mindestens drei-viermal in die Hand genommen zu werden. Von diesem Autor sollten wir noch mehr zu lesen bekommen.
Eine Grenze übertreten sowohl der Ich-Erzähler als Kellner in seinem Tagleben, als auch «Löwe» in seinem „inoffiziellen» Leben mit Irina. Beide gehen zu weit und die Auflösung tritt – wie immer – in Gestalt von Unordnung ein. Die anfängliche Genauigkeit im Beschreiben auf den ersten Seiten, übervoll mit Details, das akribische Beobachten, die ein Stillstehen suggerieren, ein Verweilen in Gegenwart aufbauen, weichen zum Höhepunkt hin mehr und mehr. Nach dem Eklat ist die Sprache fragmentarisch, nicht gerade einfacher dadurch.
Für eine flüchtige Lektüre zwischendurch ist das Büchlein fast zu schade. Auch wenn es sich schnell liest, hat es verdient, mindestens drei-viermal in die Hand genommen zu werden. Von Clemens Berger sollten wir noch mehr zu lesen bekommen. Das hoffe ich doch schwer. ■
Clemens Berger: Ein Versprechen von Gegenwart, Roman, 160 Seiten, Luchterhand Verlag, ISBN 978-3-630-87410-4
.
Weitere Rezensionen von Karin Afshar im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
Interessante Literatur-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Clemens Umbricht: «Museum der Einsichten»
 Seit seiner frühen Lyrik-Veröffentlichung «Der Abstand der Wörter» vor rund 20 Jahren zählt der im Luzernischen Reiden geborene Schriftsteller und Verleger Clemens Umbricht zu den gewichtigen Poesie-Stimmen der Schweiz. Nun legt der inzwischen verschiedentlich mit Preisen prämierte Lyriker seine neue Sammlung «Museum der Einsichten» als 38. Ausgabe der Reihe «Fund-Orte» im Zürcher Orte-Verlag vor.
Seit seiner frühen Lyrik-Veröffentlichung «Der Abstand der Wörter» vor rund 20 Jahren zählt der im Luzernischen Reiden geborene Schriftsteller und Verleger Clemens Umbricht zu den gewichtigen Poesie-Stimmen der Schweiz. Nun legt der inzwischen verschiedentlich mit Preisen prämierte Lyriker seine neue Sammlung «Museum der Einsichten» als 38. Ausgabe der Reihe «Fund-Orte» im Zürcher Orte-Verlag vor.
«Museal» waren Umbrichts Gedichte noch nie – noch nicht mal das Etikett «regional» gilt (ein die Schweizer Lyrik oft treffendes Vorurteil). Vielmehr durchmessen Umbrichts «Einsichten», poetisch verwandelt und geadelt, ein reiches Themata-Spektrum vom «Austernfrühstück» bis zum «Spaziergang in Venedig», von «Atlantis» bis zur «Osterinsel». Gegliedert ist der vom Verlag sehr qualitätsvoll realisierte Band in die fünf Abschnitte «Leer vom Hunger nach Licht» , «Der Kontinent, den niemand kennt», «Doppelgänger beim Frühstück», «Britische und andere Impressionen» und «Anwesenheit, Abwesenheit». Umbricht breitet hier eine sehr bildreiche, oft packende, manchmal still-eindringlich wirkende Palette von Poesie, lyrischen Impressionen und Aphoristischem aus. Lesenswert. (we) ■
Clemens Umbricht: Museum der Einsichten, Gedichte, 74 Seiten, Orte Verlag, ISBN 3-85830-166-6
.
.
Rainer Wedler: «Es gibt keine Spur»
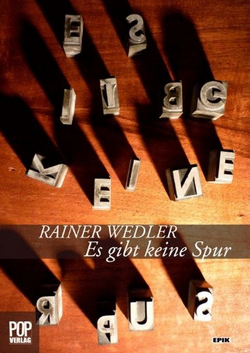 Im Gegensatz zu seinen früheren Prosa-Publikationen schöpft der Karlsruher Schriftsteller Rainer Wedler (geb. 1942) in seinem jüngsten Belletristik-Band «Es gibt keine Spur» nur schon äusserlich diesmal aus dem Vollen: Auf üppigen 330 Seiten fächert Wedler ein thematisch wie sprachlich beeindruckendes Kaleidoskop von ultrakurzen bis ellenlangen Prosastücken auf.
Im Gegensatz zu seinen früheren Prosa-Publikationen schöpft der Karlsruher Schriftsteller Rainer Wedler (geb. 1942) in seinem jüngsten Belletristik-Band «Es gibt keine Spur» nur schon äusserlich diesmal aus dem Vollen: Auf üppigen 330 Seiten fächert Wedler ein thematisch wie sprachlich beeindruckendes Kaleidoskop von ultrakurzen bis ellenlangen Prosastücken auf.
Den weit über 50 Erzählungen – sie stammen teils aus früheren Schaffensjahren – eignet durchwegs enorme sprachliche Virtuosität und eine Varianz der Diktion, die verblüfft: Vom Staccato beim Darstellen «objektiver philosophischer Zustände» bis hin zum epischen Legato beim Schildern emotionaler Untiefen findet der wort- und bildverliebte Autor den adäquaten Sprachfluss. Über bzw. unter allem schimmert dabei eine (durchaus auch selbst-)ironische Nuance durch, die alle Intellektualität literarisch durchwächst. Keine einfache, eine anstrengende Lektüre, die desto stärker fesselt, je konzentrierter man sie zu sich nimmt. Empfehlenswert. (we) ■
Rainer Wedler: Es gibt keine Spur, Prosastücke, 330 Seiten, Pop Verlag, ISBN 978-3863560522
.
.
Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
.
Interessante Musik-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Katharina Apostolidis: «Buntes Geigenwunderland» Band 1
 Selbstverständlich ist die neue Violinschule «Buntes Geigenwunderland» aus dem Hause Bosworth nicht die erste ihrer Art – Dutzende vergleichbarer, durchaus nutzbringender Anfänger-Werke sind im Handel erhältlich. Das neue «Geigenwunderland» für 5-9-jährige Schüler, dessen erster Band nun von Katharina Apostolidis präsentiert wird, besticht aber durch besonders sorgfältige und qualitätsvolle Auswahl sowohl seines musikalischen wie visuellen Materials und durch besonders kindgerechte Aufbereitung der Inhalte. Stichworte sind hier: Karten-, Gehör-, Bewegungs- und Würfelspiele, aber auch Notenrätsel, Malaufgaben, Improvisationsanregungen, Farbsaiten oder die Ton-für-Ton-Einführung der C-Skala. Dabei wird bewusst auf Bewegungsbeschreibungen und methodische Anmerkungen verzichtet; sie bleiben der Lehrperson überlassen. Weiteres Plus des sehr ästhetisch konzipierten Heftes: die beiliegende CD enthält die Stücke in einem betont langsamen Mitspiel-Tempo. Empfehlenswert. (we) ■
Selbstverständlich ist die neue Violinschule «Buntes Geigenwunderland» aus dem Hause Bosworth nicht die erste ihrer Art – Dutzende vergleichbarer, durchaus nutzbringender Anfänger-Werke sind im Handel erhältlich. Das neue «Geigenwunderland» für 5-9-jährige Schüler, dessen erster Band nun von Katharina Apostolidis präsentiert wird, besticht aber durch besonders sorgfältige und qualitätsvolle Auswahl sowohl seines musikalischen wie visuellen Materials und durch besonders kindgerechte Aufbereitung der Inhalte. Stichworte sind hier: Karten-, Gehör-, Bewegungs- und Würfelspiele, aber auch Notenrätsel, Malaufgaben, Improvisationsanregungen, Farbsaiten oder die Ton-für-Ton-Einführung der C-Skala. Dabei wird bewusst auf Bewegungsbeschreibungen und methodische Anmerkungen verzichtet; sie bleiben der Lehrperson überlassen. Weiteres Plus des sehr ästhetisch konzipierten Heftes: die beiliegende CD enthält die Stücke in einem betont langsamen Mitspiel-Tempo. Empfehlenswert. (we) ■
Katharina Apostolidis: Buntes Geigenwunderland / Band 1, Geigenschule für Kinder von 5-9 Jahren, 68 Seiten / mit CD, Bosworth Musikverlag, ISBN 978-3865437563
.
.
Contzen & Bredohl: Violin-Sonaten von Hindemith und Heucke
 Immer wieder finden sich – trotz enormem Spar- bzw. Kostendruck und schwindender Umsätze im Klassik-CD-Markt – innovative musikalische Spitzenkräfte ihres Faches, die sich unbekannter bzw. sperriger Literatur abseits des Geschmack-Mainstreams annehmen. So auch die Violinistin Mirijam Contzen und der Dortmunder Pianist Tobias Bredohl, die sich in ihrer jüngsten Einspielung den beiden Hindemith-Sonaten in Es- und E-Dur, v.a. aber zwei Violin-Sonaten des bedeutenden baden-württembergischen Komponisten Stefan Heucke (geb. 1959) widmen. Vor allem letzteres ist eine besonders verdienstvolle Anstrengung der zwei renommierten Solisten: Heuckes Oeuvre gehört unbedingt vermehrt in die CD-Regale, denn trotz editorischer Anstrengungen seines Verlegers Schott ist das bereits ebenso umfangreiche wie vielfältige Schaffen dieses innovativen zeitgenössischen Komponisten noch nicht in gebührender Präsenz eingespielt. Hörenswert.(we) ■
Immer wieder finden sich – trotz enormem Spar- bzw. Kostendruck und schwindender Umsätze im Klassik-CD-Markt – innovative musikalische Spitzenkräfte ihres Faches, die sich unbekannter bzw. sperriger Literatur abseits des Geschmack-Mainstreams annehmen. So auch die Violinistin Mirijam Contzen und der Dortmunder Pianist Tobias Bredohl, die sich in ihrer jüngsten Einspielung den beiden Hindemith-Sonaten in Es- und E-Dur, v.a. aber zwei Violin-Sonaten des bedeutenden baden-württembergischen Komponisten Stefan Heucke (geb. 1959) widmen. Vor allem letzteres ist eine besonders verdienstvolle Anstrengung der zwei renommierten Solisten: Heuckes Oeuvre gehört unbedingt vermehrt in die CD-Regale, denn trotz editorischer Anstrengungen seines Verlegers Schott ist das bereits ebenso umfangreiche wie vielfältige Schaffen dieses innovativen zeitgenössischen Komponisten noch nicht in gebührender Präsenz eingespielt. Hörenswert.(we) ■
Mirijam Contzen, Tobias Bredohl: Violin-Sonaten von Paul Hindemith und Stefan Heucke, 61 Minuten, Classic Clips (Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit)
.
.
.
Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Gesina Stärz: «Die Verfolgerin» (Roman)
.
«Heute Nacht bin ich gestorben»
Günter Nawe
.
 Was wäre, wenn… man einfach einen Menschen töten würde. Einfach so – auf der Straße? Traum oder Albtraum – oder gar Wirklichkeit? Ein solcher Gedanke jedenfalls wird für Jossi zu einer Art Obsession. Dabei ist Jossi, Anfang vierzig, eine eigentlich recht unauffällige Frau, die in sogenannten gutbürgerlichen Verhältnissen lebt. Ihr Mann ist Kardiologe, die beiden Söhne studieren, sie verdient sich ihr Geld als Texterin.
Was wäre, wenn… man einfach einen Menschen töten würde. Einfach so – auf der Straße? Traum oder Albtraum – oder gar Wirklichkeit? Ein solcher Gedanke jedenfalls wird für Jossi zu einer Art Obsession. Dabei ist Jossi, Anfang vierzig, eine eigentlich recht unauffällige Frau, die in sogenannten gutbürgerlichen Verhältnissen lebt. Ihr Mann ist Kardiologe, die beiden Söhne studieren, sie verdient sich ihr Geld als Texterin.
Wäre da nicht… Von ihrem Mann, der im Roman nur als «der Ehemann» oder «der Mann» bezeichnet wird, fühlt sie sich nach zwanzig Jahren Ehe nicht mehr genügend beachtet, ja verlassen – und wird es letztendlich auch. Ihre Liaison mit Till ist mehr oder minder oberflächlich. Bleibt nur der Schmerz, das Unausgefülltsein. Am Ende hat der Leser ein großartiges Psychogramm einer Frau gelesen.
«Heute Nacht bin ich gestorben», so heißt es zu Beginn des Romans. «Innerlich… Der Mann neben mir im Bett hat geschnarcht…« Ein Whiskey sour lässt «alle Zellen in mir in Schneekristalle verwandeln. Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber ich fühlte mich besser, und etwas in mir wusste, dass dieser Zustand anhalten würde.»
Soweit also die «psychologischen» Voraussetzungen in dem Roman «Die Verfolgerin» von Gesina Stärz. Die Autorin, sie ist in Sachsen geboren, lebt in München und hat mit «kalkweiss» bereits 2011 einen beachtlichen und beachteten Roman veröffentlicht. In ihrem neuen Roman gelingt es ihr auf sehr subtile Weise, Fiktion und Wirklichkeit in Einklang zu bringen, ein spannendes Geflecht von Traum und realem Erleben herzustellen.
Jossi «erfindet» sich ein neues Leben außerhalb der bisherigen Lebenswirklichkeit. Sie verstrickt sich in die Gedankenwelten von Mörderinnen und Mördern, plant gedanklich den perfekten Mord. Motiv: Fehlanzeige. Ihre «Opfer»: Zufallsbegegnungen und Menschen, auf deren Gesichtern alle Empfindungen gelöscht sind. Sie wird zur «Verfolgerin» – auf der steten Suche nach ihren Opfern.
Hier bekommt der Roman einen interessanten kriminalistischen Touch. Jossi recherchiert bis ins kleinste Detail eine Tötungsmethode, die keine Spuren hinterlässt. Ein Gift, das nicht oder kaum nachweisbar ist, wird über eine komplizierte Konstruktion durch einen Stock für das Opfer kaum wahrnehmbar injiziert wird.

Gesina Stärz hat einen schönen und spannenden Roman geschrieben, der angesiedelt ist zwischen Psychologie und Kriminalistik, zwischen Traum und Wirklichkeit – und zugleich eine interessante psychologische Studie darstellt über Fiktion und Realität
Die «Planungen» der Morde, die Recherche nach einem seltenen Gift, die Konstruktion der «Waffe», die «Durchführung» (Jossi hat 17 Morde begangen, und niemand hat es bemerkt) – dies alles steht in direktem Zusammenhang mit dem realen Leben der Verfolgerin. Nach außen sieht es so aus, als gelte der ganze Aufwand einem Romanprojekt. Familie, Freundinnen, der Liebhaber – sie alle werden auf raffinierte Art und Weise getäuscht. Alles andere bleibt offen. Fiktion oder Realität? Am Ende bekennt die Verfolgerin: «Ich wollte nicht, das der Ehemann geht. Ich wollte, dass er mich sieht, dass er mich spürt, dass er mir die Hand reicht.». Gibt es hier doch das, was Psychologen und Kriminologen ein Motiv nennen?
Am Ende steht auch ein Satz, der diesen Roman in sprachlicher Hinsicht charakterisiert: «Ihr Ton ist sachlich und wirkt streng.» Das gilt auch für Gesina Stärz’ Sprache, die fast emotionslos ist und wie ein Dossier gelesen werden kann. Die Spannung bezieht das interessante Werk aus seiner gelungenen Mischung von Traum und Wirklichkeit – und tieferer Bedeutung. ■
Gesina Stärz: Die Verfolgerin, Roman, edition 8, 174 Seiten, ISBN 978-3-85990-183-4
.
.
.
.
Nico Bleutge: «Verdecktes Gelände» (Gedichte)
.
Moderne Lyrik – mit Voraussetzungen
Bernd Giehl
.
 Wer schreibt heute eigentlich noch Naturgedichte? Ich muss gestehen: Ich bin nicht auf dem Laufenden. Jedes Jahr erscheinen so viele Lyrikbände, da kann man schon mal den Überblick verlieren – Sarah Kirsch fällt mir ein oder Wulf Kirsten, aber sonst? Gibt es auch noch jüngere Autoren, die die Natur zu ihrem Gegenstand wählen? Ich habe ein wenig im 25. Jahrbuch der Lyrik (S. Fischer 2007) geblättert. Ein paar habe ich im Teil von 1998 gefunden (Jürgen Becker, Friederike Mayröcker). Sonst: nicht viel. Naturlyrik scheint gerade nicht «in» zu sein. Dabei vereint dieser Band doch die Gedichte unterschiedlichster Autoren aus den Jahren 1979-2006.
Wer schreibt heute eigentlich noch Naturgedichte? Ich muss gestehen: Ich bin nicht auf dem Laufenden. Jedes Jahr erscheinen so viele Lyrikbände, da kann man schon mal den Überblick verlieren – Sarah Kirsch fällt mir ein oder Wulf Kirsten, aber sonst? Gibt es auch noch jüngere Autoren, die die Natur zu ihrem Gegenstand wählen? Ich habe ein wenig im 25. Jahrbuch der Lyrik (S. Fischer 2007) geblättert. Ein paar habe ich im Teil von 1998 gefunden (Jürgen Becker, Friederike Mayröcker). Sonst: nicht viel. Naturlyrik scheint gerade nicht «in» zu sein. Dabei vereint dieser Band doch die Gedichte unterschiedlichster Autoren aus den Jahren 1979-2006.
Viele Gedichte Nico Bleutges handeln vom Erleben der Natur. Aber es ist keine idyllische Natur, sondern eine eher fremdartige, vom Menschen unter seine Herrschaft gezwungene, die Bleutge beschreibt:
«am ufer ankommen, wach/ unter dem schwelgeruch der flure, ruß-/ wasser, wandernder austritt, der sog/ lief langsam in sich zurück. keller / die nachhallten, gänge, einfach überwölbt, / von feuchte durchzogen, sie zeigte sich vorne, / bewegte sich im hintergrund, kaltluft drang nach, / infiltrierte die stufen, moos, die rohe verflechtung/ löste sich aus dem raum, löste sich auf im gehen/das schon innen war, wände verschwammen, zellen/ wuchsen in die gänge ein, porig, vertraut/ mit den fugen, ließen sie, ringsum verlängert / pflanzen austreiben, wuchernde blattformen/ führten tiefer ins ufer hinab.»
Bleutges Technik ist die der Überblendung. Bilder schieben sich ineinander. Da ist zum einen das Bild eines Bach- oder Seeufers und zum anderen das Bild eines alten bemoosten Kellergewölbes oder Kellergangs, und beide werden bis zur Ununterscheidbarkeit vermischt. An anderen Stellen beschreibt Bleutge nur Natur, aber er geht so nah heran, dass das Bild verschwimmt:
«wasser im sinn haben, steine, / das rundumlaufende licht/ auf den schichten des piers// meeresbeweglichkeit, kurzes/ sprühen, austausch von wärme/ und gewicht, denken an//
Witterung, kiemen, brüchiges/, holz, das sich ablöst, gleich/ wieder angesaugt wird//
von den pfosten am pier./ fischsilber, mölekulares/ glänzen, rohglas, zersplittert//
und doch aufgenommen, vermischt/ mit der entfernung zum hafen/ die masse durchdringt sich, wasser//
in wasser, ein drängen so eins/ in sich, so unterschieden/ wie die steine, die gleiten, leicht//
ihre schuppen verlieren, sinken/ versenken zinkweiße strömung/ aus spannung und klang//
die nicht nachläßt/ sich formt/ im gedanken an flutwechsel, / dämmerungsdichte am hafen.»
Natur wie fotografiert vom Makroobjektiv. Der Pointillismus fällt mir ein, eine Strömung, die sich Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Impressionismus entwickelte, und dessen Bilder man nur erkennen kann, wenn man Abstand nimmt.
Aber keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt auch andere Gedichte, die fast schon verständlich sind beim ersten Lesen. Gedichte, von denen man den Eindruck hat, man könne ihren Inhalt in eigenen Worten wiedergeben.(«die augen meiner Mutter waren hinter glas», S.36, «und manchmal nachts da geht der atem leise, S.40) Das sind dann keine Gedichte über die Natur, sondern über das eigene Bewusstsein.

Die Gedichte Nico Bleutges handeln vom Erleben der Natur. Aber es ist keine idyllische Natur, sondern eine eher fremdartige, vom Menschen unter seine Herrschaft gezwungene, die Bleutge beschreibt. Komplexe Sprachgebilde, die gewisse Kenntnisse der modernen Literatur voraussetzen.
Gedichte, so habe ich es schon mehrfach behauptet, sagen nicht unmittelbar, was sie meinen, sondern sie sprechen in Bildern, und manchmal stellen sie ihre Leser auch vor Rätsel. So betrachtet sind diese Gedichte durchaus lesenswert. Allerdings sollte man schon eine Ahnung von moderner Lyrik haben, ehe man sich mit ihnen befasst… ▀
Nico Bleutge: Verdecktes Gelände, Lyrik, C.H. Beck Verlag, 68 Seiten, ISBN 978-3406646782
.
Interessante Buch-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Ferdinand Wedler: «stARTistik» – Die Welt in Kunstkuchen
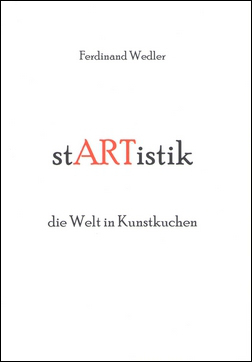 Der deutsche Philologe und technische Software-Redakteur Ferdinand Wedler (geb. 1979) ist als freiberuflicher Illustrator und Karikaturist vielseitig tätig. In seiner jüngst erschienen «stARTistik» knöpft er sich die oft verräterisch skurrile Welt der Zahlen, Statistiken, Umfragen vor. Als «erzählte Zählungen» will er seine «Welt in Kunstkuchen» verstanden wissen: Seine Kuchendiagramme – jeweils durch eine stilisierte Zeichnung illustriert – haben einen teils direkten, teils mehrdeutigen und auch erst zu enträtselnden Sprachwitz. Vor Wedlers humorvollem Zugriff ist dabei kein Alltagsbereich sicher; das Bändchen ist unterteilt in die Segmente: leben, wohnen und essen, lieben, denken, arbeiten, reisen, sehen-hören-lesen. Denn wie meint der Autor: «An allen Schauplätzen des Lebens lassen sich aus dem Erlebten Kuchenstücke bilden. Teile eines Kuchens, der Raum für das Gedachte öffnet». – Originell. ■
Der deutsche Philologe und technische Software-Redakteur Ferdinand Wedler (geb. 1979) ist als freiberuflicher Illustrator und Karikaturist vielseitig tätig. In seiner jüngst erschienen «stARTistik» knöpft er sich die oft verräterisch skurrile Welt der Zahlen, Statistiken, Umfragen vor. Als «erzählte Zählungen» will er seine «Welt in Kunstkuchen» verstanden wissen: Seine Kuchendiagramme – jeweils durch eine stilisierte Zeichnung illustriert – haben einen teils direkten, teils mehrdeutigen und auch erst zu enträtselnden Sprachwitz. Vor Wedlers humorvollem Zugriff ist dabei kein Alltagsbereich sicher; das Bändchen ist unterteilt in die Segmente: leben, wohnen und essen, lieben, denken, arbeiten, reisen, sehen-hören-lesen. Denn wie meint der Autor: «An allen Schauplätzen des Lebens lassen sich aus dem Erlebten Kuchenstücke bilden. Teile eines Kuchens, der Raum für das Gedachte öffnet». – Originell. ■
Ferdinand Wedler: stARTistik – Die Welt in Kunstkuchen, 72 Seiten, epubli Berlin, ISBN 978-3844216349
.
.
Carola Vahldiek: «Ein Tag wie ein Schmetterling»
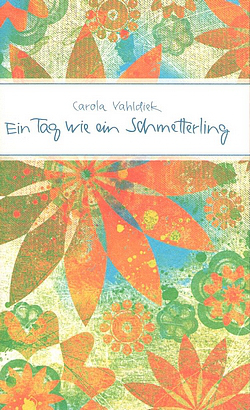 «Das weiße Blatt / des Tages mit / Worten / beschreiben: / “Guten Morgen!” / Den Morgen gut sein lassen» – so eröffnet die Lyrikerin und bekannte norddeutsche Naturphotographin Carola Vahldiek ihr jüngstes kleines «Wohlfühl-Bändchen» namens «Ein Tag wie ein Schmetterling». Und ebenso leicht-luftig kommen alle anderen Sprüche und Illustrationen auf diesen schmuck gestalteten, betont positiv gehaltenen “Frühlingsblättern” daher. Innehalten, aber auch Wandlung sind dabei zwei zentrale inhaltliche Leitmotive des auch kalligraphisch hübsch konzipierten Büchleins. Problembewusstsein oder philosophische Schwere findet sich nirgends auf diesen paar farbhellen Seiten – dafür viel guter Zuspruch und die Aufforderung zum Wahrnehmen des Moments: «Am Ende / mit blauen Stiften / Nacht / einkehren lassen / und einen / Stern». – Wellness. ■
«Das weiße Blatt / des Tages mit / Worten / beschreiben: / “Guten Morgen!” / Den Morgen gut sein lassen» – so eröffnet die Lyrikerin und bekannte norddeutsche Naturphotographin Carola Vahldiek ihr jüngstes kleines «Wohlfühl-Bändchen» namens «Ein Tag wie ein Schmetterling». Und ebenso leicht-luftig kommen alle anderen Sprüche und Illustrationen auf diesen schmuck gestalteten, betont positiv gehaltenen “Frühlingsblättern” daher. Innehalten, aber auch Wandlung sind dabei zwei zentrale inhaltliche Leitmotive des auch kalligraphisch hübsch konzipierten Büchleins. Problembewusstsein oder philosophische Schwere findet sich nirgends auf diesen paar farbhellen Seiten – dafür viel guter Zuspruch und die Aufforderung zum Wahrnehmen des Moments: «Am Ende / mit blauen Stiften / Nacht / einkehren lassen / und einen / Stern». – Wellness. ■
Carola Vahldiek: Ein Tag wie ein Schmetterling, 24 Seiten, Verlag am Eschbach, ISBN 978-3-86917-216-3
.
.
Johanna Adorjan: «Meine 500 besten Freunde»
 Die bekannte FAZ-Feuilletonistin Johanna Adorján präsentiert mit ihrem Band «Meine 500 besten Freunde» nun bereits ihre dritte grössere Belletristik-Novität – nach dem Theaterstück «Die Lebenden und die Toten» (2004) und nach «Eine exklusive Liebe» (2009).
Die bekannte FAZ-Feuilletonistin Johanna Adorján präsentiert mit ihrem Band «Meine 500 besten Freunde» nun bereits ihre dritte grössere Belletristik-Novität – nach dem Theaterstück «Die Lebenden und die Toten» (2004) und nach «Eine exklusive Liebe» (2009).
Der Band versammelt 13 eher lose miteinander verknüpfte Erzählungen aus und über Deutschlands Hauptstadt. Die 1971 in Stockholm geborene Autorin breitet dabei ein durchaus sensibel beobachtetes Kaleidoskop von Berliner Protagonisten aus, deren Leben sich extrem widersprüchlich zwischen Sein und Schein abspielt, gespiegelt in der oft scharf formulierten Ironie Adorjans. Die skurrile bis abstruse Welt der Berliner Schickeria und ihren Modemachern, Regisseuren, Schauspielern und Journalisten – hier wird sie literarisches Ereignis. – Lesevergnügen. ■
Johanna Adorján: Meine 500 besten Freunde, Erzählungen, 256 Seiten, Luchterhand Verlag, ISBN 978-3-630-87354-1
.
.
.
Weitere Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
.
Gisela Elsner: «Zerreissproben» (Erzählungen)
.
Nichts für zarte Gemüter
Dr. Karin Afshar
.
 Bestimmt haben Sie als Leser oder Leserin mehr als einmal darüber nachgedacht, zu welcher Gruppe Leser Sie wohl gehören würden, wenn es in Buchhandlungen nicht die üblichen Sparteneinteilungen in Sachbücher, Romane, Fantasy, Frauenromane etc. gäbe, sondern Einteilungen wie z.B. in Kundensparten: «Interessiert sich für die politische Richtung eines Autors», oder «Meint, kein Autor schreibe anders als autobiografisch», oder «Interessiert sich für in Widersprüche verstrickte Autoren», zu deren Regale Sie dergestalt orientiert Ihre Schritte lenken könnten, um sicherzustellen, dass Sie auch genau die Bücher, die Sie interessieren, in die Hände bekämen und nicht unnötigerweise – das Leben hält genug schlechte Überraschungen bereit – solche, die sie enttäuschen würden. Die Sparten in Kombination würden Ihnen jenes Buch auswerfen, um das es in den nächsten Absätzen gehen wird.
Bestimmt haben Sie als Leser oder Leserin mehr als einmal darüber nachgedacht, zu welcher Gruppe Leser Sie wohl gehören würden, wenn es in Buchhandlungen nicht die üblichen Sparteneinteilungen in Sachbücher, Romane, Fantasy, Frauenromane etc. gäbe, sondern Einteilungen wie z.B. in Kundensparten: «Interessiert sich für die politische Richtung eines Autors», oder «Meint, kein Autor schreibe anders als autobiografisch», oder «Interessiert sich für in Widersprüche verstrickte Autoren», zu deren Regale Sie dergestalt orientiert Ihre Schritte lenken könnten, um sicherzustellen, dass Sie auch genau die Bücher, die Sie interessieren, in die Hände bekämen und nicht unnötigerweise – das Leben hält genug schlechte Überraschungen bereit – solche, die sie enttäuschen würden. Die Sparten in Kombination würden Ihnen jenes Buch auswerfen, um das es in den nächsten Absätzen gehen wird.
Wenn Sie den Eingangssatz durchdrungen haben, stehen Sie bereits mitten in einem Labyrinth; so ist es zumindest bei Gisela Elsner. Besagter Satz ist nur ein fader Abklatsch dessen, was sie zu Papier bringt. Die kafkaeske Art ist ihr Stil, ihr Markenzeichen: sie konstruiert Sätze, die erstaunen, zum Lachen bringen, ungeduldig, atemlos, ja, wütend machen. Sie wiederholt, insistiert, ist akribisch, sie zählt auf, spitzt zu, zerpflückt, zerteilt… Dieser Erzählstil unterstreicht natürlich Inhalte, und die sind nicht lustig. Ihre Texte handeln von der Künstlichkeit einer bürgerlichen Welt, die einerseits die Schrauben immer fester anzieht, andererseits verschroben daher kommt.
Elf Erzählungen Elsners hat die Herausgeberin Christine Künzel neu choreographiert, und die Abfolge ist gelungen. Christine Künzel betreut seit 2002 die Werkschau Gisela Elsners im Verbrecher Verlag Berlin: «Die Zähmung», Roman (2002), «Das Berührungsverbot», Roman (2006), «Heilig Blut», Roman (2007), «Otto der Großaktionär», Roman (2008) und «Fliegeralarm», Roman (2009) sind bereits erschienen. Gisela Elsner erhielt etliche internationale Auszeichnungen, darunter den Prix Formentor für ihren ersten Roman «Die Riesenzwerge» (1964), an dessen Erfolg sie nicht wieder anknüpfen konnte. Sie veröffentlichte Romane, Erzählungen, Aufsätze, Hörspiele und das Opernlibretto «Friedenssaison».
Elsner beschreibt in den vorliegenden Erzählungen vor allem Menschen, die sie aus dem Kollektiv herausarbeitet, wie man einen 3D-Abdruck aus einem Nagelbild herausarbeitet: hinten wird gedrückt und vorne entsteht das Bild. Sie beschreibt das Kollektiv, die Welt der Oberfläche, die sie sodann demaskiert, damit das Darunter – das Scheinheilige – zum Vorschein kommt. Die Geschichten verlangen starke Nerven, denn Elsner zerlegt und karikiert so gründlich, dass sie sich selbst und dem Leser den Boden unter den Füßen wegzuziehen vermag.
In «Die Zerreißprobe» (der ersten Erzählung im Band 2) geht es um eine Frau, die sich – als Terroristin verdächtigt – im Fadenkreuz des Verfassungsschutzes glaubt. Ihre Wohnung wird beobachtet. Wenn sie nicht zuhause ist, kommen «sie», schalten Tischlampen aus, verrücken Möbel und schneiden von Kleidungsstücken Stofffetzen ab. Von einem Nachbarn, dem Vormieter dieser Wohnung, in der sie nun lebt, erfährt sie, dass in der Wohnung in erst kürzlich zurückliegender Vor-Nach-Stammheimer Zeit Terroristen untergeschlüpft sein sollen. Der Verdacht – so vermutet die Erzählerin, die auch in der Erzählung Schriftstellerin ist – fällt jetzt auf sie, aber sie geht der Sache auf den Grund.
In «Der Maharadscha-Palast» mokiert sie sich über eine Reisegesellschaft, die am Ort ihrer Unterkunft mit einigen Überraschungen konfrontiert ist: keiner der Betroffenen wird sich – zurück in Deutschland – die Blöße geben und zugeben, sich angesichts des Vorgefundenen entlarvt zu haben.
«Der Selbstverwirklichungswahn» verhöhnt nicht nur die Selbstfindungswelle der frühen 80er Jahre, sondern nimmt die Auswüchse der «Grünlichen» aufs Korn, und dabei nicht weniges vorweg. Wie überhaupt die spitz gezeichneten Bilder sowohl allesamt Abbilder der 70er und 80er sind, als auch eine Vorwegnahme, die wir jetzt – 2013 – im Nachhinein in voller Tragweite bestätigen können. Elsners Geschichten sind meiner Meinung nach mehr als Satire. Unsere Zeit hat die Satire längst eingeholt, und bei manchen Erzählungen ereilt mich der Verdacht, Elsner habe geahnt, worauf es hinausläuft, und ist Opfer ihres persönlichen Minenfeldes geworden. Damit musste sie eine Herausgefallene werden!
In «Der Sterbenskünstler» geht es um die Friedensbewegung und ihre Abstrusitäten, in «Der Antwortbrief Hermann Kafkas auf Franz Kafkas Brief an seinen Vater» bricht sie mit ihrem «Gott» Franz, an dem sich orientieren zu können sie in jungen Jahren glaubte: «Du schreibst, Du wärest mir als das Ergebnis meiner Erziehung peinlich. […] Viel peinlicher indes als das Ergebnis meiner Erziehung ist für mich die Tatsache, dass ich es durch Dich mehr und mehr verlerne, nicht allein die Welt zu begreifen, sondern auch mich. […]» Kafka, ohne dies ergiebig zu vertiefen, lebte vor den Toren zur Gegenwart und trat nicht über die Schwelle ins Jetzt. Seine Hauptthemen waren durchweg voller Anklage an jene, von denen er glaubte, sie verhinderten ihn. Das wiederum übte eine gewisse Faszination – nicht nur auf Elsner – aus.

In ihrem zweiten Erzählband “Zerreissproben” legt Gisela Elsner ein Zeugnis ihrer selbst ab, und das so fundamental und radikal, dass es einem die Luft abdrehen kann. Wir blicken in Abgründe…
«Die Zwillinge» und «Vom Tick-Tack zum Tick» kommen im Vergleich zu «Die verwüstete Glückseligkeit» harmlos daher, zeugen aber gerade deshalb von Elsners – es Talent zu schreiben zu nennen, wäre eine Beleidigung – mal lauter, mal leiser Demontierungswut und Wortgewalt. Elsner geht auch mit sich selbst hart ins Gericht, demontiert sich selbst und erwartet anscheinend doch unendlich viel – oder gar nichts mehr? Was weiß man von dieser Frau? Muss man etwas über sie wissen? Ich finde ja: man muss! Sie ist gegen die Friedensbewegung, sie lehnt die Errungenschaften von 68 radikal ab, sie bekennt sich zum Kommunismus, ist aber doch wankelmütig (Eintreten, dann Austreten, dann Wiedereintreten in die DKP), sie will nicht Dichterin genannt werden, … Sie inszeniert sich selbst und später – als das nicht mehr reicht – ihre Selbstzerstörung. Sie hadert mit sich, ist unzufrieden, gehört nirgendwo dazu, und braucht das vielleicht doch sehr dringend? «Irgendwie» besteht die «reine Möglichkeit», dass das Ende der ganzen Kette von Missständen, dem Abstrusen, dem verhassten Kapitalismus, der Kleinbürgerlichkeit … ein anderes Leben bedeuten könnte – bis es jedoch soweit ist, fehlt ihr eine wirklich positive Perspektive. Gisela Elsner wird 1937 in Nürnberg geboren, und nimmt sich 1992 das Leben.
Im Buch enthalten sind Erklärungen zu Elsners erzählerischem Werk, editorische Notizen zur Historie der einzelnen Erzählungen sowie deren Verortung im Gesamtwerk. Niemand schreibt anders als autobiografisch – zu dieser Ansicht bin ich im Laufe meines Lebens gelangt. Das Herausstechendste an Elsners hier vorgelegten Erzählungen ist: sie legt ein Zeugnis ihrer selbst ab, und das so fundamental und radikal, dass es einem die Luft abdrehen kann. Wir blicken in Abgründe. Nicht viel Spaß wünsche ich nun beim Lesen, sondern viele Erkenntnisse! ●
Gisela Elsner: Zerreissproben, Erzählungen (Band 2), 224 Seiten, Verbrecher Verlag, ISBN 9783943167054
.
.
.
.
.
Hanns-Josef Ortheil: «Das Kind, das nicht fragte»
.
«Kennst du das Land / Wo die Zitronen blühn?»
Christian Busch
.
 Milde, sanfte Zephirwinde, verzaubernder Duft, im Sonnenlicht gereifte Zitrusfrüchte, melodienschöne Klänge fremder Sprache, in Olivenöl getauchte, mediterrane Speisen, antike, sagenumwobene Kulissen, historische Schätze beherbergende Stätten, die zu den Wurzeln abendländischer Kultur führen: Das alles ist Italien, das Land der Sehnsucht und Objekt germanischen Fernwehs. Der nicht erst seit Goethes Mignon vielbeschworene literarische Topos figuriert in der Gestalt Siziliens auch in Hanns-Josef Ortheils neuem Roman «Das Kind, das nicht fragte» als magischer Ort, der den Lauf der Dinge und der Menschen verändert.
Milde, sanfte Zephirwinde, verzaubernder Duft, im Sonnenlicht gereifte Zitrusfrüchte, melodienschöne Klänge fremder Sprache, in Olivenöl getauchte, mediterrane Speisen, antike, sagenumwobene Kulissen, historische Schätze beherbergende Stätten, die zu den Wurzeln abendländischer Kultur führen: Das alles ist Italien, das Land der Sehnsucht und Objekt germanischen Fernwehs. Der nicht erst seit Goethes Mignon vielbeschworene literarische Topos figuriert in der Gestalt Siziliens auch in Hanns-Josef Ortheils neuem Roman «Das Kind, das nicht fragte» als magischer Ort, der den Lauf der Dinge und der Menschen verändert.
Seine autobiographische Züge tragende Hauptfigur ist ein Benjamin, der Ethnologe Benjamin Merz, das von klein auf unterdrückte, jüngste Kind einer siebenköpfigen bürgerlichen Familie. Von Köln bricht er im Frühjahr auf zu neuen Ufern – nach Mandlica, einer (fiktiven) sizilianischen Kleinstadt. «Gedankenleser» – so werden die Einwohner Mandlicas ihn auf Grund seiner Begabung, den Menschen zuzuhören, ihnen in ihren Erzählungen zu folgen und sie auf diesem Weg zu erforschen, in respektvoller Verehrung nennen, wenn sie sich ihm öffnen. Dass ihn sein wissenschaftliches Forschungsprojekt nicht nur weg von den eigenen morbiden Wurzeln seiner Familiengeschichte und der Enge der Heimat führen wird, sondern auch zu den eigenen tief in ihm vergrabenen Ursprüngen seiner ethnologischen Studien, ahnt man. «Wenn ich die Augen schließe und an Deutschland denke, sehe ich ein Land der Quiz- und Kochsendungen, der überdrehten, wichtigtuerisch vorgetragenen Wetterberichte und der sich täglich ins Kleinste verlaufenden politischen und ökonomischen Kommentare, die ein immerwährendes Unwohlsein verbreitet und dieses Unwohlsein kultivieren.»
So bezieht Benjamin sein Quartier in einer kleinen Pension und beginnt die Wege und Gespräche der Menschen zu suchen. In der Pension trifft er zunächst auf ausgewanderte Landsleute, die den Reizen Siziliens bereits erlegen und verbunden sind: die redselige Maria mit ihrer verschlossenen herb-schönen Schwester Paula, welche zugleich Übersetzerin und Hüterin des Hauses des sizilianischen Nobelpreisträger für Literatur. Schritt für Schritt findet er Zugang zu den bedeutenden und geheimnisvollen Gestalten des Ortes und zu ihren Geheimnissen. Da ist der Buchhändler Alberto, Lucio mit den feuchten und weit geöffneten Augen, Besitzer eines klassischen, traditionellen Ristorante, der für windige EU-Projekte eintretende Bürgermeister Enrico Bonni, seine außergewöhnliche Tochter Adriana und zuletzt die weise Signora Vulpi mit ihrem «gefühligen» Sohn Matteo.
Der zunächst eher karg und verhalten beginnende Roman gewinnt durch die beständige Ich-Perspektive und die stets Unmittelbarkeit des Geschehens evozierende Gegenwart zunehmend an atmosphärischer Dichte. Die dadurch erzeugte Sogkraft hilft dabei, den doch sehr glatt reüssierten Siegeszug der Hauptfigur zu übersehen und dem durchweg photogen und mit sinnlichem Gespür für sizilianische Wirklichkeit erzählten Geschehen treu zu bleiben, bis man ihm schließlich atemlos erlegen ist. Hier erweist sich Hanns-Josef Ortheil erneut als kunstvoller und bis ins Detail ausgefeilter, souveräner Erzähler einer sehr erzählenswerten, zuweilen auch märchenhaft anmutenden Geschichte.
Wendepunkt im Roman ist die nicht gänzlich überraschende Beziehung zu Paula, die als charakterstarke Deutsch-Sizilianerin das nicht gesuchte, aber benötigte Pendant zu «Beniamino» und eine neue Qualität menschlicher Beziehung darstellt: «Das Leben mit Paula ist also ein Erzählstrom eigener lebendiger und heftigerer Art, im Grunde ist es ein erotisches Sprechen, das unsere Vereinigungen vorbereitet oder sogar begleitet.»

Hanns-Josef Ortheils «Das Kind, das nicht fragte» ist ein geradezu klassischer Reiseroman mit Bildungs-, Entwicklungs- und Liebesgeschichte – ein wunderbares Buch für alle fernab des Konsum-Tourismus reisenden Menschen.
So ist Ortheils Roman ein geradezu klassischer Reiseroman mit Bildungs-, Entwicklungs- und Liebesgeschichte, ein wunderbares Buch für alle fernab des Konsum-Tourismus reisenden Menschen, die mit beiden Beinen fest auf dem Teppich stehen, ohne die Hoffnung zu verlieren, dass er fliegen lernt: «Letztlich waren es die Menschen, die ihre Zurückhaltung und Schüchternheit im Umgang mit der Fremde zunehmend verloren. Genau deshalb gingen sie ja in die Fremde: Um dort die störenden Eigenschaften ihrer früheren Identität gegen eine neue, von der Fremde begründete und geformte Identität einzutauschen. In der Fremde verwandelten sie sich, blühten auf und spürten die positiven Auswirkungen ihrer Forschungen am eigenen Leib und an der eigenen Seele.»
Am Ende des Romans färben die etwas altbacken wirkenden Reminiszenzen an Don Camillo und Cinema paradiso den Roman ein wenig rosa – kleine, sympathische Schönheitsflecke in einem nicht nur Sehnsucht nach Sizilien, dem Schmelztiegel zwischen römisch- und griechisch-antiker Kultur weckenden großen Roman über «Das Kind, das nicht fragte». ■
Hanns-Josef Ortheil: Das Kind, das nicht fragte, Roman 426 Seiten, Luchterhand Verlag, ISBN 978-3-630-87302-2
.
.
.
.
.









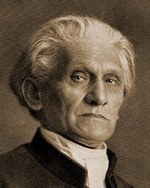
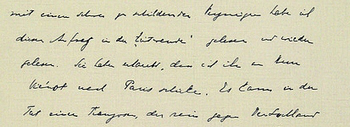
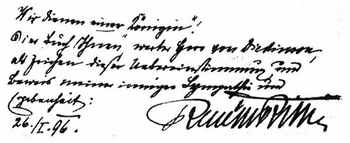











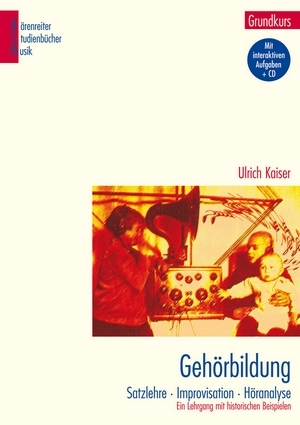

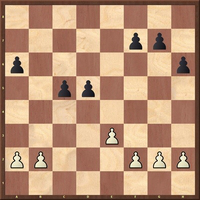
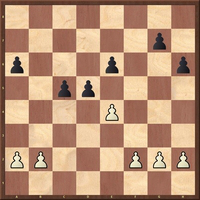
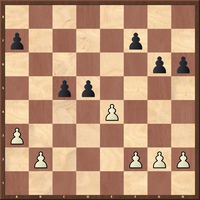
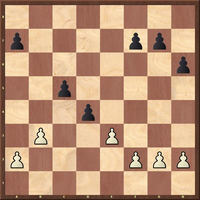


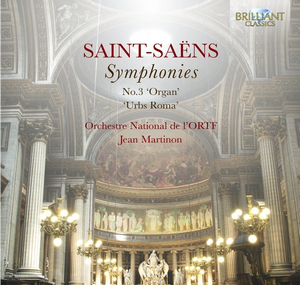


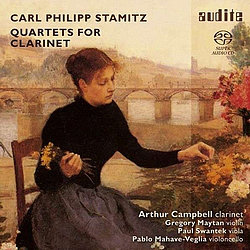 Der Komponist Carl Philipp Stamitz hatte ein Musikerleben geführt, wie es dem romantischen Bild eines Künstlerlebens entsprach. Er selbst war kein Romantiker, dafür lebte er 50 Jahre zu früh. Doch rastlos war er seit seinem 25. Lebensjahr durch die damalige Welt der Musik gehetzt, von Paris bis Dresden, zunächst als Violinen- und Bratschenvirtuose, dann als versierter Komponist von hochmodischer Musik, die an den fürstlichen Höfen angesagt war. Achtzig Symphonien sind so entstanden, eine erhoffte Anstellung aber verschaffte ihm das unermüdliche Werken nicht. Nach zwanzig Jahren Wanderleben heiratete er, ließ sich in Greiz, dem Heimatort seiner Frau nieder, zeugte vier Kinder, die alle früh verstarben, und schließlich starb er 56-jährig 1801 in Jena, verarmt. Drängt sich da nicht langsam ein Vergleich auf mit einem anderen Musiker seiner Zeit?
Der Komponist Carl Philipp Stamitz hatte ein Musikerleben geführt, wie es dem romantischen Bild eines Künstlerlebens entsprach. Er selbst war kein Romantiker, dafür lebte er 50 Jahre zu früh. Doch rastlos war er seit seinem 25. Lebensjahr durch die damalige Welt der Musik gehetzt, von Paris bis Dresden, zunächst als Violinen- und Bratschenvirtuose, dann als versierter Komponist von hochmodischer Musik, die an den fürstlichen Höfen angesagt war. Achtzig Symphonien sind so entstanden, eine erhoffte Anstellung aber verschaffte ihm das unermüdliche Werken nicht. Nach zwanzig Jahren Wanderleben heiratete er, ließ sich in Greiz, dem Heimatort seiner Frau nieder, zeugte vier Kinder, die alle früh verstarben, und schließlich starb er 56-jährig 1801 in Jena, verarmt. Drängt sich da nicht langsam ein Vergleich auf mit einem anderen Musiker seiner Zeit?

















leave a comment