Interessante Musik-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Richard Wagner: «Sämtliche Briefe» Band 21
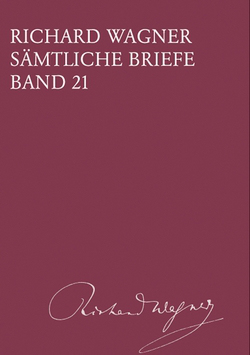 Eine musikeditorische Spitzenleistung des Leipziger Breitkopf&Härtel-Verlages stellt die Herausgabe sämtlicher Briefe Richard Wagners dar. Gestartet Ende 1999, ist Werner Breigs von Grund auf neu konzipierte Reihe auf 35 Ausgaben zuzüglich Supplements ausgelegt. Highlights aller Bände sind jeweils die wissenschaftlich hochwertige Kommentierung, Anreicherung durch zahlreiche Faksimiles sowie die Illustration durch wenig bekannte Photographien, aber vor allem auch die Aufnahme zahlreicher Erstpublikationen.
Eine musikeditorische Spitzenleistung des Leipziger Breitkopf&Härtel-Verlages stellt die Herausgabe sämtlicher Briefe Richard Wagners dar. Gestartet Ende 1999, ist Werner Breigs von Grund auf neu konzipierte Reihe auf 35 Ausgaben zuzüglich Supplements ausgelegt. Highlights aller Bände sind jeweils die wissenschaftlich hochwertige Kommentierung, Anreicherung durch zahlreiche Faksimiles sowie die Illustration durch wenig bekannte Photographien, aber vor allem auch die Aufnahme zahlreicher Erstpublikationen.
Der vorliegende 21. Band enthält die Briefe des sog. «Siegfried-Jahres» 1869: Die Schreiben drehen sich um entscheidende Arbeiten an der Partitur, um die intensivierten Kontakte zu Nietzsche, die Geburt seines Sohnes Siegfried und um grundsätzliche Zusammenhänge in der Verbindung Wagner-Ludwig-II. Eine für die Wagner-Rezeption referentielle Briefe-Sammlung dieses Jahres 1869. ■
Richard Wagner: Sämtliche Briefe / Band 21 – 1869, 844 Seiten, Breitkopf&Härtel, ISBN 978-3-7651-0421-3
.
.
T. Renner/S. Wächter: «Wir hatten Sex in den Trümmern und träumten»
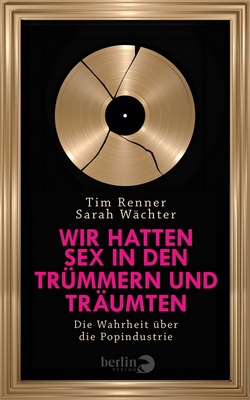 Mit Tim Renner als einem der bedeutendsten deutschen Popmanager sowie der bekannten Radio-Promotorin Sarah Wächter blicken zwei Insider hinter die Kulissen einer teils euphorischen, teils dreckigen, teils hochkreativen Musikindustrie, die in den letzten Jahrzehnten das digitale Zeitalter verschlafen hat, die aber inzwischen wieder allmählich Boden unter den Füßen kriegt. Neben der witzig-satirischen Schreibe und einer schonungslosen Analyse der katastrophalen Zustände in der Branche glänzt der Band nicht zuletzt mit zahlreichen Tipps für angehende Pop-Musiker – und einem positiven Ausblick: “Niemand muss mehr auf einen Plattenvertrag warten” (Renner und Wächter in einem Interview).
Mit Tim Renner als einem der bedeutendsten deutschen Popmanager sowie der bekannten Radio-Promotorin Sarah Wächter blicken zwei Insider hinter die Kulissen einer teils euphorischen, teils dreckigen, teils hochkreativen Musikindustrie, die in den letzten Jahrzehnten das digitale Zeitalter verschlafen hat, die aber inzwischen wieder allmählich Boden unter den Füßen kriegt. Neben der witzig-satirischen Schreibe und einer schonungslosen Analyse der katastrophalen Zustände in der Branche glänzt der Band nicht zuletzt mit zahlreichen Tipps für angehende Pop-Musiker – und einem positiven Ausblick: “Niemand muss mehr auf einen Plattenvertrag warten” (Renner und Wächter in einem Interview).
Insgesamt eine Untersuchung ohne musiksoziologische Ansprüche, aber ein entwaffnender, oft bissiger, teils auch durchaus liebevoller Blick auf eine Sehnsuchtsmaschinerie mit ihren Papp-Stars und Klischee-Produkten. Amüsant und aufschlussreich. ■
Tim Renner, Sarah Wächter: Wir hatten Sex in den Trümmern und träumten – Die Wahrheit über die Popindustrie, 336 Seiten, Berlin Verlag, ISBN 9783827011619
.
.
.
Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Das Zitat der Woche
.
Vom Nutzen und Zweck der Arbeit
Richard Wagner
.
Der Künstler hat, außer an dem Zwecke seines Schaffens, schon an diesem Schaffen, an der Behandlung des Stoffes und dessen Formung selbst Genuß, sein Produzieren ist ihm an und für sich erfreuende und befriedigende Tätigkeit, nicht Arbeit. Dem Handwerker gilt nur der Zweck seiner Bemühung, der Nutzen, den ihm seine Arbeit bringt; die Tätigkeit, die er verwendet, erfreut ihn nicht, sie ist ihm nur Beschwerde, unumgängliche Notwendigkeit, die er am liebsten einer Maschine aufbürden möchte: seine Arbeit vermag ihn nur aus Zwang zu fesseln, deshalb ist er auch nicht mit dem Geiste dabei gegenwärtig, sondern beständig darüber hinaus bei dem Zwecke, den er so gerade wie möglich erreichen möchte.
Ist nun aber der unmittelbare Zweck des Handwerkers nur die Befriedigung eines eigenen Bedürfnisses, z. B. die Herstellung seiner eigenen Wohnung, seiner eignen Gerätschaften, Kleidung usw., so wird ihm mit dem Behagen an den ihm verbleibenden nützlichen Gegenständen allmählich auch Neigung zu einer solchen Zubereitung des Stoffes, wie sie seinem persönlichen Geschmacke zusagt, eintreten; nach der Herstellung des Notwendigsten wird daher sein auf weniger drängende Bedürfnisse gerichtetes Schaffen sich von selbst zu einem künstlerischen erheben: gibt er aber das Produkt seiner Arbeit von sich, verbleibt ihm davon nur der abstrakte Geldeswert, so kann sich unmöglich seine Tätigkeit je über den Charakter der Geschäftigkeit der Maschine erheben; sie gilt ihm nur als Mühe, als traurige, saure Arbeit. Die Letztere ist das Los des Sklaven der Industrie…
Aus Richard Wagner, Die Kunst und die Revolution, Dresden 1849
.
.
Aufgeschnappt
.
Richard Wagner in Israel immer noch gebannt
Nach wie vor scheint die Musik des deutschen Opern-Genies Richard Wagner in Israel absolut unerwünscht zu sein. Und gemäß David Stern, dem neuen Music Director der Israeli Opera in Tel Aviv, wird sich daran auch in Zukunft nichts ändern. Denn obwohl das Oberste Gericht Israels vor einigen Jahren entschied, dass es nicht verboten sei, im Lande Wagner-Musik zu spielen, ist der geniale Romantiker und «Tristan»-Schöpfer für viele Israelis ein Sinnbild für die Kultur der deutschen Nationalsozialisten und antisemitischen Ideologien. Dirigent Stern unlängst im «Wall Street Journal» dazu: «Das ist kein großer Verlust für das israelische Publikum, es gibt vieles anderes, das es sich in Israel zu dirigieren lohnt.»
Splitter
.
«Welcher Dichter unter den Musikern führt die edelste Feder?»
(Frage in einem groβen deutschen Musik-Forum)
Auf die Gefahr hin, als verknöcherter Anachronist rüberzukommen:
Ich nenne Richard Wagner.
Allerdings nicht unbedingt jenen des «Walküren»-Ritts, zu dessen heroisch lärmendem Fortissimo-Tremolo ein Coppola seine tötende Helikopter-Armada über dem brennenden Vietnam wunderbar einen schaurigen Totentanz im Abendlicht tanzen lassen konnte.
Auch nicht jenen «Blut-und-Boden»-Anbeter, dessen Bayreuth vor noch gar nicht so langer Zeit einen hässlichen braunen kleinen schnauzbärtigen Mordbuben mit offenen Armen willkommen hieβ.
Und erst recht nicht jenen «Tannhäuser»-Pilger, wie er vor Gnade triefend ergriffen ins Heil eingeht.
Sondern den Jahrhundert-Wagner des «Tristan», der – nur ein Beispiel unter vielen – mit «Isolde» dichtet:
«O tör’ge Magd!
Frau Minne kenntest du nicht?
Nicht ihres Zaubers Macht?
Des kühnsten Mutes
Königin?
Des Weltenwerdens
Wälterin?
Leben und Tod
sind untertan ihr,
die sie webt aus Lust und Leid,
in Liebe wandelnd den Neid.
Des Todes Werk,
nahm ich’s vermessen zur Hand,
Frau Minne hat es
meiner Macht entwandt.
Die Todgeweihte
nahm sie in Pfand,
faßte das Werk
in ihre Hand.
Wie sie es wendet,
wie sie es endet,
was sie mir küre,
wohin mich führe,
ihr ward ich zu eigen:
nun laß mich Gehorsam zeigen!»
Gruss: Walter Eigenmann
Das Leben der Cosima Wagner
.
Oliver Hilmes: «Herrin des Hügels»
 Richard Wagner – keine andere Gestalt der deutschen Kulturgeschichte ruft bis heute so leidenschaftliche wie widersprüchliche Reaktionen hervor. An der posthumen Politisierung seines Werks, die von den National-Sozialisten dankbar aufgegriffen wurde, hatte seine Witwe Cosima maßgeblichen Anteil. Cosima Wagner war in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Die uneheliche Tocher Franz Liszts und Marie d’Agoults heiratete 1857 im Alter von 19 Jahren den Dirigenten Hans von Bülow, von dem sie nach einer turbulenten Ehe 1870 geschieden wurde. Zu dieser Zeit lebte sie bereits mit Richard Wagner zusammen, den sie wenig später heiratete. Nach seinem Tod führte sie als Herrin des Hügels die Bayreuther Festspiele erfolgreich weiter. Oliver Hilmes zeichnet ein umfassendes, auch psychologisch überzeugendes Charakterbild der Cosima Wagner, die es als «Gralshüterin» des Wagner-Kults durch organisatorisches Geschick und ideologische Hartnäckigkeit verstand, das Wagner-Bild nachhaltig zu prägen. (Verlagsinfo)
Richard Wagner – keine andere Gestalt der deutschen Kulturgeschichte ruft bis heute so leidenschaftliche wie widersprüchliche Reaktionen hervor. An der posthumen Politisierung seines Werks, die von den National-Sozialisten dankbar aufgegriffen wurde, hatte seine Witwe Cosima maßgeblichen Anteil. Cosima Wagner war in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Die uneheliche Tocher Franz Liszts und Marie d’Agoults heiratete 1857 im Alter von 19 Jahren den Dirigenten Hans von Bülow, von dem sie nach einer turbulenten Ehe 1870 geschieden wurde. Zu dieser Zeit lebte sie bereits mit Richard Wagner zusammen, den sie wenig später heiratete. Nach seinem Tod führte sie als Herrin des Hügels die Bayreuther Festspiele erfolgreich weiter. Oliver Hilmes zeichnet ein umfassendes, auch psychologisch überzeugendes Charakterbild der Cosima Wagner, die es als «Gralshüterin» des Wagner-Kults durch organisatorisches Geschick und ideologische Hartnäckigkeit verstand, das Wagner-Bild nachhaltig zu prägen. (Verlagsinfo)
Oliver Hilmes: Herrin des Hügels, Das Leben der Cosima Wagner, Siedler Verlag, 478 Seiten, ISBN 978-3886808366
.
.







leave a comment