Das Zitat der Woche
.
Über den Neoliberalismus
Urs Marti
.
Konflikte nehmen in einer Gesellschaft im gleichen Maß zu wie der Abstand zwischen Reichtum und Armut, Macht und Ohnmacht; auf dieser Einsicht baut das politische Denken seit Jahrtausenden auf. Manche Indizien sprechen dafür, dass es um die Stabilität moderner Gesellschaften nicht zum Besten steht. Gewiss, die revolutionäre Linke ist, wo sie überhaupt eine Rolle spielt, minoritär, von einigen lateinamerikanischen Ländern vielleicht abgesehen. Doch dem Neoliberalismus als der derzeit wohl konsistentesten Doktrin zur Verteidigung der kapitalistischen Marktwirtschaft ist es bislang nicht gelungen, ein konsensfähiges politisches Projekt zu formulieren oder gar umzusetzen. Derweil nimmt der Abstand zwischen Reich und Arm absurde Ausmaße an, der Mittelstand fürchtet den Abstieg, und niemand kann sich mit der Hoffnung trösten, der Markt belohne Fleiß und bestrafe Faulheit […]
Indizien der Destabilisierung sind derzeit aber nicht revolutionäre Bewegungen, eher Pathologien unterschiedlicher Art, Frustrationen und Ressentiments. Demokratische Verfahren mutieren zu marktähnlichen Mechanismen, und häufig drängt sich der Eindruck auf, nachgefragt wurde primär, was den größten Unterhaltungswert verspricht. Beliebt ist der grobe Ton, das Aufhetzen, die Verunglimpfung und moralische Diskreditierung der Gegenseite. Es entbehrt nicht der Ironie, wenn in einem Klima der permanenten Mobilisierung gegen ganze Menschengruppen, denen das Recht auf Partizipation und Inklusion abgesprochen wird, linke Argumente als bloßer Ausdruck einer veralteten Ideologie des Klassenkampfs «widerlegt» werden. Der Klassenkampf ist keine Erfindung der Linken, allenfalls besitzt, wer linke Anliegen vertritt, ein etwas feineres Sensorium für das soziale Konfliktpotenzial, das in der Unvereinbarkeit von Interessen liegt. Dieses Potenzial wird durch weltfremde Utopien einer ausschließlich aus Eigentümern, Konsumenten und Investoren bestehenden Gemeinschaft nicht entschärft. Während die als Neoliberalismus bezeichnete Doktrin in ihrem Selbstverständnis eher eine Wissenschaftskritik ist als eine Wissenschaft, sind ökonomische Theorien, auf die er sich stützt, in den letzten Jahrzehnten regelmäßig falsifiziert worden. Statt sich jedoch mit empirischen Falsifikationen auseinanderzusetzen, ziehen es Neoliberale vor, jeden Versuch, aufgrund rationaler Reflexion alternative Ordnungen zu entwerfen, der Sünde des »Konstruktivismus« zu bezichtigen.
Wenn Krisensymptome nicht oder nur verzehrt wahrgenommen werden, so auch deshalb, weil rationale Diskussionen über die Wünschbarkeit und Realisierbarkeit von Alternativen im politischen Tagesstreit kaum auf Interesse stoßen. In dieser Situation hat die revolutionäre Linke naturgemäß einen schweren Stand. Ihre Konzeption eines freiheitlichen Sozialismus ist vorderhand nicht mehr als eine Hypothese, und Projekte einer revolutionären Politik können nicht mehrheitsfähig werden, wenn es nicht gelingt, den die politische Auseinandersetzung prägenden Irratiopalismus zu überwinden. Immerhin ist zu konstatieren, dass zumindest in der akademischen Welt die Bereitschaft, Marx’ Theorie ernsthaft zu diskutieren, zugenommen hat. In einem kürzlich erschienenen Buch, dessen Herausgeber man wohl dem Lager der Ordoliberalen zurechnen darf, steht zu lesen, Marx habe den zeitgenössischen Liberalismus gerade deshalb abgelehnt, weil ihm die individuelle Freiheit so überaus wichtig gewesen sei. Ebenso wird konstatiert, sein Werk biete «eine lebhaft sprudelnde Quelle der Inspiration, aus der freilich – wenn nicht alles täuscht – gegenwärtig kaum geschöpft wird» (Pies/Leschke: Karl Marx’ kommunistischer Individualismus, Tübingen 2005). Diesem Befund kann man nur beipflichten.
Revolution heißt Veränderung sozialer Institutionen, Neuverteilung der Macht mittels Neudefinition von Rechten, insbesondere Partizipations- und Eigentumsrechten. Revolution in diesem Sinne hat nichts zu tun mit einer moralischen Läuterung oder einer kulturellen Wiedergeburt. Der Liberalismus ist für den Marxismus eine notwendige Stufe der Zivilisationsgeschichte, hinter die zurückzugehen so sinnlos wie verhängnisvoll wäre. Die Revolution verändert nicht den Menschen, sie schafft ein anderes Anreizsystem, sie verändert die Bedingungen, unter denen Menschen handeln, sich entfalten, Wissen sammeln und nutzen können, sie zielt auf die Schaffung neuer Formen der Kooperation, worin in den Worten von Marx und Engels «die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist». ♦Aus Urs Marti, Freiheit, Recht und Revolution, in: Zukunft der Demokratie, Das postkapitalistische Projekt, Rotpunkt Verlag 2008
.
.
.
.
.
.
Beat Ringger: «Die Zukunft der Demokratie»
.
Wege aus dem Kapitalismus
Walter Eigenmann
.
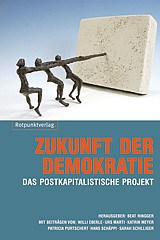 In seinem Vorwort zur eben im Zürcher Rotpunkt-Verlag erschienenen Essay-Sammlung«Zukunft der Demokratie – Das postkapitalistische Projekt» steckt Urs Marti, Professor für Politische Philosophie in Zürich, den Denk-Rahmen des Bandes betont breit aus. Denn, so Marti: «Dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, ist ein Befund, dem zu widersprechen mittlerweile auch überzeugten Anhängern des Kapitalismus schwerfällt. In dem Maß, wie er sich bestätigt, wird klar, dass der Kapitalismus unfähig ist, die von ihm gegebenen Versprechen zu halten. Die ungleiche Verteilung des Wohlstands – und damit auch der Chancen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen – gehört zu den großen Problemen der Gegenwart; ein weiteres ist die Unfähigkeit des Kapitalismus, der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen Einhalt zu gebieten. Der Kapitalismus als private Aneignung der Welt steht im Widerspruch zu den großen Prinzipien der Moderne: Der demokratischen Mitbestimmung einerseits, die notwendigerweise auch die kollektive Nutzung der Ressourcen einschließt, der individuellen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung andererseits, die heute im Namen der unerbittlichen Gesetze des Marktes für die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung faktisch negiert werden.»
In seinem Vorwort zur eben im Zürcher Rotpunkt-Verlag erschienenen Essay-Sammlung«Zukunft der Demokratie – Das postkapitalistische Projekt» steckt Urs Marti, Professor für Politische Philosophie in Zürich, den Denk-Rahmen des Bandes betont breit aus. Denn, so Marti: «Dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, ist ein Befund, dem zu widersprechen mittlerweile auch überzeugten Anhängern des Kapitalismus schwerfällt. In dem Maß, wie er sich bestätigt, wird klar, dass der Kapitalismus unfähig ist, die von ihm gegebenen Versprechen zu halten. Die ungleiche Verteilung des Wohlstands – und damit auch der Chancen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen – gehört zu den großen Problemen der Gegenwart; ein weiteres ist die Unfähigkeit des Kapitalismus, der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen Einhalt zu gebieten. Der Kapitalismus als private Aneignung der Welt steht im Widerspruch zu den großen Prinzipien der Moderne: Der demokratischen Mitbestimmung einerseits, die notwendigerweise auch die kollektive Nutzung der Ressourcen einschließt, der individuellen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung andererseits, die heute im Namen der unerbittlichen Gesetze des Marktes für die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung faktisch negiert werden.»
Demgegenüber aber auch: «Viele werden dem Urteil zustimmen, der Kapitalismus sei unökonomisch im Gebrauch von Ressourcen und ungerecht in deren Verteilung. Dennoch werden sie die Frage, ob die Überwindung des Kapitalismus eine realistische Perspektive sei, verneinen. Tatsächlich sind die Erfahrungen des zo. Jahrhunderts ernüchternd. Das sozialdemokratische Projekt einer Zähmung des Kapitalismus ist nicht zuletzt deshalb gescheitert, weil kaum ernsthaft versucht worden ist, demokratische Kontrolle auf den Bereich der Wirtschaft auszudehnen. Sozialistische Projekte, den Kapitalismus durch ein anderes System zu ersetzen, haben statt mehr Freiheit neue Formen totaler Herrschaft geschaffen.»
 Zwischen diesen beiden realpolitischen Befunden verlaufen nun die thematischen Stränge der sieben umfangreichen Aufsätze dieses Bandes, wobei die Autorinnen&Autoren Urs Marti (geb. 1948, Politologe an der Universität Zürich), Katrin Meyer (geb. 1962, Philosophin an der Universität Basel), Patricia Purtschert (geb. 1973, Kulturwissenschaftlerin in Basel), Willi Eberle (geb. 1948, Gewerkschafter in Zürich), Hans Schäppi (geb. 1942, Vorstandsmitglied von «Sans Papier» in Basel), Beat Ringger (geb.1955, Zentralsekretär der Schweizer Gewerkschaft VPOD) und Sarah Schilliger (geb. 1979, Soziologin an der Universität Basel) sich einig sind in ihrem aufklärerischen Bestreben, welches der Vorwort-Verfasser programmatisch (und dezidiert an Marx&Engels anknüpfend) umreißt: «So groß die Unzufriedenheit der Menschen mit den bestehenden Zuständen in den Gesellschaften der Gegenwart auch sein mag, so setzt sie doch so lange keine revolutionären Energien frei, wie die Mechanismen kapitalistischer Fremdbestimmung nicht durchschaut werden und das Wissen um die Veränderbarkeit der Verhältnisse fehlt. Mit dem vorliegenden Buch wollen die Autorinnen und Autoren beitragen zur Überwindung jenes Irrationalismus, der den Kapitalismus zum Schicksal erklärt, die Frage nach vernünftigen Alternativen tabuisiert und dem Projekt revolutionärer Veränderung die Legitimität abspricht.»
Zwischen diesen beiden realpolitischen Befunden verlaufen nun die thematischen Stränge der sieben umfangreichen Aufsätze dieses Bandes, wobei die Autorinnen&Autoren Urs Marti (geb. 1948, Politologe an der Universität Zürich), Katrin Meyer (geb. 1962, Philosophin an der Universität Basel), Patricia Purtschert (geb. 1973, Kulturwissenschaftlerin in Basel), Willi Eberle (geb. 1948, Gewerkschafter in Zürich), Hans Schäppi (geb. 1942, Vorstandsmitglied von «Sans Papier» in Basel), Beat Ringger (geb.1955, Zentralsekretär der Schweizer Gewerkschaft VPOD) und Sarah Schilliger (geb. 1979, Soziologin an der Universität Basel) sich einig sind in ihrem aufklärerischen Bestreben, welches der Vorwort-Verfasser programmatisch (und dezidiert an Marx&Engels anknüpfend) umreißt: «So groß die Unzufriedenheit der Menschen mit den bestehenden Zuständen in den Gesellschaften der Gegenwart auch sein mag, so setzt sie doch so lange keine revolutionären Energien frei, wie die Mechanismen kapitalistischer Fremdbestimmung nicht durchschaut werden und das Wissen um die Veränderbarkeit der Verhältnisse fehlt. Mit dem vorliegenden Buch wollen die Autorinnen und Autoren beitragen zur Überwindung jenes Irrationalismus, der den Kapitalismus zum Schicksal erklärt, die Frage nach vernünftigen Alternativen tabuisiert und dem Projekt revolutionärer Veränderung die Legitimität abspricht.»
Diese Anthologie ist eine provokante Bestandesaufnahme und zugleich ein ideologisches Granulat jener modernen antikapitalistischen Denk-Strömungen, die – von aller Patina eines spätmarxistischen Revoluzzertums befreit – durchaus den humanistischen Utopie-Entwurf mit realpolitischer Praktikabilität verschmilzt, wobei der «Projekt»-Charakter eben dieses alternativen Entwurfes von völlig unterschiedlichen Blickwinkeln aus angegangen wird (siehe dazu auch das nachstehende Inhaltsverzeichnis). Eine sehr notwendige Sammlung, die – eigentlich gewidmet auch der differenzierteren Identitätsfindung der aktuellen linken Bewegungen – genau richtig kommt in unseren Zeiten des omnipräsenten, dabei schamlosest monetär grundierten Rechtspopulismus’ und einer global unverbrämt-ruinösen Bankenwirtschaft. ■
Beat Ringger (Hrsg): Zukunft der Demokratie – Das postkapitalistische Projekt, Rotpunkt Verlag, 260 Seiten, ISBN 3-85869-366-9
____________________________________







leave a comment