Vera Jürgens’ angewandte Schachpsychologie
.
Ticken Schachspieler anders?
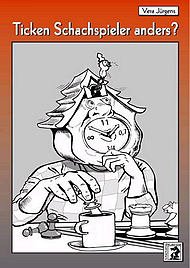 In ihrem Erstlingswerk stellt die bulgarische Großmeisterin und Nationalspielerin Vera Jürgens ihr feines psychologisches Einfühlungsvermögen unter Beweis: Zielsicher entlarvt sie in diesem voller Hintersinn geschriebenen Lesebuch die Sonderbarkeiten der Schachspieler und gibt mit ihren Einblicken zugleich den leidgeprüften Angehörigen von Schachspielern wertvolle Lebenshilfe! Ob wichtige «Verhaltensmaßregeln» für mitreisende Ehepartner auf Schachturnieren, Psychokrieg am Brett oder Frustbewältigung nach Niederlagen; alles wird zielsicher durch den Kakao gezogen, passend ergänzt durch die wie immer trefflichen Karikaturen von Frank Stiefel. Doch auch ernste Inhalte stehen zur Diskussion, z.B. ob Schachspieler wirklich intelligenter sind, oder ob Schach ein legitimer Lebensinhalt sein darf. Auch hier spricht die Autorin in großartiger Weise aus dem kollektiven Gedächtnis der Schachfamilie – Erkenntnisse, die jeder leidenschaftliche Schachspieler spontan unterschreiben wird, die aber noch niemals offen ausgesprochen wurden!
In ihrem Erstlingswerk stellt die bulgarische Großmeisterin und Nationalspielerin Vera Jürgens ihr feines psychologisches Einfühlungsvermögen unter Beweis: Zielsicher entlarvt sie in diesem voller Hintersinn geschriebenen Lesebuch die Sonderbarkeiten der Schachspieler und gibt mit ihren Einblicken zugleich den leidgeprüften Angehörigen von Schachspielern wertvolle Lebenshilfe! Ob wichtige «Verhaltensmaßregeln» für mitreisende Ehepartner auf Schachturnieren, Psychokrieg am Brett oder Frustbewältigung nach Niederlagen; alles wird zielsicher durch den Kakao gezogen, passend ergänzt durch die wie immer trefflichen Karikaturen von Frank Stiefel. Doch auch ernste Inhalte stehen zur Diskussion, z.B. ob Schachspieler wirklich intelligenter sind, oder ob Schach ein legitimer Lebensinhalt sein darf. Auch hier spricht die Autorin in großartiger Weise aus dem kollektiven Gedächtnis der Schachfamilie – Erkenntnisse, die jeder leidenschaftliche Schachspieler spontan unterschreiben wird, die aber noch niemals offen ausgesprochen wurden!
Vera Jürgens wurde 1969 in Bulgarien geboren. Als mehrfache Mädchen- und Damenmeisterin des Landes nahm sie mit der heimischen Nationalmannschaft an zwei Schacholympiaden teil. Später, nach ihrer Heirat mit einem deutschen Schachspieler, vertrat sie 2006 die Bundesrepublik in Turin. Daneben tat sie sich u.a. als Übersetzerin der Bücher von Ex-Schach-Weltmeister Khalifman hervor. (Verlagsinfo)
Vera Jürgens, Ticken Schachspieler anders?, Kania Schachverlag, 128 Seiten, ISBN 978-3931192358
.
Leseprobe
Einblick in die Psyche von Schachspielenden
und NichtschachspielendenSind Schachspieler und -spielerinnen überintelligent? Was genau geht in ihnen während einer Schachpartie vor?
Diese und ähnliche Fragen versuchen Wissenschaftler, Literaten, Psychologen und Journalisten seit Jahrzehnten zu beantworten. Es gibt unzählige Bücher und Artikel, die sich mit der Psychologie des Schachspiels bzw. mit der Psyche von Schachspieler/innen befassen. Insbesondere die Spieler werden beschrieben, ihre Eigenarten bewundert, beschimpft oder ausgelacht. Wen wundert es also, daß diese allmählich den Eindruck gewinnen, sie gehörten einer besonderen Menschenrasse an, die für wissenschaftliche Zwecke unter strenger Beobachtung stehe?
Einen Nichtschachspieler könnte man mit einem Zoobesucher vergleichen, der mit Ehrfurcht und aus sicherer Distanz eine seltsame Tierart (den Schachspieler) anstarrt. Niemals würde der Zoobesucher auf die Idee kommen, daß jene seltsamen Wesen nicht sich, sondern ihn für seltsam halten.
Schachspieler wissen, wie sie selber denken und fühlen. Interessant und hilfreich für sie wäre eher eine Antwort auf die Frage, wie Nichtschachspieler funktionieren. Das Lehrbuch, das ihnen den Umgang mit Nichtschachspielern erleichtert, das informiert und berät, muß aber erst noch geschrieben werden.
Nichtschachspieler wiederum haben weder das Bedürfnis noch die notwendige Kompetenz, eigene Verhaltens- und Denkweisen aus der Perspektive von Schachspielern zu ergründen. Schachspieler ihrerseits halten sich nicht für prädestiniert, das Wesen von Nichtschachspielern zu erforschen. Möglicherweise nehmen sie an, Nichtschachspieler seien makellose Geschöpfe, da sie nicht durch Schach vorbelastet sind. Warum also sollte man solche Menschen unter die Lupe nehmen? Und schließlich sind es die Schachspieler, die eine Minderheit bilden. Eine Minderheit, die das geistreichste aller Spiele beherrscht, was eine außergewöhnliche Intelligenz voraussetzt und interessante Verhaltensauffälligkeiten zur Folge hat, die es verdienen, erforscht zu werden.
Nichtschachspieler „wissen“, daß Schachspieler in der Regel beziehungsunfähig sind, daß sie täglich stundenlang hinter ihren Lehrbüchern sitzen und zum „Ausgleich“ endlose Blitzpartien im Club oder im Internet runterklopfen. Schachspieler dagegen…






leave a comment