Vergessene Bücher (3): «So grün war mein Tal» von Richard Llewellyn
.
Existentielle Fragen des Menschseins
Walter Ehrismann
.
 «So grün war mein Tal», 1939 im englischen Original erschienen, war das Hauptwerk des walisischen Autors Richard Llewellyn (Pseudonym von Richard Dafydd Vivian Llewellyn Lloyd), ein Roman über das Leben in einer Bergbausiedlung im Süden von Wales, 1942 von John Ford mit Maureen O’Hara und Walter Pidgeon verfilmt unter dem Titel «How Green Was My Valley». Der Streifen wurde für zehn Oscars nominiert, mit fünf Oscars prämiert, und gilt als einer der besten Filmwerke aller Zeiten – später, 1975, nochmals verfilmt als sechsteilige Fernsehserie. 1990 wurde der Film von John Ford ins Verzeichnis der National Film Registry aufgenommen, seiner kulturellen, historischen und ästhetischen Bedeutung wegen. Von Richard Llewellyn, 1906 in London geboren, ist dieser Roman das bekannteste seiner Werke. Der Schriftsteller verbrachte jedoch nur einen Teil seines Lebens in Wales. «Wie grün war mein Tal doch und das Tal jener, die nicht mehr sind» – so endet der Roman.
«So grün war mein Tal», 1939 im englischen Original erschienen, war das Hauptwerk des walisischen Autors Richard Llewellyn (Pseudonym von Richard Dafydd Vivian Llewellyn Lloyd), ein Roman über das Leben in einer Bergbausiedlung im Süden von Wales, 1942 von John Ford mit Maureen O’Hara und Walter Pidgeon verfilmt unter dem Titel «How Green Was My Valley». Der Streifen wurde für zehn Oscars nominiert, mit fünf Oscars prämiert, und gilt als einer der besten Filmwerke aller Zeiten – später, 1975, nochmals verfilmt als sechsteilige Fernsehserie. 1990 wurde der Film von John Ford ins Verzeichnis der National Film Registry aufgenommen, seiner kulturellen, historischen und ästhetischen Bedeutung wegen. Von Richard Llewellyn, 1906 in London geboren, ist dieser Roman das bekannteste seiner Werke. Der Schriftsteller verbrachte jedoch nur einen Teil seines Lebens in Wales. «Wie grün war mein Tal doch und das Tal jener, die nicht mehr sind» – so endet der Roman.
Im Mittelpunkt der beeindruckenden Familiensaga steht die Geschichte der Bergbau-Familie Morgan, die um 1880 ein einfaches, aber zufriedenes Leben führt. Geburt, Kindheit und Jugend, kirchliche Einsegnung, die ersten langen Hosen und der erste Kuss, Schule und Arbeit, Konflikte, Fussballspiel und Chorsingen, Diebstahl und Totschlag, Krankheit und Alter sind eingebettet in das Drama der kommenden Entfremdung. Die vordergründige Idylle findet ein jähes Ende, denn man hat im Tal neue Kohlevorkommen entdeckt, und schon bald entbrennt zwischen der Dorfgemeinschaft und den skrupellosen englischen Grubenbetreibern ein rücksichtsloser Interessenkampf um Gewinn und Arbeiterehre, um Privilegien und althergebrachtes Leben, um Modernisierung und Zerfall der bestehenden Gesellschaftsstrukturen. Es ist die Geschichte eines Tales und eines Städtchens, das vom Bergbau lebt und vom Bergbau zugrunde gerichtet wird, eines Ortes wie viele auf der Welt, die am Ende des vorletzten und zu Beginn des letzten Jahrhunderts durch die maßlose Industrialisierung verändert, ruiniert wurden und mit ihnen die ganze Lebensart. Am Ende wirft der Grosse Krieg (1. WK) seinen drohenden Schatten voraus.

Wenn der Industrie und der Wirtschaft ganze Landstriche geopfert werden: Szene aus dem s/w-Film «How green was my valley» (1941)
Wenn früh am Morgen die Männer aus den Häusern treten und zur Grube gehen, stehen die Frauen unter der Tür und schauen ihnen nach, wie sie die Strassen hinunter marschieren, einander grüssen, das Essenspaket in der einen Hand, die Pfeife in der andern. Links und rechts der Strasse die typischen Reihenhäuser, zweistöckig, weiss getüncht, die schmalen Vorgärten mit dem Sitzplatz und hinter den Häusern der Gemüsegarten, ein Bäumchen, Beerensträucher, ein Kaninchenstall oder ein Gehege für ein paar Hühner. Huw, der Jüngste der Familie Morgan, erzählt von seinen Eltern, die hart am Wandel der Zeit tragen, aber dennoch stets versuchen, die Familie zusammenzuhalten. Die ganze Familie Morgan ist mit darin verwickelt – der Vater Gwilym als Stollenmeister, die fünf älteren Söhne als Hauer oder Maschinisten. Die Brüder, stolze und leidenschaftliche Männer, machen sich für die Rechte der Arbeiter stark und gründen neu eine Gewerkschaft, während Angharad, eine der Schwestern, den Sohn eines Grubenbesitzers heiratet. Eine beginnende, zarte Romanze zwischen ihr und dem viel älteren Prediger hat sich nicht erfüllt. Und die Mutter? Sie verwaltet die Geldbüchse, die jeder am Schluss der Woche mit seinem Lohn füllt. Zu Bronwen, der Braut eines seiner Brüder, schaut Huw in jugendlicher Verehrung auf. Er himmelt sie an, denn sie ist es, die ihn in der langen Zeit seiner Krankheit pflegt und aufmuntert. Später wird sie zu seiner ersten grossen Liebe, und nur das gegenseitige Wissen um die Zugehörigkeit verhindert ein Abgleiten ins Unerlaubte.
In Rückblicken erzählt der Autor mit der Stimme des halb erwachsenen Huw die Geschichte. Er spürt den Ernst des drohenden Streiks, der den Streit entfachen wird zwischen dem Vater mit seinen althergebrachten Ansichten und Huws Brüdern. Huw Morgan, noch zu jung für den Einstieg in die Grube, ruft sich in Erinnerung, wie er als Knabe die dramatischen Ereignisse erlebte, die nicht nur das Leben seiner Eltern und der ganzen Familie, sondern auch sein eigenes und das aller Bewohner des Minenstädtchens radikal veränderte. Danach zieht er für immer weg von Cwn Rhondda, weg aus dem Tal wie alle, die versuchen, einen Platz an der Sonne, das heißt Arbeit und überhaupt eine Zukunft zu haben.
Im Verlaufe der Geschichte wird der Leser, die Leserin mit Fragen konfrontiert, die unser aller Zusammenleben betreffen: Was ist allgemein gültig? Was ist Moral, gibt es Sünde, und wie steht es mit der Strafe, der Rache? Darf der Vater eines geschändeten und ermordeten Mädchens den überführten Täter töten? Llewellyn meint dezidiert «Ja» – und als Leser/Leserin ist man hin- und hergerissen, wenn das eigene moralische Denkgebäude ins Wanken gerät, gerade wenn wir an die heutigen Fälle von Kinderschändung denken und unser Rachegefühl von der Justiz schlecht bedient wird, das Gesetzbuch Lücken aufweist oder die wankelhafte Auslegung durch Richter, Psychiater und zeitbedingte Ansichten uns unsere eigene Verantwortung abnimmt. Die ganze männliche Dorfgemeinschaft in dieser Tragödie eines «zurückgebliebenen» Bergbaugebiets in Wales am Ende des vorletzten Jahrhunderts beteiligt sich an der Suche nach dem Mörder, übergibt, als sie ihn findet, den jämmerlich um sein Leben flehenden Mann an der Stelle, wo das achtjährige Kind getötet wurde, dem Vater und überlässt den wimmernden Täter der Rache des Vaters. Es war ein «Ausländer», ein zugewanderter Engländer, der nicht zur Gemeinschaft der kleinen Stadt gehörte. Die Männer bilden einen Kreis um die beiden und schauen zu, die Frauen und Kinder sind im Dorf geblieben und hören die Schreie. Diese archaische Szene ungefähr in der Mitte des Buches bildet den Auftakt zu Huws endgültigem Erwachsenwerden. Rückblickend überschaut der Erzähler seine Kindheit und Jugend in diesem Städtchen im Süden von Wales, das unter den täglich größer werdenden Schlackebergen der Kohleförderung, die schleichend langsam bis zu den Hintergärten reichen, zu ersticken droht. Wo früher Wiesen und Weiden für Schafe waren, Obstgärten, Teiche, Wege und Plätze, überallhin stößt nun die Schlacke vor, die Reste der Kohle, die bei der Verhüttung übriggeblieben sind, oder der unverwertbare Teil des Aushubs aus den Bergwerken, der nicht allein die Landschaft verschandelt, sondern sich auch in den Lungen der Menschen festsetzt, sie krank macht. Dieser Verfallsprozess des Einzelnen und der Gemeinschaft ist der Inhalt des Romans, der uns in eindrücklichen Bildern zeigt, was Gier, Gewinnsucht, Aufhebung der innerlich verspürten Schranken in den Menschen anrichtet. Die Söhne entfremden sich dem Vater, die Frauen den Männern, die Tochter entfremdet sich der Mutter, der Einzelne dem gemeinsamen Wohl. Dazwischen schieben sich Erinnerungsstücke von umwerfender Komik, wenn ein Fussballmatch zwischen zwei Orten zu den damaligen Regeln ausgetragen wird, die Besäufnisse und Schlägereien nach dem Schlusspfiff, wenn der ortsansäßige Chor eingeladen wird, vor der Königin (Viktoria) zu singen, oder wenn Huw von einem Boxer, dem Freund eines seiner Brüder, auftrainiert wird, um in der Schule den ungerechten, verhassten Lehrer verprügeln zu können.
Huw Morgan wird das Bergbau-Städtchen und die wenigen Übriggebliebenen seiner Familie am Ende der Geschichte verlassen. Als Erinnerungsstück nimmt er das blaue Tuch, das seine Mutter jeweils als Schal um die Schultern gewickelt hat, mit auf den langen Weg. Als er geht, ist das Schicksal der kleinen Stadt und der Landschaft längst besiegelt: Alles wird zerstört werden wie so viele Städte und Dörfer dieser Gegend, der Kohleförderung, den Zechen, den Begleiterscheinungen des Bergbaus und den Hüttenwerken geopfert im Verlaufe der fortschreitenden Industrialisierung. Kaputtgemacht auch die Sitten, Bräuche und Bindungen der in Jahrzehnten gewachsenen Gemeinschaft, hingegeben dem Moloch Moderne.
Huws Erinnerungsarbeit beginnt dort, wo er und einer seiner Brüder heimlich die geheimen Versammlungen der Arbeiter nachts am Berg belauschen, die Rede des allgemein geachteten Vaters anhören, der den Leuten ins Gewissen redet und sie von der Nutzlosigkeit und Unrechtmässigkeit eines Streiks zu überzeugen versucht, wie sich die Mutter einmischt in das beginnende gewerkschaftliche Gebaren der Männer, wie sie auf dem Rückweg von der Versammlung auf dem Eis des Baches ausrutscht und Huw ihr das Leben rettet, indem er stundenlang ihren Körper mit dem seinen stützt im Eis. Er wird krank, bettlägrig, verpasst die Einschulung und wird zuhause vom Prediger der Gemeinde in Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet. Bronwen, die junge Frau seines Bruders, päppelt ihn auf, verwöhnt ihn mit ihrer Kochkunst. Sie wird zum ersten Idol seiner Knabenjahre. Und als Huw endlich dem Unterricht der Primarschulstufe folgen kann, hat er Mühe, sich einzugliedern. Eine verarmte Frau, die ihren bei einem Eisenabstich verbrühten Mann pflegt, lehrt für ein paar Pences in ihrer Stube die Kinder der Bergleute das Einmaleins und die Buchstaben des Alphabets. Noch schwieriger wird’s für Huw auf der Mittel- und Oberstufe. Er muss ins benachbarte Städtchen, ist gut eine Stunde zu Fuss unterwegs. Es ist eine Tagesschule, jedes Kind bringt von daheim die Mittagsverpflegung mit. Walisisch, ihre ureigene Sprache, ist im Unterricht und auf dem Pausenplatz strikte verboten. So müssen sie halt Englisch parlieren, für die Jugendlichen eine Fremdsprache. Ihr Walisisch ist nahe dem Gälischen und dem Bretonischen verwandt und weist überhaupt keinen Bezug zur englischen Sprache auf. Wer gegen diese eiserne Schulregel verstößt, bezieht Prügelstrafe, damals an der Schule gang und gäbe, vom Prügelmeister mit dem Rohrstock vollzogen. Dieser «Sprachenstreit» gibt einen Einblick in die Distanz, die zwischen den ehemaligen Eroberern aus England und den walisischen Untertanen herrschte und immer noch herrscht. Erst in jüngerer Zeit ist an den Schulen Walisisch als Unterrichtssprache an der Unter- und Mittelstufe wieder eingeführt worden, zuerst den Behörden in der Thatcher-Ära abgetrotzt und dann rechtlich abgesichert.
Der Junge verliebt sich. Leider stammt das Mädchen, das mit ihm dieselbe Schulklasse der Oberstufe besucht, aus dem Nachbarort. Nachts auf dem Berg lässt er seine Angebetete den Klang der Nachtigal hören, in freier Natur unter dem Sternenhimmel. Sie schlüpfen, weil es gegen morgen kalt wird, unter die Decke und Huw erkundet die Geheimnisse des weiblichen Körpers. Plötzlich Lärm und Fackeln! Die Männer des andern Städtchens suchen die zwei, und nur mit knapper Not entkommen sie unerkannt der drohenden Strafe.
Im Gottesdienst ihrer Kirche muss Huw einmal mitansehen, wie es einer jungen Frau ergeht, die «gefallen» ist: Vor der Gemeinschaft der Gläubigen beichtet sie ihren Abfall vom rechten Glauben und von der gültigen Moral, und obwohl Huw weiß, dass der ältliche Pastor ein Verhältnis mit Huws junger Schwester hat, gelingt es ihm nicht, eine weniger rigide Denkart im Kreis der Diskutierenden einzubringen. Er muss in der Kirche schweigen, weil er unter den Gläubigen noch zu jung ist. Nachher aber, vor der Kirche, wagt er es, für die Gemassregelte Partei zu ergreifen. Sein Vater ist erschüttert über den unbotmäßigen Jungen, dass er ihn tagelang mit Schweigen bestraft.
So ist vieles in diesem Roman gezeichnet durch die Denkart einer längst entschwundenen Zeit, und doch, wenn man das Lokalkolorit weglässt, schälen sich die existentiellen Fragen des Menschseins heraus. Wer einen Vergleich herbeiziehen möchte, schaue sich den Film «Billy Elliot – I will dance» an. Auch diese Geschichte spielt im tristen Milieu einer Bergbau-Familie in Wales. Arbeit, Biertrinken, Boxen, Streik – all das ist in dieser Geschichte ebenfalls drin, vor realem Hintergrund der Thatcher-Ära hundert Jahre später als «So grün war mein Tal» – in der Zeit der grossen Arbeiteraufstände um 1980 wegen der angedrohten Schliessung der Gruben. Und auch in dieser Geschichte fällt der Junge aus der Reihe: Er will tanzen, nicht boxen! Billy wird in die Royal Dance Company aufgenommen, Huw Morgan, das alter ego des Schriftstellers Llewellyn, studiert in London. Beide verlassen ihren «Urgrund» und werden sich in der fernen Hauptstadt behaupten müssen. Bei beiden stellt sich die Familie anfangs quer. Bis der Vater stolz sein kann auf den Jungen, vergeht eine Zeit der Irrungen und Wirrungen. Huw erfährt die Unterstützung durch die Familie früher, er hat ja der Mutter das Leben gerettet. Außerdem gewinnt er den Schönschreibe-Wettbewerb einer Zeitung, sodass der Vater bereits früh stolz auf ihn sein kann.
Das alles entscheidende Ereignis aber ist der Streik. Huw erlebt die tiefe Spaltung zwischen Vater und Söhnen. Die Brüder Huws befürworten die Arbeitsniederlegung und verlassen im Streit die Familie und ihr Haus. Im Ort herrschen wegen des Streiks Hunger und Not, die letzten Reserven, das Geld der Gewerkschaft und die Nahrungsmittel, sind aufgebraucht, die Lohnbüchse der Mutter bleibt leer. Die Familien helfen einander, so gut es geht, aber zuletzt hat niemand mehr etwas. Obwohl Huws Vater lange gegen den Streik war und gar als Streikbrecher auftritt, stellt er sich zuletzt loyal hinter die Forderungen der Arbeiter und muss dafür bitter büssen. Der Streik misslingt und die Fabrikbesitzer nehmen Rache. Der Grubenbesitzer stellt ihn bei Kälte, Regen und Schnee als Eingangskontrolleur im Freien auf. Dann zerstört ein Wetter die Grube. Als Vater Gwilym auf Druck der Arbeiterkollegen nochmals als Retter zugelassen wird, gerät er auf der Suche nach Verschütteten in einen zusammenbrechenden Stollen. Unter den Toten ist auch er. Der Schaden ist immens, die Grube wird definitiv geschlossen. Die Ehe Angharads scheitert, ein Bruder stirbt an Depression, die andern sind weg, Vater und Mutter gestorben. So endet die Geschichte.

... ist eine Essay-Reihe, in der das Glarean Magazin Werke vorstellt, die vom kultur-medialen Mainstream links liegengelassen oder überhaupt von der «offiziellen» Literatur-Geschichte ignoriert werden, aber nichtsdestoweniger von literarischer Bedeutung sind über alle modische Aktualität hinaus. Die Autoren der Reihe pflegen einen betont subjektiven Zugang zu ihrem jeweiligen Gegenstand und wollen weniger belehren als vielmehr erinnern und interessieren.
Anhand der Inhaltsangabe ist man geneigt, das Buch als düster und traurig zu bezeichnen. Das ist es nicht, eher bittersüß, wenn es von Huws glücklicher Kindheit und Jugend erzählt. Die Tragödien, die die Familien und das Tal treffen und der schleichende Zerfall der Gemeinschaft wechseln sich ab mit fröhlichen Ereignissen, alles getragen von einer glücklichen, zusammenhaltenden und sich sehr liebenden Familie, auch wenn die schließlich auseinander gerissen wird. Bei der Sprache ist zu berücksichtigen, dass der Roman 1939 geschrieben wurde. Sie ist zwar «altmodisch», aber schön, das merkt man auch in der Übersetzung. Das Buch erreichte eine Weltauflage von weit mehr als zwei Millionen Exemplaren. An diesen Erfolg konnten die späteren Werke Llewellyns nicht anknüpfen. Die Fortsetzung der Morgan-Saga, unter dem Titel «Das neue Land der Hoffnung» erschienen, überzeugte literarisch nicht. Mangelnde Sachkenntnis im Flieger-Roman «Den Sternen nah» und schlicht Kitsch im Kibbuz-Buch «Und morgen blüht der Sand» wurde Llewellyn in der Kritik vorgeworfen. Der Autor verstarb im Dezember 1983 in Dublin.
Ich liebe Familiensagas, ihre Detailversessenheit, ihr autobiographisches Cachet, die Geschichten einer Epoche in ihrem historischen Rahmen. Oft verlege ich meine Ferien in das Gebiet eines Romans, den ich grad gelesen habe. So habe ich mal die ganze südliche Provence durchstreift auf der Suche nach den Orten aus dem Roman «Die Kinder der Finsternis». Oder ich lese Fachbücher, Geschichte, Reisebeschreibungen, sammle Zusätzliches. So bin ich vor kurzem auf einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung gestossen: Phönix aus der Kohle – die Auferstehung von Cardiff (NZZ vom 7. Juli 2011). Zitat: «Eine knappe halbe Stunde dauert die Fahrt von Cardiff Richtung Norden, dann ist man im Grünen. Das war nicht immer so. Erst in den vergangenen Jahren wurden hier die Löcher aufgefüllt, welche durch den Kohleabbau in der Region seit 1880 entstanden waren. Aber die Zeit heile alle Wunden, heißt es, und so entstanden auf den ehemaligen Kohleminen schrittweise Landschaftsparks, die den Touristen zum Wandern, Biken oder auch einfach nur zum Verweilen einladen. Wer die Spuren der Kohleindustrie von nahem besichtigen möchte, ist in Blaenavon gut aufgehoben. Die einstige Boomtown der industriellen Revolution ist heute Unesco-Weltkulturerbe. Hier kann man sich von einem Guide 90 Meter unter der Erde durch die einstige Mine, den ‘Big Pit’, führen lassen. Auf der Rückfahrt präsentiert sich dann die Landschaft wieder so, wie man sie sich vorgestellt hat – Ortschaften, deren Namen geschrieben werden, als wäre eine Katze einmal quer über die Tastatur spaziert, wechseln sich ab mit saftigen Matten, auf denen Schafe weiden. Zwei bis vier Schafe pro Einwohner soll es in der Heimat von Dylan Thomas, Richard Llewellyn, Tom Jones und Ryan Giggs geben, je nachdem, wen man fragt». ■
.
____________________________________
Geb. 1943 in Chur/CH, Ausbildung zum Lehrer, Studium an der Zürcher Fachhochschule für Gestaltung, 1966 Unfall im südfranzösischen Meer, seither im Rollstuhl, zahlreiche malerische, bildhauerische und literarische Publikationen, lebt und arbeitet als Bildender Künstler und Schriftsteller in Urdorf/CH
.
.
.
.
.
Vergessene Bücher (2): «Die Offizierin» von Nadeschda Durowa
.
Aller «naturhaften» Determinierung entzogen
Marianne Figl
.
 In Österreich diskutiert man zur Zeit die Abschaffung der Wehrpflicht. Meine beiden Söhne haben ihre Pflicht im Zivildienst abgeleistet und damals noch viel Spott über sich ergehen lassen müssen – also: Was fasziniert mich an Nadeschda Durowa, dieser Frau, die vor ca. 200 Jahren ihr bequemes bürgerliches Leben gegen ein anstrengendes, gefahrvolles und sehr schlecht entlohntes Dasein als Kavallerist(in) eingetauscht hatte, dabei offiziell als Mann auftrat und schließlich für ihre großartigen Leistungen einen der höchsten Orden vom Zar erhielt? Was ist es, das diese Abenteurerin so anmutig erscheinen lässt, dass sie in ihrer Heimat fast wie eine Heilige verehrt wird? Wer war überhaupt die Autorin von «Die Offizierin» – einer Autobiographie, von der heute kaum jemand mehr redet?
In Österreich diskutiert man zur Zeit die Abschaffung der Wehrpflicht. Meine beiden Söhne haben ihre Pflicht im Zivildienst abgeleistet und damals noch viel Spott über sich ergehen lassen müssen – also: Was fasziniert mich an Nadeschda Durowa, dieser Frau, die vor ca. 200 Jahren ihr bequemes bürgerliches Leben gegen ein anstrengendes, gefahrvolles und sehr schlecht entlohntes Dasein als Kavallerist(in) eingetauscht hatte, dabei offiziell als Mann auftrat und schließlich für ihre großartigen Leistungen einen der höchsten Orden vom Zar erhielt? Was ist es, das diese Abenteurerin so anmutig erscheinen lässt, dass sie in ihrer Heimat fast wie eine Heilige verehrt wird? Wer war überhaupt die Autorin von «Die Offizierin» – einer Autobiographie, von der heute kaum jemand mehr redet?
2012 jährt sich die Schlacht bei Borodino zum zweihundertsten Mal; Russland zwang damals Napoleon endgültig zum Rückzug. Die Durowa hat sich auch in dieser Schlacht Lorbeeren geholt – die Autorin von «Die Offizierin» also eine blutrünstige Schlächterin, ein Mannweib, verbittert und gedankenleer? Nein, eben nicht, eben ganz anders.
Natürlich, sie verlässt nächtens ihren Mann und ihr Kind, reitet fast ohne Gepäck und Geld los in eine ungewisse Zukunft, um sich bei den durchziehenden Soldatenwerbern als Jung-Offizier rekrutieren zu lassen, eben zum Kampf gegen Napoleon. Die Frage also nochmals andersrum: Was trieb diese exzellente Reiterin, die schon früh auf Bäume kletterte, mit Pfeil und Bogen schoß, mit ihrem Vater lange Ritte ins wilde Gelände unternahm, was trieb die blutjunge Frau dazu, ihre weibliche Identität aufzugeben und fortan unter dem Namen Alexander Durow zu leben, nachdem sie ihr gesamte Familie ohne alle Verabschiedung fluchtartig hinter sich gelassen hatte?
Nadeschda Durowa hatte nie Schulbildung genossen, und doch brachte sie es im Selbststudium so weit, dass sie heimische, französische und polnische Literatur lesen konnte. 1994 brachte Rainer Schwarz beim Kiepenheuer Verlag eine erste deutsche Übersetzung ihrer Autobiographie heraus: «Die Offizierin – Das ungewöhnliche Leben einer Kavalleristin» (zwischenzeitlich auch im Insel-Taschenbuch-Verlag veröffentlicht). Darin ist zu lesen, dass Nadeschda bereits als Vierzehnjährige beschließt, ein Mann zu werden und zu den Soldaten zu gehen. Und wörtlich weiter: «Zwei Gefühle, die einander so widersprechen – die Liebe zu meinem Vater und die Abscheu vor meinem Geschlecht -, erregten meine junge Seele mit gleicher Stärke und mit einer Festigkeit und einer Ausdauer, wie sie einem Mädchen in meinem Alter selten zu eigen sind. Ich begann, einen Plan zu überlegen, um die Sphäre zu verlassen, die dem weiblichen Geschlecht von der Natur und den Sitten bestimmt ist.»

... ist eine Essay-Reihe, in der das Glarean Magazin Werke vorstellt, die vom kultur-medialen Mainstream links liegengelassen oder überhaupt von der «offiziellen» Literatur-Geschichte ignoriert werden, aber nichtsdestoweniger von literarischer Bedeutung sind über alle modische Aktualität hinaus. Die Autoren der Reihe pflegen einen betont subjektiven Zugang zu ihrem jeweiligen Gegenstand und wollen weniger belehren als vielmehr erinnern und interessieren.
Nadeschda Durowa nahm sich also die Freiheit, über ihr Leben selbst zu entscheiden, sie machte sich unabhängig – und zahlte für diese Freiheit den Preis der Einsamkeit, der Abgeschiedenheit zwischen den Schlachten und Einsätzen, die sie lesend und ihre Erinnerungen aufzeichnend verbrachte.
Zehn Jahre im Militärdienst, teilweise auch im Winter, bei Regen und Wind, oft auf offenem Felde, jedenfalls immer in ungeheizten Unterkünften nächtigend, doch nie wirklich krank werdend, obwohl ihre Ernährung kümmerlich war… Den ganzen Tag – oft auch mondhelle Nächte nutzend – jagte sie zuletzt als Ordonanz des Feldherrn Kutusow auf ihrem Pferd von Stellung zu Stellung, berühmt für ihren Mut, berüchtigt für ihre kühl distanzierte Haltung gegenüber ihren männlichen Kollegen…
Als ich von ihrer Lebensgeschichte hörte und las, hat Nadeshda mein Herz berührt – genau an der Stelle, wo der Kant`sche «Herzenskündiger» sitzt: Die Durowa hat gehandelt, und gehandelt nach ihrem eigenen Gewissen, um in der Freiheit sich nicht instrumentalisieren zu lassen, auch nicht durch Ehe und Mutterschaft, dieser «naturhaften Determinierung» hat sie sich entzogen, riskierend nicht verstanden zu werden, einsam zu bleiben – aber frei. ▀
____________________________________
Geb. 1946 in Wien, Studium Malerei&Graphik an der Hochschule für Angew. Kunst/Wien; Atelier in Salzburg & Online-Galerie, Literarische Texte in Anthologien, lebt in Salzburg/A
.
.
..
.









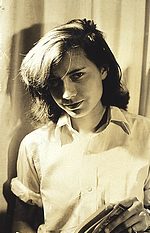








2 comments