Die besten Online-Schach-Portale
.
Virtuell Schach spielen – einfach, praktisch, gut
Walter Eigenmann
.
Seit es das World-Wide-Web 2.0 gibt, gibt’s auch internationale Server, die jedermann/-frau das virtuelle Gamen und Zocken am Computer ermöglichen – Internet-Seiten also, wo man sich in Minutenschnelle (mit Echt- oder Pseudo-Namen) anmeldet, um dann gegen zahllose andere Spieler/innen weltweit in allen möglichen und unmöglichen Spiele-Sparten antreten zu können.
.
Groß und mächtig: Chessbase & Co.
In Sachen Schach mischt seit vielen Jahren die Hamburger Software-Schmiede Chessbase («Fritz») ganz vorne in der Online-Szene mit, und in deren zahllosen virtuellen Turniersälen tummelt sich zu jeder Tages- und Nachtzeit tausendfach der Anfänger wie der Profi, der Patzer wie der Großmeister. Handling, Organisation und Funktionalität von «Schach.De» bzw. «PlayChess» genügen absolut professionellen Ansprüchen, was die enorme Beliebtheit dieses Schachservers begründet. Sogar ganze Vereine können hier ihre Mitgliedschaft zu Blitzturnieren einladen/anmelden, und regelmäßig gastieren internationale GM-Koriphäen mit Video-Theorieschulungen oder Simultan-Vorstellungen. Einen Nachteil für Gelegenheitsspieler hat aber Chessbase mit vielen anderen Anbietern gemeinsam: der Dienst ist kommerziell bzw. nur anfänglich kostenlos.
Ein weiterer, insbesondere im angelsächsischen Raum ebenfalls tausendfach frequentierter und seit Jahren bewährter Schachserver ist der Internet Chess Club (ICC). Auch hier ist das Spielangebot für Anfänger, Vereins- oder Meisterspieler gross, wenngleich für Teilnehmer mit ggf. rudimentären Englischkenntnissen das Handling vielleicht etwas anstrengend ist. Grösster Nachteil für den Amateur-Gelegenheitsspieler allerdings auch hier: Nur der erste Monat ist gratis, anschließend geht’s aufs Portemonnaie.
.
Kommerziell kontra nicht-kommerziell
Natürlich wäre das Internet nicht das weltumspannende Virtual Net, wenn sich gerade im Schach-Bereich nicht auch diverse interessante Server tummelten, die das Online-Schachspielen kostenlos frei Haus liefern. Wer hartnäckig recherchiert im Netz, entdeckt mit Sicherheit zahllose weitere Schach-Portale, kleinere oder ganz kleine, wo sich nach Herzenslust, in klein-intimem Rahmen mit der Compi-Maus die Schachfiguren rumschieben lassen. Sogar die gewaltige FIDE, der weltweite Dachverband aller organisierten Schachspieler, ist inzwischen auf den Geschmack gekommen und bietet das Online-Spiel ebenfalls an unter ihrer «Arena»-Seite (inkl. Rating-System…)
Seit bereits einiger Zeit wird nun der internationale Schachserver-«Markt» mit einer neuen Website aufgemischt, die es mir persönlich ganz besonders angetan hat, nämlich lichess.org.
.
Online-Schach am Beispiel «lichess»
Zu diesem Server fallen einem Stichworte ein, die jeden Online-Schächer in Verzückung versetzen: werbefrei, kostenlos, übersichtlich, vielfältig, verbreitet, computerfrei, lehrreich – dies alles sind unschlagbare Attribute, die auch den Autor dieser Zeilen zu einer Anmeldung bewogen… (Ok, ich geb’s zu, ich bin auch noch bei anderen Schachportalen Mitglied… ;-)
Für all jene, die (z.B. wie ich) momentan Schlechtwetter-Ferien haben, oder die – wegen Betriebsferien des Lokals – nicht an ihren Klubabend gehen können, oder die eher nachts als am Tag schachspielen möchten, oder die pensioniert sind und Zeit en masse haben, oder die aus irgendwelchen privaten oder medizinischen Handicap-Gründen nicht in einem regulären Schachverein mitmachen können, oder einfach überhaupt für alle, die schon immer mal Schach im Internet spielen wollten, aber sich noch nie trauten – für diese ist lichess.org mit Sicherheit eine der allerersten Adressen.
Das Anmelden gestaltet sich denkbar simpel (und funktioniert bei den meisten Schachservern ähnlich): Auf der Hauptseite 1. gewünschten Namen ( = Pseudonym) eingeben – 2. gewünschtes Passwort schreiben 3. Captcha-Abfrage ( = einfache Schachaufgabe) bestätigen – und schon kann’s losgehen. Oben stehen als Ausgangspunkte die Menüs «Spielen» (fürs Aufspüren/Einladen der Gegner), «Partien» (fürs Kiebitzen bei laufenden Games), «Training» (z.B. fürs Lösen von Schachaufgaben), «Turniere« (für die Teilnahme/Eröffnung neuer Blitz-Turniere), «Schachspieler» (für die Mitglieder-Recherche), «Mannschaften» (fürs Beitreten zu internationalen Spieler-Gruppierungen) und «Forum» (fürs Diskutieren über diverse Schach- und andere Themen mit Gleichgesinnten) zur Verfügung.
.
Kein Computereinsatz bitte!
Bereits bei der Registrierung wird einem deutlich klargemacht, dass die Zuhilfenahme von Schachcomputern bzw. -engines auf «lichess» grundsätzlich verboten ist. (Die meisten Schachserver setzen mittlerweile spezialisierte Software ein, die die Menschen-Partien auf typische «Computerzüge» hin analysieren, und die mit ihren Spezialalgorythmen äußerst effizient als Ermittler funktionieren). Es sei denn, man wolle nicht mit, sondern gegen die Bit-Virtuosen antreten – zurzeit ist das die bekannte Chess-Engine «Stockfish», deren Spielstärke man in 8 Schritten runterdrosseln kann (damit man als Mensch nicht schon in 15 Zügen unter die Räder kommt…)
Selbstverständlich lässt sich auch die Option «Mit einem Freund spielen» anklicken, sprich eine Rundum-Einladung mit gezielten Vorstellungen bezgl. Bedenkzeit und gegnerischer Spielstärke verschicken. Wer «nur zum Plausch» mitmachen, also seine Partien nicht werten lassen will, kann auch dies tun. Weiters kann man sich in einen der angebotenen «Autopairing-Pools» einspeisen und erhält dort schnell einen Gegner (gemäß selbstdefinierter Bedenkzeit) zugeteilt. Wie bei vielen anderen Portalen ist aber auch bei «lichess» das Mitmachen als Nur-Gast ohne Registrierung eine Option – für das gelegentliche Spielchen zwischendurch.
.
Schön – einfach – gut
Was gilt es im Zusammenhang mit «lichess» noch an Highlights zu erwähnen? Beispielsweise, dass sogar Anhänger der nach wie vor exotischen, seinerzeit von Bobby Fischer propagierten Spiel-Variante «Chess960» auf ihre Kosten kommen. Oder dass man seine Partien gleich im Anschluss nicht nur als PGN runterladen und damit sammeln, sondern vom Computer bzw. einer Schach-Engine sogar analysieren lassen kann – versehen mit allerlei Statistik sowie mit Zug-Kommentaren wie «Ungenauigkeiten», «Fehler» oder «Patzer» (sowohl im eigenen Spiel wie in jenem des Gegners…)
Alles in allem: «lichess» ist einfach nur empfehlenswert, eine wirkliche Alternative zu den großen kommerziellen Anbietern. Klein und schlicht, aber oho: Schönes Layout, einfaches Handling, viele Optionen, und praktisch jederzeit mit einem Spielerfeld von 1’000 bis 1’500 Teilnehmern aller Nationen und Levels verfügbar – was will das Herz des Online-Schach-Zockers mehr!?
Nur eines ist m.E. noch schöner als Schach am Compi: Die reale Partie in einem realen Verein am realen Brett gegen einen realen Menschen… ■
.
Meine persönliche Liste der 14 wichtigsten Online-Angebote
zum Schachspielen (keine Garantie auf Vollständigkeit)
– ChessCom: http://schach.chess.com/
– SchachOnline: http://www.schachonline.ch/
– ChessPoint: http://www.chesspoint.ch/portal/10-schach-online-spielen
– SchachArena: http://www.schacharena.de/
– FIDE-OnlineArena: http://arena.myfide.net
– PlayChess/Schach.De: http://www.schach.de/
– Free Internet Chess Server: http://www.freechess.org/
– LiChess: http://de.lichess.org/
– ChessMail: http://www.chessmail.de/
– RemoteChess: http://www.remoteschach.de/
– ChessNet: http://www.chess.net/
– GameKnot: http://gameknot.com/
– Caissa’sWeb: http://www.caissa.com/
– ShredderchessNet: http://www.shredderchess.net/
.
.
Michael Dartsch: «Musik lernen, Musik unterrichten»
.
Der aktuelle Stand der musikpädagogischen Dinge
Walter Eigenmann
.
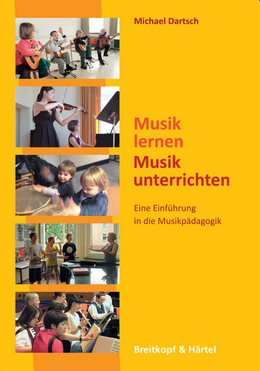 In der modernen Diskussion über Musikpädagogik hat der 1964 geborene Autor dieser neuen Einführung «Musik lernen, Musik unterrichten» eine einflußreiche Stimme. Denn als Mitglied der bundesrepublikanischen «Arbeitsgemeinschaft der Leitenden musikpädagogischen Studiengänge» sowie als Musikrat-Mitglied im «Bundesfachausschuss Musikalische Bildung» gestaltet Michael Dartsch massgeblich Inhalte und Strukturierungen der aktuellen akademischen Musiklehrer-Ausbildung mit und findet damit Beachtung im ganzen deutschsprachigen Raum.
In der modernen Diskussion über Musikpädagogik hat der 1964 geborene Autor dieser neuen Einführung «Musik lernen, Musik unterrichten» eine einflußreiche Stimme. Denn als Mitglied der bundesrepublikanischen «Arbeitsgemeinschaft der Leitenden musikpädagogischen Studiengänge» sowie als Musikrat-Mitglied im «Bundesfachausschuss Musikalische Bildung» gestaltet Michael Dartsch massgeblich Inhalte und Strukturierungen der aktuellen akademischen Musiklehrer-Ausbildung mit und findet damit Beachtung im ganzen deutschsprachigen Raum.
Die vorliegende Monographie unternimmt denn auch nicht nur den Versuch einer breiten theoretischen Einführung in praktisch alle wichtigen Disziplinen der Thematik inklusive ihre musikhistorischen Bezüge, sondern referiert teils sehr ausführlich ebenso die didaktisch-praktische Umsetzung der jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Der Band grundiert seinen Überblick zuerst mit einer Beleuchtung der zentralen psychologischen bzw. gesellschaftlichen Einflussfaktoren auf das Musiklernen: Begabung, Sozialisation, Übeeinsatz und Motivation heißen da die wesentlichen Stichworte. In der Folge werden eine Reihe von spezifischen Inhaltsfeldern behandelt: Elementare Musikpraxis, Erfinden von Musik, Musikverstehen, Interpretieren, Üben seien hier nur als die wichtigsten Themata angeführt. Der praxisorientierte Bezug ist außerdem vertreten in Abschnitten wie «Methoden» oder «Zielgruppen und Unterrichtsformen». Ein Blick auf die Institutionen der nicht-akademischen Musikerziehung in der BRD – Stichworte: Öffentliche Musikschulen, Selbstständige Musiklehrerschaft, Laienmusizieren u.a. – rundet den 248-seitigen Band ab.

Michael Dartschs «Musikpädagogik» ist eine sowohl hinsichtlich Strukturierung wie inhaltlicher Gewichtung überzeugende Gesamtschau auf den aktuellen Forschungsstand – eine Bereicherung der aktuell relevanten musikpädagogischen Literatur.
Dartschs «Musikpädagogik» ist eine sowohl hinsichtlich Strukturierung wie inhaltlicher Gewichtung überzeugende Gesamtschau auf den aktuellen Forschungsstand. Von der Systematik des musikpädagogigschen Begriffsapparates und seiner kulturhistorischen Fundamente über die lernpsychologischen bzw neurophysiologischen Grundlagen moderner wissenschaftlicher Untersuchungen bis hin zur konkreten didaktischen Umsetzung in der täglichen Instrumentalpraxis vermittelt der Autor seinen umfangreichen Stoff mit klarer thematischer Gliederung und in wohltuend «einfacher» Sprache, was dieses Einführungs- und Lehrwerk nicht nur für Musik-Studierende und -Lehrende, sondern durchaus auch für Pädagog/inn/en anderer, wenngleich involvierter Schulbereiche interessant macht. Eine Bereicherung der aktuell relevanten musikpädagogischen Literatur! ■
Michael Dartsch: Musik lernen, Musik unterrichten – Eine Einführung in die Musikpädagogik, 248 Seiten, Breitkopf & Härtel Verlag, ISBN 9783765103995
.
.
.
Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Interessante Musik-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Hans-Günter Heumann: «The Beatles – 50 Mega-Hits»
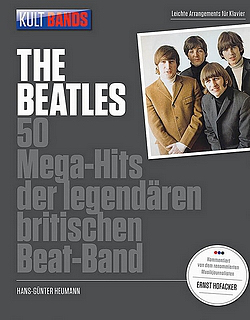 Noch immer sorgen sie für üppig Sekundärliteratur, die vier innovativen Pop-Pilzköpfe aus Liverpool – The Beatles und kein Ende. Im Bosworth-Musik-Verlag wird unterm Label «Kult-Bands» jetzt eine Sammlung von «50 Mega-Hits der legendären britischen Beat-Band» vorgelegt. Herausgeber & Arrangeur H.G. Heumann nahm – chronologisch exakt aufgelistet von 1962 bis 1970 – praktisch alle Beatles-Songs auf, die in jenen Jahren weltweite Pop-Geschichte schrieben. Jedes Notenstück wird dabei garniert mit Anmerkungen des Musikjournalisten Ernst Hofacker zu Entstehung und Rezeption des jeweiligen Songs. Heumanns Bearbeitungen sind durchwegs stark vereinfacht und leicht spielbar, tragen aber doch der spezifischen Rhythmik und Harmonik der Stücke meist stilsicher Rechnung. Im Verbund mit den Akkordangaben und der traditionellen Hand-Verteilung («links = Begleitung / rechts = Melodie») sind die Songs auch problemlos für das Keyboard-Spiel verwendbar. Insgesamt eine auch buchbinderisch gediegene Edition, die ihren Weg in die Tasten-Unterrichtsstuben wohl finden dürfte. (we) ■
Noch immer sorgen sie für üppig Sekundärliteratur, die vier innovativen Pop-Pilzköpfe aus Liverpool – The Beatles und kein Ende. Im Bosworth-Musik-Verlag wird unterm Label «Kult-Bands» jetzt eine Sammlung von «50 Mega-Hits der legendären britischen Beat-Band» vorgelegt. Herausgeber & Arrangeur H.G. Heumann nahm – chronologisch exakt aufgelistet von 1962 bis 1970 – praktisch alle Beatles-Songs auf, die in jenen Jahren weltweite Pop-Geschichte schrieben. Jedes Notenstück wird dabei garniert mit Anmerkungen des Musikjournalisten Ernst Hofacker zu Entstehung und Rezeption des jeweiligen Songs. Heumanns Bearbeitungen sind durchwegs stark vereinfacht und leicht spielbar, tragen aber doch der spezifischen Rhythmik und Harmonik der Stücke meist stilsicher Rechnung. Im Verbund mit den Akkordangaben und der traditionellen Hand-Verteilung («links = Begleitung / rechts = Melodie») sind die Songs auch problemlos für das Keyboard-Spiel verwendbar. Insgesamt eine auch buchbinderisch gediegene Edition, die ihren Weg in die Tasten-Unterrichtsstuben wohl finden dürfte. (we) ■
Hans-Günter Heumann: The Beatles – 50 Mega-Hits, Leichte Arrangements für Klavier, 302 Seiten, Bosworth Music, ISBN 978-3865437945
.
.
.
.
.
Weitere Musik-Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
Literatur – Musik – Schach
.
Editorial / Inhalt
Literatur…..…………………..Musik…..…………………..Schach
.
…sind drei auf den ersten Blick heterogene Kultur-Phänomene. Beim zweiten Hinsehen werden Gemeinsamkeiten offenbar, denen nachzuspüren eine der Intentionen dieses Internet-Kultur-Journals ist. Und: Literatur, Musik, Schach – das steht auch für drei der grundlegenden menschlichen Komponenten, nämlich fürs Denken, fürs Fühlen, fürs Spielen. –
Zur Navigation durch die vielfältigen und umfangreichen Inhalte nutzen Sie einfach das nachstehende Inhaltsverzeichnis, die obenstehende «Suche»-Funktion und die «Stichwörter»-Liste der Sidebar rechts. –
Das «Glarean» ist ein privates Kultur-Angebot, das keinerlei kommerziellen Ziele verfolgt. Wer uns unterstützen möchte, schaltet eine kleine Bannerwerbung (siehe «Media-Daten»). –
Kommentare – auch wenn die darin geäußerten Ansichten von jenen der Redaktion abweichen – sind uns willkommen. (Bitte stehen Sie mit Namen und Mail-Adresse – letztere wird nicht veröffentlicht – zu Ihrer Meinung). Bei thematisch fremden Link-Angaben, Spam-Inhalten oder anonymen wie rechtswidrigen Texten behält sich die Redaktion Kürzung oder Änderung bzw. Nichtveröffentlichung vor. –
Rezensions-Exemplare von Buch-oder CD-Novitäten nimmt die Redaktion gerne entgegen, eine Besprechung kann aber nicht immer garantiert werden. –
Seit seiner Gründung vor rund acht Jahren verzeichnet das «Glarean Magazin» inzwischen weit über drei Millionen Besucher; mittlerweile wird das «Glarean» monatlich ca. 30’000 mal angeklickt. Für dieses enorme Interesse an unseren Kultur-Inhalten danken wir allen Besucherinnen und Besuchern und wünschen weiterhin unterhaltsame und informative Lese-Stunden! –
Walter Eigenmann / August 2015
.
Glarean = Schweizer/Glarner Humanist und Universal-Gelehrter (1488-1563): Musiker, Dichter, Mathematiker, Philologe, Historiker und Geograph
Das Glarean Magazin abonnieren 
.
Inhalte
.
 Essays & Aufsätze von Richard Albrecht, Mario Andreotti, Janko Ferk, Arnold Leifert, Joanna Lisiak, Karl-Heinz Schreiber, Rolf Stolz u.v.a. Essays & Aufsätze von Richard Albrecht, Mario Andreotti, Janko Ferk, Arnold Leifert, Joanna Lisiak, Karl-Heinz Schreiber, Rolf Stolz u.v.a. |
 Neue Prosa von Karlheinz Barwasser, Peter Fahr, Herbert Friedmann, Jutta Miller-Waldner, Norbert Sternmut, Rainer Wedler u.v.a. Neue Prosa von Karlheinz Barwasser, Peter Fahr, Herbert Friedmann, Jutta Miller-Waldner, Norbert Sternmut, Rainer Wedler u.v.a. |
 Neue Lyrik von Werner K. Bliß, Tanja Dückers, Brigitte Fuchs, Petra Ganglbauer, Martin Kirchhoff, Ines Oppitz u.v.a. Neue Lyrik von Werner K. Bliß, Tanja Dückers, Brigitte Fuchs, Petra Ganglbauer, Martin Kirchhoff, Ines Oppitz u.v.a. |
 Zitate der Woche von Friedrich Nietzsche bis Jürgen Habermas und von Charles Darwin bis Roger Willemsen u.v.a. Zitate der Woche von Friedrich Nietzsche bis Jürgen Habermas und von Charles Darwin bis Roger Willemsen u.v.a. |
 Rezensionen neuer Bücher, Musikalien und CDs aus den Sparten Belletristik, Sachbücher, Klassik, Jazz, Pop, Schach u.v.a. Rezensionen neuer Bücher, Musikalien und CDs aus den Sparten Belletristik, Sachbücher, Klassik, Jazz, Pop, Schach u.v.a. |
 Wettbewerbe und Preise Musik- und Literatur-Ausschreibungen, Info-Service für alle Genres u.v.a. Wettbewerbe und Preise Musik- und Literatur-Ausschreibungen, Info-Service für alle Genres u.v.a. |
 Schach in seinem ganzen Spektrum mit Aufgaben und Studien, Computer-Schach, Chess960, Partien, Bücher, Tests u.v.a. Schach in seinem ganzen Spektrum mit Aufgaben und Studien, Computer-Schach, Chess960, Partien, Bücher, Tests u.v.a. |
 Denksport in allen Facetten mit Musik-, Literatur- und Schach-Kreuzworträtseln, Sudoku, Streichholz-Rätsel, Tangram u.v.a. Denksport in allen Facetten mit Musik-, Literatur- und Schach-Kreuzworträtseln, Sudoku, Streichholz-Rätsel, Tangram u.v.a. |
 Interviews und Events aus den drei Glarean-Sparten mit News, Turnieren, Festivals, Seminare, Historie u.ä. Interviews und Events aus den drei Glarean-Sparten mit News, Turnieren, Festivals, Seminare, Historie u.ä. |
 Humor & Sensationen in den Rubriken Cartoons, Karikaturen, Aufgeschnappt, Videos u.ä. Humor & Sensationen in den Rubriken Cartoons, Karikaturen, Aufgeschnappt, Videos u.ä. |
 Gratis-Downloads von kostenlosen Musiknoten (Pop, Klassik, Jazz, Volkslieder), Schachpartien u.v.a. Gratis-Downloads von kostenlosen Musiknoten (Pop, Klassik, Jazz, Volkslieder), Schachpartien u.v.a. |
 Media-Daten Der Herausgeber – Media-Daten & Impressum – Kontakt – Archiv: SCRIPTUM – auf DVD Media-Daten Der Herausgeber – Media-Daten & Impressum – Kontakt – Archiv: SCRIPTUM – auf DVD |
Neue Texte (Essays, Prosa, Gedichte, Reportagen u.a.) sind willkommen! (siehe Impressum)
_________________________________
Die Redaktion ist weder verantwortlich für die Inhalte der im «Glarean Magazin» verlinkten Seiten, noch macht sie sich diese zu eigen. Es ist aufgrund der Vielzahl der Einträge unmöglich, alle regelmäßig zu überprüfen. Bei Hinweis auf illegale Inhalte werden Einträge sofort entfernt. – Sämtliche im «Glarean Magazin» redaktionell bearbeiteten Inhalte unterstehen dem internationalen Copyright und dürfen erst nach schriftlicher Erlaubnis anderweitig verwendet werden.
.
Interessante Buch-Novitäten – kurz vorgestellt
.
Marion Bönsch-Kauke: «Schach im Kindergarten»
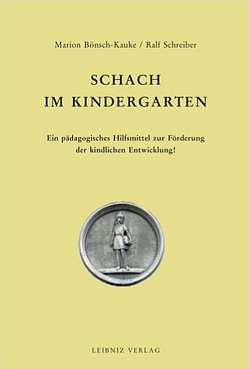 Die ostdeutsche (Schach-)Psychologin Dr. Marion Bönsch-Kauke hatte sich schon vor Jahren mit meta-schachlichen Studien zum Spiel der Könige beschäftigt: In ihrem Band «Klüger durch Schach» untersuchte sie grundsätzliche Aspekte der Schachpädagogik. Letztere steht auch im Zentrum ihrer jüngsten Publikation: In «Schach im Kindergarten» will sie mit Co-Autor Ralf Schreiber «eine Forschungsreportage mitten aus dem pulsierenden Leben im Alltag des Kindergartens» liefern, wobei die Monographie basiert auf umfangreichem Erfahrungsmaterial von schachspielenden 3- bis 6-jährigen Kindern. Das euphorische Fazit der Autorin: «Schüchterne Kinder wagten, den Mund aufzumachen. Tobende, lärmende, unruhestiftende Kinder wurden ruhiger beim Spiel. Entwicklungsauffällige, “gestörte”, kaum führbare, relativ schwierige Problemkinder besserten sich. Unterschätzte Kids zeigten ein neues Gesicht. Stille Begabungen wurden transparent.» Kurzum: das schachwissenschaftliche Projekt habe gezeigt, dass sich das Schachspiel im Kindergarten als hervorragendes pädagogisches Hilfsmittel bewährt habe und die Entwicklung der Kinder spürbar stimuliere. – Bemerkenswertes Experiment. (we) ■
Die ostdeutsche (Schach-)Psychologin Dr. Marion Bönsch-Kauke hatte sich schon vor Jahren mit meta-schachlichen Studien zum Spiel der Könige beschäftigt: In ihrem Band «Klüger durch Schach» untersuchte sie grundsätzliche Aspekte der Schachpädagogik. Letztere steht auch im Zentrum ihrer jüngsten Publikation: In «Schach im Kindergarten» will sie mit Co-Autor Ralf Schreiber «eine Forschungsreportage mitten aus dem pulsierenden Leben im Alltag des Kindergartens» liefern, wobei die Monographie basiert auf umfangreichem Erfahrungsmaterial von schachspielenden 3- bis 6-jährigen Kindern. Das euphorische Fazit der Autorin: «Schüchterne Kinder wagten, den Mund aufzumachen. Tobende, lärmende, unruhestiftende Kinder wurden ruhiger beim Spiel. Entwicklungsauffällige, “gestörte”, kaum führbare, relativ schwierige Problemkinder besserten sich. Unterschätzte Kids zeigten ein neues Gesicht. Stille Begabungen wurden transparent.» Kurzum: das schachwissenschaftliche Projekt habe gezeigt, dass sich das Schachspiel im Kindergarten als hervorragendes pädagogisches Hilfsmittel bewährt habe und die Entwicklung der Kinder spürbar stimuliere. – Bemerkenswertes Experiment. (we) ■
Marion Bönsch-Kauke / Ralf Schreiber: Schach im Kindergarten – Ein pädagogisches Hilfsmittel zur Förderung der kindlichen Entwicklung, 408 Seiten, Leibniz Verlag (St. Goar), ISBN 978-3931155056
.
.
Johanna Heutling: «Wörterbuch Musik / Dictionary of Music»
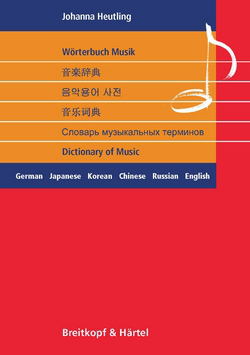 Mit ihrem «Wörterbuch Musik» in den sechs weltumspannenden Sprachen Englisch, Chinesisch, Russisch, Deutsch, Japanisch und Koreanisch offeriert die Autorin eine weitgehende Abdeckung des internationalen Grundwortschatzes Musik. Angesprochen fühlen von den Kompendium sollen sich vor allem ausländische Musikstudierende an Musikhochschulen, -akademien, -konservatorien und -universitäten, aber auch grundsätzlich die Institutionen, die sich mit der Vermittlung von Musik beschäftigen: «Um eine erfolgreiche Eingliederung in den Studien- und Berufsalltag zu ermöglichen, ist es erforderlich, auch die fachspezifische Terminologie zu vermitteln».
Mit ihrem «Wörterbuch Musik» in den sechs weltumspannenden Sprachen Englisch, Chinesisch, Russisch, Deutsch, Japanisch und Koreanisch offeriert die Autorin eine weitgehende Abdeckung des internationalen Grundwortschatzes Musik. Angesprochen fühlen von den Kompendium sollen sich vor allem ausländische Musikstudierende an Musikhochschulen, -akademien, -konservatorien und -universitäten, aber auch grundsätzlich die Institutionen, die sich mit der Vermittlung von Musik beschäftigen: «Um eine erfolgreiche Eingliederung in den Studien- und Berufsalltag zu ermöglichen, ist es erforderlich, auch die fachspezifische Terminologie zu vermitteln».
Aufgeteilt wurden die Musikthemata in die Kapitel Allgemeines (Musikleben, Studium, Institutionen etc.), Musiktheorie, Musikgeschichte/ Formenlehre, Musikpädagogik, Instrumental-/ Gesangsunterricht, Instrumentenkunde und Vortragsbezeichnungen.
Der Band ist lexikalisch-übersichtlich gegliedert, jeder Terminus wird 6-sprachig und 1-zeilig auf Doppelseiten hinweg übersetzt, ebenfalls in den sechs Sprachen wird schließlich der gesamte Begriffsapparat in die einzelnen Sprach-Register aufgeschlüsselt. – Nützlich. (we) ■
Johanna Heutling: Wörterbuch Musik, 388 Seiten, Breitkopf & Härtel Musikverlag, ISBN 978-3-7651-0397-1
.
.
Weitere Rezensionen im Glarean Magazin
.
.
.
.
.
.
Das 50-Euro-«Glarean»-Schach-Preisrätsel
.
Der neue Euro-Schach-Kreuzworträtsel-Spaß
Das jüngste 50-Euro-«Glarean»-Preisrätsel richtet sich diesmal an die Schach-Experten
unter unseren Lesern. Es beinhaltet sowohl einfache wie knifflige Fragen.
.
Wer zuerst die komplette Lösung des Rätsels präsentiert, erhält wie immer 50 Euro.
Einsende-Schluss ist am 23. September 2011 (24 Uhr). Für die Einsendung
ist die untenstehende «Kommentar»-Funktion zu benützen
(Link auf eine entspr. Grafik-Datei inkl. Namensangabe).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. –
Viel Spaß und Erfolg!
Rätsel zum Ausdrucken (pdf)
.
.
.
Michael Dartsch / Susanne Richter: «Der Cellokasten»
.
Wertvolle Ergänzung des Cello-Anfängerunterrichts
Walter Eigenmann
.
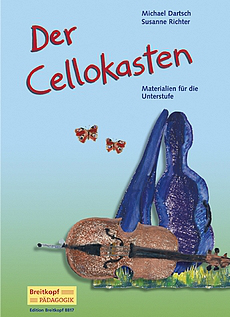 In Sachen Streicherschulung leistet die moderne «Pädagogik»-Heftreihe des Wiesbadener Musikverlages Breitkopf schon seit längerem eine vielbeachtete Arbeit. Nach innovativen Material-Veröffentlichungen für die Violine widmet sich die neueste Streicher-Publikation dieser Verlags-Serie nun dem Violoncello. Unterm Titel «Der Cellokasten» versammelt das renommierte Autorenduo Michael Dartsch und Susanne Richter dabei auf 124 Seiten Lied- und Übungsmaterial für die Unterstufe des Cello-Unterrichts.
In Sachen Streicherschulung leistet die moderne «Pädagogik»-Heftreihe des Wiesbadener Musikverlages Breitkopf schon seit längerem eine vielbeachtete Arbeit. Nach innovativen Material-Veröffentlichungen für die Violine widmet sich die neueste Streicher-Publikation dieser Verlags-Serie nun dem Violoncello. Unterm Titel «Der Cellokasten» versammelt das renommierte Autorenduo Michael Dartsch und Susanne Richter dabei auf 124 Seiten Lied- und Übungsmaterial für die Unterstufe des Cello-Unterrichts.
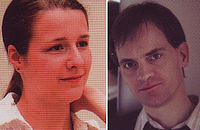
Das Autorenduo Susanne Richter und Michael Dartsch
Konzeptionell ebenso wie layouterisch schließt sich «Der Cellokasten» nahtlos den Pendants der Reihe «Breitkopf Pädagogik» an: In seiner steten, wenngleich betont ruhigen didaktischen Progression, in seinem Schwerpunkt auf das praktische Musizieren, und in seiner lockeren, gestalterisch sehr ästhetischen Aufbereitung offeriert man der (jungen und jüngsten) Schülerschaft auch hier eine vielfältig-farbige Palette von ein- bis max. zweistimmigen Melodien, Stücken und Übungen, deren technische Ansprüche vom allerersten Leersaiten-Zupfen bis zum kurzen imitatorischen Duett mit Sechzehntel und max. drei Kreuzen/B’s reichen. Dem Prinzip Learning-by-Doing wurde innerhalb der didaktischen Zielsetzungen breitester Raum gegeben, und jeder Cello-spezifische Inhalt wird ausführlich mit Spielmaterial aus Vergangenheit und Moderne gestützt.

Der promovierte Musikpädagoge Michael Dartsch und die Freiburger Solo-Cellistin Susanne Richter legen mit ihrem neuen «Cellokasten» eine sehr durchdacht aufbereitete, in der Progression plausible Materialiensammlung für den modernen Violoncello-Unterricht vor. Möglicherweise wird der/die eine oder andere Cello-Lehrer/in die von anderer Unterrichtsliteratur her gewohnte CD-Mitlieferung vermissen. Doch auch in reiner «Printform» ist das jüngste Streicherheft aus dem Hause Breitkopf eine sehr willkommene, weil sehr sorgfältig komponierte Edition, die ihren Weg durch die neuzeitlichen Cello-Anfänger-Schulstuben machen dürfte.
Gleichwohl garniert das Heft seinen ebenso umfang- wie abwechslungsreichen Stücke-Fundus immer wieder mit «theoretischen» Einschüben entweder in Form von verspielten Quiz-Fragen oder mit Hilfe leicht nachvollziehbarer improvisatorischer Anleitungen. Das Gemeinschaftserlebnis Musik wird dabei durch betont häufiges Spiel mit der Lehrperson im Duett (bzw. mit einer technisch schwierigeren Zweitstimme) hergestellt.
Sehr zur Auflockerung des – im übrigen großzügig konzipierten, auch großnotigen – Schriftbildes tragen die unzähligen Farbillustrationen von Juliane Gottwald bei; sie sind nicht einfach Blattlückenbüßer, sondern stimulieren visuell die kindliche Spielfreude in thematischem Bezug zum jeweilige Stück.
Der promovierte Musikpädagoge Michael Dartsch – Autor bereits eines «Geigenkastens» – und die Freiburger Solo-Cellistin Susanne Richter legen mit ihrem neuen «Cellokasten» eine sehr durchdacht aufbereitete, in der Progression plausible Materialiensammlung für den modernen Violoncello-Unterricht vor. Möglicherweise wird der/die eine oder andere Cello-Lehrer/in die von anderer Unterrichtsliteratur her gewohnte CD-Mitlieferung vermissen. Doch auch in reiner «Printform» ist das jüngste Streicherheft aus dem Hause Breitkopf eine sehr willkommene, weil sehr sorgfältig komponierte Edition, die ihren Weg durch die neuzeitlichen Cello-Anfänger-Schulstuben machen dürfte. ■
M.Dartsch/S.Richter, Der Cellokasten – Materialien für den Anfänger-Violoncellounterricht, 124 Seiten, Breitkopf & Härtel, ISMN 979-0-004-18383-0
.
.
Leseprobe
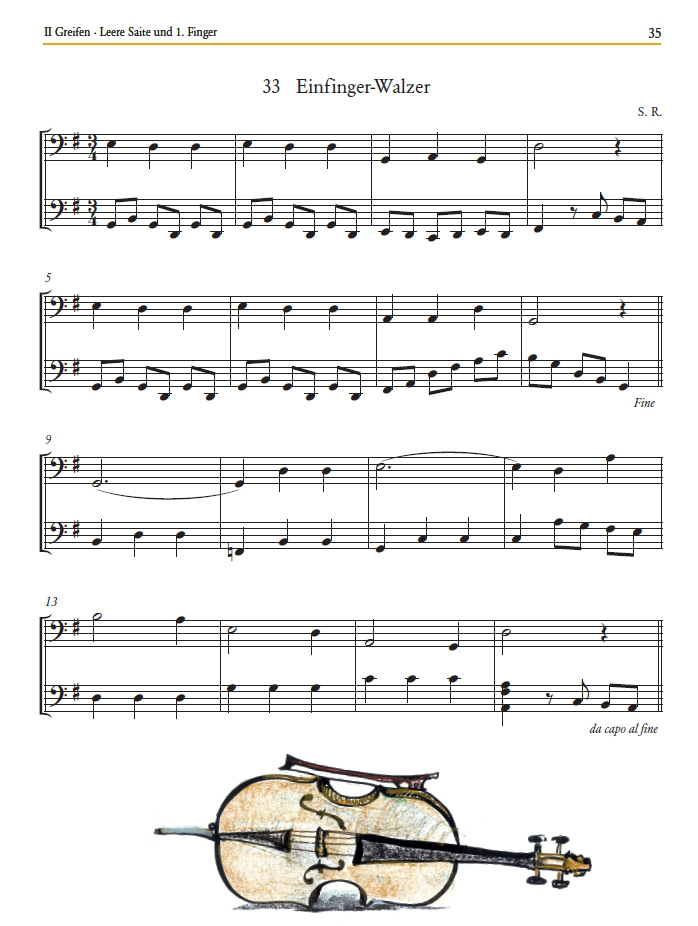 Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages
.
.
Frank Martin: «Messe für Doppelchor» u.a.
.
Chormusizieren von beeindruckender Gestaltungskraft
Walter Eigenmann
.
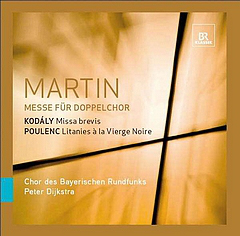 Mit dem Genfer Frank Martin, dem Pariser Francis Poulenc und dem Kecskeméter Zoltán Kodály gruppieren Dirigent Peter Dijkstra und sein Bayerischer Elitechor auf ihrer ersten gemeinsamen Disk sprituell inspirierte Chorwerke dreier sowohl stilistisch und klangästhetisch wie kompositionstechnisch sehr unterschiedlicher Zeitgenossen des frühen 20. Jahrhunderts. Gemeinsam wiederum ist diesem Komponisten-Trio ihre längst «klassische» Modernität – und eben ihre biographisch verbürgte ursprüngliche (wenngleich unterschiedlich ausgeprägte) Religiösität. Diese ist bei Martin gerade durch seine berühmte Doppelchor-A-capella-Messe (innerhalb eines reichen liturgischen bzw. geistlichen Vokal-Oeuvres) referentiell dokumentiert; auch Poulencs Schaffen verzeichnet gewichtige religiös motivierte Chorkompositionen, während Kodálys Gesamtwerk nur wenige, aber interessante (allerdings seltener aufgeführte) liturgisch intendierte Werke aufweist.
Mit dem Genfer Frank Martin, dem Pariser Francis Poulenc und dem Kecskeméter Zoltán Kodály gruppieren Dirigent Peter Dijkstra und sein Bayerischer Elitechor auf ihrer ersten gemeinsamen Disk sprituell inspirierte Chorwerke dreier sowohl stilistisch und klangästhetisch wie kompositionstechnisch sehr unterschiedlicher Zeitgenossen des frühen 20. Jahrhunderts. Gemeinsam wiederum ist diesem Komponisten-Trio ihre längst «klassische» Modernität – und eben ihre biographisch verbürgte ursprüngliche (wenngleich unterschiedlich ausgeprägte) Religiösität. Diese ist bei Martin gerade durch seine berühmte Doppelchor-A-capella-Messe (innerhalb eines reichen liturgischen bzw. geistlichen Vokal-Oeuvres) referentiell dokumentiert; auch Poulencs Schaffen verzeichnet gewichtige religiös motivierte Chorkompositionen, während Kodálys Gesamtwerk nur wenige, aber interessante (allerdings seltener aufgeführte) liturgisch intendierte Werke aufweist.

Gesangsensemble von europäischem Spitzenformat: Der Chor des Bayerischen Rundfunks bei Radioaufnahmen
Poulencs 14 Litaneien «à la Vierge Noire» für dreistimmigen Frauenchor (hier in der Originalfassung mit Orgel eingesungen), mehr noch die achtteilige «Missa brevis» Kodálys garnieren diese Chor-CD mit teils üppiger Klangsinnlichkeit, teils entrückter Sphärik, dann wieder mit jubilierender Hymnik oder (kontrastierend) mit inbrünstig deklamierendem Meditieren. Massgeblich untermalend hier bei beiden Werken das registersichere, differenziert eingehörte Spiel des Organisten Max Hanft (an der «romantisch» disponierten Wöhl-Orgel der Münchner Herz-Jesu-Kirche).

Musikalische Spiritualität von höchster Authentizität: Anfang des Credo aus der Messe für Doppelchor von Frank Martin
Den Schwerpunkt dieser Disk bildet jedoch Frank Martins halbstündige Doppelchor-Messe, vom BR-Chor bereits im Frühling 2007 mit dem erst 29-jährigen Dijkstra im 1’500 Plätze großen Orlando-Saal der Germeringer Stadthalle für das damals extra neu gegründete Label «BR-Klassik» eingesungen. Martins A-capella-Messe, vom Komponisten fast sieben Jahre lang buchstäblich erarbeitet – Martin: «Diese Messe ist eine Sache zwischen Gott und mir» – und erst 40 Jahre nach ihrer Entstehung uraufgeführt – Martin: «Ich kannte damals nicht einen Chorleiter, der sich für dieses Werk hätte interessieren können» -, stellt in ihrer rhythmischen Differenziertheit, ihrer klanglichen Expressivität in allen vier Stimmlagen, ihrer Weite der Phrasierung und Atmung, ihrer satztechnischen Durchhörbarkeit, ihres weiten emotionalen Spektrums vom quasi-gregorianischen Unisono über fugative Strukturen bis hin zu clusterartigen Klangschichtungen höchste sprach- und interpretationstechnische Anforderungen auch an Berufsensembles.

Eine gültige, auch liturgisch «unbefleckte» Zuhörerschaft in ihren Bann ziehende, über weite Strecken gar maßgebliche Produktion.
Der Chor sang eine nicht nur stets lupenrein intonierte und mit enormem dynamischem Spektrum aufwartende, auch Martins eng am Wort orientierte Chormusik expressiv formende, dabei sehr stimmpräzis agierende CD ein, sondern transponierte adäquat den hohen spirituellen, urpersönlich empfundenen Gehalt in Martins Werk. Letzteres natürlich v.a. Verdienst des Dirigenten, dem offenbar gleichsam ein Instinkt für diese gestenreiche, buchstäblich wortreiche liturgische Vokalmusik zur Verfügung zu stehen scheint. Dabei haben sich Dijkstra und sein Chor durchaus gegen hochstehende Interpretationen anderer Formationen durchzusetzen, etwa des «Sixteen»-Ensembles unter Christopher (2005) oder des «Westminster Cathedral Choir» (O’Donnell/1998). – Eine gültige, auch liturgisch «unbefleckte» Zuhörerschaft in ihren Bann ziehende, über weite Strecken gar maßgebliche Produktion. ■
Martin: Messe für Doppelchor / Kodály: Missa brevis / Poulenc: Litanies à la Vierge Noire; Chor des Bayerischen Rundfunks / Peter Dijkstra; Label BR-Klassik
.
.
Das 50-Euro-Schach-Preisrätsel
.
Der Glarean-Rätsel-Schachspaß im März 2011
Das neue 50-Euro-«Glarean»-Preisrätsel richtet sich diesmal erneut an die Schach-Freunde
unter unseren Lesern. Es beinhaltet sowohl einfache wie knifflige Fragen (die allerdings
in unserem Google-Zeitalter auch keine Schrecken mehr verbreiten…)
.
.
Wer zuerst die komplette Lösung des Rätsels präsentiert, erhält wie immer 50 Euro.
Einsende-Schluss ist am 18. März 2011 (24 Uhr). Für die Einsendung
ist die untenstehende «Kommentar»-Funktion zu benützen
(Link auf eine entspr. Grafik-Datei inkl. Namensangabe). –
Viel Spaß und Erfolg!
Rätsel zum Ausdrucken (pdf)
.
.
.
.
.
.
.
Der brillante Schachzug (89)
Interview mit dem Fernschach-Großmeister Arno Nickel
.
Der Fernschachmeister als Schach-Forscher
Walter Eigenmann
.
Neueste Schach-Datenbanken wie die hier kürzlich besprochene «Corr Database 2011», aber weit mehr noch die modernen Schach-Rechenprogramme, beispielsweise die verbreiteten PC-Engines «Rybka», «Stockfish», «Shredder» oder «Fritz» u.v.a. mit ihrer mittlerweile extremen Spielstärke, die keinen internationalen Großmeister mehr fürchtet, lassen immer wieder neu und immer heftiger die Diskussion aufflammen, ob das Fernschach nicht inzwischen tot ist. Und nicht wenige der früher glühenden Verehrer des altehrwürdigen Korrespondenzschachs (Correspondence Chess) haben sich inzwischen enttäuscht davon zurückgezogen: «Ich will nicht gegen Maschinen spielen!»
Denn je länger desto mehr kann im Fernschach das Phänomen beobachten werden: Man rechnet nicht mehr, man lässt rechnen. Stunden-, ja tagelang «brütet» jetzt nicht mehr der FS-Spieler über den Partien, sondern Rybka&Co. wird mit den Stellungen gefüttert, wonach meist ein taktisch einwandfreier, ja oft sogar brillanter Zug resultiert – was aber in den Turnier-Resultaten nicht als Plagiat deklariert wird, sondern als persönlich-menschliche Eigenleistung auftaucht…
Über die Zukunft des internationalen Fernschachs, die Chancen und Gefahren der neuen Software-Generationen für das Fernschach, die spezifischen Anforderungen, die der Einbezug von Schachprogrammen für den ambitionierten FS-Spieler mit sich bringt, befragte das Glarean Magazin den internationalen Fernschach-Großmeister Arno Nickel (aktuell die Nummer 25 der Weltrangliste).
Der auch im Nahschach erfahrene Turnierspieler Nickel ist seit Jahrzehnten eine in der internationalen Correspondence-Chess-Szene sehr aktive und bekannte Persönlichkeit. Darüber hinaus gilt der 58-jährige Berliner Schach-Journalist, -Organisator, -Autor und –Verleger als versierter Kenner auch auf dem Gebiete der neuen Schach-Software. Für seine engagierte, kenntnisreiche und ebenso ausführliche wie informative Stellungnahme hier zum ganzen Themenkomplex «Modernes Fernschach» besten Dank! –
Glarean Magazin: Hand aufs Herz, nutzt der Top-25-Spieler Arno Nickel nicht auch wie viele andere Fernschach-Meister exzessiv die modernen Schach-Engines, als da sind: Rybka, Shredder, Fritz, Hiarcs u.a., oder auch die zahllosen starken Freeware-Programme wie beispielsweise Stockfish, Critter oder Houdini?
Arno Nickel: Eine nette Einstiegsfrage. Wenn nun noch definiert würde, was unter «exzessiv» (das Maß überschreitend, ausschweifend) zu verstehen ist, dann könnte ich darauf vielleicht besser antworten, aber ich versuche es gern auch so: Fernschach ist per se exzessiv, wenn wir mal von den Zeitbedingungen und den theoretisch unbegrenzten Hilfsmitteln ausgehen – oder auch von der idealistischen Zielvorstellung, eine perfekte Schachpartie zu spielen. Wäre man da nicht ein lausiger Fernschachspieler, wenn man nicht alle seine Ressourcen nutzte, um zum Erfolg zu kommen?
Andererseits gilt: Masse macht noch keine Klasse, das rein quantitative Maß der Engine-Nutzung sagt für sich genommen nicht viel aus. Es geht um das Wie der Nutzung und um das Wozu.
GM: Inwiefern hat der verbreitete Gebrauch von Schach-Software das Durchschnittsniveau des Fernschachs verändert?
AN: Die Veränderungen auf dem Durchschnittsniveau sind natürlich dramatisch, vermutlich noch gravierender als an der Fernschachspitze. Spieler, die früher – ohne Computer – einfache taktische Zusammenhänge nicht verstanden oder anfingen merkwürdig zu spielen, wenn ihr Buchwissen erschöpft war, spielen auf einmal mustergültige Partien, die auch ein Anand über weite Strecken kaum besser behandeln könnte. Ihr Pech ist nur, dass viele solcher – ich nenne sie mal: virtuellen – Schachpartien remis ausgehen, weil der Gegner den gleichen Sekundantenstab nutzt. Das kann auf die Dauer natürlich nicht befriedigen, weshalb auch «Durchschnittsspieler» früher oder später die Lust am Risiko wiederentdecken und eigene Wege suchen, vielleicht nicht in jeder Partie, aber doch hier und da, weil sie tief im Innern wissen, dass nur die eigene Leistung wirklich befriedigen kann.
In gewisser Weise hat die Nivellierung des allgemeinen Leistungsniveaus infolge elektronischer Sekundanten, die stärker sind als ihre menschlichen Arbeitgeber, zu einer Leistungsverzerrung geführt, da die natürlichen Unterschiede zwischen den Spielern nicht mehr ungefiltert zur Geltung kommen. Der stärkere Spieler muss sich zunehmend Gedanken machen, wie er vermeiden kann, dass der schwächere entscheidend von Engine-Leistungen profitieren kann – keine leichte, sondern eine höchst delikate Aufgabe. Welche Eröffnungen, welche Strategien soll man wählen, um einen nominell oder potentiell schwächeren Schachspieler zu überspielen? Das ist insbesondere für den Schwarz-Spieler eine ziemlich heikle Sache. Man kann nicht einfach wie im Nahschach die Stellung komplizieren, den Gegner in Zeitnot bringen und dergleichen, man muss tatsächlich schon eine strategische Auseinandersetzung anpeilen und darf den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. In der Tat enden wohl auch viel mehr Fernschachduelle zwischen zum Beispiel 2400ern und 2600ern remis als im Nahschach. Man kann versuchen, mittels Datenbanken ein Dossier seines Gegners zu erstellen, um seine Stärken und Schwächen auszuloten, aber wird dieses auch wirklich aktuell sein und zutreffen? Der Fernschachgegner ist schon aufgrund seiner unbekannten Ressourcen an Hilfsmitteln viel mehr eine «black box» als jeder Nahschachgegner. Das macht aber andererseits auch einen gewissen Reiz aus. Man wird gezwungen, die Messlatte höher zu legen und damit auch die Anforderungen an sich selbst zu erhöhen.
.
Kann man auch ohne Schach-Software noch FS-Großmeister werden?
.
GM: Ist eigentlich für einen ambitionierten FS-Spieler der Gedanke noch realistisch, im internationalen CC-Wettbewerb auch ohne Software Großmeister-Niveau erreichen zu können?
AN: Nein. Da sich das «Großmeister-Niveau» durch Software-Einfluss erheblich gesteigert hat, ist dies auf eine größere Partienzahl bezogen undenkbar. Auch im Fernschach ist niemand in der Lage, ohne Engines auf einem Elo-Durchschnittsniveau von 3000 oder mehr zu spielen. Das aber wäre etwa die geschätzte Leistungssteigerung, die man erhielte, wenn man 10 Fernschach-GMs ohne Engines gegen 10 Fernschach-GMs mit Engines spielen ließe. Nahezu überflüssig, zu erwähnen, dass auch Nahschach-Supergroßmeister ohne Engines, wenn sie es denn versuchten, im Fernschach chancenlos wären. Inzwischen werden ja sogar schon Nahschach-Profis gefragt, ob sie sich eröffnungsmäßig noch ausreichend ohne Computerhilfe vorbereiten können, ob sie sich gar trauen, «Neuerungen» aufs Brett zu bringen, die sie nicht zuvor «gefritzt» haben… Das heißt, der Einfluss der Schach-Software nimmt auch im Nahschach spürbar zu.
GM: Wo haben denn Rybka&Co. ihre grundsätzlichen bzw. strukturellen Schwächen? Im «strategischen» Bereich? Im Endspiel?
AN: Wenn man in Bezug auf Computer von strukturellen Schwächen oder strategischen Defiziten spricht, muss man sich über zwei Dinge im klaren sein:
1. Schachprogramme verfolgen keine «Strategien», sondern sie bewerten aus einer gegebenen Stellung zig Millionen von möglichen Folgestellungen, evaluieren sozusagen, wie das Spiel sich auf diese und jene Züge hin entwickeln und verzweigen könnte. Die Auswahl der am höchsten bewerteten Varianten mag als Simulation von «Strategie» erscheinen, was aber im Grunde eine optische Täuschung ist, denn diese «best move»-Evaluationen ergeben sich rein per Ausschlussverfahren gemessen an den Stellungen, die eben schlechter bewertet werden. Nicht das Programm verfolgt eine «Strategie», sondern der Mensch interpretiert die Programmvorschläge und ordnet sie mit seinem Schachwissen und -verständnis strategischen Kategorien zu, die mehr oder weniger zutreffend sein können.
Häufig ergeben Engine-Evaluationen in fast oder scheinbar gleichstehenden Stellungen ein etwas merkwürdiges Bild. Die Engine zeigt zum Beispiel im 5-Varianten-Modus fünf ziemlich gleich bewertete Varianten an, die aber völlig unterschiedlichen «Strategien» zu folgen scheinen (mal mit Damentausch, mal ohne, mal geschlossen, mal offen, mal agressiv, mal ruhig). Der Laie neigt in solchen Situationen zu dem ergötzlichen Kommentar: «Der weiß ja nicht, was er will!» Und die Pointe ist – der Laie hat Recht, aber er weiß nicht warum und kann daraus keinen Nutzen für sich ziehen! Korrekt wäre als erstes eine Interpretation etwa dergestalt: Das Programm sieht in der gegebenen Rechentiefe (und unter Berücksichtigung diverser Parameter) in den nächsten Zügen keine signifikante Veränderung des Stellungsgleichgewichts. Und nun ist eigentlich erstmal der Mensch gefragt, diesen Befund unter Berücksichtigung seiner eigenen Zugkandidaten zu analysieren. Stimmt der Befund auch dann noch bzw. bleibt es dabei, wenn man tiefer in die Varianten hineingeht? Oft entsteht hier das Problem einer weitläufigen Verzweigung, und da beginnt die eigentliche Fernschacharbeit…
2. Schachprogramme sind in ihren Berechnungen aber auch ohne «Strategie» meistens so genau, dass sie die Versuche von Menschen, strategische Ziele zu verfolgen und diese taktisch durchzusetzen, erstmal durchkreuzen bzw. deutlichen Widerspruch anmelden. Sie finden immer das berühmte «Haar in der Suppe». Menschen stehen daher, sofern sie das selbständige Denken nicht völlig aufgeben wollen, vor einem Bündel komlizierter Fragen, die es durch gründliche Erforschung der Stellung zu beantworten gilt, zum Beispiel:
a) Ist meine «Strategie» wirklich stellungsgemäß oder muss ich sie ändern? Muss ich sie grundlegend ändern oder nur modifizieren?
b) Treffen die Stellungsbewertungen der Engine(s) zu? Welche Aussagekraft haben sie? Sind Bewertungsunterschiede zwischen einzelnen Varianten relevant oder nicht?
c) Ist mein taktisches Vorgehen richtig?
d) Wie gut «versteht» das Schachprogramm die Stellung – wie gut verstehe ich selbst sie?
Das Analysieren mit Computer geschieht in Form eines Dialogverfahrens, gesteuert durch den Anwender, und die Qualität der Ergebnisse hängt sehr stark von der Qualität des Frage- und Antwortspiels ab. Der Mensch muss erkennen, welches sinnvolle und lohnenswerte Fragen sind, und dann die Antworten kritisch bewerten. Dabei ist ein hohes Maß an Objektivität gefordert. Vorurteile und Oberflächlichkeit schlagen letztlich gegen ihn selbst zurück. Die Ergebnisse werden um so besser sein, je gründlicher der Analytiker zunächst einmal versucht, die Stellung zu verstehen, anstatt sich vorschnell auf einen «besten Zug» zu orientieren.
Um nun auf die Frage nach «strukturellen» oder «strategischen» Schwächen von Engines zurückzukommen – das wäre ein großes Thema für sich. Für Programme ist es naturgemäß schwierig, die Bedeutung langfristiger Faktoren angemessen zu bewerten, also zum Beispiel die Auswirkungen einer Bauernstruktur im frühen Mittelspiel für ein Endspiel, das noch in weiter Ferne ist; ähnliches gilt für den Wert der Figuren für einen späeteren Übergang vom Mittelspiel zum Endspiel. Ein anderer Aspekt sind spezielle Stellungs- bzw. Endspieltypen. Man muss sich allerdings vor Verallgemeinerungen hüten. Wenn es auch vielleicht zutrifft, dass zum Beispiel Rybka 4 immer noch gewisse Defizite in der Einschätzung und Behandlung von Turmendspielen oder ungleichen Läuferendspielen aufweist, so heißt dies nicht, dass dies in jeder konkreten Stellung zu Buche schlägt, wie umgekehrt ein anderes Programm, nehmen wir zum Beispiel Shredder 12, das von vielen unter anderem wegen seiner Endspieltechnik geschätzt wird, in bestimmten Fällen auch mal gehörig danebenliegen kann.
In der Fernschachanalyse stößt man oft auf komplexe oder tiefliegende Zusammenhänge, die sich auch mit Engines und trotz großen Zeitaufwandes einer klaren und eindeutigen Durchdringung entziehen – sprich: das Schachspiel bleibt auch mit größtem Computereinsatz in vieler Hinsicht geheimnisvoll.
.
Die Programme als elektronische Sekundaten
.
GM: Worin besteht die Herausforderung an den Turnier-FS-Spieler hinsichtlich des effizienten Umgangs mit moderner Schach-Software?
AN: Bei «Schachsoftware» muss man natürlich unterscheiden zwischen den Engines, der Benutzeroberfläche, den Datenbanken und menschlichen Kommentierungen aller Art, die in die «Software» eingegangen sind. Auch die Hardware bestimmt das praktische Leistungspotential der Software. Generell versucht wohl jeder auf seine Weise, sein technisches Arsenal im Sinne eines Partieerfolges auszuschöpfen, was in Anbetracht der hohen Leistungsdichte eine zunehmend schwierige Aufgabe ist. Es bedarf eines vielfältigen ständigen Experimentierens, um herauszufinden, was «effizient» ist, denn dafür gibt es keinerlei Patentrezept, und die Herausforderung stellt sich mit jeder neuen Partie im Grunde genommen immer wieder neu und immer wieder etwas anders.
Als besonders gelungen erscheinen mir geglückte Versuche, menschliche Ideen mit Hilfe oder auch gegen den zeitweiligen Widerstand von Engines zu verwirklichen. Nehmen wir an, ein Spieler hat eine Opferidee, die ihn nicht loslässt, aber das Schachprogramm zeigt ihm erstmal nur die kalte Schulter. Nach langen Versuchen und Umstellungen findet der Spieler einen Weg, das Opfer doch zu rechtfertigen und die Engine zu «überzeugen», dass dies der einzige aussichtsreiche Gewinnversuch ist – ist das nicht ein äußerst reizvolles Szenario? Lehrreich und wertvoll sind aber auch Beispiele, wo der Mensch seine Stellungs- oder Partieeinschätzung als Ergebnis des Dialoges mit der Engine (seinem elektronischen Sekundanten!) grundlegend revidieren muss – das kann bis hin zu einer Widerlegung von Varianten bzw. Spielplänen gehen, die in der «Theorie» bislang als gesichert galten.
Der Fernschachspieler ist im Unterschied zum Nahschachspieler in viel stärkerem Maße beim Einsatz von Software (insb. Engines) der Wahrheit verpflichtet. Ein Eröffnungsbuch-Autor, der für den Nahschachspieler schreibt, was ja der Regelfall ist, lotet seine Varianten nicht in der Tiefe aus wie ein Fernschachspieler, der dies auf begrenztem Raum sehr wohl tut, wenn er auch nur einen kleinen Ausschnitt des Großen und Ganzen sieht, um das sich der Eröffnungsbuch-Autor kümmern muss. Was der Experte fürs Nahschach empfiehlt oder nicht, muss für den Fernschachbereich, wo bei jedem Zug in die Tiefe analysiert wird, nicht immer gelten und kann sich sogar als ziemlich fragwürdig erweisen, egal welch große Namen hinter den Empfehlungen stehen.
GM: Ist das moderne Fernschach zur reinen Materialschlacht verkommen, oder gibt es technisch-organisatorische Möglichkeiten, es wieder als kreativ-menschliche Leistung zu etablieren?
AN: Das Wort «Materialschlacht» weckt Assoziationen an den Ersten Weltkrieg, wo diese Bezeichnung zum erstenmal als gängiger Begriff aufgetaucht ist. Scheinbar verschwindet der Mensch völlig hinter den von ihm geführten Maschinen bis hin zu der Extremvorstellung, dass es die Maschinen bzw. heute eben die Computer selbst sind, die die Auseinandersetzung führen und entscheiden. Bezogen auf das Schach «hinkt» die Parallele aber in verschiedener Hinsicht: beim Schach wird abwechselnd gezogen und man kann zur Zeit immer nur einen Zug machen. Wenn der Zug erzwungen ist, spielt es keine Rolle, wie schwach oder stark die Maschinerie ist. Wenn der Spieler die Stellung nicht versteht und sich vollkommen der Maschinerie anvertraut, wird er gegen bessere Spieler regelmäßig scheitern, auch wenn diese nur über eine schwächere Ausstattung verfügen. Man kann heute allerdings davon ausgehen, dass zumindest auf Meisterniveau ein einigermaßen ausgeglichenes Niveau an Software- und Computerausstattung besteht, weshalb wirklich der intelligente Umgang mit beidem viel entscheidender geworden ist als die Ausstattung selbst. Die Ungleichgewichte in der Ausstattung, vor allem international gesehen, sind in den letzten Jahren immer geringer und jedenfalls unbedeutender geworden.
Nun mag es wohl Fernschachspieler geben, die ihre Rechner und ihre Software nicht effizient und vor allem nicht selbstkritisch genug einsetzen und dies so wahrnehmen, als hätten sie eine «Materialschlacht» verloren. Doch im Grunde ist dies eine bequeme Ausrede, sie geben die Verantwortung für ihre Züge an die Engines ab, statt gründlicher zu analysieren.
Man muss sich über einige weitere Dinge im klaren sein:
1.) Der Einsatz von Software, insb. von Engines, bedeutet absolut gesehen nicht eine Verringerung des menschlichen Zeit- und Arbeitsaufwandes, sondern dieser ist im Vergleich zu früher eher gleich geblieben. Er ist vermutlich etwas rationeller geworden, was für beide Seiten in einer Fernschachpartie gilt. Wer statt dessen Rechner einsetzt, um schnell und mit möglichst wenig eigenem Einsatz zum Erfolg zu gelangen, wird auf die Dauer nicht allzu weit kommen.
2.) Das moderne Fernschach ist durch einen wissenschaftlich-kreativen Stil geprägt. Diese Kombination ist kennzeichnender denn je. Man mag es bedauern, dass der kühne Gambit- oder Angriffsspieler heute vielleicht weniger auf seine Kosten kommt als früher, aber die Zeit lässt sich nun mal nicht zurückdrehen, so wenig wie sich ein Schachspieler der aufgeklärten Steinitz-Ära ins romantische Zeitalter zurückbeamen konnte.
3.) Um im Fernschach heutzutage zum Erfolg zu kommen, muss man Leistungen und Vorgaben («Eröffnungstheorie») aus dem Nahschachbereich kritischer denn je analysieren. Viele Erfolgsrezepte und -konzepte aus dem Nahschach überzeugen im Fernschach nicht, weil der strenge elektronische Sekundantenstab sich zu Recht unbeeindruckt von ihnen zeigt, nicht zuletzt auch weil Nahschachspieler insgeheim immer ein wenig auf die menschlichen Schwächen ihrer Gegner spekulieren, was aber im Fernschach selten funktioniert.
Wer im Fernschach gegen gute Gegner gewinnen will, muss sich heute meines Erachtens schon in der Eröffnung mehr eigene Gedanken denn je machen, denn der Erkenntnisfortschritt in den Hauptvarianten (das können auch Modevarianten sein, die dabei sind, alte Hauptvarianten zu verdrängen) hat grundsätzlich eine starke Remistendenz. Gute Fernschachspieler folgen nicht einfach blind irgendwelchen aktuellen Eröffnungszügen von Anand, Kramnik oder Carlsen, nur weil diese gewonnen oder remis gehalten haben, sondern loten durchaus viele kritische Stellungen von Vorgängervarianten bis zu einer gewissen Tiefe aus.
Kreativität ist also durchaus sehr gefragt im modernen Fernschach.
Ergänzend sei darauf verwiesen, dass Fernschachspieler, die ihr Hobby ohne Engine-Einfluss genießen wollen, also möglichst traditionell, sich in enginefreien Turnieren zusammenfinden können (und dies ja auch tun), wo man also unter Gleichgesinnten gemäß einem Ehrenkodex spielt. So etwas gibt es unter anderem beim BdF, dem Deutschen Fernschachbund; wie erfolgreich, das entzieht sich meiner Kenntnis. Eine andere Idee, ist die Popularisierung des Fischer-Schachs bzw. Chess960 im Fernschachbereich, die quasi dem «Overkill» im Eröffnungsbereich entgegenwirkt, allerdings die Engines nicht außen vor lässt.
.
Vermisst: Hochkarätige Turniere und FS-Sponsoring
.
GM: Gibt es bei dieser positiven Sicht des modernen Fernschachs denn überhaupt Probleme, die jetzt und in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen bzw. spielen könnten? Wie sehen die Wachstumszahlen im Mitgliederbereich aus?
AN: Letzteres vermag ich nicht genau zu sagen, es hat schon einen gewissen Mitgliederschwund im organisierten Fernschach als Folge der «Computerisierung» gegeben; das hat aber viel mit der Altersstruktur zu tun. Früher gab es viele Ältere im Fernschach, die einfach über mehr Zeit verfügten als Berufstätige oder Schüler/Studenten. Das geht bis hin zum Briefmarken- oder Postkartensammler, der einen ganz anderen Zugang zu seinem Fernschach-Hobby hatte als der ehrgeizige Turnierspieler. Interessanterweise gibt es heute viel mehr Fernschachspieler außerhalb der etablierten Verbände, weil nämlich das Internet unglaublich viele und attraktive Angebote bereithält, die auch genutzt werden. Wenn man die Fernschachserver bzw. -websites, auf denen gespielt wird, mitzählt, könnte man also vielleicht feststellen, dass heute allgemein mehr Fernschach gespielt wird als früher. Es wäre eine verdienstvolle Aufgabe, dies näher statistisch zu untersuchen. Nebenbei bemerkt, gehören ja auch alle diese Freizeit-Fernschachspieler zum Markt für Schachsoftware.
Die neuen alternativen Spielangebote im Internet kommen oft moderner daher als die traditionellen Verbände, die diese Spieler, darunter sicherlich viele junge, gar nicht erst erreichen.
Im Grunde interessiert mich das aber nur am Rande. Wesentlich mehr beschäftigen mich die Probleme im Spitzenfernschach, die ich wie folgt sehe:
1.) Es gibt zu wenig hochkarätige Turniere, wozu ich Turniere ab Kategorie 15 (Eloschnitt über 2600) zähle. Insbesondere sind die Fernschachweltmeisterschaften seit einigen Jahren wegen eines unattraktiven Qualifikationsmodus, der elo-stärkere Spieler von einer Beteiligung abhält, tendenziell unterklassig. Es handelt sich durchschnittlich um Kategorie 13-Turniere (Eloschnitt 2550-2575).
2.) Es gibt zu wenig Sponsoring im Fernschach. Dies ließe sich mit einem aktiveren Erscheinungsbild, insbesondere durch mehr hochkarätige Ereignisse, vermutlich etwas verbessern. Das Fernschach müsste meiner Ansicht nach auch bereiter sein, Quereinsteigern aus dem Nahschachbereich, also zum Beispiel Nahschach-Großmeistern, entsprechende Anreize zu bieten. Deren Bekanntheitsgrad könnte oft werbewirksam fürs Fernschach genutzt werden.
3.) Die Normenanforderungen für Fernschach-Titel waren bis vor kurzem allgemein zu niedrig angesichts der vermehrten Angebote, Normen erreichen zu können. Das hat in den letzten 10 Jahren zu einer Titelinflation geführt. Man ist dabei, dies nun wieder etwas zurückzufahren, aber mit welchem Erfolg muss sich noch zeigen. Rückwirkend geht das natürlich überhaupt nicht. Der Fernschachbund hat leider etwas zu starke Signale mit den Titeln als «Lockmittel» gegeben, – mit dem Ergebnis, dass er nun peinlicherweise hier und da öffentlich gefragt wird, wie es möglich ist, dass Spieler mit einem Nahschach-Niveau von deutlich unter 2000 (teilweise sogar um 1600) reihenweise internationale Titelträger werden, darunter sogar immer mehr Großmeister.
4.) Womit das Fernschach aber tatsächlich beeindrucken kann und muss, sind Partien, also schachliche Leistungen und deren angemessene Aufbereitung in Publikationen. Wie heißt es doch so schön? «An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!» So wäre es beispielsweise wünschenswert, dass die besten und interessantesten Partien von Fernschachspielern, ganz gleich, ob es sich um Titelträger handelt oder nicht, in Gestalt eines Fernschach-Informators regelmäßig vorgestellt würden. Frühere Versuche dieser Art sind als Printmedien nach einigen Jahren leider gescheitert. Es scheint nun an der Zeit, in diese Richtung neue – professionelle – Schritte zu unternehmen und dabei auch die Möglichkeiten des Internets bzw. der Computertechnologie zu nutzen. Ein besonderer Leckerbissen könnte in solchen Veröffentlichungen die Diskussion von konkreten Engine-Ergebnissen und -Anteilen sein, denn die Zeiten, in denen Fernschachspieler verschämt oder aus falscher Eitelkeit solche Aspekte in ihren Analysen und Kommentaren verschwiegen, sollten nun endgültig der Vergangenheit angehören. Der moderne Fernschachmeister hat mehr denn je Anteil an der Erforschung des Schachspiels – das gilt es zu erkennen, anzustreben und zu vermitteln..■
.
Nationale Fernschach-Verbände
Schweizer Fernschach-Vereinigung (SFSV)
Deutscher Fernschach-Bund (BdF)
Fernschach im Österreichischen Schachbund (ÖSB)
.
Internationale Fernschach-Verbände
International Correspondence Chess Federation (ICCF)
Internationaler E-Mail-Schachverbund (IECF)
.
.
.
.
Chessbase: «Corr Database 2011»
.
Qualitätsvolles historisches Kompendium des Fernschachs
Walter Eigenmann
.
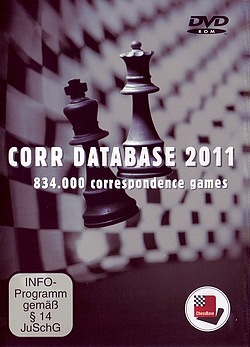 Die etwas älteren Semester unter den Freunden des internationalen Wettkampf-Fernschachs erinnern sich noch an Zeiten, da hatte das Correspondence Chess ein gänzlich anderes, einige meinen: ein sympathischeres Gesicht als heute. Es war die Zeit der persönlichen Partien-Karteien und der schönen Briefmarken, auch die Zeit der dicken Variantenkoffer und der unleserlichen Handschriften, die Zeit der monatelangen Zugübermittlung und des freundschaftlichen Briefwechsels, die Zeit des stundenlangen Ausprobierens von vielversprechenden Opferkombinationen mit mehreren Schachbrettern gleichzeitig auf dem heimischen Stubentisch…
Die etwas älteren Semester unter den Freunden des internationalen Wettkampf-Fernschachs erinnern sich noch an Zeiten, da hatte das Correspondence Chess ein gänzlich anderes, einige meinen: ein sympathischeres Gesicht als heute. Es war die Zeit der persönlichen Partien-Karteien und der schönen Briefmarken, auch die Zeit der dicken Variantenkoffer und der unleserlichen Handschriften, die Zeit der monatelangen Zugübermittlung und des freundschaftlichen Briefwechsels, die Zeit des stundenlangen Ausprobierens von vielversprechenden Opferkombinationen mit mehreren Schachbrettern gleichzeitig auf dem heimischen Stubentisch…
Doch das sind schon seit langem Tempi passati, bestenfalls schöne Nostalgie. Denn erfolgreiches Fernschach, und spiele es sich auch nur national ab, sieht heutzutage gänzlich verändert aus. Es kommt längst daher in Gestalt des modernen PC: An die Stelle der Postkarte sind zahlreiche Schach-Mail-Server getreten, die (auch Online-)Partienverwaltung übernehmen spezielle Archivierungsprogramme, und sogar durch das immer wieder frisch wuchernde Taktik-Gestrüpp hilft dem Spieler mittlerweile extrem starke Schach-Software, die imstande ist, jedem Großmeister Paroli zu bieten.
Und schließlich die unverzichtbare Eröffnungs- bzw. Partien-Sammlung, die man früher mühsam mittels themenverwandten Zeitschriften, Loseblatt-Kompendien und natürlich umfangreichen Schachbibliotheken zusammenzustoppeln pflegte? Sie ist schon seit Jahren ersetzt durch systematisch gepflegte, hinsichtlich Spieler- wie Turnier-Namen vereinheitlichte Datenbanken – beispielsweise die «Corr Database» des deutschen Schachsoftware-Herstellers Chessbase.
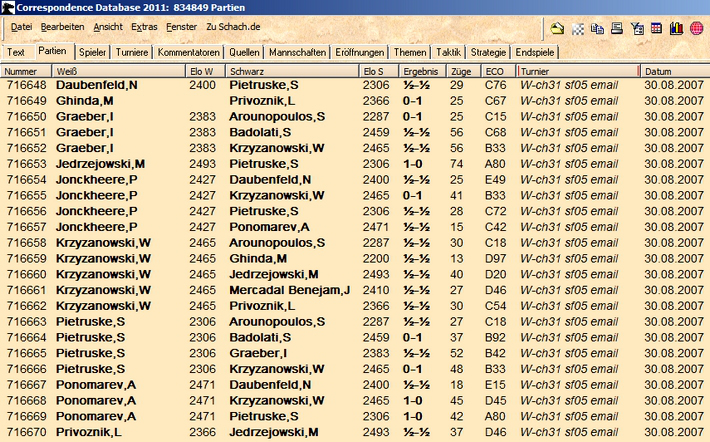
Screenshot der über 834’000 Games umfassenden «Corr»-Partienliste mit ihren vielfältigen Sortier- und Such-Optionen
Die neue «Corr Database 2011»-DVD aus der Hamburger Softwareschmiede knüpft hinsichtlich Konzeption und Handling nahtlos an ihre Vorgängerinnen an, umfasst aber inzwischen mehr als 834’000 Fernschach-Partien. Der Zeitraum aller archivierten Partien erstreckt sich dabei über 206 Jahre; das erste (unvollständige, mit Sicherheit via Post oder Telegraphie ausgetragene) Game (eines Friedrich Von Mauvillon gegen einen N.N.) datiert aus dem Jahre 1804, die jüngste Partie stammt vom April dieses Jahres (eine auf dem ICCF-Server via E-Mail gespielte Begegnung zwischen den beiden Franzosen Dejonckheere und Jacon).
Die Sammlung beinhaltet nun Partien von nicht weniger als 79’000 Spielern aus über 50’000 Turnieren, wobei praktisch alle relevanten Wettkämpfe und Matches enthalten sind, von den historischen Weltmeisterschaften bis zu den modernen ICCF-Thematurnieren, von den weltweiten FS-Olympiaden bis runter zu nationalen Mannschaftskämpfen.
Die Installation der insgesamt 531 Megabyte schweren DVD gestaltet sich einfach und voraussetzungslos: Nach «setup.exe», «Sprache wählen» und einem Computer-Neustart hat man den kostenlos mitgelieferten «Chessbase Reader 9.0» auf dem Desktop, womit dann in der «Corr Database 2011» direkt ab DVD (oder nach entspr. Dateien-Kopieren auf der Harddisk) gesurft werden kann. Dabei liest der CB-Reader nicht nur das hauseigene CBH/CBF-, sondern auch das international verbreitete PGN-Format. Mit verschiedenen Such-Masken lässt sich dann komfortabel recherchieren und filtern, etwa spezifische Kommentare, Stellungen und Materialverhältnisse, oder sogar nach detaillierten Figuren-Manövern suchen. Wen’s nach noch weitergehenden Datenbank-Techniken (z.B. Doubletten-Suche, Varianten-Statistik u.a.) gelüstet, der kann sich im Netz auch leistungsstarke Freeware-Programme wie z.B. «Scid» runterladen oder dann zu (nicht gerade billiger) Software wie beispielsweise «Chess Assistant» oder «ChessBase» greifen, die bezüglich Partien-Handling keine professionellen Wünsche mehr offen lassen; mit ihnen lassen sich dann Partiensammlungen wie die «Corr Database 2011» archivieren, systematisieren, katalogisieren, sortieren, selektieren, online recherchieren und aktualisieren.
Konkurrenz erwuchs der Hamburger «Corr» schon seit ihrer Erstauflage im Jahre 1997 – damals «Corr Nr. 1» genannt – immer mal wieder von zwei weiteren kommerziellen Fernschach-Datenbanken, nämlich der bis vor einigen Jahren von ChessMail (Tim Harding) vertriebenen «Mega Corr» sowie der seinerzeit ebenfalls recht verbreiteten «Ultra Corr» aus dem gleichen Haus. Interessant ist ein direkter Vergleich einiger wichtiger «Features» dieser drei Bases bzw. ihrer zurzeit aktuellen Versionen:
Etwas unschön springt hier der relativ hohe Anteil von sog. «Bye»-Partien in der «Corr Database» ins Auge – doch das hat durchaus nachvollziehbare Methode: Die Hamburger Sammlung legt besonderen Wert auf chronologische Vollständigkeit, wodurch der Leser gerade aufgrund dieser Null-Züge- bzw. Forfait-Partien die betroffenen Turniere und Begegnungen schachhistorisch lückenlos rekonstruieren kann. (Im Hinblick aufs Eröffnungsstudium sind sie allerdings nur lästige Datenleichen…)
Ein Blick auf die Aktualität weist die Chessbase-Sammlung als die weitaus modernste aus (auch wenn man über die Namensgebung angesichts der jüngsten Partie, die aus dem Frühjahr 2010 stammt, geteilter Meinung sein kann…). Wer hinsichtlich neuesten Partien- bzw. Eröffnungsmaterials wöchentlich auf dem Laufenden sein will, kommt ohnehin bei keiner der drei genannten Sammlungen darum herum, sich im Internet die entsprechenden Free-Downloads zu besorgen; zwei seit Jahren erste Adressen sind diesbezüglich TWIC (Nahschach) und das ICCF-Game-Archiv (Fernschach). Eine riesige Fülle von Schachpartien jeder Art und Qualität findet sich außerdem bei dem bekannten Online-Sammler Lars Balzer.
Die «Corr Database 2011» setzt die gepflegte Tradition des Hauses Chessbase in Sachen Datenbanken fort; auch diese DVD weist Sorg- und Vielfalt in der Partien-Zusammenstellung, Schnelligkeit der Software, hoher Grad der Vereinheitlichung von Spieler- und Turniernamen, differenzierte Filter-Optionen, einen beachtlichen Anteil von hochstehenden Kommenta(to)ren sowie das typische aufgeräumte Erscheinungsbild aller CB-Bases von «Fritz» übers «CB-Magazin» bis hin zur 4-Millionen-«Megabase» auf. Hinzu kommt als Sahnehäubchen ein spezielles «Fernschach-Lexikon», das ca. 71’000 Spieler umfasst.
Als bescheidene technische Voraussetzungen für ein flottes Arbeiten mit der Datenbank nennt Chessbase einen Pentium PC mit Windows XP, 32 MB Hauptspeicher, 350 MB Harddisk-Bedarf sowie den bereits erwähnten, gratis mitgelieferten CB-Reader9.
.
Bliebe noch die Frage, ob der verhältnismäßig hohe Verkaufspreis dieser DVD von 80 Euro gerechtfertigt ist. Denn wer als nur gelegentlicher «Hobby-Korrespondenzler» nach neuen FS-Partien sucht, der wird heutzutage problem- und kostenlos fündig auch im Internet mit seinem Überangebot an Open-Source-Lösungen und Freeware-Materialien.

Wer als seriöser Wettkampf-FS-Spieler auf internationalem Niveau erstens den eröffnungshistorisch kompletten Überblick sucht, zweitens auf statistisch verlässliches Material hinsichtlich prozentualer Auswertungen der Systeme und Varianten angewiesen ist und drittens ein sorgfältig aufbereitetes, in den Details vereinheitlichtes Partien-Kompendium sucht, der wird gerade in dem Nischenmarkt Fernschach-Software um diese über Jahre hinweg sorgfältig begleitete «Corr Database 2011» schwerlich herumkommen; Sie ist sicher die zurzeit beste käufliche Datenbank in dieser Kontinuität, Systematik und Qualität des Handlings.
Wer hingegen als seriöser Wettkampf-FS-Spieler auf internationalem Niveau erstens den eröffnungshistorisch kompletten Überblick sucht und dabei zweitens auf statistisch verlässliches Material betreffend prozentualer Auswertungen der Systeme und Varianten angewiesen ist, der wird gerade in dem Nischenmarkt Fernschach-Software um die hervorragend aufbereitete, über Jahre hinweg sorgfältig begleitete und in den Daten-Details wohltuend vereinheitlichte «Corr Database 2011» schwerlich herumkommen; Sie ist sicher die zurzeit beste käufliche Datenbank in dieser Kontinuität, Systematik und Qualität des Handlings.
Für die Hamburger Software-Köche scheint die «Corr» jedenfalls nicht auf den Massenmarkt des schachlichen Fast-Food zu zielen; dafür ist das ganze Mahl wohl zu teuer angerichtet. Angesprochen ist vielmehr der FS-Gourmet, der sich dies exquisite Partien-Menü auch was kosten lässt… ■
Corr Database 2011, 834’000 Fernschach-Partien, DVD-ROM, 531 MB, Chessbase Hamburg
.
.
Lesen Sie zum Thema «Fernschach» auch unser Interview mit dem
internationalen Fernschach-Großmeister Arno Nickel !
.
.
Berühmte Gospel-Songs für 1 oder 2 Panflöte/n
Anzeige
.
Die schönsten Gospel-Melodien für Panflöte
«Gospel for Pan» ist eine Sammlung von 14 der berühmtesten
Gospel- und Spiritual-Melodien für 1 oder 2 Panflöte/n.
Die Bearbeitung erfolgte in besonders leichter Manier,
bei einigen Stücken kommen aber auch fortgeschrittene Spieler auf ihre Kosten.
Die Melodien sind mit nur einer Panflöte ebenfalls gut spielbar.
.
Der Inhalt: Kumbaya, my Lord * Oh when the Saints *
Joshua fit the battle of Jericho * Swing low, sweet Chariot *
Nobody knows * Down by the riverside *
He’s got the whole world * It’s me, oh Lord *
My Lord, what a morning * Rock-a my soul *
Ev’ry time I feel the Spirit * Somebody’s knocking at your door*
Oh happy Day * Amazing grace *
ISBN 9783738637236
.
.
Probeseite (Screenshot)
.
.
32 Seiten – (A5) * Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 12.- / SFR 15.-
Bei Ihrem Buch- oder Musikhändler
ISBN 9783738637236
.
.
.
.
Valeri Bronznik: «1.d4 – Ratgeber gegen Unorthodoxe Verteidigungen»
.
Weiße Rezepte gegen die schwarze Giftküche
Walter Eigenmann
.
 Der gebürtige Ukrainer Valeri Bronznik, seines Zeichens Internationaler Meister und seit Jahren in Stuttgart ansäßig, genießt nicht nur als Spieler, sondern auch als Buchautor wie als Schachpädagoge einiges Ansehen. Das Credo, dem dabei der rührige IM als Schach-Coach wie als Theoretiker anhängt, erläutert er selber einschlägig z.B. hier:
Der gebürtige Ukrainer Valeri Bronznik, seines Zeichens Internationaler Meister und seit Jahren in Stuttgart ansäßig, genießt nicht nur als Spieler, sondern auch als Buchautor wie als Schachpädagoge einiges Ansehen. Das Credo, dem dabei der rührige IM als Schach-Coach wie als Theoretiker anhängt, erläutert er selber einschlägig z.B. hier:
«Viele meinen, dass es völlig ausreichend sei, eigene Partien mit dem Computer zu analysieren. “Fritz sagt, daß falls ich Lc1xh6 gespielt hätte, wäre es +2,7 für mich”; oder “Es war praktisch ausgeglichen, ich sollte nur Da1-h8 spielen”. Wozu braucht man noch einen Trainer, wenn ein Schachprogramm alles sofort sieht und zeigt?
Die Antwort ist eigentlich einfach. Kein Schachprogramm erklärt Ihnen, wie Sie den richtigen Zug finden. Es erklärt Ihnen auch nicht, warum Sie diesen, und nicht den anderen Plan verwirklichen sollen. In Ihren weiteren Partien werden Tausende neuer Positionen entstehen, aber kein Programm sagt Ihnen, mit welcher Vorgehensweise Sie die zukünftigen Probleme lösen können. Kein Programm kann erkennen, zu welchen Fehlern Sie neigen, aus welchem Grund, und Ihnen dann eine entsprechende Hilfe anbieten. Kein Programm zieht Psychologie in Betracht, welche im Schach eine enorm große Rolle spielt.
Das alles läßt sich aber mit Hilfe eines qualifizierten Trainers lösen. Und wenn Ihre Zusammenarbeit mit ihm gut läuft, dann sehen Sie nach einiger Zeit, daß Sie das Schachspiel viel besser verstehen, in Ihren verschiedenen Turniersituationen viel besser zurecht kommen und folglich einfach besser spielen und davon mehr Spaß haben.»
Nun könnte man solcherlei auf den ersten Blick als simpel-worthülsige Reklame fürs eigene Gewerbe abtun, hätte Bronznik den Tatbeweis seiner Qualitäten nicht längst auch in Form vielbeachteter Buchpublikationen angetreten. Nach spezifischen Eröffnungs-Monographien (z.B. über «Tschigorin» und «Colle») sowie einem Positionsspiel-Lehrbuch (gemeinsam mit Anatoli Terekhin) widmete er sich nun verschiedenen Nebenlinien gegen ungewöhnliche schwarze Reaktionen auf 1.d4; der Band nennt sich vielsagend: «1.d4 – Ratgeber gegen Unorthodoxe Verteidigungen / Ihr Gegner will Sie überraschen? Bleiben Sie cool!»
Und in der Tat hat wohl jeder ambitionierte d4-Spieler gegen den schwarzen Mainstream der Halboffenen Spiele – der da ist: alle bekannten «grossen» Indischen Verteidigungen inkl. Grünfeld und Benoni sowie natürlich der ganze Damengambit-Komplex – seine Lieblingspfeile im Eröffnungsköcher; wenn aber die Nachziehenden mit vielversprechendem Exotischem daherkommen – z.B. betont Taktik-Lastigem wie die Englund-, Schara-Hennig-, Albins-Gambite oder auch einer «gesunden» Keres- oder Englisch-Verteidigung zuzüglich Budapester Gambit -, dann kann das beim unvorbereiteten Weißen schon mal die Schweißtropfen der hochnotpeinlichen Überraschung auf die Stirn treiben (siehe auch untenstehendes Inhaltsverzeichnis).
Dagegen nun fährt Valeri Bronzniks Veröffentlichung kräftig Geschütze auf – wobei er dezidiert keine «Eröffnungsbibel» schrieb, sondern eher ein «Wegweiser», der teils zwar bei komplexen Systemen eine variantenreiche Binnengliederung nötig machte, teils bei klareren «Fällen» auch eine einfachere Strukturierung des Materials verwendete. Dementsprechend beanspruchen «seriösere» Systeme – z.B. Keres-Verteidigung, Verzögerter Stonewall, Budapester Gambit oder Englische Verteidigung – ausführlich Raum, während Waghalsig-Unkorrektes wie beispielsweise Soller- bwz. Englund-Gambit oder das Wusel mit ein paar wenigen Seiten bzw. dem Hinweis auf «natürliche Züge» für den Anziehenden abgefertigt werden konnten. Grundsätzlich reduziert Autor Bronznik aber eigentlich weitverzweigendes Variantengestrüpp in wohltuendem Pragmatismus einfach auf ein besonders vielversprechendes Abspiel mit dem Hinweis: «Die Variante, die ich Ihnen empfehle, ist darauf orientiert, einen vielleicht nicht sehr großen, dafür aber stabilen Vorteil zu erhalten.»
Im Zuge seiner Untersuchungen greift dabei Bronznik immer wieder dezidiert u.a. auf Arbeiten des Münsterer Schachautoren und Dortmunder Bundesligisten Stefan Bücker zurück, um dessen umfangreiche Recherchen in Sachen «Groteske Schacheröffnungen» konstruktiv aufzugreifen bzw. kritisch zu hinterfragen. Denn Kaissiber-Herausgeber Bücker hat sich gerade als Experte für Unorthodoxes einen Namen gemacht, so dass Valeri Bronznik in verschiedenen Details die Arbeit des Münsterer FIDE-Meisters zum willkommenen Ausgangspunkt seiner Aktualisierungen nehmen konnte.
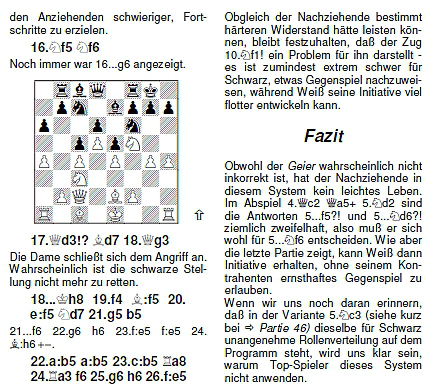
Lesefreundliches Schriftbild, schönes Layout, inkl. «Fazit»: Auszug der «Geier»-Analyse von Valeri Bronznik
Stichwort Aktualität: diesbezüglich ist diese d4-Abhandlung Bronzniks über jeden Zweifel erhaben – sowohl hinsichtlich des Partien- wie bezüglich des Variantenmaterials. Sogar die Grundlagen- bzw. Beispiel-Partien, welche das zu behandelnde System je verallgemeinernd umreißen, sind – im Gegensatz zu vergleichbaren Publikationen – meist nicht älter als 10-15 Jahre, weiterführende exemplarische Games stammen manchmal gar aus dem Zeitraum der letzten zwei Jahre. Auch hinsichtlich taktische Akkuratesse – ein in älteren Monographien dieser Art immer wieder kritisches Element – befriedigt Bronzniks Arbeit: der Autor hat offensichtlich ausführlich Gebrauch gemacht von modernster Software, was die Gefahr von fehlerhaften taktischen Details minimiert, und an einzelnen Stellen werden gar dezidiert Analyseergebnisse von starken Schach-Programmen wie z.B. «Rybka» oder «Fritz» zitiert.

Mit seinem neuesten «Ratgeber» für d4-Spieler, die geeignete Waffen gegen unorthodoxe schwarze Eröffnungssysteme suchen, präsentiert der Stuttgarter IM Valeri Bronznik eine qualitätsvolle Monographie, die sehr originelle Rezepte vorlegt und dabei so manche schwarze Überfalls-Idee ad absurdum führt. Eine sehr interessante und empfehlenswerte Produktion aus dem Hause Kania.
Ein Knackpunkt bei variantenorientierter Schachliteratur ist selbstverständlich immer wieder die Ausgewogenheit von verbalem Beschrieb und konkreten Zugfolgen – und gerade hier auch überzeugt Bronzniks schachliterarischer Ansatz. Das teils durchaus enorm detailreiche Variantenmaterial in seinen oft starken Verästelungen wird vom Autor immer wieder strukturierend unterbrochen mit strategischen Hinweisen, positionellen Anmerkungen, allgemeinschachlichen Tipps – was in diesem Mix auch das Spektrum der Zielgruppen wünschenswert dehnt: Der Band dürfte auf allen Stärke-Levels vom erfahrenen Vereinsamateur bis zum ambitionierten Open-Spieler mit Gewinn konsultiert werden; erstere werden die grundsätzliche Einschätzung eines Gambits bzw. eines Eröffnungskomplexes zu schätzen wissen, die anderen die zahlreichen konkreten, zwar verästelten, aber nie ausufernden Abspiele als Grundlage für die eigene Eröffnungsarbeit nehmen. Über den grundsätzlichen Wert eines jedes vorgestellten Systems gibt dabei der Autor am Ende des jeweiligen Kapitels Auskunft in einem eigenen «Fazit», das die vorausgegangene Analyse mit einer Empfehlung für den Weißen (oder ggf. einer Warnung für Schwarz…) zusammenfasst.
Hilfreich beim Buchstudium ist dabei auch das differenzierende Schriftbild des Bandes: Die Partiefortsetzung kommt in größeren, die Variante in kleineren fetten, die weitere Untergliederung in normalen Buchstaben daher. Verbunden mit einer übersichtlichen Einzug- bzw. Absatz-Gestaltung sowie einer wohldosierten Diagramm-Verwendung unterstützt das Übersichtlichkeit und Lesefluss. Auch in Sachen Buchdruck überzeugt die neue Produktion aus dem Hause Kania vorbehaltlos: Stabiler Hardcover-Einband, schöne Fadenheftung, ästhetisches Layout mit tadellosem Diagramm-Druck auf qualitätsvollem Papier – wenngleich dies alles nicht anders erwartet aus einem Schach-Verlag, der schon seit Jahren anerkanntermaßen nicht auf Quantität, sondern auf Qualität setzt. Zum Preis von 20 Euro erhält der Schachfreund erneut also ein Schachbuch der mustergültigen Art, das in dieser Thematik und mit dieser Qualität willkommen eine Lücke schließt. ■
Valeri Bronznik: 1.d4 – Ratgeber gegen Unorthodoxe Verteidigungen, 236 Seiten, Kania Schachverlag, ISBN 3-978-3-931192-37-2
Leseproben (Scans)
Weitere Leseproben (pdf)
Inhalt
Einführung
TEIL I Verschiedene 1... Züge Kapitel 01 Englund-Gambit und Verwandtes Kapitel 02 Holländisches Benoni Kapitel 03 Das Wusel Kapitel 04 Die Polnische Verteidigung Kapitel 05 Die Owen-Verteidigung Kapitel 06 1...Sc6 Kapitel 07 Die Keres-Verteidigung Kapitel 08 Die Englische Verteidigung
TEIL II Variationen im Damengambit Kapitel 09 Die Marshall-Verteidigung Kapitel 10 Die Österreichische Verteidigung Kapitel 11 Die Baltische Verteidigung Kpaitel 12 Albins Gegengambit Kapitel 13 Das Schara-Hennig-Gambit Kapitel 14 Der verzögerte Stonewall
TEIL III Indische Spezialitäten Kapitel 15 Snake-Benoni Kapitel 16 Der Geier Kapitel 17 Das Fajarowicz-Gambit Kapitel 18 Das Budapester Gambit Kapitel 19 Black Knight's Tango
Literaturverzeichnis
Spielerverzeichnis
Index
.
.
Sandra Uschtrin: «Handbuch für Autorinnen und Autoren»
.
Kompendium des deutschsprachigen Literaturbetriebes
Walter Eigenmann
.
 «Informationen und Adressen aus dem deutschen Literaturbetrieb und der Medienbranche», so lautet der Untertitel des neuen «Handbuchs für Autorinnen und Autoren», das die Münchner Verlegerin und «Federwelt»-Chefin Sandra Uschtrin in ihrem gleichnamigen Verlag zusammen mit Co-Herausgeber Heribert Hinrichs in diesem Frühsommer auf den Markt gebracht hat. Hinter dieser sachlichen Titelei verbirgt sich ein mächtiger Konvolut von über 700 Seiten, randvoll gefüllt mit Adresslisten, Tipps, Essays, Infos, Internet-Links, Reportagen, Autoren-Beiträgen, Abhandlungen, Musterverträgen, Schreibhilfen u.v.a. rund um den längst unüberblickbar gewordenen Themen-Komplex «Veröffentlichung von Literatur».
«Informationen und Adressen aus dem deutschen Literaturbetrieb und der Medienbranche», so lautet der Untertitel des neuen «Handbuchs für Autorinnen und Autoren», das die Münchner Verlegerin und «Federwelt»-Chefin Sandra Uschtrin in ihrem gleichnamigen Verlag zusammen mit Co-Herausgeber Heribert Hinrichs in diesem Frühsommer auf den Markt gebracht hat. Hinter dieser sachlichen Titelei verbirgt sich ein mächtiger Konvolut von über 700 Seiten, randvoll gefüllt mit Adresslisten, Tipps, Essays, Infos, Internet-Links, Reportagen, Autoren-Beiträgen, Abhandlungen, Musterverträgen, Schreibhilfen u.v.a. rund um den längst unüberblickbar gewordenen Themen-Komplex «Veröffentlichung von Literatur».

Sandra Uschtrin
So vielfältig wie sein Gegenstand ist denn auch das Inhaltsverzeichnis des dicken Ratgebers – um daraus nur ein paar der interessantesten Stichworte zu zitieren: «Schriftsteller-Werden und -Bleiben», «Unverlangt eingesandte Manuskripte», «Warum so viele Lyrik-Manuskripte abgelehnt werden», «Regionalkrimis», «Verlage mit historischen Romanen», «Literaturwettbewerbe», «Preise & Stipendien», «Books on demand», «Zuschuss-Verlage», «Heftromane», «Literatur-Zeitschriften», «Schreiben fürs Theater», «Hörspiel-Literatur», «Kontaktaufnahme, Anschreiben, Exposés», «Ausbildung für SchriftstellerInnen», «Geld verdienen mit Literatur», «Literatur-Marketing», «Autorenrechte», «Literarische Einrichtungen», «Übersetzungen», «Musterverträge», etc.

Sandra Uschtrins «Handbuch» geht in sein 25. Jahr – ein deutliches Indiz für das ungebrochene Interesse, das ihm inbesondere Literatur-Debütierende entgegenbringen. Doch auch erfahreneren Schreibenden hat der sowohl layouterisch wie buchbinderisch sorgfältig und ansprechend gefertigte Band mit seinem riesigen Adressen-Pool eine Menge zu bieten. Sehr nützliche Edition!
Sandra Uschtrins «Handbuch» geht mit dieser siebten und abermals deutlich ausgebauten bzw. erneuerten Auflage bereits in sein 25. Jahr – ein deutliches Indiz für das ungebrochene Interesse, das ihm inbesondere Debütierende im deutschsprachigen Literaturbetrieb entgegenbringen. Doch auch erfahreneren Schreibenden hat der dicke, sowohl layouterisch wie buchbinderisch sehr sorgfältig und ansprechend gefertigte Band mit seinem riesigen Adressen-Pool sowohl aus dem Print- wie elektronischen Bereich eine Menge zu bieten. Abgerundet wird das Kompendium durch ein umfangreiches 32-seitiges Register. Sehr zu empfehlen für alle Autorinnen und Autoren – und jene, die’s noch werden wollen. ■
Sandra Uschtrin / Heribert Hinrichs, Handbuch für Autorinnen und Autoren – Informationen und Adressen aus dem deutschen Literaturbetrieb und der Medienbranche, Uschtrin Verlag, 704 Seiten, ISBN 978-3932522147
.
Inhaltsverzeichnis (pdf)
.
Das komplette 32-seitige Register (pdf)
.
Duden: «Wer hats gesagt?» – Zitate & Redewendungen
.
«Jetzt geht mir ein Licht auf»
Walter Eigenmann
.
 Es gibt Zitate und Redensarten, die kennt einfach jeder (oder sollte jeder kennen): Beispielsweise ist «Errare humanum est» (Hieronymus: Briefe), «Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach» (Bibel: Matthäusevangelium), «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker» (Nietzsche: Götzen-Dämmerung), «In vino veritas» (Alkaios: Fragmente) «Liebe macht blind» (Platon: Dialoge), «Wie sag ich’s meinem Kinde?» (Deutscher Aufklärungsfilm 1970) oder «Es geht mir ein Licht auf» (Hiob & Psalm 97) so häufig in aller Munde, dass buchstäblich vom «Volksmund» geredet werden kann.
Es gibt Zitate und Redensarten, die kennt einfach jeder (oder sollte jeder kennen): Beispielsweise ist «Errare humanum est» (Hieronymus: Briefe), «Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach» (Bibel: Matthäusevangelium), «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker» (Nietzsche: Götzen-Dämmerung), «In vino veritas» (Alkaios: Fragmente) «Liebe macht blind» (Platon: Dialoge), «Wie sag ich’s meinem Kinde?» (Deutscher Aufklärungsfilm 1970) oder «Es geht mir ein Licht auf» (Hiob & Psalm 97) so häufig in aller Munde, dass buchstäblich vom «Volksmund» geredet werden kann.
Weniger geläufig im Leben neuzeitlicher Gesellschaften sind da schon Wendungen wie «Im Anfang war die Tat» (Bibel: Johannesevangelium), «Kritik des Herzens» (Wilhelm Busch: Gedichte), «Cogito ergo sum» (Descartes: Principia philosophiae), «Getretner Quark wird breit, nicht stark» (Goethe: Westöstlicher Diwan) oder «Non liquet» (Cicero: Reden). Und vollends unbekannt sind heutzutage solche einst sehr gebräuchlichen Zitate wie «Es war die Nachtigall und nicht die Lerche» (Shakespeare: Romeo und Julia), «Friede den Hütten! Krieg den Palästen!» (Rosa Luxemburg: Die Russische Revolution) oder «Hic Rhodus, hic salta!» (Äsop: Fabeln).
Eine Buch-Neuheit in der Reihe «Allgemeinbildung», die 500 solcher berühmten Zitate und Redewendungen von Religionsstifter Jesus («Ich bin das A und O») über Revolutionär Lenin («Die Wahrheit ist immer konkret») bis hin zu Trainer Trapattoni («Ich habe fertig!») versammelt, präsentiert nun die deutsche Duden-Redaktion. Unter dem Titel «Wer hats gesagt?» klärt sie dabei Herkunft bzw. Quellen der Wendungen auf, erläutert ihren tradierten Gebrauch, geht nötigenfalls auf ihre weiterführende Bedeutung im modernen Alltag ein, streift auch etwaige semantische Transformationen im Laufe der Jahrhunderte.
Über Details solcher Zusammenstellungen, zumal bei deren erklärtem Ziel, «Kluges und glaubwürdiges Zitieren» zu erleichtern, lässt sich immer streiten, und ob beispielsweise die Sprachprobleme eines Fußballtrainers (s.o.) – so witzig und bekannt das ist – tatsächlich in den Olymp der «500 berühmten Zitate und Redewendungen» eines renommierten Duden-Verlages gehievt werden sollen, ist Geschmacksache. Auch wünschte man dem immerhin 224-seitigen Band über seine simple alphabetische Reihung hinaus eine zumindest grobe thematische Gliederung. Und schließlich hätte der lexikalischen «Bleiwüste» dieses Buches die eine oder andere Illustration gut getan.
Aber das sind unterm Strich Marginalien, für die eine breite und abwechslungsreiche Zitaten-Palette, redaktionell sehr sorgfältig recherchierte sowie detailliert ausgearbeitete Definitionen, Quellenhinweise und semantische Verknüpfungen mehr als entschädigen. Wer also seine Allgemeinbildung in Sachen Zitate erweitern, die eine oder andere entfallene Wendung neu recherchieren oder einfach seinen bildungsbürgerlichen Wortschatz zwecks Angeberei etwas auf Vordermann bringen will, kommt mit dieser Duden-Novität voll auf seine Kosten. ■
Duden: Wer hats gesagt? – Berühmte Zitate und Redewendungen, 224 Seiten, ISBN 978-3-411-74131-1
.
Leseproben
.
.
.
Gerhard Josten (Hg.): «A Study Apiece»
.
Faszinierender Blick in die Studienschach-Küche
Walter Eigenmann
.
 Der 72-jährige Kölner Schachkomponist, -historiker, -feuilletonist und -schiedsrichter Gerhard Josten ist in der internationalen Schachszene seit Jahren eine ebenso markante wie produktive Persönlichkeit. Seinen Arbeiten, Büchern, Reportagen und Untersuchungen rund ums vielseitig schillernde Thema «Schach» begegnet man in Schachzeitungen wie der Rochade Europa, auf Problemschach-Portalen wie der Schwalbe und bei anderen internationalen Turnier-Ausrichtern, in zahlreichen Monographien, ja sogar in einem gestandenen Schach-Roman.
Der 72-jährige Kölner Schachkomponist, -historiker, -feuilletonist und -schiedsrichter Gerhard Josten ist in der internationalen Schachszene seit Jahren eine ebenso markante wie produktive Persönlichkeit. Seinen Arbeiten, Büchern, Reportagen und Untersuchungen rund ums vielseitig schillernde Thema «Schach» begegnet man in Schachzeitungen wie der Rochade Europa, auf Problemschach-Portalen wie der Schwalbe und bei anderen internationalen Turnier-Ausrichtern, in zahlreichen Monographien, ja sogar in einem gestandenen Schach-Roman.
Nun hat der umtriebige Enthusiast des Königlichen Spiels die Welt des Problemschachs um eine weitere Publikation bereichert, indem er 68(!) bekannte (und auch weniger bekannte) Autoren aus aller Welt einlud, je eine eigene Lieblingsstudie und deren Entstehungsgeschichte zu einer großangelegten Anthologie beizusteuern. Das Resultat ist ein 280-seitiges Kompendium namens «A Study Apiece» («Eine Studie pro Kopf»), das nicht nur international anerkannte Endspielschaffende und faszinierende Schach-Endspiel-Aufgaben versammelt, sondern auch sehr authentische Einblicke eröffnet in die kreative, teils auch skurile, immer aber faszinierende Werkstatt moderner Studienschöpfer.
Die Teilnehmer-Liste von Jostens umfangreicher Sammlung – das Vorwort schrieb übrigens kein geringerer als der EG-Gründer John Roycroft – liest sich dabei wie das «Who-is-who» der aktuellen internationalen Schachstudien-Szene: Lebende Legenden wie John Nunn und Pal Benkö oder Problemschach-Prominente wie Michal Hlinka, Mikhail Zinar und Jan Rusinek steuerten ihr ganz persönliches «Best-of» ebenso bei wie solche unbekannten, aber innovativen Komponisten wie Ilham Aliev, Marco Campioli, Yuri Roslov, Gheorghe Telbis oder Wouter Mees – der interessanten Köpfe wären noch einige. Natürlich kann man in solchen Anthologien immer auch ein paar wichtige Namen vermissen; so hätten meines Erachtens Kostproben verschiedener jüngerer, aber nichtsdestoweniger einflussreicher Autoren wie beispielsweise Abdelaziz Onkoud, Piotr Murdzia oder Miodrag Mladenović den Band noch zusätzlich aufgewertet.
Und wenn wir schon bei den Schönheitsfehlern sind: Schade, dass den jeweiligen Hauptdiagrammen nicht die gleiche grafische Sorgfalt zuteil wurde, wie sie ansonsten den Band auszeichnet; solche grobpixeligen Illustrationen – wohl durch Vergrößerung entstanden – dürften eigentlich nicht mehr vorkommen im Zeitalter hochtechnisierten Desktop-Publishings, erst recht nicht bei einem stattlichen Buchpreis von knapp 30 Euro. Ansonsten ist «A Study Apiece» aber ein layouterisch zwar einfach, aber durchaus ansprechend gestalteter, auch buchbinderisch solide gefertiger Band mit zahlreichen Diagrammen, Fotos und viel Varianten- wie Fließtext; alles in allem sein Geld sicher wert.
Die von den 68 Buchautoren präsentierten Aufgaben kommen so vielfältig-heterogen daher wie die Biographien ihrer Schöpfer bzw. die Geschichte(n) ihrer Entstehung. Neben simplen Sechsteinern, die im Zeitalter der Datenbanken keinerlei endspieltechnische, wohl aber ungebrochen ästhetisch-künstlerische Bedeutung haben (wie obenstehendes Beispiel von J.M. Loustau zeigt), stehen hochkomplexe Patt-Konstrukte wie z.B. Per Olins Stück (rechts), und natürlich sind innerhalb der beiden Grundforderungen, die eine richtige Endspiel-Schachstudie immer stellt – nämlich entweder a) «Weiß zieht und gewinnt» oder b) «Weiß zieht und hält remis» -, zahlreiche «klassischen» Motive der Studien-Geschichte und deren gewachsene «Studienschulen» anzutreffen.
Wie stehen eigentlich die heutigen Studien-Komponisten zum Problemfeld «Computer»? Charakteristisch hierzu scheint das Statement des bedeutenden neuseeländischen Autors Emil Melnichenko zu sein, der (S.153ff) schreibt: «Today, I usually check my work with a computer, but I never totally trust the machine, and I certainly never use it to garner ideas, because I do not know how, nor do I enjoy the human computer interface, in fact, I find it tedious, distracting and contra the artistic spirit that employs serendipity as muse.» Und weiter stellt Melnichenko klar, dass er zwar um die Präzision der sog. EGTBs wisse, aber trotzdem an der Jahrhunderte alten Konvention festhalte: «Computer literate composers are welcome to make use of their power but as a dinosaur I still remain attached to the primitive and manual method of composing that employs a tangible medium I have enjoyed since youth, in preference to one I personally find self defeating.»

Drei Pioniere der Computer-Endspiel-Forschung: Ken Thompson, Eugene Nalimov, Stefan Meyer-Kahlen (v.o.n.u.)
Selbstverständlich ist solches Selbstverständnis des «artistic spirit» zu respektieren, gleichwohl muss leise angemerkt werden, dass in den einschlägigen Studien-Datenbanken mit ihren abertausenden von Aufgaben zahlreiche – teils bekannte, ja als «historisch wertvoll» deklarierte – Stücke lagern, deren Lösungszüge das doppelt vergebene Ausrufezeichen keineswegs verdienen, sondern vielmehr von dem ach so tumben Computer unbarmherzig als nebenlösige oder gar inkorrekte Kompositionen entlarvt werden. Heutzutage tut ein Studien-Autor also gut daran, seine Vielzüger- bzw. -steiner dem finalen Röntgenlabor seines heimischen Silikanten und dann erst dem internationalen Schiedsrichter zuzustellen… (Inwieweit auch «A Study Apiece» fehlerhafte Aufgaben enthält, habe ich nicht en détail untersucht; anzunehmen ist aber, dass Herausgeber (und Computerschach-Sympathisant) Josten diesbezüglich seine Hausaufgaben gemacht hat).
Nichtsdestoweniger soll in diesem Zusammenhang eine warnende Stellungnahme des bulgarischen Schiedsrichters Petko Petkov nicht unterschlagen werden (S.14ff): «Because at present we have many bad examples with using of ‘Nalimov’s databases’ I think that this threat to endgame genre is very serious an can be fatal in near future when this databases can embrace settings with 7 pieces on the board. But after that can follow also envelop of 8,9 etc. positions. If the Nalimov’s tables give all positions with 7 pieces […] the ‘moving-formula’ for the many endgames can be: x+7 where all new themes and ideas the composer should demonstrate only in this ‘introduction’ with ‘x’ pieces, because after it all is without any sense banal known. As professional lawyer I should say that at present very important for the world endgame – composition ist the question for the copyrights in the light of existence of Nalimov’s databases. If after x moves we receive a position with 6 pieces which is computer – Nalimov’s position the main question ist obviously how fare are original these x moves as an introduction…»
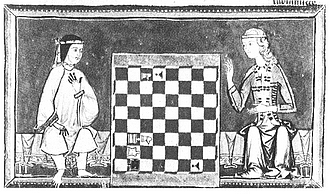
Schach-Studien kennt die Welt schon seit alters her; hier ein Detail aus dem «Buch der Spiele» von König Alfons dem Weisen (13. Jh.)
Die je spezifische Art, wie die 68 Co-Autoren des Bandes ihre Werke vorstellen, wirft ein bezeichnendes Licht auf ihre Komponisten-Persönlichkeit: Einigen wie z.B. Javier Ibran genügen zwei Seiten, zwei Diagramme, zwei Varianten und ein paar Sätze, um ihre Lieblingsposition in Szene zu setzen, andere wie z.B. Siegfried Hornecker erläutern ihren kompositorischen Höhenflug auf fünf und mehr Seiten mittels ausgiebiger Verbalität, wieder andere (z.B. Daniel Keith) stürzen sich variantenverliebt in geradezu Hübnersche Abspiel-Orgien.
Dieser immer sehr subjektive, für den Leser interessant und authentisch wirkende Zugriff aller Komponisten auf ihre ganz persönliche «Top-One»-Stellung ist die große Stärke von «A Study Apiece». Gerhard Josten legt mit dieser Endgame-Anthologie keine erschlagende Fülle von hunderten Aufgaben vor, sondern ein fast intimes, autobiographisches Kaleidoskop der Herstellungsverfahren und der individuellen Motivation der Studien-Schaffenden. In dieser betont persönlich-offenen Art des Einblicks in die internationale Werkstatt der Endspiel-Komposition sucht dieses Schachbuch von Herausgeber Gerhard Josten seinesgleichen. (Selbstverständlich ist der Band bei solch internationaler Autorenschaft komplett in englischer Sprache gehalten). Eine sehr willkommene, die bestehende Problem-Bibliothek bereichernde Buch-Edition. ■
Gerhard Josten (Hg.), A Study Apiece (68 Studien-Autoren und ihre Lieblingsaufgaben – engl.), Edition Jung Homburg, 280 Seiten, ISBN 978-3-933648-38-9
.
.
.
.
________________________________________________________
.
English Translation
(Thanks to John Rice/UK) .
A fascinating look into the world of the chess study
.
72-year-old Gerhard Josten, from Cologne, is a chess composer, historian, feature-writer and judge. For many years he has been both a notable and at the same time a productive figure on the international chess scene. His work, his books, reports and investigations concerning the multifaceted and enigmatic subject that is “chess” can be found in chess magazines such as Rochade Europa, in chess-problem outlets like Die Schwalbe and at other international tourney events, in numerous monographs and even in a mature chess novel.
Now this energetic enthusiast of the royal game has enriched the world of chess composition with another publication. He invited each of 68 (!) well-known (and less well-known) composers from all over the world to contribute one favourite study from their own output, along with details of its genesis, to be included in a wide-ranging anthology. The result is a 280-page volume entitled “A Study Apiece” which, with its assembly of internationally recognised names, provides not only a collection of absorbing chess endgame-studies but also a genuine insight into the creative and sometimes comical yet always fascinating workshop of present-day study-composers.
The list of contributors to Josten’s extensive collection, with its preface written by no less a figure than EG-founder John Roycroft, reads like a “Who’s who” of the current international chess-study scene. Living legends such as John Nunn and Pal Benkö or leading figures of compositional chess like Michal Hlinka, Mikhail Zinar and Jan Rusinek sent in their very personal “best” selections, alongside lesser known yet innovative composers such as Ilham Aliev, Marco Campioli, Yuri Roslov, Gheorghe Telbis or Wouter Mees and a number of other interesting figures. Of course it’s always possible with such anthologies to regret the absence of important names; in my view the inclusion of samples from various younger but no less influential composers such as Abdelaziz Onkoud, Piotr Murdzia or Miodrag Mladenovic, to name just a few, would have appreciably enhanced the value of the work.
And while we’re on the subject of shortcomings, it’s a pity that the main diagrams were not accorded the graphical care that characterises the rest of the book. Such unrefined illustrations, doubtless enlargements, have no place in the digital age of desktop publishing, especially not in a book with a cover price as high as 30 Euros. But otherwise “A Study Apiece”, with its admittedly simple layout, is attractively produced in a robust binding, with numerous diagrams and photos, and text typeset both for variation-play and for continuous reading. All in all it’s certainly worth the asking price.
The studies of the 68 contributors appear just as varied as the biographies of their composers and the details of the works’ genesis. Alongside simple 6-piece items, which in these days of endgame databases have no technical significance but still display a certain aesthetic artistry (like Loustau’s diagrammed example), one finds highly complex stalemate constructions such as Per Olin’s study (diagrammed). And of course within the two basic stipulations found in all genuine chess endgame studies, viz. (a) White to play and win or (b) White to play and draw, one comes across innumerable “classical” features from the history of studies and the various study-schools that have arisen.
What is the attitude of today’s study-composers to the thorny question of computers? This statement (p.153ff) from the eminent composer from New Zealand, Emil Melnichenko, seems typical: “Today, I usually check my work with a computer, but I never totally trust the machine, and I certainly never use it to garner ideas, because I do not know how, nor do I enjoy the human computer interface, in fact, I find it tedious, distracting and contra the artistic spirit that employs serendipity as muse.” And Melnichenko goes on to affirm that while he knows about the precision of so-called EGTBs he still sticks to the centuries-old convention: “Computer-literate composers are welcome to make use of their power but as a dinosaur I still remain attached to the primitive and manual method of composing that employs a tangible medium I have enjoyed since youth, in preference to one I personally find self-defeating.”
Naturally this awareness of the “artistic spirit” commands respect. At the same time it must be observed that in the relevant study databases with their many thousands of compositions there are numerous items stored, in some cases well-known and in others deemed to be “of historical value”, whose solutions contain moves that in no way merit the double exclamation-mark but which are mercilessly revealed by the crass computer to be cooked or completely insoluble. Nowadays a composer is well advised to give his study, if it has many moves and/or pieces, to the x-ray lab of his personal silicon-friend before submitting it to the international judge… (I have not investigated in detail whether “A Study Apiece” contains faulty compositions; but it is to be assumed that editor Josten, who is by no means averse to computer-chess, has done his homework in this regard.)
Nevertheless a note of caution is sounded in this connection by Bulgarian judge Petko Petkov (p.14ff), and it deserves a mention: “Because at present we have many bad examples with using of ‘Nalimov’s databases’ I think this threat to endgame genre is very serious and can be fatal in near future when this databases can embrace settings with 7 pieces on the board. But after that can follow envelop of 8, 9 etc. positions. If the Nalimov’s tables give all positions with 7 pieces […] the ‘moving-formula’ for the many endgames can be: x+7, where all new themes and ideas the composer should demonstrate only in this ‘introduction’ with ‘x’ pieces, because after it all is without any sense banal known. As professional lawyer I should say that at present very important for the world endgame-composition is the question for the copyrights in the light of existence of Nalimov’s databases. If after x moves we receive a position with 6 pieces which is computer-Nalimov’s position, the main question is obviously how fare are original these ‘x’ moves as an introduction…”
The individual manner in which the 68 co-authors of the book present their work casts a distinctive light on their composing personality. Some, like e.g. Javier Ibran, need no more than 2 pages, 2 diagrams, 2 variations and a few sentences to tell us everything about their chosen position. Others, e.g. Siegfried Hornecker, spread themselves over 5 or more pages of elaborate verbosity, while others again (e.g. Daniel Keith) take delight in plunging into an orgy of variations in a manner worthy of Hübner.
The way each composer approaches his personal favourite position is always very subjective and interesting to the reader, and it conveys a truly genuine impression. This is the great strength of “A Study Apiece”. In this endgame anthology Gerhard Josten does not offer a deadening mass of hundreds of studies, but an almost intimate, autobiographical kaleidoscope of study-composers’ processes of creation and individual motivation. This work by editor Gerhard Josten provides an emphatically personal insight into the international workshop of endgame composition, and as such it is unlike any other chess book. (Of course with contributions on an international scale the book is in English throughout.) A very welcome publication that enriches the existing library of chess composition. (Walter Eigenmann) ■
.
.
Probeseiten
.
.
.
.
Martina Freytag: «Einsingen – allein und im Chor»
.
Effizientes Warm-up beim Gesangstraining
Walter Eigenmann
.
 In früheren Zeiten des (Laien-)Chormusizierens rangierte das professionell gestaltete Warm-up, das effiziente chorische Einsingen, die Disponierung von Körper und Stimmapparat für den niveauvollen Chorgesang sowohl bei der Dirigenten- wie bei der Sängerschaft ziemlich weit hinten – als lästige Pflichtübung vor dem «eigentlichen Musizieren», die es in maximal drei Minuten hinter sich zu bringen galt. In der Nachkriegszeit, auch im Zuge der rasant wachsenden stimmphysiologischen, chordidaktischen und atemmedizinischen Erkenntnisse schlug das Pendel landauf, landab in die andere Richtung aus: Einsingen wurde sogar bei (ggf. ambitionierteren) Laienchören zur halbstündigen Stimmbildung ausgeufert, quasi als Selbstzweck zelebriert und unverhältnismäßig aufgebläht, mit viel gesangspädagogischem (Theorie-)Ballast im Schlepptau.
In früheren Zeiten des (Laien-)Chormusizierens rangierte das professionell gestaltete Warm-up, das effiziente chorische Einsingen, die Disponierung von Körper und Stimmapparat für den niveauvollen Chorgesang sowohl bei der Dirigenten- wie bei der Sängerschaft ziemlich weit hinten – als lästige Pflichtübung vor dem «eigentlichen Musizieren», die es in maximal drei Minuten hinter sich zu bringen galt. In der Nachkriegszeit, auch im Zuge der rasant wachsenden stimmphysiologischen, chordidaktischen und atemmedizinischen Erkenntnisse schlug das Pendel landauf, landab in die andere Richtung aus: Einsingen wurde sogar bei (ggf. ambitionierteren) Laienchören zur halbstündigen Stimmbildung ausgeufert, quasi als Selbstzweck zelebriert und unverhältnismäßig aufgebläht, mit viel gesangspädagogischem (Theorie-)Ballast im Schlepptau.
Heute ist die gängige Praxis, wie man sich bei verantwortlichen Landes-, Regional- und Kreis-Chordirigenten umhören bzw. den einschlägigen Lehrkanon der Musikhochschulen konsultieren kann, eine pragmatische: Eingesungen wird nach der Devise «So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig». Angesichts immer knapper Probenzeit bzw. überfrachteter oder/und anspruchsvoller moderner Lied-Programme auch bei Amateurchören gewiss die praktikabelste Losung.
Den grundsätzlich gleichen, betont praxisorientierten Ansatz verfolgt auch eine neue Einsing-«Fibel» namens «Einsingen – allein und im Chor» der Thüringer Gesangspädagogin, Dozentin und Komponistin Martina Freytag. In 40 detailliert abgehandelten, mit viel Noten- und Zeichen-Grafik unterstützten, singtechnisch gut nachvollziehbaren Lektionen gibt die bekannte Gesangsexpertin lernpsychologische Hinweise, setzt gezielte Einzeltechniken auseinander, illustriert mit betont bildreicher Sprache die physiologischen Voraussetzungen und Prozesse, animiert zum entspannten Umgang mit dem gesamten menschlichen Singapparat.
Gewiss, Freytags Vokabular, überhaupt ihr ganzer theoretischer wie psychologischer Zugang zur Materie mag für «Uneingeweihte», möglicherweise gar erstmals in dieser Konzentration mit dem Problemfeld «Einsingen» Konfrontierte (zumal aus dem Amateur-Lager) etwas gewöhnungsbedürftig sein. Betont «psychologisierende» Animierungen wie beispielsweise die folgende lesen sich prima vista eher als Beschwörungsformeln denn als präzise Praxisanweisung:
«In der kurzen Einatmung bläst sich der Atemgürtel wie ein Schwimmring blitzartig um den Bauch auf. Er trägt Sie während der Gesangsmelodie, lockert sich ein wenig in der Atempause am Ende der Melodie, um sich in der nächsten Einatmung genauso zackig zu füllen und Sie stabil durch die Tonfolge zu tragen. Singen Sie die Melodie wie eine Honig sammelnde Biene, die ihr regsames und unermüdliches Tun mit einem Summen begleitet. Der ganze Bereich um Mund und Nase wird zum klingenden Bienenrüssel, der schwingt und vibriert. Neugierig, ob in dieser oder jener Blüte noch Honig zu finden ist, fordern Sie sich selbst zu nicht ablassender Intensität.» (S.43)

Zwei «klassische» Mundstellungen der Gesangs-Pädagogik: Die «Sängerschnute» (oben) und der «Sängerbiss»
Gleichwohl entbehren solche empathischen Sentenzen keineswegs einer gewissen intuitiven Suggestion, die in einer konkreten Übesituation zielführender sein kann als trocken-distanziertes Theoretisieren, sobald sich der (singende) Leser im thematischen Spektrum der Freytagschen Terminologie ein bisschen eingelebt hat. Auf alle Fälle gilt uneingeschränkt, wie alle chorsängerische Erfahrung zeigt, die Einschätzung der Autorin: «Seien Sie positiv eingestellt in jedem Moment, in dem Sie singen. […] Jede seelenlos gesungene Singübung kann letztendlich ungesungen bleiben, weil sie Ihnen keinen Fortschritt in Ihrer stimmlichen Entwicklung bringt.»
Selbstverständlich belässt es die vielseitig tätige Gesangspädagogin nicht beim enthusiastischen Schildern «nützlicher Emotionalitäten». Vielmehr ist jede ihrer 40 Lektionen fachlich fundiert auf ein bestimmtes stimmliches Anliegen fokussiert, methodisch einleuchtend aufgebaut, trägt dabei den beteiligten physiologischen Prozessen Rechnung und flankiert illustrativ mit Gesichts- und Körperabbildungen ebenso wie mit zahlreichen Notenbeispielen. Aufgebaut sind dabei fast alle Übungen nach einem gleichbleibenden Muster.
Am Anfang steht jeweils eine Notenzeile, welche das stimmliche Anliegen vorstellt:
Daran schließen sich Ausführungen zu den eigentlichen stimmtechnischen Aspekten der jeweiligen Übung an:
Im dritten Teil offeriert die Autorin Gedanken, «die den Ausdruck und das Gefühl während des Singens darstellen lassen bzw. vertiefen können».
Viertens gibt’s jedesmal passende «Klavierpattern», die als ausgeschriebene Begleitparts auch auf der beiliegenden Compact Disc zu finden sind und in verschiedenen Tonarten «durchexerziert» werden können:
(Die komplett ausnotierten Klavierstimmen sind als PDF-Datei ebenfalls auf der CD zu finden). Apropos mitgelieferte Audio-CD: Sie ist ein nützlicher, ja eigentlich integrativer Bestandteil für all jene, die sich die Übungen nicht bei Dirigent/Chor, sondern alleine erarbeiten wollen.
Vor diesem eigentlichen Praxis-Teil, der mit seinen 40 gezielten Einheiten den Löwenanteil des Bandes ausmacht, finden sich auf knapp vierzig Seiten, quasi als Einführung in die facettenreiche Welt der menschlichen Stimme, die theoretischen und technischen Voraussetzungen des qualitätsvollen Singens: «Stimmsitz», «Registerausgleich», «Resonanz», «Vokalausgleich» oder «Intonation» sind hier u.a. die in Gesangskreisen weitgehend bekannten Stichwörter.
Zusammengefasst: Martina Freytags «Einsingen» ist eine sehr nützliche, ganz auf die Praxis zugeschnittene Anthologie von unmittelbar anwendbaren und meist auch unmittelbar wirkungsvollen singtechnischen Unterweisungen, die «Geist und Körper» ganzheitlich erfassen wollen, um dem/r Sänger/in entspannend und gleichzeitig anregend zu einer optimalen stimmlichen Disposition zu verhelfen. Der Band ergänzt interessant das bereits auf dem Markt befindliche Bücher-Angebot zur Thematik, und wer die bewusst «phantasievolle Sprache» der engagierten Autorin nicht scheut, sondern sich – durchaus auch als Dirigent/in – auf diese Form der individuellen Motivation und «Emotionalisierung» des Singübens einlässt, wird einigen Nutzen für den individuellen oder chorischen Gesang daraus ziehen können. ■
Martina Freytag, Einsingen allein und im Chor, Mit 40 Gesangsübungen, Audio-CD mitgeliefert, 112 Seiten, Bosse Verlag, ISBN 978-3764926489
.
.
H.-J. Neumann / H. Eberle: «War Hitler krank?»
.
Das Urteil: Vollumfänglich schuldfähiger Verbrecher
Walter Eigenmann
.
 Lange Jahre stand, angesichts von Millionen Kriegs- und Mord-Toten während des deutschen «Dritten Reiches», für viele fest: Nur ein Wahnsinniger, nur ein hoffnungslos kranker Psychopath konnte solche Zerstörung, solch kollektives Leid, solch abgrundtiefe Unmenschlichkeit über die ganze Welt ausbreiten, und schon lange vor Kriegsende, also vor dem totalen Zusammenbruch der Deutschen und ihrer Hitlerei, fragten sich die ob solch unfassbarer Barbarei Entsetzten öffentlich oder insgeheim: Ist/War Hitler krank? Wurde die weltweit wütende Wehrmacht von einem Drogenabhängigen geführt? Hat ein krankes Hirn die Abschlachtung von Millionen Menschen befohlen? War Auschwitz womöglich «nur» die Ausgeburt eines perversen Morbiden, der für seinen wahnhaften Zustand «eigentlich gar nichts konnte?»
Lange Jahre stand, angesichts von Millionen Kriegs- und Mord-Toten während des deutschen «Dritten Reiches», für viele fest: Nur ein Wahnsinniger, nur ein hoffnungslos kranker Psychopath konnte solche Zerstörung, solch kollektives Leid, solch abgrundtiefe Unmenschlichkeit über die ganze Welt ausbreiten, und schon lange vor Kriegsende, also vor dem totalen Zusammenbruch der Deutschen und ihrer Hitlerei, fragten sich die ob solch unfassbarer Barbarei Entsetzten öffentlich oder insgeheim: Ist/War Hitler krank? Wurde die weltweit wütende Wehrmacht von einem Drogenabhängigen geführt? Hat ein krankes Hirn die Abschlachtung von Millionen Menschen befohlen? War Auschwitz womöglich «nur» die Ausgeburt eines perversen Morbiden, der für seinen wahnhaften Zustand «eigentlich gar nichts konnte?»
Dieser Frage gehen nun, nach einigen bisherigen anderen, thematisch ähnlich gelagerten Publikationen, die beiden deutschen Autoren Prof. Dr. Hans-Joachim Neumann (Medizinhistoriker & Pathograph) und Prof. Dr. Henrik Eberle (Historiker) in einem «abschließenden Befund» unter dem Titel «War Hitler krank?» nach.
Auf über 300 Seiten breiten dabei die zwei Wissenschaftler Zeit- und aktuell recherchierte Dokumente aus: Medizinische Gutachten, pharmakologische Analysen, Zeitzeugen-Gespräche, Tagebücher, Befehls-Unterlagen, Arzt-Berichte, u.v.a. Und Seite um Seite demontieren die Autoren den ebenso langlebigen wie allen betroffenen Schuldigen zupassekommenden Mythos von Hitler als einem hinfälligen Psychopathen im Bunker der Reichskanzlei, der von seinem Leibarzt Morell «kaputtgespritzt» worden sei.
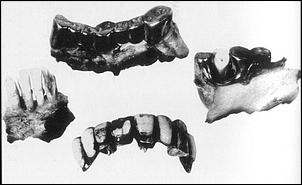
Unmittelbar nach Kriegsende exhumierten sowjetische Offiziere Hitlers verbrannte Überreste und stellten die Echtheit anhand seiner Zähne fest.
Denn zwar bestreiten Neumann und Eberle natürlich nicht, dass Hitler unter verschiedenen Erkrankungen litt (u.a. Augen- und Hals-/Nasen-Probleme, psychosomatische Verdauungs-Beschwerden, Bluthochdruck, Koronarsklerose, später Parkinson, evtl. Medikamenten-Missbrauch), aber die wegweisenden Entscheidungen traf Hitler schon früh, als gesunder Mensch, und krankheitsbedingt war, wie die Buchautoren nachweisen, kein einziger seiner zahllosen destruktiven Befehle. Auch für eine schuldmindernde Beeinträchtigung infolge psychopathologischer Erkrankungen fehlt jeder wissenschaftlich haltbare Beweis, wie Neumann und Eberle dokumentieren.
Die beiden Pathographen wörtlich: «Die Konstellation seiner Familiengeschichte teilten Millionen Deutsche. Ein dominierender, möglicherweise gewaltätiger Vater und eine überfürsorgliche, vielleicht zu sehr liebende Mutter waren der Normalfall in einem Haushalt der vorletzten Jahrhunderte. Alle anderen exogenen, also von außen verursachten seelischen Beeinträchtigungen gehören in das Reich der Mythologie und der vorsätzlichen Lüge. […]

Fast das gesamte deutsche Volk jubelte seinem Führer begeistert zu (Video-Dokument: «Adolf Hitler spricht im Berliner Sportpalast»)
Hitler hasste zwar, war aber immer in der Lage, seinen Wunsch nach Vernichtung der Juden mit den Vorstellungen der Gesellschaft zu synchronisieren. Gerade die zahlreichen taktischen Wendungen – etwa der Hitler-Stalin-Pakt mit der jüdisch-bolschewistischen Sowjetunion – zeigen die enorme Flexibilität seines Handelns.

Hitler im März 1945 an der Ostfront in einer Lagebesprechung. Er war gezeichnet von seiner Parkinson-Krankheit und konnte nicht mehr länger als eine halbe Stunde stehen; die zitternde linke Hand ist unter dem Kartentisch verborgen. Neumann&Eberle: «Seine geistigen Fähigkeiten wurden durch die Krankheit nicht beeinträchtigt.»
So zynisch es klingt: Alle Verbrechen, die er anordnete und ermöglichte, der Völkermord an den Juden, die Ermordung von Sinit und Roma, Massentötungen von Geisteskranken, sind durch sein Agieren in den gesellschaftlichen Handlungs-Spielräumen erklärbar. […] Die wirklichen Ursachen für diese Verbrechen sind in der deutschen Gesellschaft zu suchen, in ihrer Geistesgeschichte und den sozialen Zusammenhängen.»
Neumann und Eberle kommen nach ihrem 320-seitigen Report denn auch zu einem ebenso eindeutigen wie abschließenden Befund: «Der Krieg wurde nicht geführt, und die Juden wurden nicht vernichtet, weil Hitler krank war, sondern weil die meisten Deutschen seine Überzeugungen teilten, ihn zu ihrem Führer machten und ihm folgten.» ■
Hans-Joachim Neumann & Henrik Eberle, War Hitler krank? – Ein abschließender Befund, Lübbe Verlag, 320 Seiten, ISBN 978-3-7857-2386-9
.
Leseproben
_____________________
.
Themenverwandte Links
Genese von Hitlers Vernichtungsantisemitismus – Hitler mit Parkinson-Verdacht – Der deutsche Entschluss zum Angriff auf die Sowjetunion – Hitlers Verbrechen – Hitlers Asche – Der Nürnberger Prozess – Hitler hatte nur einen Hoden – Ver-Führer und Verführte – Eva Braun, Hitlers Geliebte – Der grosse Diktator – Bis zum Untergang – Sophie Scholl – Ich war Hitlers Schutzengel – Die kollektive Unschuld – Warum die Deutschen auch heute Hitler toll finden würden – Die Lüge vom Machtantritt Hitlers – Verschwörung gegen Amerika – Holocaust-Lügner Zündel – Hitler-Verarschung mit Gerhard Polt – Hitlers Leibwächter – Hitler-Gemälde – Laut gegen Nazis – Henrik Eberle – Für eine Geschichte der Überlebenden – Blutiges Edelweiss – Die Holocaust-Industrie – The Authoritarians
.
.
Das neue Glarean-Schachrätsel
.
Schach-Kreuzworträtsel im Februar 2010
Lösung: —>(weiterlesen…)
.
.
.
Das «Glarean»-Literatur-Kreuzwortätsel
.
Literatur-Kreuzworträtsel im Januar 2010
Copyright by Walter Eigenmann / Glarean Magazin 2010
.
.
Einfach ausdrucken!
Lösung: —>(mehr…)
.
.
.
.
Schach zum 1. Adventssonntag
.
Die sechszügige Matt-Kerze
Weiß setzt in 6 Zügen matt
© Walter Eigenmann (Die Adventskerze –
Urdruck: 29. Nov. 2009 / Glarean Magazin)
Lösung hier: —> (weiterlesen…)
.
.
Halloween 2009
.
Weiß am Zug
2qkbr2/8/r1n2b1p/P2pp2B/3PP3/8/2NRRQ2/3KN3 w – – 0 1
Copyright/Urdruck: Walter Eigenmann
31. Oktober 2009 / Glarean Magazin
.
Lösung: —> (mehr…)
.
.
Advents- und Weihnachtslieder für 1 oder 2 Panflöte/n
Anzeige
«Christmas for Pan»
«Christmas for Pan» ist eine Sammlung der 22 schönsten Weihnachtslieder aus aller Welt für eine oder zwei Panflöte/n. Der Schwierigkeitsgrad bewegt sich zwischen sehr leicht bis mittelschwer. Mit Strophen-Texten zum Mitsingen. Jedes Stück kann auch solistisch gespielt werden.
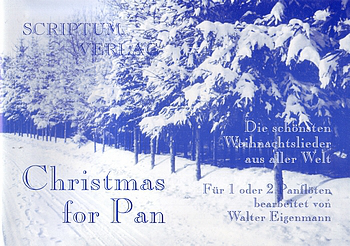 Der Inhalt: Es kommt ein Schiff geladen, Kommet ihr Hirten, Go tell it on the mountain, Jetzt sei uns willkommen, Indianisches Weihnachts-Lied, O Tannen-Baum, Andachts-Jodler, Süsser die Glocken nie klingen, Leise rieselt der Schnee, An des Paradieses Tor, In dulci jubilo, Maria auf dem Berge, S’ist für uns eine Zeit angekommen, Es glüht der Weihnachtsmorgen, Jingle bells, O du fröhliche…, Susani, Susani, Maria durch ein Dornwald ging, Les anges dans nos compagnes, Stille Nacht, Es ist ein Ros’ entsprungen, Adeste fideles.
Der Inhalt: Es kommt ein Schiff geladen, Kommet ihr Hirten, Go tell it on the mountain, Jetzt sei uns willkommen, Indianisches Weihnachts-Lied, O Tannen-Baum, Andachts-Jodler, Süsser die Glocken nie klingen, Leise rieselt der Schnee, An des Paradieses Tor, In dulci jubilo, Maria auf dem Berge, S’ist für uns eine Zeit angekommen, Es glüht der Weihnachtsmorgen, Jingle bells, O du fröhliche…, Susani, Susani, Maria durch ein Dornwald ging, Les anges dans nos compagnes, Stille Nacht, Es ist ein Ros’ entsprungen, Adeste fideles.
28 Seiten – (A5) * Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 12.- / SFR 15.-
Bei Ihrem Musikhändler
oder mit nachstehendem Bestellformular
(zuzügl. Versandkosten: SFr. 3.- (Schweiz) / Ausland gegen Vorkasse/Rechnung):
.
Bestellformular
.
.
.
Probeseite (verkleinert)
.
Jetzt mit neuer Begleit-/Karaoke-CD für Ihren Playback-Auftritt !
.
.
.
.
Oruç Güvenç: «Heilende Musik aus dem Orient»
.
«Harmonisierung von Körper und Geist»
Walter Eigenmann
.
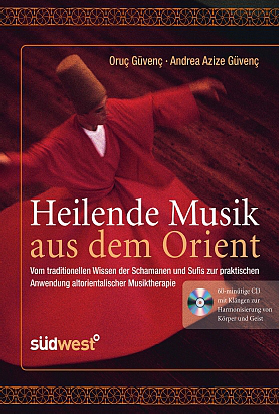 Alternative therapeutische Verfahren wie beispielsweise die (bei uns kaum bekannte) sog. «Altorientalische Musiktherapie» subsumiert der westliche Rationalist oft, wenn er wohlwollend ist, unter «Ethno», vielleicht auch naserümpfend unter «Esoterik» – oder überhaupt gleich unter «Scharlatenerie». Wissenschaftlich gestützte Musiktherapie ja – aber Schamanen-Gesänge, Uighurische Tänze, Wassermurmeln und Trommelrhythmen?
Alternative therapeutische Verfahren wie beispielsweise die (bei uns kaum bekannte) sog. «Altorientalische Musiktherapie» subsumiert der westliche Rationalist oft, wenn er wohlwollend ist, unter «Ethno», vielleicht auch naserümpfend unter «Esoterik» – oder überhaupt gleich unter «Scharlatenerie». Wissenschaftlich gestützte Musiktherapie ja – aber Schamanen-Gesänge, Uighurische Tänze, Wassermurmeln und Trommelrhythmen?
Wenn da bloß nicht die unleugbaren Erfolge der alternativen Heilmethoden wären – und das Votum zahlreicher, sehr wohl ernst zu nehmender Wissenschaftler wie beispielsweise des Direktors des Instituts für Medizinische Psychologie am Klinikum der Universität Heidelberg. Er schreibt: «In der wissenschaftlich fundierten Heilkunde Mitteleuropas wollen sich die Menschen darauf verlassen können, dass das, was man Therapie nennt, nachweislich wirkt. Man will wissen, bei welchen gesundheitlichen Störungen welche Interventionen die Heilung fördern. Dazu werden eine differenzierte Diagnostik und Versuchspläne gefordert, die es ermöglichen, die spezifischen Wirkungen therapeutischer Interventionen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollgruppen herauszufinden. […] Meiner Meinung nach ist es bei den Bemühungen um medizinische Exaktheit sinnvoll, zwischen eher körperlichen und eher seelischen Wirkungen von Musik zu unterscheiden, auch wenn man das letztlich nicht voneinander trennen kan. Ich werde skeptisch, wenn mir Musik auf Tonträgern angeboten wird, die spezifisch auf Gelenke, Entzündungen, Eingeweide, Geschlechtsteile oder Kopf und Augen wirken soll. […] Etwas anderes ist das Anliegen der Heilung im seelischen Bereich zu bewerten. Zuversicht, Lebensfreude, Entspannung, das Erleben von Demut oder innerem Frieden gehören in jedem Falle zur Heilung und zur Lebensqualität – und zwar unabhängig davon, was im Körper krank ist und vielleicht auch krank bleibt.»
Diese Sätze von Rolf Verres leiten eine neue AOM-Publikation mit dem Titel «Heilende Musik aus dem Orient» ein. Autor ist der Istanbuler Psychologe, Musiktherapeut und Sufi-Meister Dr. Oruç Güvenç, der gemeinsam mit seiner Frau, der deutschen Ergotherapeutin Andrea Güvenç – sie amtiert im Buch als Autorin wie als Türkisch-Übersetzerin – einen üppig ausgestatteten Text- und Bildband (mit Compact-Disc) in Sachen Altorientalische Musiktherapie (AOM) präsentiert.
Die klang-, tanz- und farbbeseelte Wellness-Reise des Ehepaares Güvenç beginnt tief in der Vergangenheit, bei 14’000 Jahre alten Felszeichnungen im Aserbaidschanischen Gobustan, wo tanzende Figuren auf die uralte Tradition heilender Bewegungsrituale hinweisen. Ein anderer wichtiger «urzeitlicher», noch heute sprudelnder Quell uralter Heilsysteme sind – nach Autor Güvenç – die Schamanen Zentralasiens, die Baksi: «Bei ihren Ritualen imitieren die Baksi mit der eigenen Stimme oder Instrumenten Tierstimmen und andere Klänge aus der Natur. Zudem ahmen sie die Gebärden, Haltungen und Bewegungen der Tiere nach. Dabei verwenden sie Instrumente wie Trommeln, Kilkopuz, Dombra und andere, die sie aus Naturmaterialien herstellen.»
Ausgehend von solchen Ur-Heilritualen erarbeitete sich die AOM ihre eigenen, Rhythmus-, Ton- und Bewegungs-gestützten musiktherapeutischen Verfahren. Dabei basiert die Methode von Güvenç und anderen schamanisch orientierten «Heilern» auf einigen zentralen, meistenteils durchaus auch für westliche «Ohren» (mittlerweile) nachvollziehbaren Axiomen. Dazu Güvenç: «Die AOM versteht sich nicht als direkter schamanischer Heilweg, wenngleich Elemente und Ideen aus schamanischen Praktiken Zentralasiens angewendet werden. Beispielsweise: a) Der Glaube, dass sich frühe ‘Techniken’ wie Klänge, Melodien, Rhythmen und Improvisationen über Jahrtausende bewährt haben und auch heute noch ihre Wirkung entfalten; b) Die Bewertung des inneren Erlebens, der inneren Erfahrung, als Ergänzung zur äußeren Welt; c) Die Vorstellung, dass es neben den technologischen Fähigkeiten auch ein nicht-technologisches Wissen des menschlichen Geistes gibt; d) Die Annahme, dass der Mensch von den Pflanzen, Steinen und Tieren lernen kann». In solchen spirituellen Ansätzen trifft sich offensichtlich das orientalische Denken mit jenem aus dem fernöstlichen Kulturraum; Die «Reise nach innen» ist grundlegende Voraussetzung beider Konzepte.
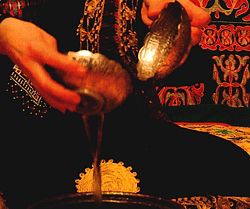
Das Element Wasser: Emotionaler Träger von Spiritualität und Beruhigung, gleichzeitig Reinigungsritual
Ein paar Ingredienzien der AOM sind zentral in der musiktherapeutischen Arbeit Güvençs: Der physische und «musikalische» Einsatz des Wassers; der Einbezug der menschlichen Stimme; die uralte Sufi-Instrumentalkultur; der Ausdruckstanz. Der kombinierte Einsatz dieser vier individuell vermittelten und erfahrenen, gezielt unter Begleitung des AOM-Leiters eingesetzten Praktiken kann laut Ehepaar Güvenç durchaus zu Trance und Ekstase führen: «Diese Trancezustände waren den Menschen in der östlichen Kultur durchaus vertraut. Sie waren gelebter Bestandteil der Riten und Rituale im Schamanen- und Sufiturm. […] Die heutige Wissenschaft sagt, dass Bewusstseinsveränderung und Trance zu den Grundfähigkeiten des Menschen gehören. Die Medizin des Orients kennt ihre heilige und heilende Wirkung schon seit langem. Erst nach und nach erkennt auch die moderne Medizin, wie sie sich diese Mechanismen zunutze machen kann, um Schmerzen zu lindern und Heilungsprozesse zu fördern.»

Der Körper als Instrument: Aufnahme von einem Sema-Ritual im Jahre 2008. Das Ritual dauerte 40 Tage und Nächte.
Mit solchen Erkenntnissen aus der eigenen musiktherapeutischen Arbeit schlägt das Ehepaar Güvenç eine Brücke zur nach wie vor kognitiv dominierten (Apparate-)Medizin des Westens. Ihr Buch wird eingefleischte Rationalisten nicht überzeugen, sondern bestenfalls in der Schublade «Interessant, aber unbewiesen» kontaminiert werden, denn der «Glaubensfaktor» als individuell zu erbringende, betont «imaginitive» Leistung des «Kranken» spielt in der AOM wie in vielen anderen therapeutischen Ansätzen (ganz gleich welcher geographischen Couleur) bekanntlich eine zentrale Rolle. Andererseits ist nicht einzusehen, warum intelligentes Therapieren neben dem ganzen okzidentalen medizinischen «Arsenal» nicht auch (nachweislich erfolgreiche) alternative Praktiken integrieren soll; hier bekäme «Ganzheitlicheit» nochmals einen neuen interessanten Bedeutungsaspekt.
Jenseits aller Theorie bekommt der Leser mit «Heilende Musik aus dem Orient» jedenfalls auch gleich den praktischen Selbstversuch inklusive detaillierte Anleitung mitgeliefert: Der reichhaltig bebilderte, bibliographisch schön gestaltete Band enthält eine 60-minütige Audio-CD der türkischen Gruppe «Tümata» (Abk. = «Türkische Musik in wissenschaftlicher Erforschung und Präsentation») mit einer Auswahl orientalischer Musik, vom schamanischen Tanz bis zu Sufi-Gesängen. Damit gerät des Ehepaars Güvenç’ «Heilende Musik aus dem Orient» zu einer sinn-lichen, seine Thematik sehr attraktiv präsentierenden Reise durch «alle Zeiten und Räume» hin zum «paradiesischen Ursprung der Musik» (Güvenç). Literaturhinweise, Sach- und Namensregister sowie ein Anhang mit Kontaktadressen und Hinweisen zu Institutionen und Ausbildungsmöglichkeiten runden den Band ab. ■
Andrea und Oruç Güvenç: Heilende Musik aus dem Orient – Vom traditionellen Wissen der Schamanen und Sufis zur praktischen Anwendung altorientalischer Musiktherapie, mit Audio-CD, 148 Seiten, Südwest Verlag, ISBN 978-3-517-08535-7
.
Leseproben
.
.
Hans Sahl: «Die Gedichte»
.
«…was sonst jeder Beschreibung spottet»
Walter Eigenmann
.
 Ein Mann, den manche für weise
Ein Mann, den manche für weise
hielten, erklärte, nach Auschwitz
wäre kein Gedicht mehr möglich.
Der weise Mann scheint
keine hohe Meinung
von Gedichten gehabt zu haben –
als wären es Seelentröster
für empfindsame Buchhalter
oder bemalte Butzenscheiben,
durch die man die Welt sieht.
Wir glauben, dass Gedichte
überhaupt erst jetzt wieder möglich
geworden sind, insofern nämlich als
nur im Gedicht sich sagen lässt,
was sonst
jeder Beschreibung spottet.
Hans Sahl, der Autor dieses Gedichtes «Memo», schrieb so in seinem zweiten zu Lebzeiten eigenhändig redigierten Lyrik-Band «Wir sind die Letzten» (1933-1975). Und die Zeilen fokussieren programmatisch, was mit Sahl einer der fruchtbarsten und zugleich am wenigsten bekannten Exil- und Nachkriegs-Lyriker deutscher Sprache zu sagen hatte. Sein lyrisches Schaffen legt nun der Luchterhand Verlag in einer Gesamtausgabe «Die Gedichte» vor – und dokumentiert damit erstmals vollständig eine Lyriker-Stimme von hoher Intensität und Authentizität.
Es scheint, als wäre diesem Schriftsteller, Übersetzer, Theaterkritiker und Kulturkorrespondent einfach alles zu Lyrik geronnen, was an Biographischem zugestoßen ist – Poesie als lebenslängliche Konstante.
Schon 1926 schreibt der 24-Jährige:
Ich wäre gern in einer Zeit geboren
Mit Blumenmustern, bunt gestickten Decken
Gedämpftem Saitenspiel von Schlossemporen
Und Schäferspielen hinter Taxushecken.
[…]
Doch weil ich nun in diese Zeit verschlagen,
will ich sie auch mit Anstand für mich brauchen
und seine Meinung zu den Dingen sagen
und zu ihr stehn und meine Pfeife rauchen.
Dann Jahre später, 1943 in New York, als Geflüchteter:
Ja, ich bin allein, und ich weiß es
Viele sind wie ich, aber es kümmert sie nicht
und sie zeugen Kinder nach altem Brauch
sitzen in eisgekühlten Palästen
gehen umher und tragen bunte Krawatten
wie das Gesetz es befahl
Ich aber bin gefangen im Stein
Schließlich 1973 der zurückgekehrte Mahnende:
Wir, die wir unsre Zeit vertrödelten
aus begreiflichen Gründen
sind zu Trödlern des Unbegreiflichen geworden
Unser Schicksal steht unter Denkmalschutz
Unser bester Kunde ist das
schlechte Gewissen der Nachwelt
Greift zu, bedient euch
Wir sind die Letzten
Fragt uns aus
Wir sind zuständig
Und endlich ganz zum Schluss, ungefähr ein Jahr vor seinem Tod:
Ich gehe langsam aus der Zeit heraus
in eine Zukunft jenseits aller Sterne
und was ich war und bin und immer bleiben werde
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile
als wäre ich nie gewesen oder kaum.
Nein, Formalismus, Hermetik, abstrakte Ästhetik oder besondere Artistik ist dem Schaffen dieses zeitlebens moralisch wie politisch hochbeteiligten Bekenntnis-Lyrikers nicht zuzuordnen. Wohl aber bilderreichste, fast sinnlich greifbare Metaphorik – und immer seine Omnipräsenz der Aufrichtigkeit und der Unbestechlichkeit:
Gib dich zufrieden mit dem
was du noch hast
deinen Mund, deine Gebeine
freue dich darüber
weine.
Zähle nicht bis drei.
Eins genügt.
Vielleicht auch zwei
Bei drei wird’s schon wer
bei drei gibt’s dich nimmermehr.
Da fressen dich die Raben.
Amen.(aus «Dann», 1985)
Schicksal, Liebe, Nacht, Gott, Ich, Zeit, Herz, Lust, Tod – solche Jahrtausende alt-mächtigen Wörter auch am Ende des katastrophalen 20. Jahrhunderts noch mitten in den Lauf der eigenen und aller Dinge zu stellen scheute sich Sahl nie; er wusste um ihre Wirkung aus dem Munde eines Dichters, der sie hautnaher als die meisten zu spüren bekommen hatte:
De Profundis
Ich bin der Zeit und ihrem Reim entfremdet,
Es hat die Zeit mir meinen Reim entwendet.Wo Welten stürzen, Völker sich vernichten,
Kann sich das Wort zum Reim nicht mehr verdichten.Wer wagt es noch, das Grauen zu besingen,
Dem Ungereimten Reime zu entringen,Wer, der noch Worte hat, im Wort zu wildern,
Den Knochenfraß der Sprache zu bebildernUnd leichten Sinn’s, wo alle Worte fehlen,
Den Totentanz nach Silben abzuzählen?Ich bin dem Reim in dieser Zeit entfremdet,
Es hat die Zeit mir meinen Reim entwendet.Schwer ist mein Mund, und meine Lippen finden
Die Kraft nicht mehr, die Sätze zu verbinden.Hier liege ich, verworfen von Epochen,
Es ist das letzte Wort noch nicht gesprochen,Es ist der letzte Reim noch nicht gefunden
Auf diesen Jammer und auf diese Wunden.Der tiefste Schrei, den je ein Mensch vernommen,
Er wird von uns, aus unserem Schweigen kommen.
Der 31-jährige Sahl muss, als Sohn eines jüdischen Industriellen in Dresden geboren, vor der Hitlerei fliehen – auf einem Fluchtweg, den so mancher Emigrant vor ihm schon gegangen war: Frankreich, Portugal, dann an die amerikanische Ostküste, nach New York. Hier entstehen – und werden gar gedruckt! – seine «Hellen Nächte», der Lyrik-Erstling. Er erscheint allerdings erst 1942, aufgrund des überzeugten Verlegers Barthold Fles – da ist Autor Sahl (bis anhin «nur» Kulturkorrespondent, Feuilletonist und Kurzprosaist) bereits ein 40-jähriger, doch nahezu unbekannter Literat. Ungeachtet der misslichen Situation der Publikationsmöglichkeit für Lyrik in Amerika schreibt und schreibt Sahl jedoch weiter, einfach für die Schublade, Gedicht an Gedicht, zum Beispiel:
Selbstportrait
Was bleiben wird von mir? Nur Dunkelheiten,
Und ein Gesicht, das manchmal schüchtern lachte
Und sich Gedanken über dies und jenes machte
Und in den Abend sah und zu gewissen ZeitenSich über fremde Züge liebend neigte
Und Worte sagte, die man ihm nicht glaubte,
Und nichts verstand und manchmal sich erlaubte
Ein Mensch zu sein und keine Reue zeigte.Was bleiben wird? Nur dies. Ein Unterfangen,
Zu groß begonnen und dann abgebrochen,
Ein Wort, verwundert in die Nacht gesprochen
Und mit den andern in die Nacht gegangen.
Gleichzeitig ist der Dichter Sahl ein bedeutender Übersetzer, widmet sich vielbeachtet insbesondere den Amerikanern Maxwell Anderson, Arthur Miller, Thornton Wilder und Tennessee Williams. Schließlich geht er 1953 nach Deutschland zurück – wo der Sozialist Sahl im rechtskonservativen Adenauer-Klima, aber auch wegen Zerwürfnissen mit linksideologisch Bornierten zu einer literarischen Unperson wird, von der das kulturelle Europa keinerlei Notiz nimmt. Sahl ist abermals Emigrant, diesmal im eigenen Land. Wie hatte er damals in «Marseille III» geklagt?
Warum bin ich nicht längst schon ausgezogen
Aus diesem Loch, wo mich die Würmer fressen
Und tote Seelen umgehn im Gemäuer?
Fern über dem Atlantik ziehn Gewitter,
Es kam schon lange nichts mehr mit dem Clipper,
Man gibt mich auf, bald bin dich ganz vergessen
Und will nichts mehr und streck’ mich nach der Decke
In dem Hottel, in dem ich hier verrecke.
Erneut flieht Sahl, diesmal nicht ums Leben bangend, sondern enttäuscht über die Ignoranz des Literaturbetriebes der frühen 50-er Jahre links wie rechts, geht 1953 zum zweiten Mal in die USA, wo Gedichte entstehen wie:
Schlaflos in New York
Hörst du
sehr fern in der Nacht
die apokalyptischen Rosse
den Schlaflosen wecken?
Kamen sie,
um ihn zu erschrecken
mit dem Gedröhn
ihrer Propeller?
Siehe,
es wird schon heller
hinter dem Fenster,
aber unter dem Bett
schläft noch immer
das Dunkel,
schläft die Nacht
mit offenen Augen.
Und wartet
auf dich.
1989 kehrt schließlich der in jeder Beziehung ewige Exilant endgültig in sein Geburtsland zurück, wo er inzwischen erkannt und bekannt wurde. Doch der Ton des nun 87-jährigen Dichters ist bitter und mischt sich mit Angriffslust. «Zu spät», antwortet der Zurückgekehrte auf die Bemerkung, dass mittlerweile doch eine Wiederentdeckung des Vergessenen stattgefunden habe – und in seinen Zeilen «Exil» heißt es:
Es ist so gar nichts mehr dazu zu sagen.
Der Staub verweht.
Ich habe meinen Kragen hochgeschlagen.
Es ist schon spät.Die Winde kreischt. Sie haben ihn begraben.
Es ist so gar nichts mehr dazu zu sagen.
Zu spät.
Das kulturoffizielle Deutschland ehrt zu schlechter Letzt den Heimgekehrten mit verschiedenen Auszeichnungen, u.a. 1982 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz und in seinem Todesjahr mit dem Lessing-Preis des Freistaates Sachsen. Doch angekommen in einem allgemeinen literarischen Bewusstsein oder gar im Deutschunterricht ist er als einer der wichtigsten Lyriker der Nachkriegszeit noch immer nicht.
In dieser Situation leistet das nun vorliegende, umfassende lyrische Sahl-Kompendium wertvollste Mitarbeit. Der Band weist Hans Sahl aus als einen hochsensiblen Stenographen eines ganzen Jahrhunderts, als einen, der gezwungen war, künstlerisch mitzuschreiben bei all dem vielen, auch vielen Ungeheuerlichen, das in seine Zeit fiel. Bleibt zu hoffen, dass diese Edition der beiden Herausgeber Nils Kern und Klaus Siblewski eine – endlich – breite Sahl-Rehabilitation einläutet. ■
Hans Sahl, Die Gedichte, Luchterhand Verlag, 336 Seiten, ISBN 978-3-630-87288-9
.
.
.
.
Neue Version des Schachprogramms «Shredder»
.
Technische Stabilität und optische Balance
Walter Eigenmann & Peter Martan
.
Für Kenner und Insider der internationalen Computerschach-Szene gehört die Software «Shredder» des deutschen Programmierers Stefan Meyer-Kahlen seit langem zum festen Bestandteil des Engine-Parkes. Denn jahrelang dominierte Meyer-Kahlen die Computerschach-Turniere weltweit fast nach Belieben, und zwar in allen Disziplinen. Nun präsentiert der 41-jährige Düsseldorfer Informatiker eine neue Version seines Shredders – mittlerweile bereits als zwölfte Generation.
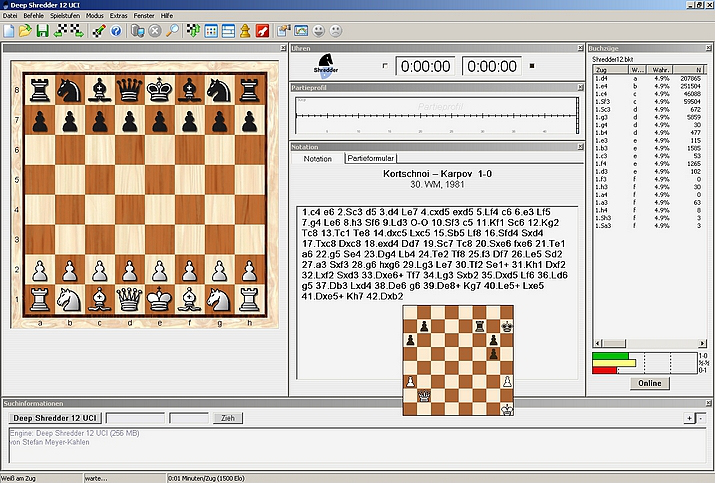
Seit Jahren im Computerschach ein Vorbild für Stabilität und klassisches Outfit: Das betont aufgeräumte, schlicht konzipierte Shredder-Interface in seiner 12. Version
Shredders «Graphical User Interface» (GUI), also seine «Benutzeroberfläche» – nicht zu verwechseln mit seiner «Engine», dem eigentlich rechnenden «Motor» – gilt seit langem als eine besonders ausgereifte Sache. Denn Stabilität und Ausgewogenheit waren schon immer die speziellen Markenzeichen dieses Schach-Paketes. «Programm-Absturz» ist für die Shredder-Gemeinde (übrigens auch im Linux- und im MacIntosh-Segment) ein Fremdwort, und die funktionale Ausgewogenheit, die «klassische» Aufgeräumtheit seiner Oberfläche war für eingefleischte Shredder-Fans schon immer ein Grund, dieses GUI den anderen, teils verspielt-überladenen User-Schnittstellen vorzuziehen.
Üppig ausgestatteter Werkzeugkasten
Nichtsdestoweniger verbirgt sich unter dem eher schlichten Outfit der üppig ausgestattete Menü-Werkzeugkasten aller modernen Schach-Software. Das Shredder-GUI lässt kaum Wünsche offen, was die Vielfalt der technischen Ansprüche angeht, die heutzutage an ein Schachprogramm gestellt werden müssen: Analyse eigener und/oder fremder Partien, Engine-Engine-Turniere, individuell angepasstes Spiel gegen den Computer, Datenbank-Funktionen, Endspiel-Untersuchungen u.v.a.
Zwei Highlights zeichnen dabei Meyer-Kahlens Programm gegenüber der Konkurrenz ganz besonders aus: Seine enge Zusammenarbeit mit der eigenen Homepage, welche in Form direkter Abfragen eigener Datenbanken als integrativer GUI-Bestandteil fungiert, sowie das Feature «Triple Brain», eine spezielle Analyse-Technik, bei der zwei (möglichst gleichstarke, aber möglichst unterschiedliche) zugeladene «Gehirne» rechnen, während ein drittes «Gehirn» über diese zwei Analyse-Ergebnisse mittels ausgeklügeltem Statistik-Verfahren entscheidet.

Zwei starke, aber unterschiedliche Engines unterbreiten einem Entscheider-Modul ihre Analyse: Das berühmte, aber immer noch zu wenig genutzte Shredder-Feature «Triple Brain»
.
Qualitätsvolles Eröffnungsbuch
Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist Shredders Eröffnungsbuch, das erneut der aktuellen Großmeister-Praxis angepasst wurde und schon länger von Sandro Necchi editiert wird. Immer mehr kommen dabei auch weniger gespielte Openings zu ihrem Recht. Zwei Beispiele: 1. e4 b6 2. d4 e6 3. c4 Lb7 4. Sc3 Lb4 5. f3 f5 6. exf5 Sh6 7. fxe6 Sf5 8. Ld3 – welches Programm (außer vielleicht «Fritz») weiß hier noch weiter? Eines der aktuell besten Bücher überhaupt in der Szene, das «R3.ctg» von J. Noomen, jedenfalls nicht. Oder auch nach: 1. b3 d5 2. Lb2 c5 3. e3 Sf6 4. Sf3 e6 5. Se5 Le7 6. f4 O-O 7. Ld3 – hier halten ebenfalls höchstens die Books von «Fritz» und «Rybka» mit. Und sollte auch bei Shredder das auf Festplatte installierte Buch nicht mehr weiter wissen, kommt bei Meyer-Kahlens Programm sofort der schon positiv erwähnte Zugriff auf die noch größere Online-Eröffnungsdatenbank zum Zuge.
Endspiel-Performance dank Datenbanken
Selbstverständlich glänzt auch der neueste Shredder nach wie vor in der quasi entgegengesetzten Ecke der Schachpartie, dem Endspiel. Hier hebt sich das Programm schon seit Jahren mit seinen von Meyer-Kahlen hauseigen adaptierten «Shredderbases» hervor, einer 6-Steiner-Datenbank, welche ebenfalls GUI-integrativ den sofortigen Online-Zugriff erlaubt. (Demnächst soll es auch alle 6-Steiner als Shredderbases im Shredder-eigenen, platzsparenden Format geben, wobei nicht die Wege zum Matt aus der jeweiligen Stellung, sondern nur Gewinn, Verlust oder Remis gespeichert werden, womit der Abruf um ein vielfaches schneller als bei herkömmlichen Verfahren sein wird). Die Shredderbases für die 3-, 4- und 5-Steiner sind bei Shredder 12 bereits im Kaufpreis inbegriffen und stehen auf der Homepage zum Download bereit.
Lese-Hilfe via Mauszeiger
Was fällt sonst noch auf am Outfit des aktuellsten Shredders? Am augenfälligsten ist sicher ein brandneues Feature: Erstmals zeigt das Interface auf jeder Zug-Notation am Bildschirm ein kleines Stellungs-Fenster, ausgelöst durch bloßes Mit-der-Maus-darauf-zeigen. Man kann also erstmals auch als in der Schachschrift ungeübter Anfänger dem Großmeister Shredder beim «Denken» zusehen, nicht nur abstrakt mitlesen. Das funktioniert sogar im «Partie-Profil», Shredders graphischer Darstellung des Partie-Verlaufes. Hier mit der Maus entlangfahren lässt das ganze Game im Tipp-Tools-Fenster gleich Revue passieren. Ein innovatives Shredder-Feature, das mit einiger Sicherheit früher oder später bei den Konkurrenz-GUIs ebenfalls erscheinen wird…
Deutliche Steigerung der Spielstärke
Und was hat denn Shredder 12 nun in Sachen Spielstärke zu bieten? Bis jetzt verzeichnete diesbezüglich noch jede neue Shredder-Version eine (teils massive) Steigerung – grundlos ist das Programm nicht vielfacher Computerschach-Weltmeister. Und die jüngste Ausgabe macht da keine Ausnahme, auch wenn heutzutage, bei dem extrem hohen Stärke-Niveau der modernen Schachprogrammierung die einzelnen Performance-Sprünge nicht mehr wie früher im 150-Elo-Bereich realisiert werden können.
Für ein definitives Urteil über Shredder 12 hinsichtlich seiner «Kampfkraft» ist es momentan, ein paar Tage nach Erscheinen, noch zu früh. (Die weltweite User-Gemeinde arbeitet daran wie gewohnt auf Hochdruck – siehe hierzu die einschlägigen Testergebnisse). Der erste Trend im Engine-Engine-Turnierbetrieb ist aber mehr als vielversprechend: Die neue Version dürfte sich unter die Top-Drei der aktuellen Programm-Rankings spielen.
Vorgänger hinter sich gelassen
Wir haben außerdem die neue UCI-Engine auf ein paar besonders anspruchsvolle Schachstellungen angesetzt, welche weder von Shredders Vorgänger noch von den meisten anderen Engines kapiert werden:
Beispiel 1 (Zugzwang)
Während sehr viele Programme wie der sprichwörtliche Esel am Berg gerade vor dem berühmt-berüchtigten Problem «Zugzwang» stehen, leitet hier der neue Shredder in nullkommanix Sekunden das 14-zügige Matt ein:
1. Kf7!! Kd3 2. Lf5+ Kc3 3. Lc8 Kd3 4. Lxa6+ Kc3 5. Lc8 Kd3 6. Lf5+ Kc3 7. Ld7 Kd3 8. Lb5+ Kc3 9. Lxa4 Kd3 10. Lb5+ Kc3 11. Ke6 a4 12. Kd5 axb3 13. Lc4 bxc2 14. Se2 matt (Studie: Knudsen 1924)
.
Beispiel 2 (Patt)
Der elfte Shredder sah hier noch keinerlei Land, sein jüngerer Bruder hingegen beweist (auf schnellen Rechnern) schon nach rund einer halben Minute seinen Durchblick (auch dank seiner «Bases») in diesem für Schachprogramme sehr anspruchsvollen Turmendspiel:
1… Tf3+!! 2. Txf3 Tb5+ 3. Ke4 Te5+ 4. Kd4 Te4+ 5. Kd3 Te3+ remis (Studie: N.N.)
.
Beispiel 3 (Initiative)
Auch in Sachen Initiative dürfte Meyer-Kahlens aktuellstes Opus zugelegt haben. Botterills effizientes Turmmanöver (in einer FS-Partie gegen Prizant) stellt jedenfalls für Shredder kein Problem dar:
17. Ta2!! De7 18. Td2 Lb8 19. Dc2 Dc7 20. Lb2 Se7 21. Lc4 mit Angriff (Botterill-Prizant, CorrGame 1993)
.
Beispiel 4 (Endspiel)
Im Endspiel war und ist Shredder bekanntlich durchaus auch ohne Datenbanken sehr kompetent, und in dieser Turm&Läufer-Stellung hat der «Zwölfer» bald den Dreh raus:
50. Txd7+!! Kxd7 51. Lxb7 Txf2+ 52. Ke3 Ta2 53. Lxa6 Kc7 54. Lc4 (Binham-Rüfenacht, CorrGame 1991)
In manchen computerschachlichen Problemzonen ist Shredder 12 also deutlich besser geworden, in spezifischen Stellungen sogar stärker als fast die gesamte Konkurrenz. Und wer noch Shredders seit jeher beeindruckende Fähigkeit des «Memorierens», will heißen seine ausgeprägte Lernfähigkeit mittels ausgeklügeltem Hash-Management (Stichwort «Retroanalyse»), aber auch sein (leider noch zu wenig bekanntes) exklusives Feature «Endspiel-Orakel» (schon seit Version 5 dabei) auf die Plus-Waage legt, der kriegt auch mit dem neuesten Meyer-Kahlen-Produkt ein bewährt effizientes Analyse-Werkzeug in die Hände.
Fazit: Empfehlenswert
Kurzum, Shredder 12 ist vielleicht (zumal in seiner Graphik) nicht der ultimativ-unwiderstehliche Überflieger der gesamten Computerschach-Szene, und auch die Anzahl seiner Novitäten mag auf den ersten Blick nicht gar so beeindrucken. Aber das brandneue Opus aus der Meyer-Kahlen-Werkstatt wird mit seiner technischen Stabilität, seinen durchdachten «Accessoires», seiner neuerlich gesteigerten Spielstärke und seiner umfangreichen Online-Integration definitiv die Herzen der «Könner und Kenner» höher schlagen lassen; der neue Shredder ist nicht nur für Sammler, sondern auch für Experten eine klare Kaufüberlegung wert. Nicht zufällig zählt das Produkt des Düsseldorfers zu den beliebtesten Schachprogrammen der ganzen Szene.
Nachfolgend eine schöne Angriffspartie des «Zwölfers» gegen die aktuelle Nummer Eins des Engine-Zirkus’ Rybka (5-moves-Book/DualCore-PC/PGN-Format):
.
[Event “15Min/Engine”]
[Site “DualCore”]
[Date “2009.10.12”]
[Round “?”]
[White “Deep Shredder 12”]
[Black “Rybka 3”]
[Result “1-0”]
[ECO “D18”]
[PlyCount “77”]
1. c4 Nf6 2. d4 c6 3. Nc3 d5 4. Nf3 dxc4 5. a4 Bf5 6. e3 e6 7. Bxc4 Nbd7 8. O-O Bb4 9. Nh4 Bg4 10. f3 Bh5 11. g4 Nd5 12. Ng2 Bg6 13. Qb3 Qb6 14. Ne2 Qa5 15. h4 h5 16. e4 Ne7 17. g5 O-O-O 18. Bf4 Bh7 19. Rfd1 Ng6 20. Bg3 Nb6 21. Ne3 Nd7 22. Bd3 Bf8 23. Nc4 Qb4 24. Qc2 e5 25. a5 Nb8 26. dxe5 Na6 27. Kg2 Nc5 28. Nd6+ Bxd6 29. exd6 Nxd3 30. Qxd3 Rd7 31. a6 f6 32. Ra3 Bg8 33. axb7+ Qxb7 34. Rda1 Qb8 35. Qc3 Ne5 36. Bxe5 fxe5 37. Ra6 Bf7 38. Qxc6+ Kd8 39. Qc5 1-0 ■
Stefan Meyer-Kahlen, Shredder 12, Schachprogramm, Download/Lizenz: www.shredderchess.de
.
.
.
.
Christoph Drösser: «Hast du Töne?»
.
«Jeder ist musikalisch!»
Walter Eigenmann
.
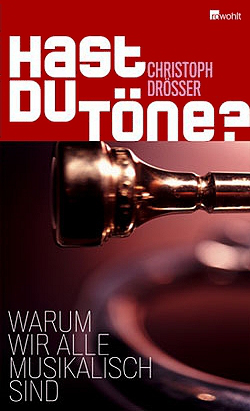 Gleich im frühesten Vorwort seiner neuen Veröffentlichung «Hast du Töne? – Warum wir alle musikalisch sind» steckt der Hamburger Wissenschaftsjournalist Christoph Drösser einen fulminanten Claim ab: «In diesem Buch schreibe ich selten über konkrete Musik, sondern vor allem über das, was man in den letzten Jahren über Musik herausgefunden hat. Die meisten Erkenntnisse, die ich zitiere, sind nach dem Jahr 2000 veröffentlicht worden, und das zeigt, dass hier ein Forschungsgebiet geradezu explodiert, und die Resultate insbesondere der Hirnforscher erschüttern so manche alte Überzeugungen. Vor allem die, dass die meisten Menschen unmusikalisch wären. Musikalität ist vielmehr eine Eigenschaft, die praktisch jeder von uns besitzt. Trotzdem hören wir zwar immer mehr Musik, aber wir musizieren immer weniger. Ich würde gern ein bisschen dazu beitragen, dass sich das ändert.» Provokativ und therapeutisch zugleich also geht der 51-jährige studierte Mathematiker und Amateur-Sänger Drössel ans Werk – und ums vorwegzunehmen: mit Erfolg bei wohl so ziemlich jeder Art von Leserschaft.
Gleich im frühesten Vorwort seiner neuen Veröffentlichung «Hast du Töne? – Warum wir alle musikalisch sind» steckt der Hamburger Wissenschaftsjournalist Christoph Drösser einen fulminanten Claim ab: «In diesem Buch schreibe ich selten über konkrete Musik, sondern vor allem über das, was man in den letzten Jahren über Musik herausgefunden hat. Die meisten Erkenntnisse, die ich zitiere, sind nach dem Jahr 2000 veröffentlicht worden, und das zeigt, dass hier ein Forschungsgebiet geradezu explodiert, und die Resultate insbesondere der Hirnforscher erschüttern so manche alte Überzeugungen. Vor allem die, dass die meisten Menschen unmusikalisch wären. Musikalität ist vielmehr eine Eigenschaft, die praktisch jeder von uns besitzt. Trotzdem hören wir zwar immer mehr Musik, aber wir musizieren immer weniger. Ich würde gern ein bisschen dazu beitragen, dass sich das ändert.» Provokativ und therapeutisch zugleich also geht der 51-jährige studierte Mathematiker und Amateur-Sänger Drössel ans Werk – und ums vorwegzunehmen: mit Erfolg bei wohl so ziemlich jeder Art von Leserschaft.
Dass der Autor, als thematisch breit tätiger TV-Redakteur, -Journalist und Print-Kolumnist, vom populärwissenschaftlichen Feuilleton herkommt, merkt man seiner Monographie auf Schritt und Buchstabe an, und seine dezidiert journalistische, nonstop vergnügliche Aufbereitung kompliziertester Forschungsergebnisse – bereits bekannt u.a. aus seinen Büchern «Der Mathematikverführer» (2007) oder «Wenn die Röcke kürzer werden, wächst die Wirtschaft» (2008) – feiert auch in «Hast du Töne?» amüsante, aber eben gleichzeitig informative Urständ.
Dabei hat er’s nicht leicht mit einem Forschungsgebiet, welches in der Tat während der vergangenen Jahre dank vielfältiger technischer Hochrüstung enormen Erkenntniszuwachs präsentieren konnte (siehe hierzu u.a. im «Glarean Magazin»: «Macht Musik schlau?»). In zehn Kapiteln muss Drössel denn eine beeindruckende Menge und Vielfalt an musikwissenschaftlichen Zahlen, Fakten und Einsichten resümmieren, für die drei mal hundert Buchseiten eigentlich allenfalls bloß die Ouvertüre liefern können.
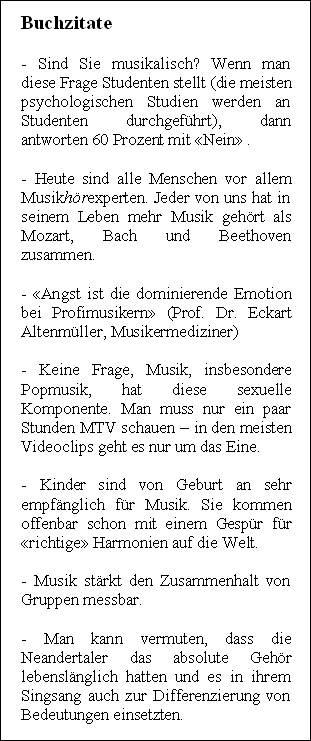 Des Autors Tour d’horizont beginnt mit der Widerlegung alter Vorurteile wie dem bereits erwähnten, dass Musikalität eine Göttergabe sei, über die nur Ausnahmebegabungen verfügten, und in diesem Zusammenhang auch, dass Hans nimmermehr könne, was Hänschen nicht gelernt hat; dass also «in puncto Musik der größte Teil der Menschen zum Zuhören veruteilt» sei. (Bei dieser Gelegenheit kriegen übrigens solche TV-Quotenhämmer wie «Deutschland sucht den Superstar» von Drössel ihr kräftig Stück Fett weg, aber ebenso die Haydn-Mozart-Beethoven-Anbeter mit ihrem unreflektierten «Genie-Kult»).
Des Autors Tour d’horizont beginnt mit der Widerlegung alter Vorurteile wie dem bereits erwähnten, dass Musikalität eine Göttergabe sei, über die nur Ausnahmebegabungen verfügten, und in diesem Zusammenhang auch, dass Hans nimmermehr könne, was Hänschen nicht gelernt hat; dass also «in puncto Musik der größte Teil der Menschen zum Zuhören veruteilt» sei. (Bei dieser Gelegenheit kriegen übrigens solche TV-Quotenhämmer wie «Deutschland sucht den Superstar» von Drössel ihr kräftig Stück Fett weg, aber ebenso die Haydn-Mozart-Beethoven-Anbeter mit ihrem unreflektierten «Genie-Kult»).
Mit Fragen wie «Gibt es einen evolutionären Nutzen der Musik?» leitet Autor Drösser dann über zu grundlegenden Untersuchungen über die (prä)-historischen Ursprünge und Entwicklungen der menschlichen Musik, über ihre neurophysiologischen Determinanten, über den Anteil der Sozialisation am überdurchschnittlichen Musiziervermögen, oder auch über spezifisch Musikpsychologisches wie der «Grammatik der Musik» und der individuellen musikalischen Präferenzen. Weitere faszinierende, teils «klassische», teils moderne Gebiete streift Drösser mit Forschungsgegenständen wie: «Neue Musik», «Universeller Chill», «Amusie», «Ton-Farben», «Musik&Emotion», «Schulmusik», «Computermusik» oder «Musik&Autismus», um natürlich nur einige zu nennen.
Wer unter der musikinteressierten Leserschaft nach statistischem Zahlenmaterial, nach wissenschaftlichen Fall-Studien oder nach apparatemedizinischer Grafik sucht, wird in Drössers «Hast du Töne?» nur sehr unterschwellig fündig. Wer sich aber eine ebenso vergnügliche wie breitest dokumentierte, dabei sehr flüssig und gleichzeitig spannend zu lesende Auseinandersetzung mit ein paar der bahnbrechenden Entwicklungen innerhalb der modernen Musikforschung gönnen will, der kommt hier, ob nun Musik-Hörender oder Musik-Ausführender, mit einer höchst anregenden Lektüre auf seine Kosten. Mehr noch: Drösser, ganz Medien-Experte, begnügt sich nicht mit Wörtern, sondern bezieht, maximal am Gegenstand orientiert, auch das Ohr mit ein: Im Buch eingestreut finden sich immer wieder Hörhinweise, denen man auf einer zugeordneten textbezogenen Internet-Seite direkt nachgehen kann. Christoph Drösser evoziert damit ein ausgesprochen abgerundetes Lektüre-Vergnügen, das neben viel Abstraktem eine gehörige Portion «Sinnliches» zugesellt. Ganz abgesehen davon, dass der mit Eloquenz plaudernde Autor immer mal wieder autobiographische Subjektivitäten seines eigenen, offensichtlich amüsanten Musiklebens einstreut und damit doppelte wissenschaftliche Authenzität (quasi im Selbstversuch) herstellt. Kurzum: Musikfreundinnen und -freunde aller Couleur und Bildung stellen diesen seinen Band ohne Zweifel mit Gewinn ins private Bücherregal. ■
Christoph Drösser: Hast du Töne? – Warum wir alle musikalisch sind, 320 Seiten, Rowohlt Verlag, ISBN 978-3498013288
.
.
.
.
Maria Lettberg: Das Solo-Klavierwerk von Skrjabin
.
Der ganze Kosmos des Alexander Skrjabin
Walter Eigenmann
.
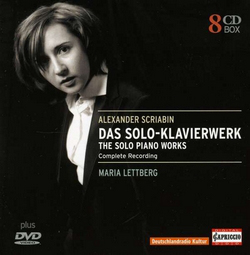 Wer war Alexander Skrjabin – was war er? Komponist? Symbolist? Mystiker? Revolutionär? Priester? Synästhetiker? Romantiker? Orgiastiker? Theosoph? Spinner? Über Skrjabin zu schreiben heißt über einen ganzen Kosmos zu schreiben: Die Entwicklung dieses genialen Ton-Exzentrikers vom hypersensiblen Chopin-Eklektiker (vor 1900) bis zum atonal entrückten Farb-Ekstatiker (ca. 10 Jahre später) ist beispiellos in der Musikgeschichte. Und der irdische Spiegel, eigentlich die zentrifugale Kraft dieses Kosmos’ des A. Skrjabin ist sein Klavierwerk.
Wer war Alexander Skrjabin – was war er? Komponist? Symbolist? Mystiker? Revolutionär? Priester? Synästhetiker? Romantiker? Orgiastiker? Theosoph? Spinner? Über Skrjabin zu schreiben heißt über einen ganzen Kosmos zu schreiben: Die Entwicklung dieses genialen Ton-Exzentrikers vom hypersensiblen Chopin-Eklektiker (vor 1900) bis zum atonal entrückten Farb-Ekstatiker (ca. 10 Jahre später) ist beispiellos in der Musikgeschichte. Und der irdische Spiegel, eigentlich die zentrifugale Kraft dieses Kosmos’ des A. Skrjabin ist sein Klavierwerk.
Die gleichzeitigen Verehrer (oder Adepten?) sowohl dieses Komponisten als auch der schwedischen Skrjabin-Expertin Maria Lettberg mussten – nach deren insgesamt dreijähriger Gesamteinspielung von Skrjabins Solo-Klavierwerk, abgeschlossen im Juni 2007 – lange warten, bis die zwischenzeitlich vergriffene Gesamtaufnahme nun kürzlich von dem Wiener Klassik-Label «Capriccio» neu aufgelegt und in einer schlicht editierten 8-teiligen CD-Box präsentiert wurde. Der instruktiv abrundende Bonus dieser (mit dem Deutschlandradio co-produzierten) Ausgabe: Eine DVD mit Interviews der (blitzgescheiten und sehr belesenen) Pianistin sowie dem Multimedia-Projekt «Mysterium» der Computer-Farb-Designerin Andrea Schmidt.
Noten- & Hörbeispiel

Große emotionale Spannweite auf kleinstem Raum: Beginn von Skrjabins 9. Klaviersonate op.68 («Die Schwarze Messe»)

Alexander Skrjabin (1871-1915)
.
Bald nach Erscheinen dieser Gesamtaufnahme im Herbst vor zwei Jahren stieß diese Lettberg-Einspielung auf größtes Interesse in der Fachwelt: Einmal der Tatsache wegen, dass hier neben allen großen Piano-Werken Skrjabins auch alle seine kaum gespielten Petitessen (frühe «Morceaux», «Nocturnes», u.a.) präsentiert wurden, und zum anderen, weil eine sowohl technisch exzellente, emotional ausgereifte und dabei auch theoretisch hervorragend dokumentierte Musikerin am Werk war.
Die in Riga geborene, in Petersburg ausgebildete, über Skrjabin promovierte und längst mit einer fulminanten internationalen Karriere beeindruckenden Pianistin gilt inzwischen als eigentliche Skrjabin-Anwältin, welche diesem Komponisten in ihren Schallplatten- und Konzert-Aktivitäten eine zentrale Rolle einräumt. Markenzeichen Lettbergscher Pianistik ist dabei neben diffizilster Anschlagstechnik, enormem Dynamikspektrum und poetischer Ausdruckskraft vor allem eine untrügliche Notennähe, aus der präziseste Phrasierung resultiert. Hört man sich diesbezüglich beispielsweise die letzten vier Sonaten an mit der Partitur vor sich, ist die exakte Realisierung des Notentextes verblüffend. Ob das diesem poetischen Phantasten mit dem teils schier improvisatorischen Duktus im Spätwerk immer gerecht wird, ist auch eine Frage des ästhetischen Standpunktes, und es mag sein, dass vorgängige Aufnahmen eines Horowitz, Hamelin oder Sokolow die eine oder andere Stelle packender, expressiver, ja explosiver, kurz: spannender nahmen.

Musikalische Synästhesie: Die Skrjabin-Klaviatur mit Ton-Farbe-Zuordnung
Gleichwohl legt Maria Lettberg hier eine übers Ganze gesehen schlicht referentielle Arbeit vor, die uns diesen pianistisch wie musikhistorisch wohl nie ganz auszuschöpfenden, äußersten widersprüchlichen, eine extreme stilistische Spannweite aufweisenden Russen sehr authentisch nahelegt. Denn bei aller intellektuell-analytischen Durchdringung der teils an neuzeitlichste Modernität des Klaviersatzes erinnernden Linien- und harmonischen Strukturen ist Lettberg eine doch auch wirkliche «Nachdichterin», deren pianistische Imagination teils betörend wirken kann (Hörproben). Kurzum: Die gültige «Bewältigung» eines Klavierwerkes, das endlich – trotz seiner teils erheblichen klaviertechnischen Hürden und v.a. seiner ständigen Forderung der «Hingabe» an die emotionale Zerrissenheit des Komponisten – unbedingt häufigerer Gast in den Klavier-Recital-Säälen der großen Musikhäuser sein müsste. Eine derartige Promotion wie Maria Lettbergs jahrelanges pianistisches Bekenntnis zu Skrjabin ist dabei ein überzeugendes Mittel. ■
Maria Lettberg, Alexander Scriabin – Das Solo-Klavierwerk, Complete Recording, 8-CD-Box (inkl. 1 DVD), Capriccio Digital / DeltaMusic, ASIN B000W4E3OS
.
.
Das Glarean-Literatur-Kreuzworträtsel
.
Literatur-Rätsel August 2009
.
.
Copyright 2009 by Walter Eigenmann – Einfach ausdrucken
.
Auflösung —> (mehr…)
.
.
Schweizer Literaturzeitschrift SCRIPTUM digitalisiert
.
SCRIPTUM – Neue Blätter für Literatur (1990-98)
Walter Eigenmann
.
Vom Sommer 1990 bis im Frühjahr 1998 wurde vom Autor die Literaturzeitschrift SCRIPTUM herausgegeben. In insgesamt 31 vierteljährlich erschienenen A4-Heften wurden dabei auf weit über 1’000 Seiten Essays, Prosatexte, Gedichte, Theaterstücke, Reportagen, Interviews und Rezensionen von über 400 bekannten und weniger bekannten SchriftstellerInnen aus dem gesamten deutschsprachigen Europa abgedruckt. Schon bald nach dem Start eroberten sich diese «Neuen Blätter für Literatur» (später: «Das Schweizer Literaturmagazin»), welche von Beginn weg auf sprachliche Qualität, thematische wie stilistische Breite sowie inhaltliche Originalität setzten, einen festen Platz in der internationalen literarischen Landschaft. Kaum ein Literaturbereich, eine literarische Strömung, ein vielversprechender Name im zeitgenössischen Literaturleben, der/die/der nicht auch seinen Niederschlag in den Neuen Blättern für Literatur gefunden hätte: Vom Haiku bis zur Konkreten Poesie, vom Shakespeare-Essay bis zur pornographischen Satire, vom Polit-Report bis zum Prominenten-Interview, vom Länder-Portrait bis zum dörflichen Literaturwettbewerb war während des 8-jährigen Erscheinens des Heftes alles zu lesen.
In seinen Spitzenzeiten hatte SCRIPTUM eine für sein Genre schier unglaubliche Auflage von 3’000 Exemplaren und war in den großen Buchhandlungen ebenso präsent wie in den wichtigen Bibliotheken. Im Soge dieses Erfolges konnte sich übrigens das Magazin eine weitere, in der internationalen Szene besonderes Aufsehen erregende Rarität leisten: ab der zehnten Nummer schüttete SCRIPTUM konsequent Autorenhonorare (wenngleich auch naturgemäß bescheidene) aus, sämtliche Abo- und Werbe-Einnahmen wurden umgehend an die SchriftstellerInnen weitergereicht.
Im Laufe der Jahre durfte der Herausgeber selbstverständlich auch zahlreiche kompetente Persönlichkeiten zu seinen ständigen redaktionellen Mitarbeitern zählen. Sie alle hier namentlich zu nennen führte zu weit; Auskunft geben die Impressum-Angaben der jeweiligen Heftausgaben. Fest steht, dass sie je die Inhalte und Präsenz von SCRIPTUM teils maßgeblich beeinflussten; Ihre langjährige Arbeit sei hier in corpore nochmals öffentlich verdankt. Nicht ohne Dank bleibe schließlich auch die zweimalige finanzielle Unterstützung durch die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia in der Anfangsphase der Zeitschrift; dies staatliche Engagement hat nicht nur mit Geld geholfen, sondern als Anerkennung die Blattmacher auch motiviert.
Im Sommer 1998 kam dann das Aus für SCRIPTUM; die Nummer 32 war zwar weitgehend konzipiert, konnte aber nicht mehr realisiert werden: Einschneidende personelle Änderungen innerhalb der Redaktion, eine ungenügend gestützte «Kapitaldecke», auch die absehbare allgemeine «Machtübernahme» so vieler Printmedien durch das Internet, vor allem aber die inzwischen massiv gestiegenen Druck- und Versandkosten zwangen nach knapp acht Jahrgängen schließlich zur Beerdigung des idealistisch-utopischen Literaturprojektes SCRIPTUM.
Dem Herausgeber wurde das Ende der Zeitschrift «erleichtert» durch die Gewissheit, unzählige interessante (auch experimentelle) literarische Strömungen begleitet, zahlreichen jungen und/oder unbekannten Schreibenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einem ersten beachteten «Auftritt» verholfen, so manchem mittlerweile international bekannten Schriftsteller eine reputierte Publikationsplattform geboten, grenzüberschreitende Autoren-Netzwerke initiiert sowie persönlich im Laufe der Jahre viele menschlich bereichernde Kontakte in alle Welt geknüpft zu haben. Walter Eigenmann –
Eine kleine Auswahl repräsentativer Presse-Stimmen aus jener Zeit
.
.
.
Sämtliche SCRIPTUM-Jahrgänge sind komplett ausverkauft. Doch seit kurzem liegen alle Hefte in einer bild-digitalisierten und ausdruckbaren Form (pdf-Format) auf DVD vor. Die DVD ist bei der Redaktion zu beziehen gegen Fr. 15.- (Inland) bzw. EUR 15.- (Ausland), jeweils inkl. Verpackung & Versand. (Lieferung nur gegen Vorkasse; Kein Einzelheft-Verkauf; Bitte benützen Sie für Ihre Bestellung ausschließlich den folgenden —> Bestell-Link).
.
Inhalte aller 8 Jahrgänge
 Heft 01 / 1990
Heft 01 / 1990
(«Neue Blätter für Literatur»)
Essays
Bodo Wenzlaff: Zeitgeist (4); Peter Stiegnitz: Die abgeklärten Aufklärer (16); Maria Hauck: Vom Kranksein (30)
Prosa
Jürg Hanselmann: Das Sackmesser (22); Mara Wegmann: Salve (26); Christian Urech: Es war einmal (34)
Lyrik
Marita Capol: 3 Gedichte (10); Fy Lüthi: 3 Gedichte (14); Michael Marx: 2 Gedichte (32); Weitere Lyrik von Günter Harnisch (27,31), Robert Reuling (9,13), Urs Richle (40), Oliver Thiele (17,18,19)
Satiren
Dorit Böhme: Von den Freuden des Schreckens (8); Hans Gysi: Panoptikum in Prosa (12)
Theater
Herbert Jost: Hamlets Rückkehr (35)
Illustrationen
Herbert Jost: Ich tanze im Licht, Tusche
Impressum (9)
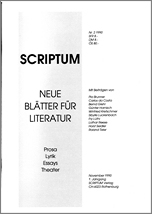 Heft 02 / 1990
Heft 02 / 1990
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (2)
Essay
Günter Harnisch: Der meditative Mensch (14)
Prosa
Bernd Giehl: Höhenfeuer (20); Horst Seidler: Das Jahrhundert der Katastrophen (26), Pia Maria Brunner: 2 Prosa-Stücke (32)
Lyrik
Fry Lüthi: 3 Gedichte (25); Winfried Kretschmer: 6 Gedichte (31); Weitere Lyrik von Lothar Reese (15,16), Sibylle Luckenbach-Tenner (17,18), Roland Tixier (23)
Theater
Carlos da Costa: Schreiber (4)
Impressum (19)
 Heft 03 / 1991
Heft 03 / 1991
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (2)
Essay
Peter Stiegnitz: Wahrheit und Wirklichkeit (4)
Prosa
Wendel Schäfer: Die Belastungsprobe (14); Norbert Schmid/Sternmut: Die Auferstehung (16); Oliver Gassner: Freudiana (19); Oliver Thiele: Der Freund (20); Manfred van Well: Nachts (28)
Lyrik
Werner Görischk: Was so wird (10); Susanna Hobi: Gedicht (15); Ruben Mullis: Gedicht (32); Weitere Lyrik von Cora Brandt (17,18), Joana Hofer (29,30), Axel Ressler (21,22), Rudolf Schmeiser (25,26), Christa Schmitt (27), Karl Seemann (5,6,7)
Satiren
Ralf Weisbecker: Positives Denken (8); Herbert Jost: Der Einzige (12);
Theater
Raphaela Schwyter: Saurer Frühlingswein (24)
Impressum (22)
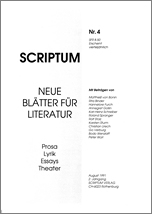 Heft 04 / 1991
Heft 04 / 1991
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (2)
Essays
Rolf Stolz: Neue Kultur – Volkskultur? Über die kulturelle Selbstbestimmung in einem anderen Europa (4); Bodo Wenzlaff: Über Vernunft und Gefühl (28)
Prosa
Christian Urech: Der Flug (24); Karsten P. Sturm: Landscapes (27); Rita Binder: Der Schrank (32)
Lyrik
Karl-Heinz Schreiber: 2 Gedichte (22); Hannelore Furch: 3 Gedichte (26); Weitere Lyrik von Matthieß von Bonin (11,12,13), Annegret Gollin (36), Peter Würl (29,30,31)
Satire
Go Verburg: Kirchenkollekte (19)
Theater
Roland Spranger: Warum waschen? (14)
Manuskriptbörse/Marktplatz (23)
Impressum (35)
 Heft 05 / 1991
Heft 05 / 1991
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (3)
Essays
Bodo Wenzlaff: Über das Wir und das Ich (4); Tim Krohn: Autobiographie als Selbstverwirklichung? Über die neue Innerlichkeit in der Schweizer Literatur, Teil 1 (28)
Prosa
Natalie Kuhn: Karem (10); Frank L. Ludwig: 3.10.1990 (12); Wendel Schäfer: 2 Prosastücke (14); Reinhard Hölbling: Die Kieselsteine (22); Peter Fahr: Begegnung (24); Peter Sigg: Im Park (27); Herbert Jost: Geschichte aus Amerika (32)
Satire
Kurt Tutschek: Das Höschen der Mona Lisa (18)
Lyrik
Fry Lüthi: 3 Gedichte (7); Frank L. Ludwig: 2 Gedichte (13); Hans Gysi: 3 Gedichte (26); Weitere Lyrik von Annegret Gollin (5), Kurt Konrad (19,20), Sibylle Luckenbach-Tenner (25), Peter Sigg (27), Annette Wildi (33,34,35), Christian Sczesny (23)
Ausschreibungen (8)
Manuskriptbörse (15)
Marktplatz (16)
Namen&Nachrichten (17)
Kurzrezensionen (21)
Walter Eigenmann: Züsli-Niscosi, «Dennoch», Cantina Verlag; Stiegnitz, «Lügen lohnt sich», Haag+Herchen Verlag; Wagemann, «Rauslassen, Rad ab, Ver-Einigung», Gauke Verlag
Graphik (36)
Impressum (6)
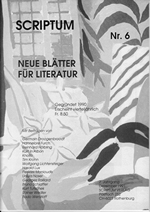 Heft 06 / 1991
Heft 06 / 1991
(«Neue Blätter für Literatur»)
Essays
Tim Krohn: Autobiographie als Selbstverwirklichung? Über die neue Innerlichkeit in der Schweizer Literatur, Teil 2 (4); Bodo Wenzlaff: Die Vision «Europa», Zukunft als Krisenmanagement (20)
Prosa
Georges Raillard: Besuch im Paradies (8); Ursula Noser: Sonderlings Beerdigung (16)
Satire
Knollo (Pseudonym): Treffen sich zwei Bayern (12)
Lyrik
Hannelore Furch: 3 Gedichte (11); Rainer Wedler: 3 Gedichte (14); Bruno Schlatter: 7 Gedichte (18,19); Germain Droogenbroodt: 3 Gedichte (30); Weitere Lyrik von Kurt In Albon (22,23), Wolfgang Lichtensteiger (10)
Theater
Perikles Monioudis: Herr Ott (26)
Illustrationen
Gilbert Piller: Öl auf Leinwand, 1982 (1); Harald Lux: Apokryphen I, Tuschezeichnung (31); Reinhard Hölbling: Stilleben, Photocollage (32)
Ausschreibungen (24)
Manuskriptbörse&Marktplatz (13)
Neuerscheinungen (15)
Gmellus, «Im Liebesrausch des Feuervogels»; Kunold/Lommel, «Männersuche»; Schmitt, «Vor dem Ende der Lesekultur»; Stiegnitz, «Eliten»
Impressum (17)
 Heft 07 / 1992
Heft 07 / 1992
(«Neue Blätter für Literatur»)
Essays
Tim Krohn: Autobiographie als Selbstverwirklichung? Über die neue Innerlichkeit in der Schweizer Literatur, Teil 3 (4); Peter Fahr: Weißes Kreuz auf braunem Grund, Zum Rassismus in der Schweiz (22)
Prosa
Thomas Frisch: Skylla (16); Horst Seidler: Maigeburten (20); Michaela Seul: Eine Liebe im Herbst (25)
Satiren
Rainer Wedler: Darum ist es am Rhein so schön (12); Michael Tonfeld: Aktion «Ein Herz für Arbeitslose» (26); Manfred Wieninger: 5 Mikrodramen (30)
Lyrik
Marcel Haag: 3 Gedichte (15); Burghard Damerau: 2 Gedichte (17); Weitere Gedichte von Renald Lilge (21), Hadayatullah Hübsch (13), Günter Born (23,24)
Theater
Patrick Cotti: Kein Stück (28)
Illustrationen
Kolibri (Pseudonym): Tusche-Zeichnungen (32)
Manuskriptbörse&Marktplatz (9)
Ausschreibungen (10)
Neuerscheinungen (11)
Samwald, «Sucht nach Zärtlichkeit»; Andreotti, «Die Struktur der modernen Literatur»; Kemper/Kaptein, «Jahreszeit»
Rezensionen (18)
Siegfried Wyler: Andreotti, «Die Struktur der modernen Literatur», Haupt Verlag; Bernd Giehl: Züsli, «Dennoch», Cantina Verlag
Impressum (21)
 Heft 08 / 1992
Heft 08 / 1992
(«Neue Blätter für Literatur»)
Essays
Tim Krohn: Autobiographie als Selbstverwirklichung? Über die neue Innerlichkeit in der Schweizer Literatur, Teil 4 (4); Mario Andreotti: Der moderne Mensch zwischen Mythos und Realität, Zu einer notwendigen Provokation der literarischen Moderne (24);
Prosa
Wolfgang Gsell: Begegnung mit einem Dichter (8); Siegfried Holzbauer: 2 Storys (14); Michaela Seul: Coitus infernale (16); Brigitte Fuchs: Gruppenaufnahme (20)
Satire
Wolfgang Reus: Begegnung im Park (22)
Lyrik
Karl-Heinz Barwasser: 4 Gedichte (7); Martin Kirchhoff: 3 Gedichte (13); Reto Baer: 3 Gedichte (15); Weitere Lyrik von Walter Haas (21), Volker Weber (23), Michael Arenz (29)
Grafik
Brigitt Filippini: 4 Variationen über «scriptare» (10,12,32)
Manuskriptbörse&Marktplatz (9)
Ausschreibungen (19)
Neuerscheinungen (11)
Widmer, «Der blaue Siphon»; Sollberger, «Lisi forever»; von Gunten, «Frauengesichter»; Wuneng, «West-östliches Kaleidoskop»; Zimmermann: «Einführung in die abendländische Geistesverwirrung»; Bezzel, Widmer, «Liebes böses Tier»; Krohn, «Surfer / Zeitalter des Esels»; Wondratschek, «Die Gedichte»
Rezensionen (18,19)
Herbert Jost: Stiegnitz, «Eliten», Edition Atelier; Tim Krohn: Widmer, «Der blaue Siphon», Diogenes Verlag
Impressum (21)
Briefe an die Redaktion (30)
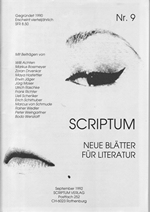 Heft 09 / 1992
Heft 09 / 1992
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (3)
Essays
Bodo Wenzlaff: Von der Sprachlosigkeit (4); Rainer Wedler: Über das Lesen von Büchern (16); Erwin Jäger: Die Dimension des Schmerzes, Kommentare zu Francois Mauriac (24)
Ratgeber
Walter Eigenmann: Die 10 Gebote der Manuskriptgestaltung (10)
Prosa
Ulrich Raschke: Smoking (14); Jürg Moser: Ein ganz neuer Mensch (20); Marcus von Schmude: Heimweg (28); Peter Weingartner: 2 Prosastücke (29)
Lyrik
Ueli Schenker: 3 Gedichte (5,6); Willi Achten: 3 Gedichte (13); Zoran Drvenka: Gedicht (21); Erich Schirhuber: 6 Gedichte (22); Markus Bossmeyer: 2 Gedichte (26,27); Maya Hostettler: 3 Gedichte (30)
Grafiken
Frank Richter: 3 Textgrafiken (8)
Manuskriptbörse&Marktplatz (9)
Neuerscheinungen (11)
Rademacher, «Das Wesen»; Zimmermann, «Der Tod ist ein Freund»; Dominik, «Fraktale Endschaften»; Karr, «Lexikon der deutschen Krimi-Autoren»; Barwasser, «Das Ypsilon der verdrehten Achsel»; Nendza, «Glaszeit»
Ausschreibungen (18)
Rezensionen (18,19)
Bernd Giehl: Hutterli, «Stachelflieder», Edition Erpf; Harald K. Hülsmann: Literaturzeitschrift «Der Freibeuter», Wagenbach Verlag; Andreaus Goetz: Runzheimer, «Im Labyrinth der Analyse», Laakes Verlag
Impressum (21)
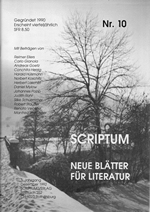 Heft 10 / 1992
Heft 10 / 1992
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (3)
Essays
Johannes Popp: Mensch ärgere dich nicht (24); Norbert Koschitz: Die Kolonialisierung des Sprechens (26); Andreas Goetz: Steht eine Hesse-Renaissance bevor? (30)
Prosa
Herbert Laschet: Für die Mabka mit (12); Conchita Herzig: Love Story (22); Daniel Mylow: Fliegen (28); Harald K. Hülsmann: Atom-Albert (32)
Satiren
Manfred Wieninger: 3 Mikrodraman (4)
Lyrik
Carlo Gianola: 3 Gedichte (5); Lyrik aus Argentinien: Virginia Rhodas, Carmen F. Lent (7); Reimer Eilers: Gedicht (23); Robert Stauffer: 2 Gedichte (25); Silke Schuemmer: Gedicht (29); Judith Rohr: 2 Gedichte (33)
Literaturszene Schweiz
Johannes Popp: «Ich möchte Erlebnisse schaffen», Interview mit Armin P. Barth (14); Johannes Popp: Berner Literaturpreis für Christoph Geiser, Zu Geisers neuem Roman «Das Gefängnis der Wünsche» (14)
Literaturszene Deutschland
Andreas Goetz: Verkaufen, verkaufen, verkaufen! Der literarische Markt in Deutschland (16)
Literaturszene Österreich
Manfred Wieninger: Literaten ins Parlament? Gespräch mit der Kulturpolitikerin Hilde Hawlicek (18)
Ausschreibungen/Veranstaltungen/Termine (10)
Manuskriptbörse&Marktplatz (11)
Rezensionen (20,21)
Johannes Popp: 2 Anthologien, Bochumer Autoren & Schriftstellerassoziation Dresden, Gasseleder; Andreas Sommer: Nendza, «Glaszeit», Atelier Verlag; Herbert Jost: Lyrismen, «Dominik’s Fraktale Endschaften», Dyade-Exil-Verlag; Konrad Weber: Bräker, «Es wird kein Friede sein», Artemis&Winkler Verlag;
Neuerscheinungen (9)
Bochumer Autoren, «Es ist alles in Ordnung»; Egner, «Als der Weihnachtsmann eine Frau war»; Kloimstein, «Stricharten»; Bräker, «Es wird kein Friede sein»; Drews, «Dichter beschimpfen Dichter II»; Frieling, «Wie schreibe ich meine Erinnerungen?»; Haffmans Magazin, «Der Rabe Nr.14»; Richter/Mitscherlich u.a., «Spuren der Verfolgung»; Lebert/Scholz, «Kinder des Windes»; Jacobi, «Tod und Teufel / Bote Nr.12»; Allemann, «Feuerlauf»; Meyer, «Durchgänge»
Briefe an die Redaktion (34)
Impressum (23)
 Heft 11 / 1993
Heft 11 / 1993
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (3)
Essays
Herbert Jost: Kunst, Kultur, Lasagne, Notizen zum deutschen Kulturbetrieb (4); Peter Bußjäger: Aus Lust werde Schmerz, Dualistische Abschweifungen (28); Rainer Wedler: Der Keiser ist tot, es lebe der Kaiser, Anmerkungen zur Rechtschreibreform (32)
Prosa
Hadayatullah Hübsch: Revolution der Glatzköpfe (14); Stefan Melnecuk: Trauma in Grau (26); Paula Küng: Der Leser (31);
Satiren
Georg Schwikart: Dichtersorgen (34); Cla Riatsch: Fernseh-Trio, literarisch (36)
Lyrik
Freddy Allemann: 3 Gedichte (13); Anna Wünsch: 2 Gedichte (15); Tanja Dückers: 3 Gedichte (24); Liane Biberger: 2 Gedichte (29); Adi Sollberger: 2 Gedichte (33); Weitere Lyrik von Udo Wilke (28), Christiane Pabst (31)
Literaturszene Schweiz
Johannes Popp: Monte Verita, Ascona und seine Kulturgeschichte (16); Johannes Popp: Blick über die Alpen, Das andere Tessin: Alberto Nessis «Abendzug» (16)
Literaturszene Deutschland
Andreas Goetz: «Schreiben ist eine einseitige Tätigkeit», Interview mit der Lyrikerin Barbara Köhler (18)
Literaturszene Österreich
Manfred Wieninger: Der Literaturmanager, Peter Schaden und sein Wiener Art Center (20)
Ausschreibungen/Veranstaltungen (10)
Manuskriptbörse&Marktplatz (7)
Rezensionen (22,23)
Konrad Weber: Hardtmann, «Spuren der Verfolgung», Bleicher Verlag; Stefan Eggerdinger: Jacobi, «Deutschdeutsch», Maistraßen-Presse; Andreas Sommer: Gianola, «Nadelrisse», Pro Lyrica Verlag; Walter Eigenmann: Wondratschek, «Die Gedichte», Diogenes Verlag; Herbert Jost: «Der Rabe» Nr.34, Haffmans Verlag; Walter Eigenmann: Werf, «Poesie der Bretagne», Atelier Verlag
Neuerscheinungen (9)
Reus, «So was und wie»; Kägi, «Die schwarze Kuh»; Werf, «Poesie der Bretagne»; Gianola, «Nadelrisse»; Kreibaum, «Fortschritt, Fortschritt über alles?»; Jacobi, «Deutsch-Deutsch»; Stadler, «Gedichte und Sprüche»; Wünsch, «Raber-Stimmungen»; Holstein, «Alptag»; Wiedl, «Fallgruben»; Fischer-Anthologie, «Durch tausend Türen»; Pflanz, «Andreas Roman und Chris Patrick»; Anthologie «Streitbarer Materialismus»; Laube, «Le dernier crie»; Garnier, «Picard – Eine Chronik»; Literaturzeitschrift «Der entfesselte Prometheus»
Briefe an die Redaktion (38)
Impressum (27)
 Heft 12 / 1993
Heft 12 / 1993
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (3)
Essays
Mario Andreotti: Ist Dichten lernbar? Über Sinn und Unsinn von Schreibseminarien (4); Erwin Jäger: Kosmetik und Schamgefühl, Zum 120. Geburtsjahr von Sidonie-Gabrielle Colette (26); Rosanna Müller-Brusco: Lesen aus Lust, Technik kontra Sprache (37)
Prosa
Lothar Becker: Hitler in der U-Bahn (20); Doris Schöni: Der Aschenbecher-Mann (28); Franz Züsli: Taksi! (32); Christine Wiesmüller: Die Dunkelkammer (34)
Satiren
Helmut Haberkamm: Burning love (19); Manfred Hausin: Die geflickte Hose (19)
Lyrik
Rainer Wedler: 3 Gedichte (7); Rosa Gruber: 3 Gedichte (23); Conradin Allemann: 3 Gedichte (31); Weitere Lyrik von Robert Stauffer (21), Klaus Schmidt-Macon (29), Bettina Balaka (33)
Literaturszene Schweiz
Johannes Popp: «Kleinverlage haben mehr Chancen denn je!», Interview mit dem Zürcher Buchhändler und Verleger Rico Bilger (8); Johannes Popp: Stories – und mehr, Zu E.M. Cuchulains Prosaband «Unruhig» (8)
Literaturszene Deutschland
Andreas Goetz: Texte, Dichter, Videos, Interviews mit den ostdeutschen Autoren Johannes Jansen und Norbert Bleisch (10)
Literaturszene Österreich
Manfred Wieninger: Ad multos annos, Kämpfe und Krämpfe um die neueste Urheberrechtsnovelle (12)
Rezensionen (14,15)
Johannes Popp: Holstein, «Alptag», Edition Leu; Andreas Sommer: Gisi, «Sturzwellen des Untergangs», Edition Lucrezia Borgia; Derek Meister: Laube, «Le dernie cri», Edition Sisyphos; Al’ Leu: Odemann, «Das hat gerade noch gefehlt», Bleicher Verlag; Bernd Giehl: Pixner, «Spitzbergen rückt näher», Edition L; Volker Koesling: Steinmann, «Nachtfahrt», Benziger Verlag; Walter Eigenmann: Ziegler, «Heinrich Heine», Artemis&Winkler Verlag; Rosanna Müller-Brusco: Fuchs, «Das Blaue vom Himmel», Glendyn Verlag
Neuerscheinungen (17)
Reus, «So was und wie»; Guitton, «Gott und die Wissenschaft»; Prêtre, «Mein Wahnsinn ist meine Insel»; Pixner, «Spitzbergen rückt näher»; Redmann, «Der Alltag im Kaffeesatz»; Hintze, «30 Rufe»; Pape, «Lichtzeichen»; Ramsauer, «Schweigen»; Steinmann, «Nachtfahrt»; Jürges, «Gedichte aus der Anderwelt»; Stadler, «Gedanken über das tägliche Leben»; Lyrik-Anthologie «Frühlingssonne&Herbststurm»; Gisi, «Helle Dunkelheit»; Hildebrand, «… kehr ich zurück»; Taugwalder, «Auf-Bruch»; Ziegler, «Heinrich Heine»; Röttger, «Preußischer Herbst»; Rother, «Reisen zu Dietrich Bonheffer»
Ausschreibungen (25)
Impressum (39)
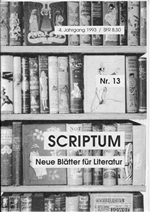 Heft 13 / 1993
Heft 13 / 1993
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (3)
Essays
Hadayatullah Hübsch: Liebe, Drogen, Spontaneität, Die Literatur der Beat-Generation (4); Rosanna Müller-Brusco: Der Januskopf, Essay über Essays (8); Freddy Allemann: «Sind Sie das Feuer?», Protokoll einer Schul-Autorenlesung (35)
Prosa
René Oberholzer: 3 Prosastücke (11); Klaus Schmidt-Macon: Im Kreis der 6 (14); Winfriede Kohlmeigner: Anopheles (24); Konrad Vogel: Introkubus (33); Brigitte Bee (Pseudonym): 2 Prosastücke (37)
Satire
Bournic (Pseudonym): Reich-Ranicki for President! Warum M. R.-R. Bundespräsident werden muss (12)
Lyrik
Wolfgang Weigel: 2 Gedichte (7); Martin Ohrt: 2 Gedichte (11); Erich Pfefferlen: 2 Gedichte (13); Jacqueline Crevoisier: 3 Gedichte (31); Brigitte Langer: 2 Gedichte (39); Arne Rautenberg: 2 Gedichte (39); Weitere Lyrik von Sabine Neumann (9), Robert Steiner(Pseudonym) (25)
Literaturszene Schweiz
Johannes Popp: Sprache und Sprachverwirrung, Über die Romandie, ihre Literatur und das Französische in der Schweiz (18); Wen-huei Chu: Eine chinesisch-europäische Verständigung, Das 1. Sino-Euro-Literatur-Symposium in Bern (19)
Literaturszene Deutschland
Andreas Goetz: «Dienstleister für Autoren», Die Druckkostenzuschuss-Verlage in Deutschland (20); Andreas Goetz: «Auch Goethe zahlte», Fragen an den Druckkostenzuschuß-Verleger Wilhelm Frieling (21)
Literaturszene Österreich
Manfred Wieninger: Chreme d’la Chreme – Eine Provokation, Zwei junge «Subliteraten» beschreiten neue Wege (22)
Ausschreibungen (16)
Lesermarkt (17)
Neuerscheinungen (27)
Uttendorf, «Und leise singt der Mond»; Weichselbaumer, «Vertrauen gibt Licht»; Kobel, «Narben und Gestalt»; Gruppe Wand, «Der Wandler Nr.12»; Garnier, «Die andere Zeit»; Röttger, «Preussischer Herbst»; Spotti, «X-Punkte»; Böhne/Motzkau, «Die Künste und die Wissenschaften im Exil 1933-1945»; Kronabitter, «Wer spricht denn noch von Liebe»; Svatek, «Bettlerzinken»; Roßmann/Catwiesel, «Sorgenpausen»; Kuprecht, «Leise Schritte»
Rezensionen (28,29)
Herbert Jost: Pretre, «Mein Wahnsinn ist meine Insel», Benziger Verlag; Heide Ullrich: Redmann, «Der Alltag im Kaffeesatz», Gauke Verlag; Konrad Weber: Verein wissenschaftl. Weltanschauung, «Streitbarer Materialismus Nr.16»; Carla Kraus: Donnell, «Leidenschaftspassage», Pygmalion Press; Pixner: Koller-Fanconi, «Die Sandbank», Verlag Koller-Fanconi; Walter Eigenmann: Günzel, «Die Brentanos», Artemis&Winkler Verlag
Impressum (17)
 Heft 14 / 1993
Heft 14 / 1993
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (3)
Essays
Klaas Willems: Physik und kritische Denkweise, Zum Selbstverständnis des Naturwissenschaftlers (4); Charles Stünzi: «It’s not words that shake me thus. Pish!», Das Sprachhandwerk in Shakespeares Dramen (14)
Prosa
Heribert Bauer: Auf geht’s, Schätzchen (6); Frank Festa: Im Schlachthaus (6); Dietmar Füssel: Unfall (6); Hubert Schirneck: Zu Gast (7); Aglaja Veteranyi: 3 Prosastücke (17)
Satire
Herbert Friedmann: Das Literaturhaus (6)
Lyrik
Irena Habalik: 2 Gedichte (8); Gabriele Haas-Rupp: 2 Gedichte (12); Ulrike Albert-Kucera: 2 Gedichte (12); Marlis Hillebrand: 2 Gedichte (12); Irene Baumgartner: 2 Gedichte (13); Radka Donnell: 2 Gedichte (17)
Literaturszene Schweiz
Johannes Popp: Regionen für Europa, Die Schweiz auf der Frankfurter Buchmesse (22)
Literaturszene Deutschland
Andreas Goetz: Weimar als Utopie, Gedanken bei der Besichtigung eines Denkmals (24)
Literaturszene Österreich
Manfred Wieninger: Quo vadis, Bachmann-Preis? Der Ingeborg-Bachmann-Literaturpreis im Spiegel prominenter österreichischer Autor(inn)en (26)
Rezensionen (18)
Volker Koesling: Schnaubelt, «Licht zwischen Schatten», Literaturedition Niederösterreich; Derek Meister: Hassler, «Auf dem Dach von Haus Nummer 107», Karma Verlag; Andreas Sommer: Lyrikzeitschrift «Das Gedicht Nr.1», Anton G. Leitner Verlag; Konrad Weber: Guitton/Grichka, «Gott und die Wissenschaft», Artemis&Winkler Verlag
Ausschreibungen/Termine (32)
Neuerscheinungen (33)
Luckenbach-Tenner, «Wind dann Sturm»; Simmen, «Landschaft mit Schäfer und anderen Reizen»; Reese, «Die Substanz der Seele»; Moser, «Wo Zwerge sich erheben»; Chessex, «Dreigestirn»; Hartmann, «Die Wölfe sind satt»; Himmelberger, «Der Strassenmörder»; Hösch, «Ein Gast im Haus»; Frieling, «Wie biete ich ein Manuskript an?»; Searle, «Die Wiederentdeckung des Geistes»; Feinberg, «Rose unter Dornen»; Innerschweizer Schriftsteller-Verein, «Schreiben in der Innerschweiz»; Orte, «Poesie-Angenda 1994»; Bösch, «Wortspielereien»; Marti/Weiss, «Gib allem ein bißchen Zeit», Gauke, «Lyrik-Kalender ’94»
Briefe an die Redaktion (34)
Illustrationen
Kolibri (Pseudonym), Zeichnungen (31,36)
Impressum (28)
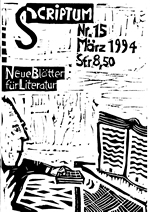 Heft 15 / 1994
Heft 15 / 1994
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (3)
Essays
Bodo Wenzlaff: Ich habe nichts zu sagen, Über das Reden und das Meinen (4); Marcus Tschudin: Tanz am Abgrund, Über die amerikanische Schriftstellerin Dorothy Parker (8); Franz Schart: Philosophie als Subversion: Zum 150. Geburtsjahr von Friedrich Nietzsche (14)
Prosa
Siegfried Holzbauer: 2 Prosastücke (7); Lutz Rathenow: Töten lernen (17); Martin Bettinger: Richtfest (31); Stephan Peters: Der Ohrring, Scriptum-Kurzkrimi 1994 / 1.Teil (32)
Lyrik
Renata Spotti: 3 Gedichte (9); Dieter P. Meier-Lenz: 2 Gedichte (13); Weitere Lyrik von Thomas Gerlach (6), Mikie Hübner (6), Marianne Leppin (6), Charlotte Olszewski (6), Liza Boumerang (Pseudonym) (7)
Graphik
Jörg Petersen: 2 Cartoons; Harald Goldhahn: 2 Karikaturen (16)
Literaturszene Schweiz
Christine Jossen: «Das Wort Gottes» ist nicht immer ein Wort Gottes, Gespräch mit dem Lyriker und Katholizismus-Kritiker Hannes Taugwalder (22)
Literaturszene Deutschland
Andreas Goetz: Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust…, Gespräch mit der Jungautorin Tanja Kinkel (24)
Literaturszene Österreich
Manfred Wieninger: «Qualität ist ein subjektiver Begriff», Vier österreichische Literaturzeitschriften im Selbstportrait (Log, Quasar, Lichtungen, Freie Zeit Art) (26)
Literaturszene International
Johannes Popp: Jung und unbekannt, Die Literatur Finnlands (28)
Rezensionen (18)
Bernd Giehl: Svatek, «Bettlerzinken», Österreichisches Literaturforum; Klaas Willems: Searle, «Die Wiederentdeckung des Geistes», Artemis&Winkler; Konrad Weber: Initiative junger Autoren, «Gegen Hass und Stumpfsinn»; Thomas Bechtold: Luckenbach-Tenner, «Wind dann Sturm», Edition L
Neuerscheinungen (19)
Goebel, «Mallarmé, Gedichte»; Brägger-Bisang, «Venussextil»; Drost, «Wie leicht wäre es…»; Literaturmagazin «Tasten Nr.6»; Literaturmagazin «Wandler Nr.13»; Literaturmagazin «Hirschstraße Nr.3»
Ausschreibungen/Termine (34)
Impressum (30)
 Heft 16 / 1994
Heft 16 / 1994
(«Neue Blätter für Literatur»)
Editorial (3)
Essays
Peter Ahrendt: «Ich bin eine schlechte Hasserin», Über die jüdische Schriftstellerin Grete Weil (4); Ernst Umbach: Autorenverbände – ja oder nein? (16); Klaus Schmidt-Macon: Über das Absurde (21)
Prosa
Robert Dannacker: Trittst im Morgenrot daher (9); Alberigo Tuccillo: Chanel No5 (13); Sabine Prochazka: Falsche Strategie (13); Stephan Peters: Der Ohrring, Scriptum-Kurzkrimi 1994 / 2.Teil (32)
Lyrik
Bruno Sommer: Drama für eine Stimme (7); Johannes Marks: 4 Gedichte (8); Klaus-Dieter Dieterich: 2 Gedichte; Martina Wieland: Gedicht (15)
Grafik
Wendel Schäfer: Tuschezeichnung (1)
Literaturszene Schweiz
Christine A. Jossen: Dürrenmatts letzte Inszenierung, «Querfahrt» – Eine Literaturausstellung über Dürrenmatt im Schweizerischen Literaturarchiv Bern (22)
Literaturszene Deutschland
Andreas Goetz: «Freudenhäuser» des Geistes? Die Literaturhäuser in Berlin, Hamburg und Frankfurt (24)
Literaturszene International
Johannes Popp: Tristesse und Leidenschaft, Über den italienischen Schriftsteller und Filmemacher Pier Paolo Pasolini (26)
Zum Tode von Charles Bukowski: Fast ein Nachruf (29)
Rezensionen (18)
Brigitte Pixner: Brägger-Bisang, «Venussextil», Editon Leu; Andreas Sommer: «Wandler» Nr.13, Gruppe Wand Konstanz; Konrad Weber: «Zeichen&Wunder» Nr.16, Casmir/Hrsg; Volker Koesling: Frieling, «Fremd unter Fremden», Frieling Verlag
Neue Bücher (19)
Fitz, «Heil!»; Frieling, «Fremd unter Fremden»; Le Gouic, «Aphorismen»; Stalder, «Die Schweine»; Juling, «Kulturmosaik»; Altmann, «Mittendrin die Perle»; Schmid/Sternmut, «Lichtpausen»; Hockl, «Liebtreu in Sarajewo»; Kamber, «Die Pendlerin»; Graf, «Irrungen oder der Beginn eines langen Anfangs»; Frieling, «Goldene Worte für jeden, der schreibt»; Wernli-Weilbächer, «Am anderen Ufer der Zeit»; Schweizer Schriftstellerverband, «Forum»-Jahrbuch Nr.7; Leppin, «Auf den Mann gekommen»; duPrel, «Verrücktes Paradies»; Bettinger, «Dachschaden»; Pixner, «Die Zeit hängt am Haken»
Ausschreibungen/Termine (30)
Marktplatz (31)
Briefe an die Redaktion (34)
Impressum (25)
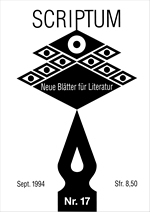 Heft 17 / 1994
Heft 17 / 1994
(«Neue Blätter für Literatur»)
Essays
Marcus Tschudin: Der Held als Poet – Zum 200. Todesjahr des französischen Lyrikers André Chénier (4); Erwin Jäger: Schlachtfest am Hochofen, Zum 100. Geburtsjahr von Hans H. Jahnn (20)
Prosa
Horst Schillinger: Was Männer mögen (7); Georg Schwikart: Orangenes Schweigen (9); Heinz Wegmann: 2 Prosastücke (9); Sebastian Hirzenreuther (Pseudonym) schreibt an… eine Redaktion (10); Margarete Böhm: Erkältungen (13); Aglaja Veteranyi: 2 Prosastücke (13); Klaus Hübner: In Dixieland (16); Alf Tondern: Ein Wahlmärchen (25); Stephan Peters: Der Ohrring, Scriptum-Kurzkrimi 1994 / Schluss (31)
Polit-Glosse
Thomas Brändle: Ansichten eines Globetrottels (10)
Lyrik
Rainer Franz Teuschl: 2 Gedichte (6); Manfred Hausin: 3 Gedichte (15); Lili Keller: 3 Gedichte; Weitere Lyrik von Gerald Fiebig (6), Silke Rosenbüchler (12), Margit Huber (12), Ingeborg Raus (12), Ingrid Fichtner (12)
Grafik&Karikatur
Roland Altmann: Titel-Grafik (1); Harald Goldhahn: Goldhahns Kommentar/Karikatur (14,27)
Literaturszene Schweiz
Christine A. Jossen: Der Sparhysterie geopfert, Gespräch mit dem Ex-Stadtbeobachter Martin R. Dean über das Kulturdebakel in Zug (22)
Literaturszene Deutschland
Andreas Goetz: Let’s talk about… Literatur, Anmerkungen zu einer Münchner Poetik-Vorlesung (24)
Literaturszene Österreich
Susanna Haunold: Musenkuss und Schulabschluss, Die Wiener Schule für Dichtung auf Erfolgskurs (26)
Literaturszene International
Johannes Popp: Auf dem Weg zu sich selbst – Die Literatur in Brasilien / Eine Skizze (28)
Rezensionen (18)
Volker Koesling: Graf, «Irrungen oder der Beginn eines langen Anfangs», Basta Verlag; Bernd Giehl: Kamber, «Die Pendlerin», R.G. Fischer Verlag; Carsten Pfefferkorn: Aust/Wedler, Literaturzeitschrift «Hirschstraße»; Walter Eigenmann: Wyssling/Schmidlin, «Thomas Mann», Artemis&Winkler Verlag; Bernd Giehl: Hockl, «Liebtreu in Sarajevo», Edition L; Thomas Röthlisberger: Fitz, «Heil», Bleicher Verlag
Bücherschau (19,21)
Conrady, «Das große deutsche Gedichtbuch»; Buchinger, «Knackpunkte»; Senft, «Echoräume»; Kanz, «Die forsythiengelbe Stube»; Conrady, «Gedichte der Deutschen Romantik»; Dorner, «Zeitgeist»; FDA-Verband, «Morgenlicht»; Bacqué, «Mut zur Trauer»; Acklin, «Das Tangopaar»; R.-G.-Fischer-Anthologie, «Autoren-Werkstatt 40»; Fues, «Verletzte Systeme»; Literaturzeitschrift «Krachkultur Nr.3»; Marchi, «Soviel ihr wollt»; Burgas, «Noch mehr Pintschereien»; Margreiter, «Morgendämmerung»; Stadler, «Ein kleines stilles Leuchten»; Zumbühl, «Ziri Gidichd»; Schwikart, «Zweifle dich durch! Lust auf Religion»; Artemis, «Kleist: Sämtliche Werke»; Guéhenno, «Das Ende der Demokratie»; Kägi, «Die Pfirsiche der schönen Melba»; Klair, «Selbst Elsa Winter hört mich nicht»; Beutler, «Die Stunde, da wir fliegen lernen»
Ausschreibungen/Termine (32)
Marktplatz (33)
Briefe an die Redaktion (34)
Impressum (33)
 Heft 18 / 1994
Heft 18 / 1994
(«Neue Blätter für Literatur»)
Statt eines Vorworts (3)
Essays
Ernst Umbach: Der Flug über alle Himmel, Zum 50. Todesjahr von Antoine de Saint-Exupéry (4); Richard Albrecht: Ohne Worte, Die Welt des Miroslav Barták (14); Michael Marx: Leben- Schreiben-Leben, Das große Abenteuer des Blaise Cendrars (20)
Prosa
Wolfgang Hermann: Namen (9); Berthold Zimmerer: Die Pinwand (11); Sebastian Hirzenreuther (Pseudonym) schreibt an… (11); Barbara Büchner: Die kleine Miss Molloy (29); Markus Rohrer: 4 Tropenbilder (30)
Polit-Glosse
Stephen Sokoloff: Die polnische Ananaskrankheit, Ein Weihnachtsmärchen (10)
Lyrik
Charles Stünzi: 2 Gedichte (12); Werner Garstenauer: 3 Gedichte (28); Weitere Lyrik von Martina Fringeli (12), Carlo Gianola (12), Eduard Rosenzopf (12)
Report
Michael Hellwig: Ach wie gut, dass jemand weiß, Das Jugendprojekt «Rumpelstilzchen» in Enger/BRD (6)
Grafik
Armin Margreiter: Titel-Zeichnung (1); Christian Born: 2 Cartoons (12); Harald Goldhahn: Godlhahns Kommentar (16); Theresa Rüegg: 2 Illustrationen (30); Lili Keller: Collage (36)
Literaturszene Schweiz
Christine A. Jossen: Und sie schreiben doch…, Zur Ausstellung «Schweizer Autorinnen 1700-1945» in Bern (22); Eintreten für ein menschenwürdigeres Leben, Zum Tode von Otto F. Walter (23)
Literaturszene Deutschland
Andreas Goetz: Maklerin im Elfenbeinturm, Gespräch mit der Literaturagentin Monika Hofko (24)
Literaturszene International
Johannes Popp: Von der Gier nach dem Leben, Zu Hannah Tillichs Memoiren «Ich allein bin» (26)
Rezensionen (18,19)
Agnes Mirtse: Samur-Kajin, «Ausgewählte Gedichte 1973-1989», Interculture Budapest; Klaus Hübner: Acklin, «Das Tangopaar», Nagel&Kimche Verlag; Herbert Jost: Schmidt, «Johanna», Lebenshilfe-Verlag Marburg; Andreas Sommer: Souto Maior, «Die parallele Katze», K. Fischer Verlag; Thomas Röthlisberger: Klair, «Selbst Elsa Winter hört mich nicht», Janus Verlag; Heide Ullrich: Marchi, «Soviel ihr wollt», Nagel&Kimche Verlag; Bernd Giehl: Schlatter, «Alltagsrevolte», Edition Sisyphos; Klaas Willems: Crick, «Was die Seele wirklich ist», Artemis&Winkler Verlag
Bücherschau (17)
Schlatter, «Alltagsrevolte»; Maior, «Die parallele Katze»; Crick, «Was die Seele wirklich ist»; Landau, «Seelenbilder»; Schnetz, «Deutsche Zustände»; Kuhn/Pitzen, «Stadt der Frauen»; Schmidt, «Wildnis mit Notausgang»; Kubli/Stump, «Viel Köpfe, viel Sinn»; Ullmann, «Eiswort Liebe»; Samur-Kajin, «Ausgewählte Gedichte»; Kulik, «Erinnerungen an morgen»; Koller-Fanconi, «Ombre», Klusen, «Lichterloh»; Segessenmann, «Der Armeleutebub»; Reichlin, «Kriegsverbrecher Wipf, Eugen»; Scharf, «Kometen und Katzen»; Balzer, Literaturzeitschrift «Tasten 7»; Schäfer, «Vögel haben keine Fenster»; Schwarzlmüller, «Der Todes des Fisches»; Vogt, «Sehn-Sucht»; Ronchetti, «Lichtfall»; Barth, «Im Netz der grünen Fledermaus»; Burmbund Innsbruck, «Texttürme Nr.2»
Ausschreibungen/Termine (32)
Briefe an die Redaktion (34)
Impressum (33)
 Heft 19 / 1995
Heft 19 / 1995
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Die Literatur in den USA»)
Editorial (3)
Titel-Report
Klaus Dieterich: Fiction or nonfiction, Die Literaturszene in Amerika (4); Amerika und seine Literaturpreise (5)
Essay
Erwin Jäger: Scheitern durch die Liebe, Zum 100. Todesjahr von Leopold Sacher-Masoch (8)
Interview
Christine Jossen: Ohne Frauendenken kein Wohlstandsstaat Schweiz, Gespräch mit der Dramatikerin Maja Beutler (16)
Prosa
Helmut Schrey: 7 satirische Skizzen (11); Hans F. Mayinger: Das Buch des Nachbarn (13); Sebastian Hirzenreuther (Pseudonym) schreibt… (13); Gabriele Markus: Das verlorene Gesicht (20); Simona Ryser: 2 Prosastücke (20);
Scriptum-Kurzkrimi des Jahres
Renate Müller-Piper: Das Photo-Fest (1. Teil) (32)
Lyrik (22,23)
Gedichte von Christoph Bauer, Andreas Hilfiker, Dieter P. Meier-Lenz, Hartmut Starnitzky, Sibylle Stoiser, Anita Tauss
Konkrete Poesie
Siegfried Holzbauer: 2 systemische Gedichte (15)
Karikaturen
Ralph Görtler: 2 Cartoons (28); Harald Goldhahn: Goldhahns Kommentar (12)
Rezensionen (24,25,26)
Charles Stünzi: Landau, Seelenbilder, Dohr Verlag; Bernd Giehl: Schwikart, Zweifle dich durch / Lust auf Religion, Kösel Verlag; Friedrich List: Schäfer, Vögel haben keine Fenster, Gollenstein Verlag; Rudolf Kraus: Turmbund Innsbruck, Texttürme Nr.2, Prosa-Anthologie; Andreas Urs Sommer: Barth, Im Netz der grünen Fledermaus, Janus Verlag; Thomas Röthlisberger: Literaturzeitschrift Perspektive Nr.28, Graz; Walter Eigenmann: Popp, Die Veränderung, Westkreuz-Verlag; Rudolf Kraus: Schwarzlmüller, Der Hofnarrenmonolog, Selbstverlag
Bücherschau (26)
Donnell, Das Frühlingsbuch; Literaturzeitschrift Unke Nr.16; Achten, Das Privileg von Pfeffer&Salz; Literaturzeitschrift Edit Nr.5; Sering, Qualmende Schlote; Zimmermann, Rotäugig; Gauke, Lyrik-Kalender 1995; Schwöbel, Zeit Ernten; Breuer, Der blaue Schmetterling; Schwarzlmüller, Der Hofnarrenmonolog; Literaturzeitschrift Neue Sirene Nr.2; Raillard, Hirnströme eines Stubenhockers; Svatek, Rendez-vous mit der Hoffnung; Schumann, Unsterblich bleiben Augenblicke; Frieling-Anthologie, Buchwelt ’94; Donnell, Am Walensee; Allemann, Hollywood liegt bei Ascona; Literaturzeitschrift Enblick, Special Nr.1; Monioudis, Das Passagierschiff; Baco, Die Nirwana Connection; Schamp, Den Berg hineinfressen; Steppuhn, Kein Vogel singt am Oetenbach; Bauereiß, Träume, Zufälle, Visionen
Literaturservice (28-31)
Szene International: Nachrichten, Personen, Ausschreibungen
Briefe an die Redaktion (34)
Impressum (9)
 Heft 20 / 1995
Heft 20 / 1995
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Das literarische Korea»)
Titel-Report
Mathias Adelhoefer: Nichts Neues im Osten? – Die Literatur in Korea: Zwischen Tradition und Emanzipation (4)
Essay
Bodo Wenzlaff: Ein Deutscher in der Schweiz, Annäherung an einen Nachbarn (8)
Portrait
Christine Jossen: Von den Texten überrannt worden, Gerhard Meier (14)
Interiew
Andreas Goetz: Erinnern im Schreiben, Gespräch mit den Ex-DDR-Autoren Margret Steckel und Johannes Popp (30)
Ratgeber
Michael Marx: Ein Gedicht entsteht, Workshop (29)
Prosa
Heini Müller: Waschen Sie sich die Hände… (11); Beatrix Maria Kramlovsky: Der Fisch (13); Adrian Sarasin: ? (16); Peter Zimmermann: Speise (16); Sebastian Hirzenreuther schreibt… (17)
Scriptum-Kurzkrimi des Jahres
Renate Müller-Piper: Das Photo-Fest (2. Teil) (32)
Lyrik (17-19)
Gedichte von Valeria Koch, Eleonora Babacek-Hübel, Gerhard Altmann, Semier Insayif, Wolfgang Weigel, Christiane Haas
Karikaturen
Harald Goldhahn: Goldhahns Kommentar (12)
Rezensionen (20,21)
Brigitte Pixner: Bettinger, Dachschaden, Gollenstein Verlag; Bernd Giehl: Ronchetti, Lichtfall, R.G. Fischer Verlag; Brigitte Pixner: Donnell, Das Frühlingsbuch, Pygmalion Press Plovdiv; Derek Meister: Zeitschrift Einblick, Social Beat, Special Nr.1; Rosemarie Schulak: Hönig-Sorg, Im Fluss der Zeit, Berger Verlag; Charles Stünzi: Klusen, lichterloh im siebten himmel, Sassafras Verlag; Carsten Pfefferkorn: Literaturzeitschrift Edit Nr.5, Leipzig
Bücherschau (23)
Glucksmann, Der Stachel der Liebe; Literaturzeitschrift Zäpfchen Nr.19; Spitzner, Zauberwort; Misalle, Der Wolkenexpreß; Hönig, Im Fluss der Zeit; White, Sterbe ist kein Tabu; Job, Die vernachlässigte Muse; Zuckmayer-Gesellschaft, Blätter Nr.1/2-1995; Helnwein, Faces; Dahlke/Shantiprem, Elemente-Rituale; Witzkewitz, Hoffnungslos optimystisch; C.G. Jung, Der Mensch und eine Symbole; Wedler, Die kaschubische Wunde; Wosniak, Sie saß in der Küche und rauchte
Literaturservice (24-28)
Szene International: Nachrichten, Personen, Ausschreibungen
Zitate
Gesagt ist gesagt (29)
Briefe an die Redaktion (34)
Marktplatz (34)
Impressum (26)
 Heft 21 / 1995
Heft 21 / 1995
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Die deutschsprachige Rechtschreibereform»)
Essays
Rosanna Müller-Brusco: Scriptare fuit, Vom Ursprung entfernt, suchst selber die Quelle, Zur neuen deutschen Rechtschreibung – Ein kritischer Versuch (4); Mario Andreotti: Was ist heute ein gutes Gedicht? Über einige Kriterien zeitgenössischer Lyrik (14)
Feuilleton
Horst J. Kleinmann: Trampelpfad zum Glück, Die Renaissance von Prof. Brinkmann&Co. (8);
50 Jahre Kriegsende
Beppo Beyerl: Gräber (10)
Report
Rudolf Kraus: Austrias Literaten katalogisiert, systematisiert, digitalisiert – Die Österreichische Literaturdatenbank des 20. Jahrhunderts (32)
Interview
Christine Jossen: Wir Menschen sind doch voller Geschichten, Gespräch mit Al Imfeld über die Schweiz und Afrika (16)
Prosa
Peter R. Wieninger: Joggen (12); Joachim G. Hammer: Wildes Autocamp (18); Claudia Zimmermann: Tag danach (18); Sebastian Hirzenreuther schreibt… (19); Walter Laufenberg: After eight (30)
Scriptum-Kurzkrimi
Jörn Thiel: Zahngold (1. Teil) (36)
Lyrik
Gedichte von Charlotte Ueckert (19); Anton Kürzi, Günter Ullmann, Michael Benke, Thomas Röthlisberger (34); Hadayatullah Hübsch, Judith Rohr, Renate Riethmüller (35)
Rezensionen (20,21)
Volker Koesling: Wedler, Die kaschubische Wende, Gollenstein Verlag; Bernd Giehl: Taugwalder, Gespräch mit dem Schweigen, Glendyn Verlag; Clemens Umbricht: Rathenow, Sisyphos, Berlin Verlag; Rudolf Kraus: Scharf, Kometen und Katzen, Berdel Verlag; Thomas Röthlisberger: Monioudis, Das Passagierschiff, Nagel&Kimche Verlag; Volker Koesling: Literaturzeitschrift Torso Nr.3; Bernd Giehl: Spitzner, Zauberwort, Oertel&Spärer Verlag; Volker Koesling: Allemann, Hollywood liegt bei Ascona, Edition Leu; Rosmarie Schulak: Günter, Erst als die letzte Trommel schwieg, Verlag freier Autoren
Bücherschau (23)
Schiwy, Das Teilhard-du-Chardin-Lesebuch; Lau/Schütterle, Speisen wie ein König; Sommer, Die Antwort des Löwen; Diwersy, Kultur an der Grenze; Gräber, Smaragdgrünes Land; Rückleben, Winterherz; Keel, Joseph Roth; Hirschfeld, Besiegt und befreit; Weeber, Alltag im Alten Rom; Günter, Erst als die letzte Trommel schwieg; Mattich, Hoffnung – meine Stärke; Literaturzeitschrift Torso Nr.3; Aebli, Müllers Aufbruch; Literaturzeitschrift Muschelhaufen Nr.33/34; Tomatis, Das Ohr und das Leben; Schmithausen, Abfallverwertung; Scheuer, Wege die mich begleiten; Schwarz, Eine Handvoll Menschen und mehr
Literaturservice (24-29)
Szene International: Nachrichten, Leute, Ausschreibungen, Termine
Zitate
Gesagt ist gesagt (29)
Karikatur
Harald Goldhahn: Goldhahns Kommentar (31)
Marktplatz (38)
Briefe an die Redaktion (38)
Impressum (29)
 Heft 22 / 1995
Heft 22 / 1995
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Moskau – Russlands Literaturmetropole zwischen Tradition und Moderne»)
Statt eines Vorworts
Report
Klaus F. Schmidt-Macon: Tage in Moskau, Impressionen über Russlands literarische Metropole (4)
Portraits
Horst J. Kleinmann: Olyas Geschichte, Verfolgt, inhaftiert, verurteilt, geflüchtet – Über die iranische Autorin Olya Roohizadegan (9); Christine A. Jossen: Namenlos-Wehrlos, Über Mariella Mehr und ihren Roman «Daskind» (17)
Interview
Rudolf Kraus: Zwischen Politik und Fiktion, Gespräch mit dem österreichischen Autor Manfred Maurer (32)
Jubiläum
Dieter P. Meier-Lenz: 40 Jahre «Die Horen», Ein Redakteur blickt zurück (7)
Projekt
Kai Engelke: Literatur im offenen Raum, Über die Hamburger Autorengruppe PENG (10)
Frankfurter Buchmesse
Horst J. Kleinmann: Nicht nur Sauna des Geistes, Streiflichter von der 47. Frankfurter Buchmesse (15)
Prosa
Hermann Josef Schüren: Heimkehr nach Bosnien (11); Elisabeth Wandeler-Deck: Die Figur der Sara (12); Günther Kaip: Liebesgeschichten (18); Paula Küng: Warten (18); Alan Niederer: Die Geschichte vom Es (19); Jürgen Kross: Wenn schon (31)
Scriptum-Kurzkrimi
Jörn Thiel: Zahngold (2. Teil) (36)
Lyrik
Gedichte von Christoph Bauer (35); Karl Feldkamp, Robert Ihnen, Ernst Schmid, Sylvia Schopf (34); Katja V. Tavern (35); Dieter Wieland (31)
Rezensionen (20-22)
Fritz List: Wagner, Der Tote in der Tonne, Snayder Verlag; Andreas Sommer: Müller, Mehr am 15. September…, Nagel&Kimche Verlag; Clemens Umbricht: Stünzi, Mensch oh Mensch!, Verlag freier Autoren; Klaas Willems: Schick/Ostrogorksi, Kommen die Russen wieder?, Mittler Verlag; Volker Koesling: Loetscher, Saison, Diogenes Verlag; Derek Meister: Kilic/Widhalm, Dicke Luft-Irre Trickohs, Krash Verlag; Bernd Giehl: Marti, Im Sternzeichen des Esels, Nagel&Kimche Verlag; Rosemarie Schulak: Ferstl, einfach-kompliziert-einfach, Va bene Edition; Al’ Leu: Buchinger, Mathieu Puissetoutgrain, Gauke Verlag; Volker Koesling: Bucher/Gegner, Poesie-Agend 96, Orte Verlag; Charles Stünzi: Derendinger, Freiland, Habegger Verlag; Andreas Sommer: Mitterhuber, Jeinseits der Passhöhe, Buch-& Kunstverlag Oberpfalz
Bücherschau (23)
Geiser, Kahn Knaben schnelle Fahrt; Baumgartner, 6x Österreich; Wagner, Chiffre; Blunck, Über die Scham; Kakar, Intime Beziehungen; Tiffert, Anwachsender Wind; Kuroyanagi, Totto-chan; Peregrin, Unterwegs in Europa; Wiesand, Handbuch der Kulturpreise 1986-1994; FrauenUmweltNetz, Computervernetzung für Frauen; Rueb, Hexenbrände; Almanach-Edition, Buchverlage in Deutschland; Gitlin, Mord an Albert Einstein; Die Allyren, Farben; Lösto, Beneidenswert; Spiess, Faszination der Miniaturen; Detela, Hinter dem Feuerwald
Literaturservice (24-29)
Szene International: Nachrichten, Leute, Ausschreibungen, Termine
Karikatur
Harald Goldhahn, Zeichnung (33)
Zitate (29)
Briefe an die Redaktion (38)
Marktplatz (38)
Impressum (29)
 Heft 23 / 1996
Heft 23 / 1996
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Gottfrieds Frauen», Zum 40. Todesjahr von Gottfried Benn)
Gastkommentar
Fritz Deppert: Retour aufs Land (3)
Essays
Michael Benke: Gottfrieds Frauen, Zum 40. Todesjahr von Gottfried Benn (4); Kunibert Reinhard: Wozu Literatur? Die Sphinx vor dem Tempel der Dichtkunst (8)
Interviews
Kai Engelke: Wer es wählt, muss es tragen – Gespräch mit dem Schriftsteller Klaus Modick (12); Rudolf Kraus: Niemals aufgeben – Gespräch mit dem experimentellen Poeten Hansjörg Zauner (16)
Portraits
Evelin Scherer: Wer knackt die Punkte? Das Schweizer Kabarett-Duo Kernbeissers (15); Christine A. Jossen: Mit Sprache der Freiheit entgegen, Zum 75. Geburtstag von Kurt Marti (19)
Sprache
Horst J. Kleinmann: Wörter und Unwörter, «Multimedia»-«Eurogeld»-«Altenplage» (21)
Prosa
Jürg Moser: Der Pfeiffer (26); Edith Ruhöfer: Sie (29); Christine Wiesmüller: Ausreise (30)
Scriptum-Kurzkrimi
Jörn Thiel: Zahngold (3. Teil) (32)
Lyrik
Gedichte von Günter Bösch (5), Maria Cervenka (30), Ingeborg Reisner (7,17), Wolfgang Reus (29), Kurt Tutschek (27), Rainer Wedler (8,9), Anna Wünsch (28), Hans Jürg Zinsli (13)
Rezensionen (22-24)
Michael Kapellen: Schnetz, Operation Pamphlet – Meine Stasi-Akte, Selbstverlag; Nathalie Amstutz: Colombat/Stieg, Frühling der Seele, Haymon Verlag; Clemens Umbricht: Schirhuber, Die Pfeife geputzt, Rampenlicht Verlag; Bernd Giehl: Frauenfelder, Die Missiama, Edition Koller-Fanconi; Friederike Pommer-Jittler: Sternmut, Verfrühtes Auslösen des Zeitraffers, Edition Thaleia; Andreas Sommer: Messner, Schwarzweiße Geschichten, Drava Verlag; Rudolf A. Schmeiser: Olivennes, Adam und Adam / Zusammen verbrannt, Verlag im Wald
Bücherschau (25)
Dankl/Schrott, Dadautriche 1907-1970; Vogt, Vergessen und erinnern; Fackler-Belli, Mit neunzehn vor 66 Jahren allein nach Ägypten; Rengel, Hoffen heißt Handeln; Abramowski, die Umarmung; Storz, Burgers Kindheiten; Barwasser, Literaturzeitschrift Pcetera Nr.7; Mallet, …und rissen der schönen Jungfrau die Kleider vom Leib; Wieninger, Die Spur der Katzen; Stricker-Hofer, mit den i-punkten Deiner küsse; Leuenberger, Tarot – kurz&praktisch; Cranston, Leben und Werk der Helena Blavatsky
News (34)
Graphik
Harald Goldhahn: Karikatur (20)
Ausschreibungen (36)
Leserbriefe (38)
Kleinanzeigen (38)
Biographien der Lyriker/innen (38)
Impressum (37)
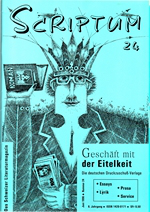 Heft 24 / 1996
Heft 24 / 1996
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Geschäft mit der Eitelkeit», Die deutschen Druckzuschuss-Verlage)
Der Kommentar
Rosanna Müller-Brusco: Ferien als Flucht (3)
Report
Kai Engelke: Geschäft mit der Eitelkeit, Die deutschen Druckzuschuss-Verlage (4)
Literaturszene Österreich
Rudolf Kraus: Austrias Gegenwartsliteratur in Beispielen (8)
Interview
Christine A. Jossen: Zwischen Dur und Moll, Gespräch mit Lukas Hartmann (Schweizer Jugendbuch-Preisträger 1995) (10)
Essays
Mario Andreotti: Das unmögliche Tragische, Anmerkungen zum zeitgenössischen Drama (13); Erwin Jäger: Attentat Endzeit, Zum 100. Todesjahr von Paul Verlaine (18)
Prosa
Bernard Wallner: Peep (27); Sabrina Ortmann: Brief aus der Hölle (29); Peter Bähr: Über Franz (30)
Scriptum-Kurzkrimi
H.P. Karr & W. Wehner: Der absolute Höhepunkt (1. Teil) (24)
Lyrik
Gedichte von Irene Alice Baumgartner (9), Katja Eggenberger (5), Kathrin Fischer (24), Carlo Gianola (6), Volker Seliger (30,31)
Bücherschau (21)
Bajiyoperak, Inka Sunrise; Irmscher, Antike Fabeln; Bremer, Unter Kannibalen; Schütt, Die Erotik des Verrats; Van Doren, Geschichte des Wissens; Laschitza, Im Lebensrausch trotz alledem; Moor, Hans Jakob lügt; Ferstl, Gräser tanzen; Golla/Zeidler, In-ter-net; Edinger, Seelen-Blues; Wosniak, Pietà; Plinke, Deutsches Jahrbuch für Autoren 1996/97; Baumgartner, Der Clown; Grill/Moser, Stilles Land an der Grenze; Mell, Borderline-Lyrik; Vetere, Die ungestillten Säuger; Maples, Knochengeflüster; Tettamanti/Bernasconi, Manifest für eine liberale Gesellschaft;
Rezensionen (22)
Georges Raillard: Rost, R(h)einfälle, Edition Cologne; Bernd Giehl: Schwikart, Alle Abwege führen durch Rom, Avlos Verlag; Charles Stünzi: Turmbund-Gesellschaft Innsbruck, Fliehende Ziele, Lyrik-Anthologie; Brigitte Pixner: Uhlmann, Der Kuss der Sphinx, Edition Spektrum; Al’ Leu: De Roulet, Die blaue Linie, Limmat Verlag; Clemens Umbricht: Stricker-Hofer, mit den i-punkten Deiner küsse, Voralberger Verlagsanstalt; Brigitte Pixner: Rückleben, Winterherz, Lit Verlag; Liane Biberger: Nöske, Mein Leben mit Kittekat, Bunte Raben Verlag
Grafik
Werner Blattmann: Karikatur, Zeichnung (4); Harald Goldhahn: Karikatur, Zeichnung (14)
Literaturservice (32,33)
Nachrichten, Wettbewerbe, Adressen
Leserbriefe/Kleinanzeigen (34)
Impressum (28)
 Heft 25 / 1996
Heft 25 / 1996
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Terra incognita» – Jenseits von Koalas und Känguruhs, Australiens Literaturlandschaft)
Der Gastkommentar
Ines Schneider-Thorn: Von der Freiheit (3)
Titel-Thema
Mathias Adelhoefer: Terra incognita – Die Literaturlandschaft Australiens (4)
Report
Rüdiger Heins: Korruption in Lackschuhen, Der «freie» kritische Schriftsteller in Deutschland – ein Trauerspiel (18)
Sprache
Horst J. Kleinmann: Die «Ku im Flusssand», Rechtschreibreform – Ein jahrelanges Tauziehen ist zu Ende (10)
Portrait
Kai Engelke: «Uns ist nicht mehr viel Zeit gegeben», Gespräch mit dem deutschen Lyriker Günter Kunert (14)
In memoriam
Christine A. Jossen: «Ich bin immer eine Fremde», Zum Tode der Basler Schriftstellerin Adelheid Duvanel (20)
Prosa
Monika Böss: Sommerfreuden (31); Claudia Glanzmann: Wintertag (35)
Satire
Udo Dickenberger: Über die Bibliotheken (28)
Scriptum-Kurzkrimi
H.P. Karr & W. Wehner: Der absolute Höhepunkt (2. Teil) (32)
Lyrik
Gedichte von Thomas T. Beck (27), Dietrich Dosdall (27), Frederike Haberkamp (11), Bernd Jaeger (16), Alfons Jestl (5,6,7), Wilhelm Riedel (27), Wolfgang Weigel (34), Peter Würl (27)
Biographien der Lyriker/innen (9)
Rezensionen (22)
Carla Kraus: Lutz, Die Mauern sind unterwegs, Ammann Verlag; Bernd Giehl; Senft, Diskurs über den Fluss, Egloff Verlag; Liane Biberger: Edition Leu, Lyrik-Anthologie 90/94; Rosemarie Schulak: Margreiter, Die Meister des Schweigens, Freya Verlag; Georges Raillard; Karau, Buschzulage, Dietz Verlag; Volker Koesling: Zahno, Doktor Turban, Bruckner&Thünker Verlag; Rainer Wedler: Sayer, Kohlrabenweißes, Klöpfer&Meyer Verlag; Charles Stünzi: Sternmut, Gedichte, Rhön Verlag
Neuerscheinungen (25)
Thibaux, Das eisige Gold; Lösto, Bewegende Augenblicke; Holliger, Aargau; Beetz, Kurzschluss im Hirnkasten; Jehle, Ulrike; Hartmann, Stumme Zeugen; Klinghardt, Lehrbuch der Psycho-Kinesiologie; Brodinger, Wie ein dunkelgrauer Regenbogen; Perko/Pechriggl, Phänomene der Angst; Köhler, Von Mensch zu Mensch; Behrenbeck, Der Kult um die toten Helden; Matthes, Apfeluhr; Pommer, Aschengrube; Vogel, Über das Hören; Blunck, Krieg und Bereinigung; Williams, Hard Core; Decaux, Eduard VIII. und Wallis Simpson
Karikatur
Harald Goldhahn: Cartoon (26)
Literaturservice (36)
Nachrichten, Wettbewerbe, Adressen
Leserbriefe/Kleinanzeigen (38)
Impressum (24)
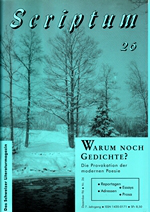 Heft 26 / 1996
Heft 26 / 1996
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Warum noch Gedichte?» – Die Provokation der modernen Poesie)
Der Gastkommentar
Jakob Fuchs: Wozu Literatur? (3)
Titel-Thema
Johann Voss: Warum noch Gedichte? Die Provokation der modernen Poesie – Eine Meditation (4)
Szene-Report
Kai Engelke: Alles ist o.k. und wird immer okayer, Poetry Slams – was ist das? (10)
Interview
Christine A. Jossen: Schreiben als Gegenentwurf, Gespräch mit dem Schweizer Dichter und Romancier Pierre Imhasly (13)
Austria-Millenium
Beate Hiltner-Hennenberg: 1000 Jahre wie ein Tag, Von der Klosterliteratur zur Staatssubvention – Ein Millenium österreichischen Schreibens (14)
Friedenspreis
Horst J. Kleinmann: Das Leben verwandeln – Mario Vargas Llosa erhält Deutschen Friedenspreis (15)
Prosa
Alexandra Lavizzari: Nordensommer (20); Walter Landin: Flugphase (23)
Satiren
Konrad Vogel: Brieföffnen (26); Wolfgang Reus: Bascho! (31)
Scriptum-Kurzkrimi
Manfred Maurer: Orgon Welles (1. Teil) (28)
Lyrik
Gedichte Alice I. Baumgartner (30), Gabriele Markus (11,27), Frauke Ohloff (30), Lilli Ronchetti (30), Peter Schantz (5,6), Ueli Schenker (30)
Biographien der Lyriker/innen (9)
Grafik
Horst Knauf: Tuschezeichnung (25); Harald Goldhahn: Karikatur (26); Iven Fritsche: Bildgedicht (36)
Neuerscheinungen (17)
Stanischeff, Tilli-Willi und die andern; Cankar, Das Haus der Barmherzigkeit; Brunner, die liebe ist nicht was ihr denkt; Neumann, Nichts; Pfaff, Je suis comme je suis; Altmann, Sinndeutende Annäherungen; Promies, Reisen in Zellen; Hübel, Gedichte; Pei, Annas Umweg; Baco, Literatalk; Loidl, Farnblüte; Sayer, Kohlrabenweißes; Kramlovsky, Eine unauffällige Frau; Mägerle, Augen im Kopf; Stüwe, Gartenfrieden
Rezensionen (18)
Volker Koesling: Vallaster, Die Tuchhändlerin, Benziger Verlag; Bernd Giehl: Weber, Lilla Petras Spuren führen ins Engadin, Ikos Verlag; Heinz Hafner: Andreotti, Traditionelles und modernes Drama, Haupt Verlag; Beate Hiltnier: Richter, Literaturkorrespondenz Nr.1, Magazin; Rudolf Kraus: Barwasser, Mutterkorn, A1 Verlag; Markus Schurr: Zach, Monrepos, Klöpfer&Meyer Verlag; Silvia Mathieu: Gänger, Ein Fest für Merle, Adonia Verlag; Klaus Hübner: Klair, Ich hüpfe nicht auf deinem Racket, Janus Verlag
Literaturservice (32)
Nachrichten, Ausschreibungen, Adressen
Briefe an die Redaktion (34)
Impressum (16)
 Heft 27 / 1997
Heft 27 / 1997
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Sprache den Sprachlosen» – Zur sozialen Aufgabe der Literatur)
Der Gastkommentar
Angela Jursitzka: Das musst Du lesen (3)
Titel-Thema
Theodor Weissenborn: Sprache den Sprachlosen, Zur sozialen Aufgabe der Literatur (4)
Portrait
Christine A. Jossen: Mit Witz und robuster Phantasie, Die Schweizer Erzählerin Helen Meier (8)
Report
Kai Engelke: Literatur ins Leben tragen, Die Literaturbüros in Deutschland (10)
Medien
Horst J. Kleinmann: Die Intrige geht zum Regenbogen, TV-Serien – nun als Magazine vermarktet (12)
Austria
Beate Hiltner-Hennenberg: Wechseljahre – Steht Wiens Kulturpolitik vor einer Wende? (15)
Prosa
Daniel Zahno: Napf (20); David Notter: Selbstmord (24)
Scriptum-Kurzkrimi
Manfred Maurer: Orgon Welles (2. Teil) (28)
Lyrik
Gedichte von Anna Arning (11), Dietrich Dosdall (6), Esther Hermann (27), Renate Irle (9), Wilhelm Riedel (5), Hendrik Rost (23), Wolfgang Weigel (21), Tullio Zanovello (31)
Biographien der Lyriker/innen (7)
Graphik
Harald Goldhahn: Karikatur (14)
Neuerscheinungen (17)
Weiß, Shalom; Pepin, Erotische Begegnungen; Brownlow, Pioniere des Films; Schröter, Sturm und Stille; Segler, Vater mein Vater…; Ruh, Dichter und Schriftsteller Deutschlands 1996; Lorenz, Literaturzeitschrift Rhabarber-A Nr.1; Vio, Dreisprachig-Trilingual-Trilingue; Suter, Der Zeitsprung; Lang, Nebel Leben; Stünzi, 50 Jahre Lyrik von Rene Marti; Sternmut, Das Zeitmesser
Rezensionen (18)
Bernd Giehl: Taugwalder, Melodie der Schöpfung, Glendyn Verlag; Liane Biberger: Pixner, Der Geist aus der Flasche trinkt Coca Cola, Heyn Verlag; Rosemarie Schulak: Baum, Agnes Stöcklin, Verlag freier Autoren; Karlheinz Schreiber: Jégou, Abtrift/Dérive, Atelier Verlag; Rudolf Kraus: Meier-Lenz, Die Schönheit einer Fledermaus, Edition Literarischer Salon; Klaas Willems: Deutsch, Die Physik der Welterkenntnis, Birkhäuser Verlag; Rainer Goldhahn: Leifert, Damit der Stein wächst, Horlemann Verlag; Carla Kraus: Konrad, Die Ration, Edition L Hockenheim;
Literaturservice (32-34)
Nachrichten, Ausschreibungen
Leserbriefe (34)
Impressum (16)
 Heft 28 / 1997
Heft 28 / 1997
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Crescendo im Text» – Über die Sprache als Musik und die Musik als Sprache)
Titel-Thema
Simona Ryser: Crescendo im Text, Über die Sprache als Musik und die Musik als Sprache (4)
Musik&Sprache
Christian Baier: Der Satzbau zu Babel, Zur sprachlichen Selbst-Vereinheitlichung der Musik im 20. Jahrhundert (8)
Report
Horst J. Kleinmann: Vom «Schaubusen» zum «Mord bizarr» – Erotische Literatur kontra TV-Sexfilme (12)
Szene
Kai Engelke: Puncher und Poeten, Über die Boxbegeisterung der Literaten (14)
Der neue Roman
Christine A. Jossen: Vom Glück im Unglück – Klaus Merz, «Jakob schläft» (16)
Prosa
Peter Wolter: Der Fluglotse (23); Konrad Pauli: Bajazzo (27)
Scriptum-Kurzkrimi
Gaby Zryd: 22, vlà les flics! (30)
Lyrik
Gedichte von Ulrich Bauer-Staeb (5), Peter Gerdes (6), Bruno Hain (13), Alfons Huckebrink (15), Karl Heinz Köster, Ursula Kramm Konowalow
Biographien der Lyriker/innen (7)
Graphik
Harald Goldhahn: Karikatur (25)
Neuerscheinungen (19)
Damshäuser, Am Rande des Reisfeldes; Kaufmann, Im Schloss zu Mecklenburg und anderswo; Harris, Wenn Einstein recht hat…; Schütt, Stein des Anstoßes – Gespräche mit Hrdlicka; Jovalekic, Ein Mandelbaum im Weltall; Balmer/Dolder, Susanne D. – Ein Leben als Prostituierte; Zytglogge-Werkbuch, Stadtentdeckungen
Rezensionen (20)
Rosemarie Schulak: Schröter, Sturm und Stille, Arnim Otto Verlag; Karl-Heinz Schreiber: Schmidt-Macon, Lob der Piranhas, Elfenbein Verlag; David Wachter: Beeler, Blues für Nichtschwimmer, Haymon Verlag; Carla Kraus: Mieck, Gegenlicht, Berdel Edition; Brigitte Pixner: Engelke, Surwold Blues, Rhön/Hohmann Verlag; Rainer Wedler: Gasseleder, Der Weg zurück, Selbstverlag; Irene A. Baumgartner: Schulak, Als ein Himmelsstreif, Brjag Print Varna
Literaturservice (32)
Nachrichten, Ausschreibungen
Impressum (18)
H eft 29 / 1997
eft 29 / 1997
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Das Spiel der Leser» – Literatur im Zeitalter der Virtual Reality)
Kommentar zur Zeit
Rosanna Müller-Brusco: Ein natürlicher Notausgang (3)
Titel-Essay
Günther Kirchberger: Das Spiel der Leser (4)
Report
Kai Engelke: «Die Welt ist eine Schreibe» – Ist die Schriftstellerei erlernbar? (1.Teil) (10)
Prosa
Peter Bußjäger: Versuch einer Anpassung an moderne Zeiten (16); Uwe Zabel: Der Besuch (20); Daniela Hättich: T-O-T (24); Barbara Macek: Stossgebet (27); Sebastian Hirzenreuther schreibt… (29)
Satiren
Wolfgang Bittner: Privatisierung (21); Udo Dickenberger: Dichterlesung (22)
Lyrik
Gedichte von August G. Holstein (5), Ernst Nef (19), Peter Albrecht (26), Patrick Probst (26), Matthias Burki (26), Wilfried Krien (26), Katja V. Taver (30), Cornelia Schmid (31), Christoph Bauer (30,31), Ingrid Quarshie (31)
Graphik
Angela von Moos: Textgraphik 1994 (7)
Zitate (6)
Rezensionen (12)
Peter Klusen: Aussen und innen, Basta Verlag; Bernd Giehl: Rosenzopf, Blutgeld, Edition Leu; Alfons Huckebrink: Jovalekic, Ein Mandelbaum im Weltall, Rhön Verlag; Bernd Giehl: Damm, Lichtspur im Nebel, Edition L/Czernik; Wolfgang Sinhuber: Korff, Schmäht ihr mich – ich muss es dulden, Gollenstein Verlag; Klaus Hübner: Löffler, Vom Einfluss des Fernsehens auf die Zeitungskultur, Picus Verlag; Peter G. Bräunlein: Grashof, Der Mantel des Fuhrmanns, Nagel&Kimche Verlag; Georges Raillard: Danieli, Die Ruhe der Welt am Gäbris, Otto Müller Verlag
Neuheiten (15)
Literaturzeitschrift Perspektive Nr.33; Literaturzeitschrift Hundspost Nr.7; Literaturzeitschrift Muschelhaufen Nr.36; Literaturzeitschrift Wortwahl Nr.1; CD Indonesische Lyrik; Hartge, Handbuch deutschsprachiger Literaturzeitschriften; Gemperle, Gegengift; Bussmann, Die Rückseite des Lichts; Herburger, Die Liebe; Walker, Zeichen am Himmel; Dickinson, Guten Morgen Mitternacht; Mayer-König, Verkannte Tiefe; Schaffner, Eine Reise; Schwend/Bohren, Faszination Schweiz; Dorner, Lust und Frust beim Schreiben; Schwarz, Melancholie – Figuren und Orte einer Stimmung; Kneipp, Kneipps Hausapotheke; Ammann, Ingeborg Bachmann und die Öffentlichkeit
Nachrichten (32)
Autorinnen- und Autoren-Vitae (33)
Varia (34)
Ausschreibungen, Kleinanzeigen, Termine, Wettbewerbe
Impressum (2)
 Heft 30 / 1997
Heft 30 / 1997
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Ibsens und Hamsuns Erben» – Norwegens Literatur im 20. Jahrhundert)
Kommentar zur Zeit
Wilhelm Busch: Der harte Winter (3)
Titel-Thema
Dirk Levsen: Ibsens und Hamsuns Erben (4)
Report
Kai Engelke: «Schreiben bereichert Ihr Leben» – Ist die Schriftstellerei erlernbar? (2.Teil) (10)
Medien
Horst J. Kleinmann: Blöde Anmache, coole Preise – Wie Werbung die Sprache verhunzt (12)
Interview
Thomas Duschlbauer: «Der gute Mensch von Österreich», Interview mit Konrad P. Liessmann (14)
Prosa
Michael Marrak: Der Geist eines wilden Gesichts (20); Tullio Zanovello: Treibhaus für Aussenseiter (23); Leo Scheyda: Bodo und das Speckmesser (26); Sebastian Hirzenreuther schreibt an… (29)
Satire
Dietmar Füssel: Der Mann mit dem Gewehr (22); Thomas Glavinic: Zeitgeist (24)
Lyrik
Gedichte von Elsbeth Maag (30), Gudrun Seidenauer (31)
Rezensionen (16)
Irene A. Baumgartner: Pridgar, irr orgel klang, Kukuruz Verlag; Klaus Hübner: Herburger, Die Liebe, A1 Verlag; Markus Schurr: Ammann, Denn ich habe zu schreiben…, Drava Verlag; Rainer Goldhahn: Supino, Die Schöne der Welt, Nagel&Kimche Verlag; Irene A. Baumgartner: Dickinson, Guten Morgen Mitternacht, Diogenes Verlag; Rosemarie Schulak: Stephan-Kühn, Ich – König von Siam, KoFa Verlag; Peter Bräunlein: von Arndt, Der 40. Tag vor Sophienlund, Segler Verlag; Al’ Leu: Himmelberger, Kaspar – Café des Pyrénées, AutorInnenverlag
Neuheiten (18,19)
Pixner, Das Kuckucksei; Brenneisen/Ruge, Böse Nachbarn; Bichsel, Schöne Schifferin; Ammann, Schöne Aussicht; Leifert, wenn wach genug wir sind; Petri-Sutermeister, Nordische Streifzüge; Verband Geistig Schaffender Österreich, Mit einem Augenzwinkern; Cankar, Aus fremdem Leben; Allner, Melanie?; Gerber, Mit Nagelschuhen durch Eiscreme; Schulze/Ssymank, Das deutsche Studententum; Hoefer, Wie das Volk spricht; Hoche, In diesem unserem Lande; Krones/Wagner, Anton Webern und die Musik des 20. Jahrhunderts; Glaser, Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1995; Literaturkalender 1998, Aufbau Verlag; Ruiss, Literarisches Leben in Österreich ’97; Prokop, Auf den Spuren Wolfgang Harichs; Nikolic, …und dann zogen wir weiter; Pardey, Jean Tinguely und Basel; Chesi, Magie und Heilkunst Afrikas; Divery/Kuenne, Myanmar – Land der goldenen Pagoden; Eska, Schall und Klang – Wie und was wir hören; Fischer-Homberger, Hunger-Herz-Schmerz-Geschlecht; Waller, Alles ist nur Übergang; Heckel, Frei sprechen lernen; Mann/Ruge, Die ideale Frau
Nachrichten (32)
Ausschreibungen, Kleinanzeigen (34)
Autorinnen- und Autoren-Vitae (33)
Impressum (2)
 Heft 31 / 1998
Heft 31 / 1998
(Das Schweizer Literaturmagazin – Titel-Thema: «Fantasy» – Monster und Magien in der modernen Literatur)
Kommentar zur Zeit
Giovanni G. Casanova: Vom vollkommenen Genuss (3)
Titel-Thema
Philipp Schaffner: Das Leben ist die Illusion, Monster und Magien in der modernen Literatur (4)
Interview
Philipp Schaffner: Phantasie als Sinnesorgan – Der Schweizer Fantasy-Autor Christoph Zimmer (8)
Portrait
Kai Engelke: «Schriftsteller sind keine moralischen Instanzen!», Gespräch mit Hannelies Taschau (10)
Report
Horst J. Kleinmann: Mord(s)gedanken in der Provinz, Krimi-Autoren setzen auf vertraute Landschaften (12)
Literaturszene Österreich
Thomas Duschlbauer: Artbite – Kunst mit Biss, Wiens Salonkultur ist wieder auferstanden (14)
Essays
Erwin Jäger: «Lasst mich in Ruhe!», Zum 100. Geburtsjahr von Bertold Brecht (20); Andreas U. Sommer: Zur Ideologie der Sinnlosigkeit (22)
Prosa
Guido Brozek: Der Auftrag (24); Rosemarie Zens: Mensch&Tier, Meditation (25); Gerhard Ochs: 3 Texte (26); Sebastian Hirzenreuther schreibt an… (29)
Lyrik
Gedichte von Guntram Balzer (30,31), Frank Lingnau (30), Wanda Schmid (31)
Rezensionen (16,17)
Liane Biberger: Kittelmann, Dahinter kommen, AV Verlag; Kai Engelke: von Arx, Marie Barmettler oder Der Sinn, Weltwoche-ABC Verlag; Klaus Hübner: Hövel/Hagens, Mach’s gut, Liebling, Tomus Verlag; Bernd Giehl: Zimmermann, Indonesische Albumblätter, Zytglogge Verlag; Volker Koesling: Schütt, Die Irren sind auch nicht mehr die einzig Normalen, Athena Verlag; Rosemarie Schulak: Koller-Fanconi, Wellen, KoFa Verlag; Peter Klusen: de Roulet, Mit virtuellen Grüssen, Limmat Verlag; Alfons Huckebrink: Dedovic, Von edlen Mördern und gedungenen Humanisten, Drava Verlag
Neuheiten (18,19)
Mazumdar, Foucault; Anwander, Büffelmilch und Fladenbrot; Höner, Am Abend als es kühler ward; Hoche, Das Evangelium nach Hoche; Gretzfeld, Märchen aus 1001 Nacht; Renold, Letzte Liebe; Rappers, Menschenspiele; Boesch, Der Kreis; Dettwiler-Rustici, Berner Lauffeuer; Wolfgang Weigel, Gedichte; Geist, Morgen Blaues Tier; Wisser, Weil man lieber nicht am Ende sterbert; Donnell, Die Goldberg-Variationen
Nachrichten (32)
Autorinnen- und Autoren-Vitae (33)
Ausschreibungen, Kleinanzeigen (34)
Impressum (2)
.
.
Lutz Jäncke: «Macht Musik schlau?»
.
Das Gehirn und die Musik
Walter Eigenmann
.
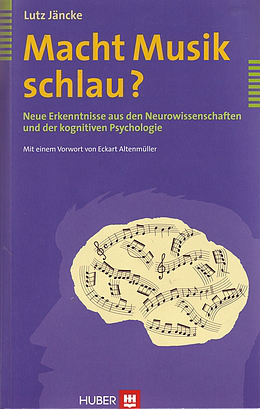 Im Anfang war Mozart. Genauer: Der sog. «Mozart-Effekt». Denn im Jahre 1993 sorgte ein Artikel in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift «Nature» für weltweite Furore, wonach durch das passive Hören klassischer Musik, insbesondere der Werke des berühmten Salzburger Genies, sich das räumliche Vorstellungsvermögen signifikant verbessern soll. Ausgangspunkt der entsprechenden Studien war ein Experiment des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und der Psychologin Frances Rauscher, welches mit 36 Probanden durchgeführt wurde, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen mussten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Klaviersonate in D-Dur / KV 448 (Video) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis. In der Folge erhitzte sich die Pro-Kontra-Diskussion ob diesem berühmt-berüchtigten «Mozart-Effekt» (Video) weit über die Natur- und Geisteswissenschaften hinaus bis tief in die Schulpädagogik, ja gar Bildungspolitik hinein – ein Mythos war geboren.
Im Anfang war Mozart. Genauer: Der sog. «Mozart-Effekt». Denn im Jahre 1993 sorgte ein Artikel in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift «Nature» für weltweite Furore, wonach durch das passive Hören klassischer Musik, insbesondere der Werke des berühmten Salzburger Genies, sich das räumliche Vorstellungsvermögen signifikant verbessern soll. Ausgangspunkt der entsprechenden Studien war ein Experiment des US-amerikanischen Physikers Gordon Shaw und der Psychologin Frances Rauscher, welches mit 36 Probanden durchgeführt wurde, die nach dem Anhören verschiedener Musikstücke Aufgaben aus IQ-Tests lösen mussten. Dabei erzielte die Gruppe, die Mozarts Klaviersonate in D-Dur / KV 448 (Video) gehört hatte, ein signifikant besseres Ergebnis. In der Folge erhitzte sich die Pro-Kontra-Diskussion ob diesem berühmt-berüchtigten «Mozart-Effekt» (Video) weit über die Natur- und Geisteswissenschaften hinaus bis tief in die Schulpädagogik, ja gar Bildungspolitik hinein – ein Mythos war geboren.
Doch was ist wirklich dran an der (wohlfeilen, eigentlich revolutionären) Hoffnung, Musik verhelfe dem Menschen zu mehr intellektueller Kompetenz? Welche Auswirkungen haben überhaupt Musikmachen und Musikhören auf den Menschen, seine Kognition, seine Psyche? Und: Lernt man schneller/besser mit Musik-Unterstützung? Oder: Wie wirken Töne therapeutisch auf Demenzerkrankte? Grundsätzlich: Wie geht das menschliche Gehirn mit dem komplexen Phänomen «Musik» eigentlich um?
Diesen und einer Reihe weiterer Fragen geht nun umfangreich die jüngste Publikation eines der renommiertesten deutschsprachigen Neurophysiologen nach, des Zürcher Gehirnforschers Prof. Dr. Lutz Jäncke. In seinem Buch «Macht Musik schlau? – Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie» breitet er in 13 Kapiteln den aktuellen Stand der neuropsychologischen und -physiologischen Diskussion aus. Dabei fördert der gebürtige Bochumer Ordinarius an der Universität Zürich eine ganze Reihe von interessanten, ja spektakulären Befunden und Erkenntnissen aus seinem Fach zutage – aufsehenerregend keineswegs nur für den Laien: Jänckes Forschungsergebnisse gerade auf dem Gebiete der Musik-Neurowissenschaften stoßen mittlerweile in den angesehendsten Peer-Reviewed-Zeitschriften auf großes Interesse und beeinflussen damit prägend die aktuelle Diskussion.
Hierzu trägt sicher nicht nur die wissenschaftliche bzw. methodische Kompetenz des Autors bei, sondern auch seine Fähigkeit, komplexe Forschungsinhalte mit geradezu «leichter» Sprachstilistik, zuweilen gar mit unverhohlen-humorvoller Fabulierlust zu servieren. Sein «Macht Musik schlau?» liest sich, wiewohl mit naturwissenschaftlichen, statistischen, methodischen und analytischen Details geradezu vollgestopft, überraschend unkompliziert, ja erfrischend spannend – Populärwissenschaft im allerbesten Sinne. Sein Vorwort-Verfasser, der Hannoveraner Berufskollege Eckart Altenmüller attestiert ihm denn auch zurecht, er erziehe «den Leser zur kritischen Analyse der Fakten, ohne als Oberlehrer aufzutreten».
Nachfolgend seien die wesentlichsten wissenschaftlichen Erkenntnisse von «Macht Musik schlau?» repliziert – teils zitierend, teils zusammenfassend, Jänckes eigenem Aufbau der Buch-Abschnitte folgend. Selbstverständlich kann es sich dabei allenfalls um eine sträfliche Verknappung der umfangreichen und vielfältigen Inhalte handeln, um einen groben Überblick auf eine Veröffentlichung, welche mit Sicherheit den wissenschaftlichen Diskurs auf diesem Gebiet für eine längere nächste Zeit wesentlich mitbestimmen dürfte. (Copyright aller wissenschaftlichen Abbildungen&Tabellen: L.Jäncke & Huber-Verlag Bern).
1. Der Mozart-Effekt
Zwar schließt Jäncke nicht aus, dass sich bei Versuchspersonen nach dem Hören von Mozart-Musik «ein Hirnaktivierungsmuster einstellt», welches eine «optimale Grundlage für die später zu bearbeitenden räumlichen Aufgaben bietet». Ein spezifischer Effekt des kurzzeitigen Hörens von Mozart-Musik auf räumliche Fertigkeiten könne hingegen «nicht zweifelsfrei nachgewiesen» werden: «Sofern Effekte vorliegen, treten sie immer in Bezug zu Ruhe- und Entspannungsbedingungen auf».
2. Einfluss des Musikunterrichts auf schulische Leistungen

Wunderkind Mozart: «War Mozart ein Genie? Wie sind seine musikalischen Leistungen wirklich entstanden? Gibt es überhaupt Genies?» (Lutz Jäncke)
Jäncke hat zahlreiche sog. «Längsschnitt-Untersuchungen» internationaler Forschergruppen herangezogen und analysiert bzw. kritisch gewürdigt – besonders populär hierzulande: die deutschsprachige «Bastian-Studie», die laut Jäncke allerdings aus methodischen Gründen «unbrauchbar» sei -, wobei grundsätzlich alle diese Forschungen thematisierten, «dass zusätzlicher Musikunterricht einen günstigen Einfluss auf schulische Leistungen, verschiedene kognitive Funktionen (insbesondere das sprachliche Gedächtnis) oder auf verschiedene Intelligenzmaße» haben könne.
Trotzdem bleibt der Buch-Autor skeptisch: Die meisten dieser Studien wiesen «methodische Mängel auf, die es nicht erlauben, die spezifische Wirkung des Musikunterrichts zu belegen». Gleichzeitig blendet aber Jäncke nicht aus, dass chinesische Untersuchungen überzeugend zeigten: Kinder mit Musikunterricht erbringen bereits nach einem Jahr «bessere verbale Gedächtnisleistungen». Jänckes Theorie hierzu: «Der Grund ist, dass die chinesische Sprache als tonale Sprache im Hinblick auf die auditorischen Verarbeitungsgrundlagen viele Ähnlichkeiten mit der auditorischen Verarbeitung der Musik aufweist.»
Insgesamt bedauert der Autor, dass «kaum eine Studie derzeit die Dauerhaftigkeit möglicher günstiger Effekte des Musikunterrichts» thematisiere. Und kritisch fragt er schließlich, welchen Zweck Musiktraining oder Musikerziehung eigentlich haben sollen: «Ist es eher zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit geeignet, oder ist es vielmehr eine wunderschöne Kulturtätigkeit, die Freude und Befriedigung unabhängig von schulischen Leistungsaspekten schenken kann?»
3. Musiker kontra Nicht-Musiker
Aufgrund «gut kontrollierter Querschnitt-Untersuchungen» zeigen sich gemäß Autor «konsistent bessere verbale Gedächtnisleistungen bei Musikern» gegenüber Nicht-Musikern. Außerdem gebe es Hinweise, dass bei Musikern auch das visuelle Gedächtnis besser sei.
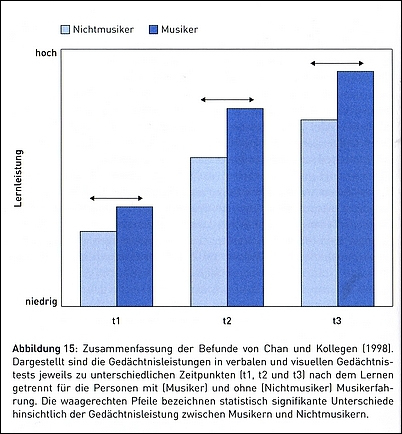 Belegt sei weiters, dass Musiker bzw. Personen mit Musikerfahrung bessere Leistungen in visuell-räumlichen Tests aufweisen. Dies hänge wahrscheinlich damit zusammen, dass «verschiedene Aspekte der Musik in unserem Gehirn räumlich repräsentiert sind. Durch das Musizieren werden diese visuell-räumlichen Funktionen offenbar häufig traniert.» Insofern sei es durchaus plausibel, dass diese Funktionen auch für andere, nichtmusikalische Leistungen genutzt werden können.
Belegt sei weiters, dass Musiker bzw. Personen mit Musikerfahrung bessere Leistungen in visuell-räumlichen Tests aufweisen. Dies hänge wahrscheinlich damit zusammen, dass «verschiedene Aspekte der Musik in unserem Gehirn räumlich repräsentiert sind. Durch das Musizieren werden diese visuell-räumlichen Funktionen offenbar häufig traniert.» Insofern sei es durchaus plausibel, dass diese Funktionen auch für andere, nichtmusikalische Leistungen genutzt werden können.
Da das Rechnen, der Umgang mit Zahlen stark von diesen angesprochenen «visuell-räumlichen Fertigkeiten abhängt, bestehe außerdem ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Musizieren und verschiedenen Rechenleistungen. Jäncke: »Einige Untersuchungen unterstützen die Hypothese, dass Musizieren und Musikbegabung die Rechenleistung fördern«.
4. Musikhören und Lernen
Die Frage, ob (und wenn ja: welche) Musik beim Lernen hilfreich sei, wurde und wird stets umstritten diskutiert. Diesbezüglich analysiert Jäncke einige mehr oder weniger anerkannte Thesen bzw. Verfahren wie z.B. die Suggestopädie und verwandte Richtungen, welche eine positive Wirkung des passiven Hintergrundmusik-Hörens propagieren. Wiederum schließt Forscher Jäncke eine «Evozierung bestimmter Hirnaktivierungsmuster», die für das Lernen besonders günstig sind, auch hier nicht aus. Die arbeitspsychologischen Untersuchungen bzw. Experimente haben indes sowohl «positive wie negative Einflüsse von HIntergrundmusik auf verschiedene Leistungsmaße» belegt, so dass auf diesem Gebiet weitere Forschungen notwendig seien.
5. Musik und Emotionen
Die Erfahrung ist alltäglich: Wenn man angenehme Musik hört, wird die psychische Leistungsfähigkeit gesteigert. Mehr noch: «Wir lernen, bestimmte Musikstücke zu mögen oder nicht zu mögen. Insofern sind auch an der Entwicklung von Musikpräferenzen Lernprozesse beteiligt» (Jäncke). Der Autor geht hier Problemfeldern nach wie: Was sind die Ursachen dafür, dass wir bestimmte Musik zu mögen scheinen und andere Musik ablehnen? Gibt es so etwas wie eine universell bevorzugte Musik? Wann hören wir welche Musik? Wie hören wir diese Musik, und vor allem: Wer hört welche Musik?
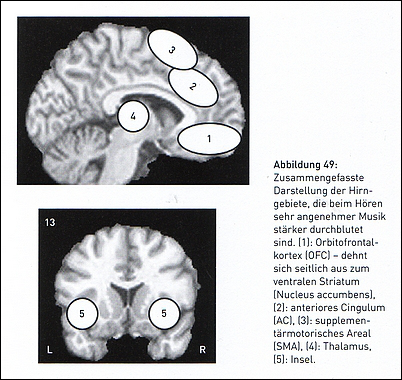 Bei solchen Fragestellungen werden die Befunde Jänckes besonders interessant, reichen sie doch womöglich an das musikkulturelle Selbstverständnis ganzer Gesellschaften heran, bzw. müssen musiksoziologische und musikästhetische Revisionen vorgenommen werden im Zusammenhang mit der hörpsychologischen Konsonanz-Dissonanz-Problematik. So hinterfragt Neurophysiologe Jäncke einerseits, ob die «Konsonanz-Dissonanz-Unterscheidung wirklich mit angeborenen emotionalen Präferenzen verbunden» ist, oder ob nicht jene Musikwissenschaftler recht haben, welche argumentieren, dass «die Präferenz für konsonante Musik, Klänge und Intervalle eher durch häufiges Hören dieser Art von Musik und Klängen bestimmt wird.»
Bei solchen Fragestellungen werden die Befunde Jänckes besonders interessant, reichen sie doch womöglich an das musikkulturelle Selbstverständnis ganzer Gesellschaften heran, bzw. müssen musiksoziologische und musikästhetische Revisionen vorgenommen werden im Zusammenhang mit der hörpsychologischen Konsonanz-Dissonanz-Problematik. So hinterfragt Neurophysiologe Jäncke einerseits, ob die «Konsonanz-Dissonanz-Unterscheidung wirklich mit angeborenen emotionalen Präferenzen verbunden» ist, oder ob nicht jene Musikwissenschaftler recht haben, welche argumentieren, dass «die Präferenz für konsonante Musik, Klänge und Intervalle eher durch häufiges Hören dieser Art von Musik und Klängen bestimmt wird.»
Fest steht gemäß verschiedenen Studien, dass schon bei vier Monate alten Babys Präferenzen für konsonante Klänge und Intervalle vorliegen – gemäß Lutz Jäncke aber nicht das schlagende Argument dafür, dass dabei «ausschließlich genetisch bestimmte Mechanismen» zum Tragen kommen: «Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Babys schon häufig konsonante Musik gehört und bereits unbewusst eine Vorliebe für diese Art der Musik entwickelt haben». Denn grundsätzlich, so die Erkenntnis des Neurophysiologen: «Wir mögen, was wir häufig hören». Und weiter: «Obwohl insbesondere in der westlichen Kultur konsonante Musikelemente eher angenehme Reaktionen hervorrufen, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass gerade die menschliche Lernfähigkeit es ermöglicht, auch Dissonanz als angenehm zu erleben.» Schließlich: «Emotionale Musik stimuliert das limbische System. Angenehme Musik kann ein ‘Gäsenhautgefühl’ hervorrufen, dem ein Aktivierungsmuster des Gehirns zugrunde liegt, das auch bei Verstärkungen, bei der Befriedigung von Süchten und beim Lernen zu messen ist. […] Insbesondere die Entwicklung von musikalischen Vorlieben wird wahrscheinlich über das Belohnungssystem vermittelt.»
6. Wie verarbeitet das Gehirn Musik?
Wichtige Erkenntnisse gewann Jäncke durch die rasante apparatetechnische bzw. computergesteuerte Entwicklung z.B. auf den Gebieten der Elektro- und der Magnetenzephalographie, welche neuropsychologisch eine «präzise zeitliche Charakterisierung» auch der menschlichen Ton- bzw. Musikwahrnehmung erlaubt. Hier verweist der Wissenschaftler zusammenfassend auf den wichtigen Befund, dass während des Musikhörens «weite Teile des Gehirns im Sinne eines Netzwerkes aktiviert werden. Es besteht also die Möglichkeit, dass man mit musikalischen Reizen eine räumlich ausgedehnte Hirnaktivierung erreichen kann.» Insofern ist im Gehirn – ganz im Gegensatz zu Spekulationen in früheren Jahrhunderten – kein typisches «Musikwahrnehmungsareal» zu identifizieren – einfach deswegen, weil bei Musik schlicht besonders zahlreiche Hirnregionen involviert sind, woraus diverse positive «Transfer-Effekte» resultieren.
7. Die Musik und die zwei Hirnhemisphären
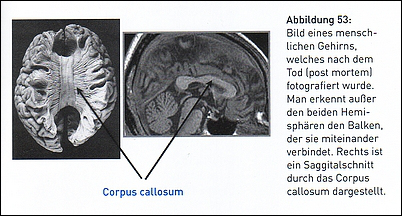 Jäncke: «Bei Musikern kann häufig festgestellt werden, dass sie Musik auch in jenen Hirngebieten verarbeiten, die eigentlich mit der Sprachverarbeitung betraut sind». Dementsprechend können bei Musikern sog. Amusien – hier ‘Motorische Amusie’: Störungen in der Produktion von Musikstücken; oder ‘Sensorische Aumusie’: Störungen in der Wahrnehmung von Musikstücken – auch auftreten, wenn Hirngebiete geschädigt sind, die bei Nichtmusikern nicht an der Kontrolle von Musikverarbeitungen beteiligt sind.
Jäncke: «Bei Musikern kann häufig festgestellt werden, dass sie Musik auch in jenen Hirngebieten verarbeiten, die eigentlich mit der Sprachverarbeitung betraut sind». Dementsprechend können bei Musikern sog. Amusien – hier ‘Motorische Amusie’: Störungen in der Produktion von Musikstücken; oder ‘Sensorische Aumusie’: Störungen in der Wahrnehmung von Musikstücken – auch auftreten, wenn Hirngebiete geschädigt sind, die bei Nichtmusikern nicht an der Kontrolle von Musikverarbeitungen beteiligt sind.
8. Wie produziert das Gehirn Musik?
Wenn man Musikstücke spielt, sind gemäß Jänckes Untersuchungen vielfältige Gedächtnisinformationen nötig: «Diese Informationen reichen von Tönen, Rhythmen und Melodien bis hin zu Erinnerungen an Episoden, Personen und Emotionen, die mit dem zu spielenden Musikstück assoziiert sind.» In diesem Zusammenhang geht der Autor auch auf die Tatsache ein, dass zahlreiche Musiker unter «erheblichen Ängsten und Sorgen hinsichtlich ihrer Spielleistung» leiden: «Sie sind teilweise derart gehemmt, dass sie nicht oder nur selten frei und locker ihren Spielfluss finden.» Kernspintomographische oder EEG-Messungen solcher Personen im Labor hätten ergeben, dass bei derartigen Blockaden insbesondere eine starke Aktivierung «frontaler Hirnstrukturen» feststellbar sei, was darauf hinweise, dass diese Hirngebiete «viel zu starke hemmende Einflüsse auf die anderen für die Musikproduktion ebenfalls wichtigen Hirngebiete ausüben». Aufgrund dieser Erkenntnis arbeite nun die Wissenschaft weiter an spezifischen Hirntrainingsmethoden für verbesserte Musikleistungen (Stichworte: «Neurofeedback», «Brain-Computer-Interface-Technik» u.a.)
9. Verändert Musizieren das Gehirn?
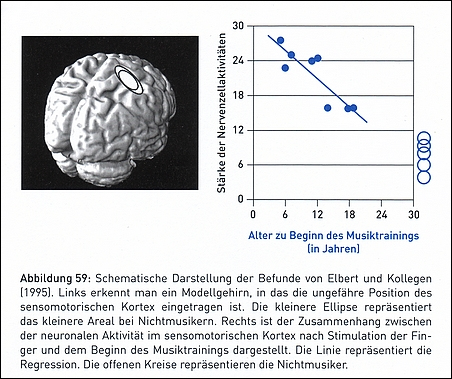 Dieser Frage widmet Lutz Jäncke einen besonders interessanten Abschnitt seines Buches. Er dokumentiert die überraschende Fähigkeit des menschlichen Gehirns zur anatomischen Anpassung bzw. zu einer Zunahme der «Dichte der grauen Substanz» (= u.a. Sitz der wichtigen «Synapsen»). Jäncke: «Intensives musikalisches Training ist mit erheblichen makroskopischen Veränderungen in Hirnbereichen gekoppelt, die besonders stark an der Kontrolle des Musizierens beteiligt sind. Diese anatomischen Veränderungen hängen offenbar von der Intensität und Häufigkeit des Musizierens ab. Je häufiger trainiert wird, desto ausgeprägter sind die Veränderungen».
Dieser Frage widmet Lutz Jäncke einen besonders interessanten Abschnitt seines Buches. Er dokumentiert die überraschende Fähigkeit des menschlichen Gehirns zur anatomischen Anpassung bzw. zu einer Zunahme der «Dichte der grauen Substanz» (= u.a. Sitz der wichtigen «Synapsen»). Jäncke: «Intensives musikalisches Training ist mit erheblichen makroskopischen Veränderungen in Hirnbereichen gekoppelt, die besonders stark an der Kontrolle des Musizierens beteiligt sind. Diese anatomischen Veränderungen hängen offenbar von der Intensität und Häufigkeit des Musizierens ab. Je häufiger trainiert wird, desto ausgeprägter sind die Veränderungen».
10. Musik und Sprache
Die neuere Erforschung des komplexen Beziehungsfeldes «Musik-Sprache» hat nach Jäncke bisherige Auffassungen stark revidiert. So könne z.B. die strikte funktionale und anatomische Trennung zwischen Sprache und Musik nicht mehr aufrecht erhalten werden: «Die Wahrnehmung der Sprache und Musik wird von stark überlappenden Nervenzellnetzwerken bewerkstelligt. Wichtig dabei ist auch, dass an der Analyse von Sprache und Musik beide Hirnhälften beteiligt sind.» Weiter: «Musik ist nach einem bestimmten Regelsystem aufgebaut. Dieses Regelsystem hat bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit dem Regelsystem der Sprache. Teilweise werden für die Analyse des Musikregelsystems gleiche Hirnstrukturen eingesetzt.» Eine der Konsequenzen solcher Forschungsergebnisse sind medizinische Ansätze: «Musikalische Interventionen werden erfolgreich für die Therapie von Sprachstörungen eingesetzt».
11. Musik und Alter
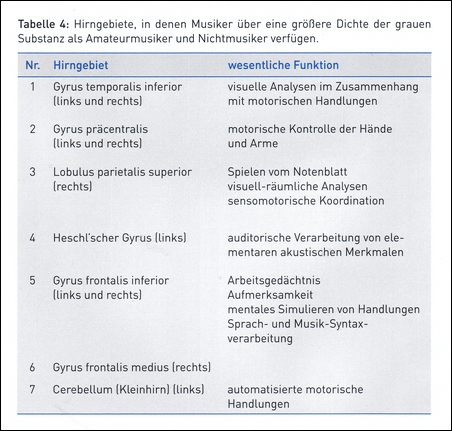 Zum Abschluss seines «Parforcerittes durch die Welt der Musik, des Lernens und des Gehirns» (Jäncke) kommt der Zürcher Wissenschaftler auf das je länger, desto intensiver thematisierte Problemfeld «Musik&Alter» zu sprechen (siehe auch unseren «Glarean»-Beitrag «Musik im Alter») Und auch Jänckes Forschungen brechen hier eine Lanze fürs Musizieren, gemäß dem bekannten Apodiktum «Use it or lose it», indem er die große Bedeutung von besonders drei Hirn-intensiven Betätigungen konstatiert: «Längsschnitt-Studien haben ergeben, dass ältere Menschen, die bis ins hohe Alter Musizieren, Tanzen und Brettspiele spielen, selten im fortgeschrittenen Alter an Demenzen leiden. Hierbei zeigte sich, dass ein Betätigungsumfang in diesen drei Freizeitaktivitäten von ca. einmal pro Woche das Risiko, später eine Demenz zu entwickeln, um ca. 7 % senkte. Die intensive Ausübung dieser Freizeitaktivitäten scheint die ‘kognitive Reserve’ im Alter zu steigern.» Zusammengefasst: «Menschen, die bis ins hohe Alter musizieren, verfügen über einen geringeren oder keinen Abbau des Hirngewebes im Stirnhirn im Vergleich zu Personen, die nicht Musizieren.» – –
Zum Abschluss seines «Parforcerittes durch die Welt der Musik, des Lernens und des Gehirns» (Jäncke) kommt der Zürcher Wissenschaftler auf das je länger, desto intensiver thematisierte Problemfeld «Musik&Alter» zu sprechen (siehe auch unseren «Glarean»-Beitrag «Musik im Alter») Und auch Jänckes Forschungen brechen hier eine Lanze fürs Musizieren, gemäß dem bekannten Apodiktum «Use it or lose it», indem er die große Bedeutung von besonders drei Hirn-intensiven Betätigungen konstatiert: «Längsschnitt-Studien haben ergeben, dass ältere Menschen, die bis ins hohe Alter Musizieren, Tanzen und Brettspiele spielen, selten im fortgeschrittenen Alter an Demenzen leiden. Hierbei zeigte sich, dass ein Betätigungsumfang in diesen drei Freizeitaktivitäten von ca. einmal pro Woche das Risiko, später eine Demenz zu entwickeln, um ca. 7 % senkte. Die intensive Ausübung dieser Freizeitaktivitäten scheint die ‘kognitive Reserve’ im Alter zu steigern.» Zusammengefasst: «Menschen, die bis ins hohe Alter musizieren, verfügen über einen geringeren oder keinen Abbau des Hirngewebes im Stirnhirn im Vergleich zu Personen, die nicht Musizieren.» – –
Lutz Jäncke, Macht Musik schlau? – Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie, 452 Seiten, Verlag Hans Huber, ISBN 978-3456845753
.
Leseproben
Inhalt
Vorwort (Eckart Altenmüller) 9 1. Einleitung 11 Von Kognitionen, psychischen Funktionen und Genen 13 Transfer 14 Wunderwelt der Neuroanatomie und Bildgebung 16 Von Zeitschriften und Büchern 18 Die Geschichte dieses Buches 20 Abschließende Bemerkungen 21 2. Der Mozart-Effekt - Beginn eines Mythos 23 2.1 Der Beginn 24 2.2 Die Folgen 33 2.3 Replikationsversuche 35 2.4 Weiterführende Experimente 45 2.5 Der Einfluss der Stimmung und der Musikpräferenz 50 2.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung 57 3. Längsschnittstudien 59 3.1 Allgemeines 59 3.2 Internationale Längsschnittuntersuchungen 61 3.3 Deutschsprachige Längsschnittstudien 74 3.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung 90 4. Querschnittuntersuchungen 95 4.1 Musik und Gedächtnis 96 4.2 Musikgedächtnis 105 4.3 Visuell-räumliche Leistungen 113 4.4 Rechenleistungen 138 4.5 Spielen vom Notenblatt 147 4.6 Motorische Leistungen 150 4.7 Musikwahrnehmung 157 4.8 Musiker und Nichtmusiker 192 4.9 Zusammenfassung und kritische Würdigung 194 5. Lernen und passives Musikhören 197 5.1 Suggestopädie 201 5.2 Ergebnisse aus dem Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching 207 5.3 Ergebnisse aus Zeitschriften, die von Fachleuten begutachtet werden 210 5.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung 233 6. Musik und Emotionen 237 6.1 Preparedness 240 6.2 Wir mögen, was wir häufig hören 246 6.3 Heute «hü» morgen «hott» - wechselnde emotionale Musikwirkungen 249 6.4 Hirnaktivität und emotionale Musik 258 6.5 Emotionen bei Profimusikern 271 6.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung 274 7. Wie verarbeitet das Gehirn Musik? 277 7.1 Zusammenfassung 292 8. Musik und Hemisphärenspezialisierung 295 8.1 Amusie 300 8.2 Amusien bei Musikern 302 8.3 Zusammenfassung 304 9. Wie produziert das Gehirn Musik? 307 9.1 Motorische Kontrolle 308 9.2 Sequenzierung 311 9.3 Gedächtnis 314 9.4 Aufmerksamkeit 315 9.5 Musizieren - Kreativität 317 9.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung 325 10. Verändert Musizieren das Gehirn? 327 10.1 Wiederholen ist die Mutter des Lernens 329 10.2 Expertise - Üben, Üben, Üben 334 10.3 Gehirne wie Knetmasse 335 10.4 Reifung und Hirnplastizität 347 10.5 Plastizität nicht nur bei Musikern 349 10.6 Zusammenfassung 355 11. Musik und Sprache 357 11.1 Funktionen und Module 359 11.2 Von Tönen und Sprache 361 11.3 Fremdsprachen und Musik 365 11.4 Syntax und Semantik 367 11.5 Klingt Musik französisch, deutsch oder englisch? 375 11.6 Musik und Lesen 376 11.7 Musik und Sprachstörungen 381 11.8 Zusammenfassung 387 12. Musik und Alter 391 12.1 Zusammenfassung 399 13. Schlussfolgerungen 401 Macht das Hören von Mozart-Musik schlau? 402 Hat Musikunterricht einen günstigen Einfluss auf Schulleistungen und kognitive Funktionen? 403 Worin unterscheiden sich Musiker von Nichtmusikern? 404 Lernt man besser, wenn man gleichzeitig Musik hört? 405 Beeinflusst Musik die Emotionen? 407 Wird Musik in bestimmten Hirngebieten verarbeitet? 408 Wie produziert das Gehirn Musik? 409 Verändert Musizieren das Gehirn? 410 Besteht ein Zusammenhang zwischen Musik und Sprache? 411 Ist es gut, wenn man im fortgeschrittenen Alter musiziert? 412 Soll man in der Schule musizieren? 413 14. Dank 415 15. Literatur 417 Sachwortregister 433 Personenregister 451
.
.
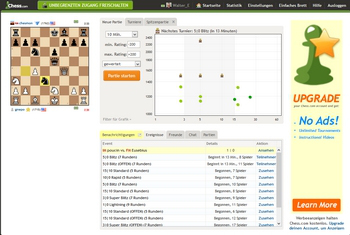
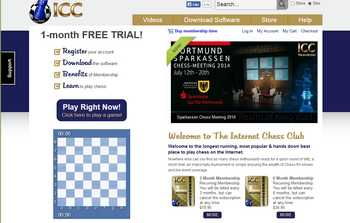

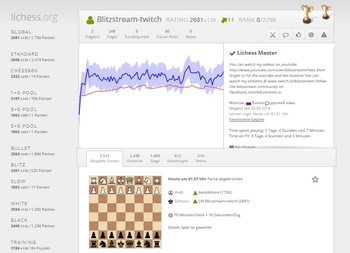

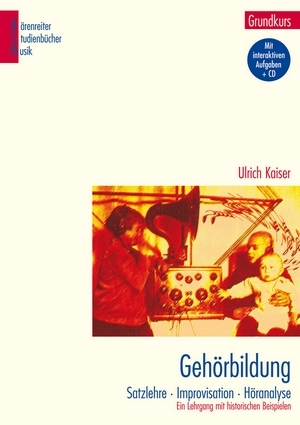

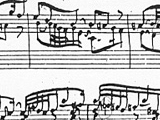


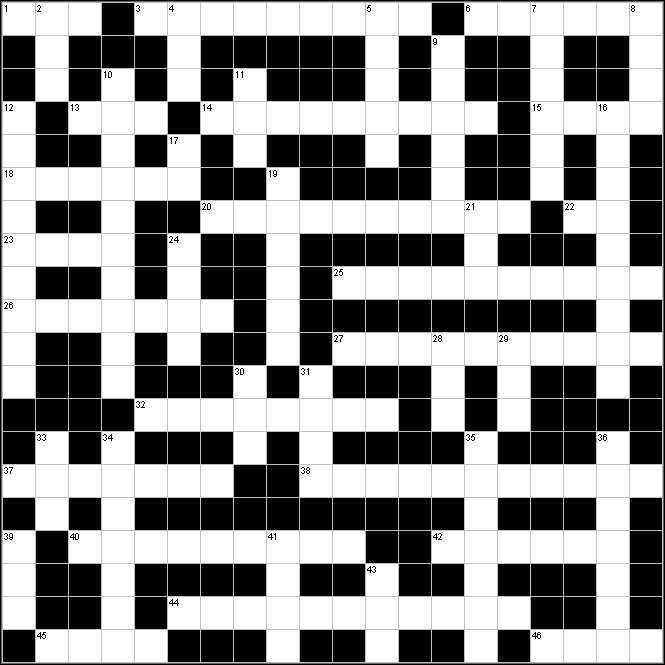
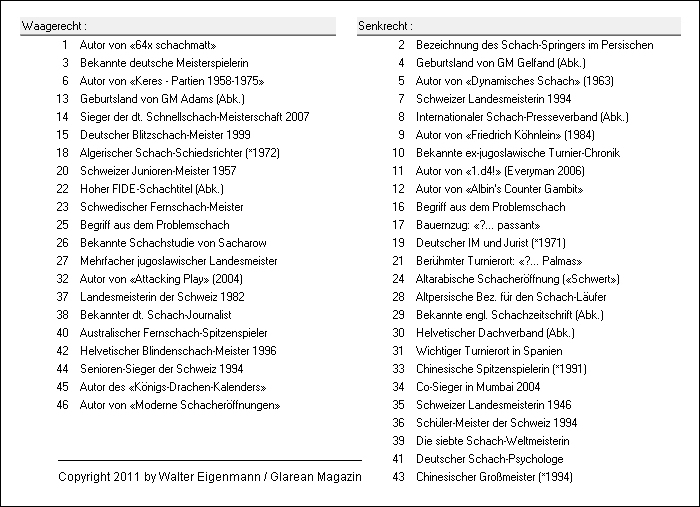






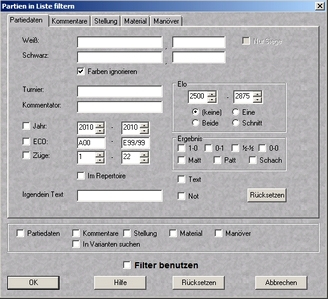
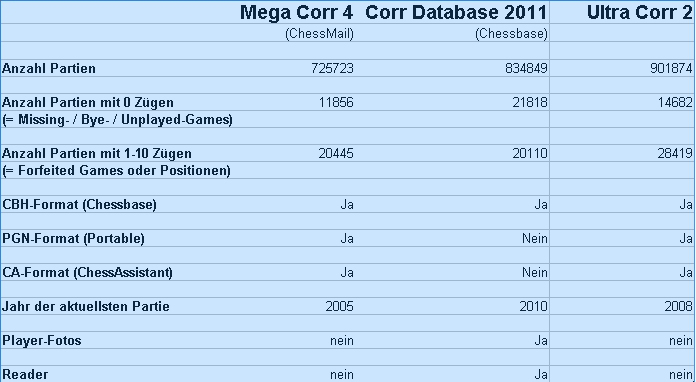



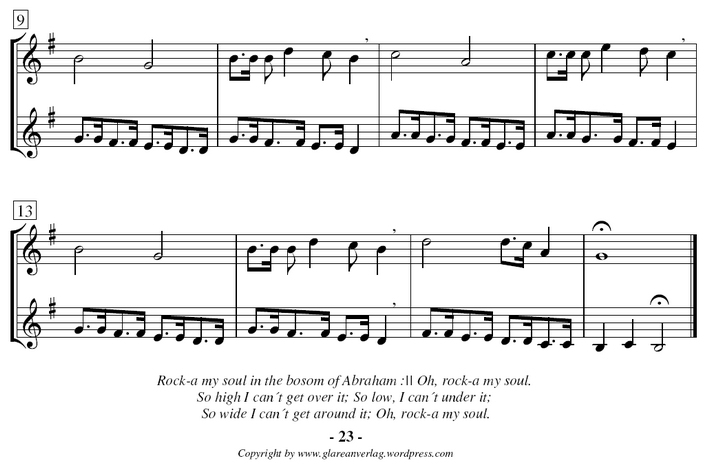
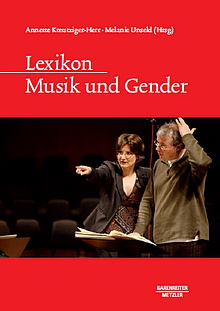

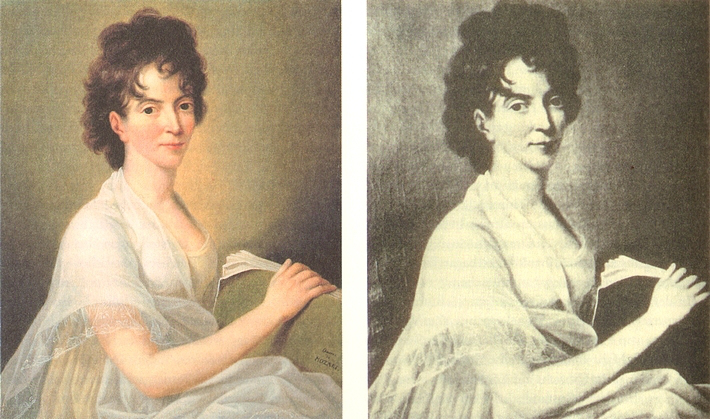
























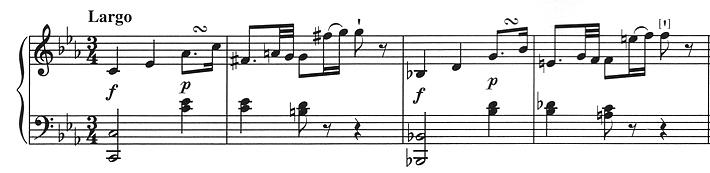




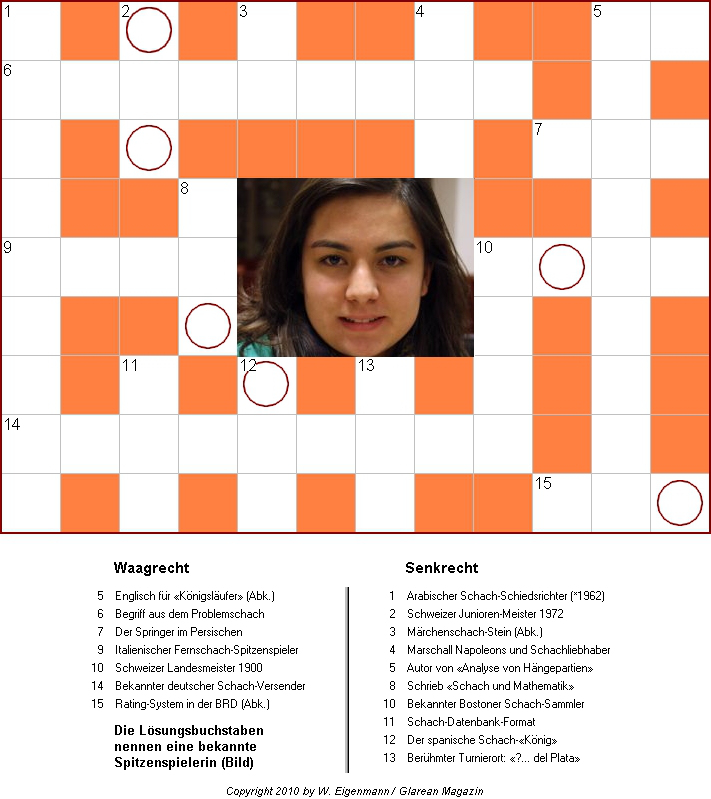
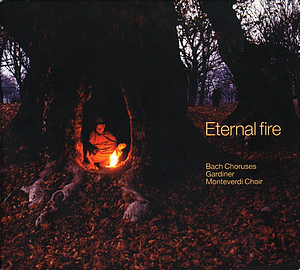


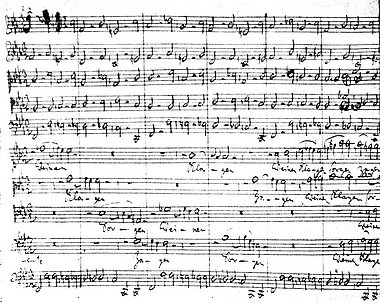

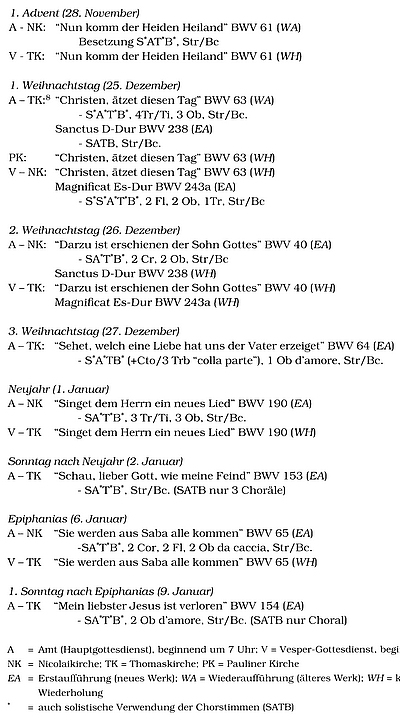


































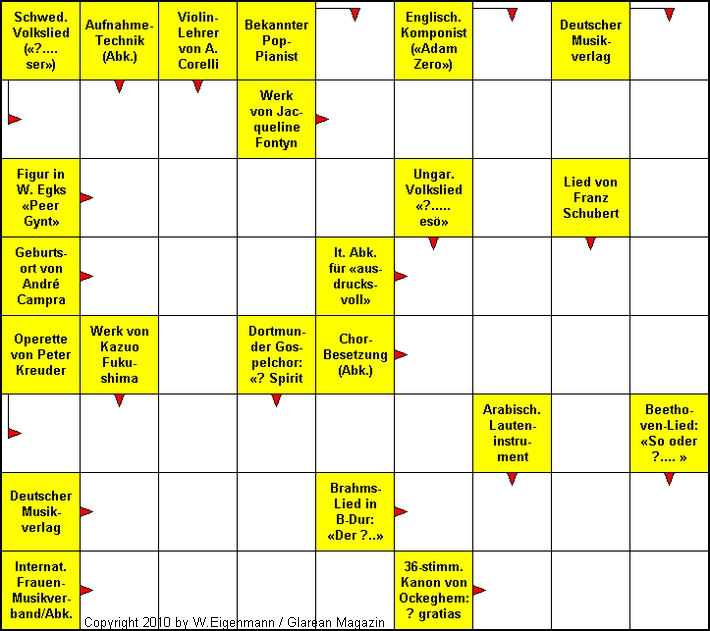
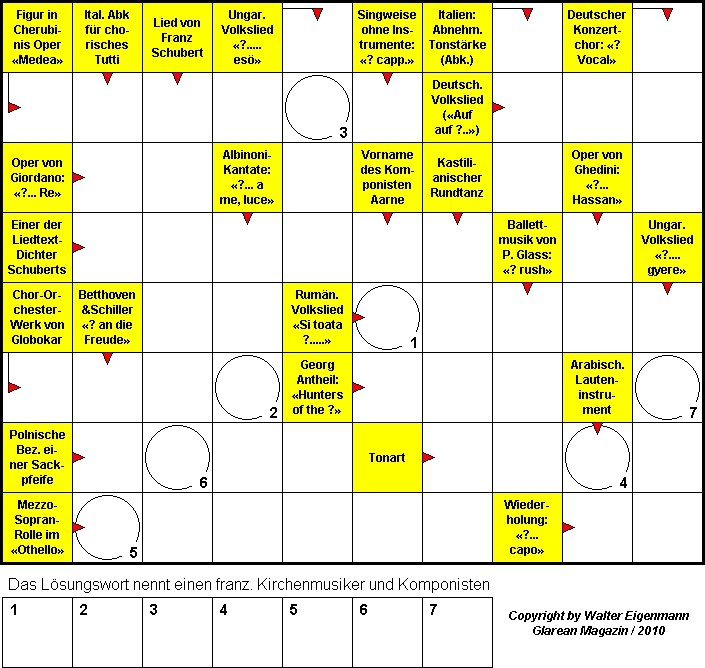
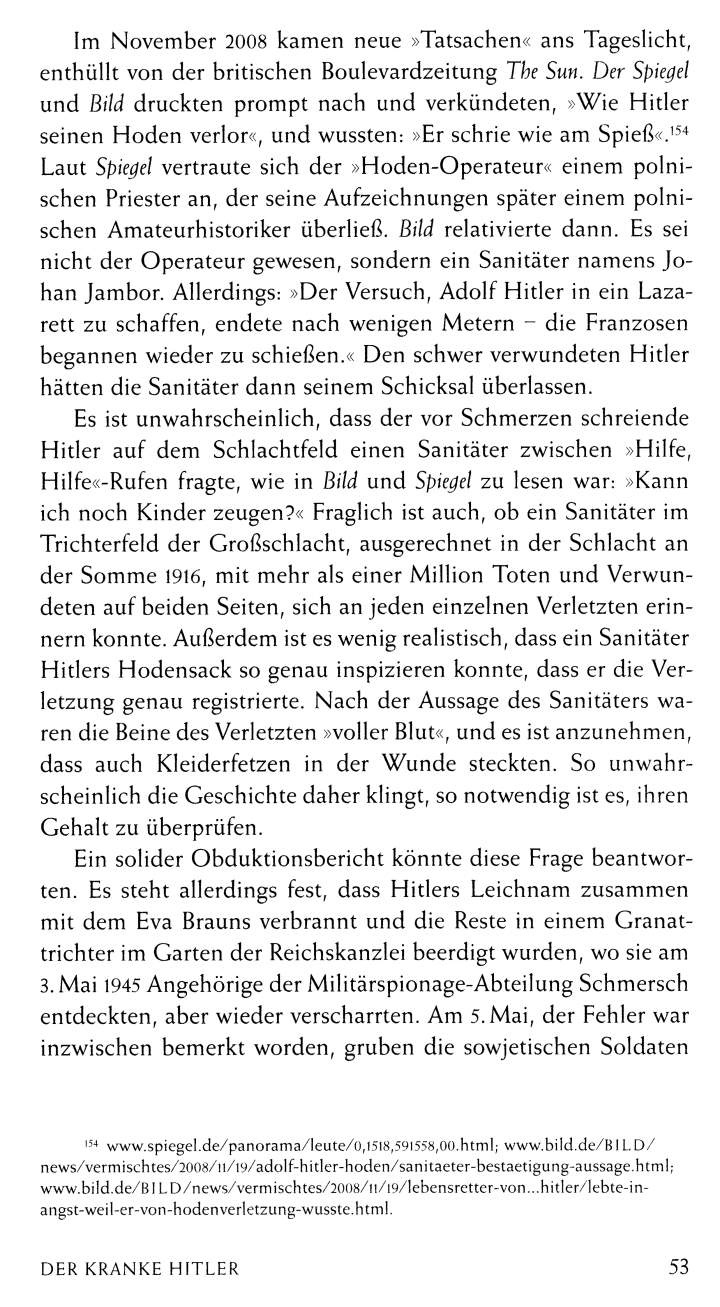
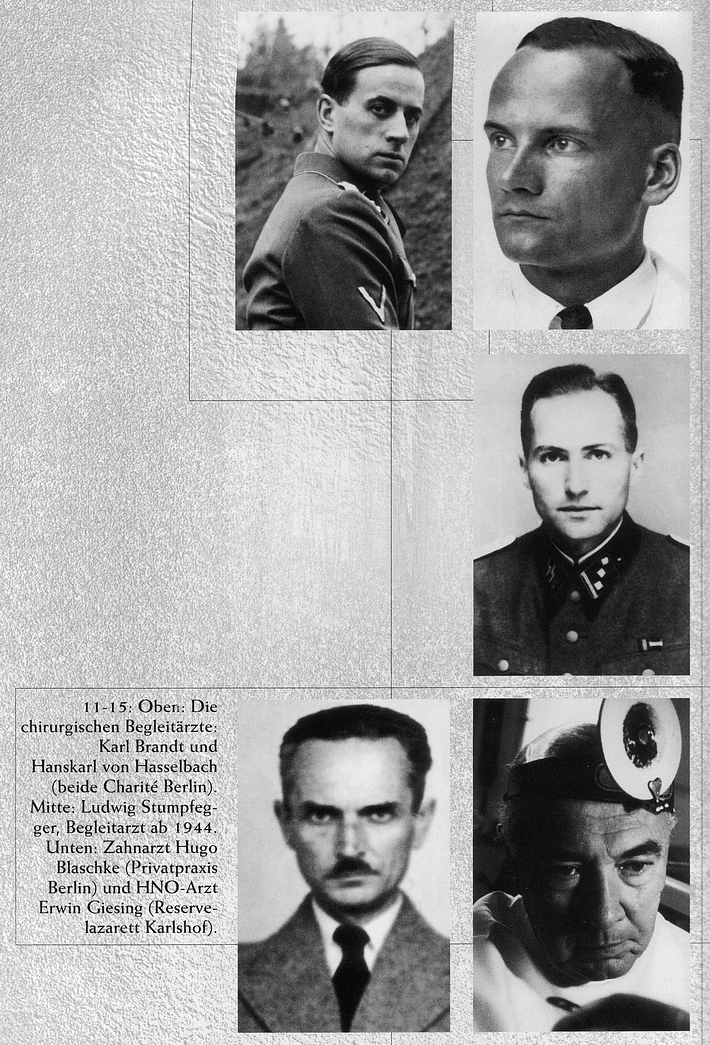
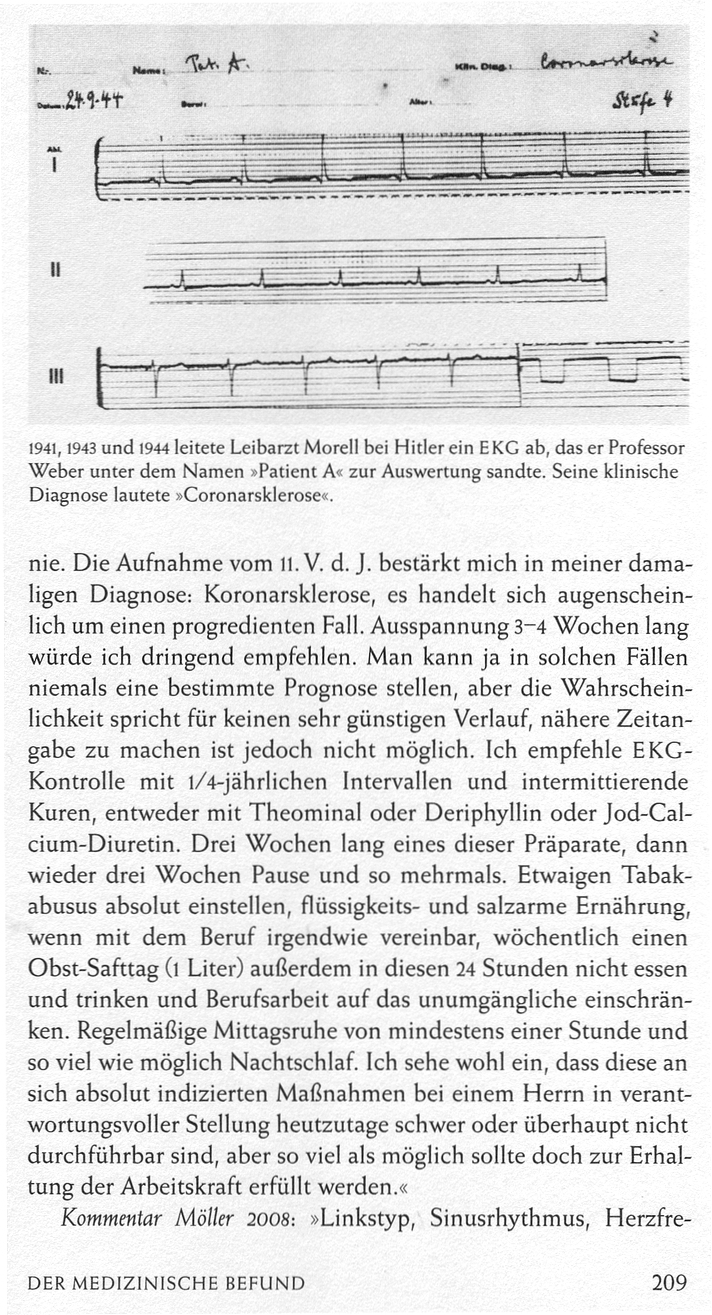
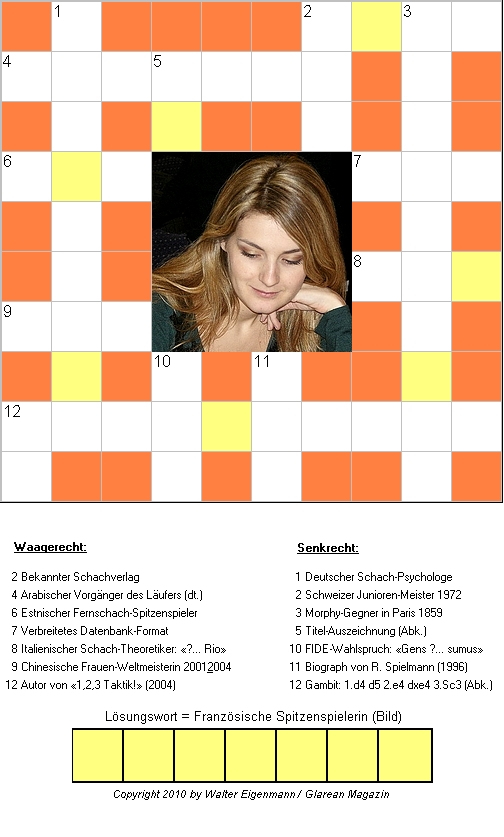

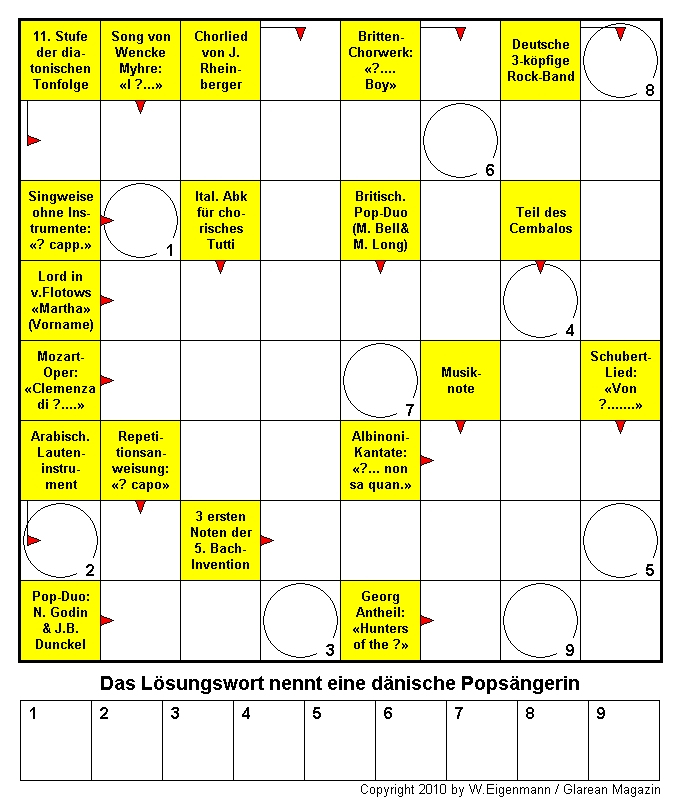
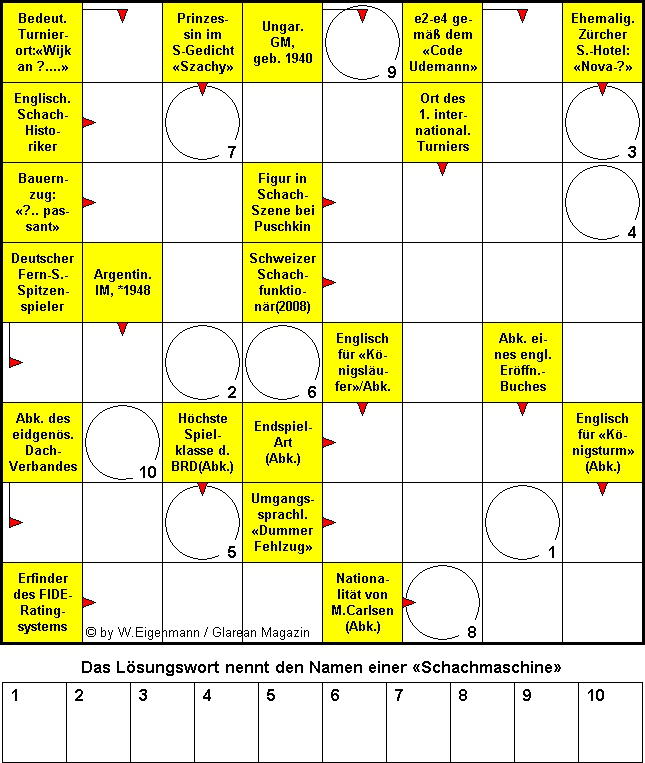
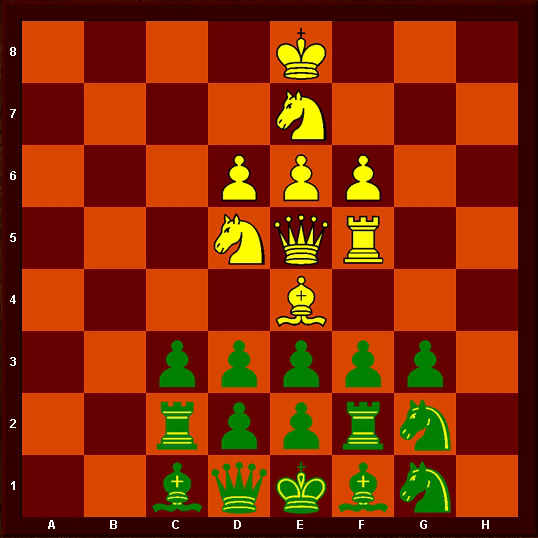
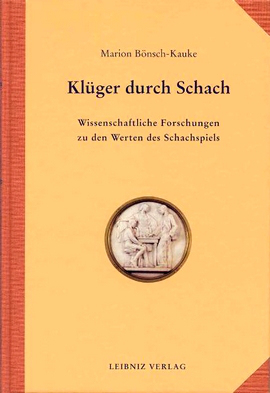

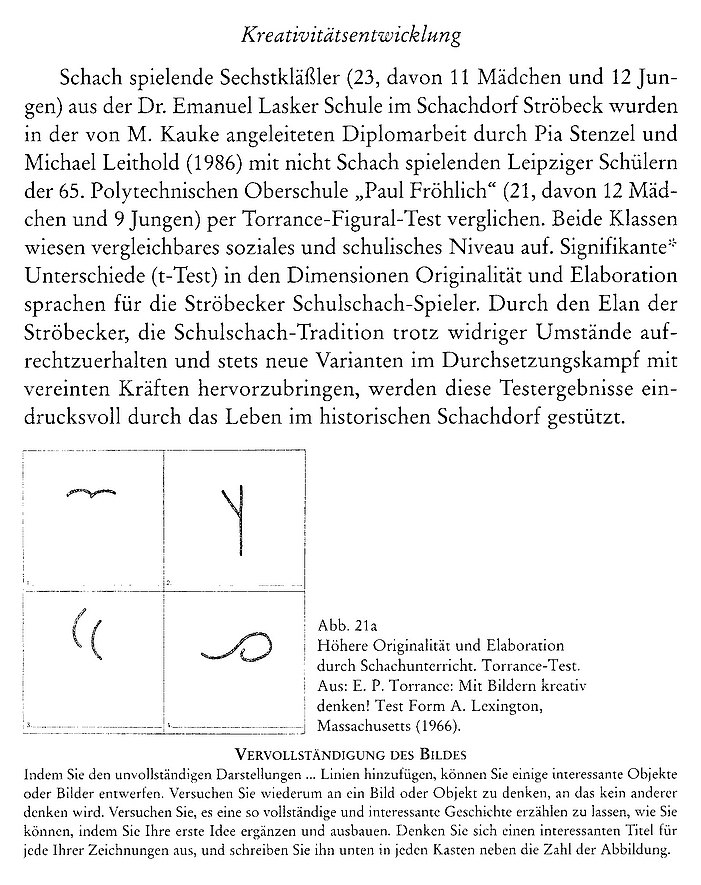

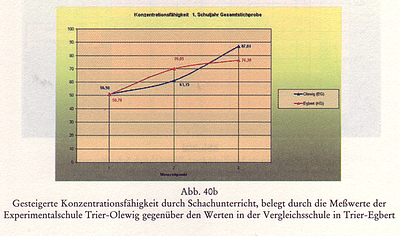
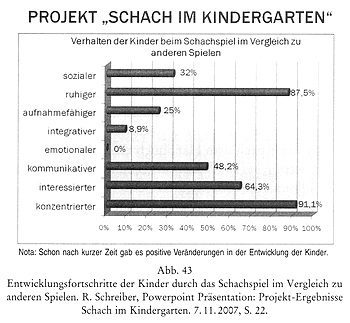
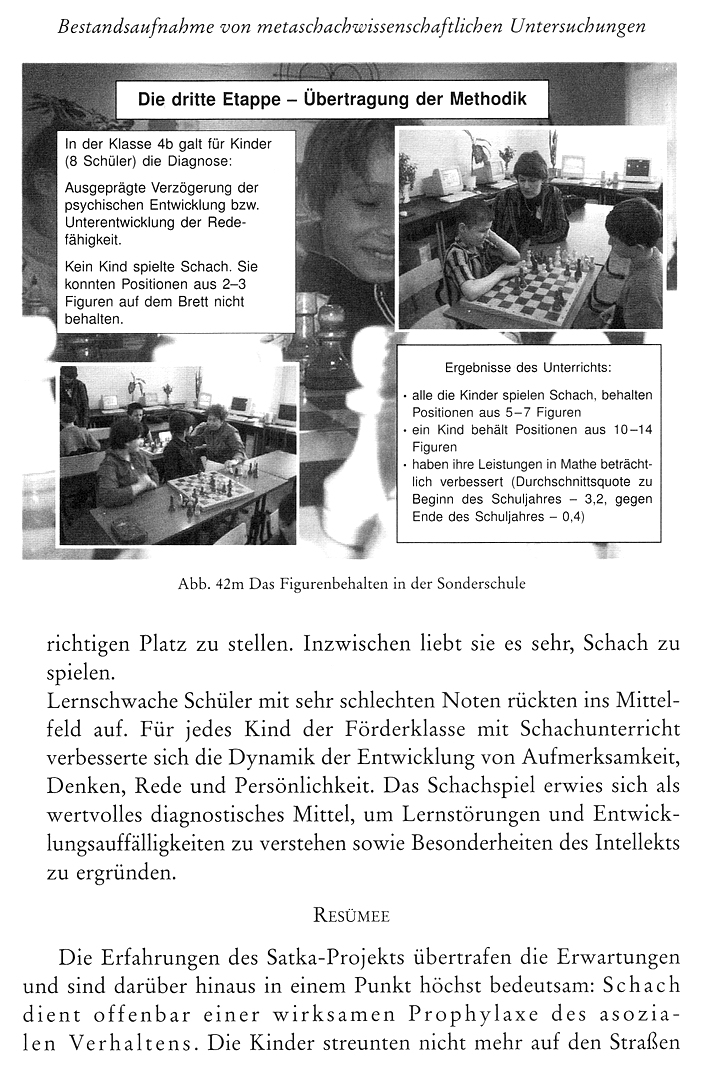

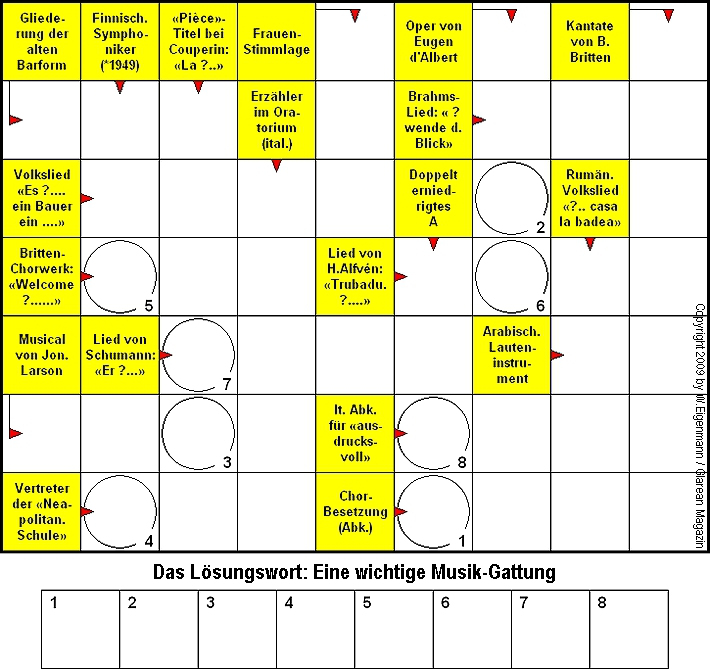
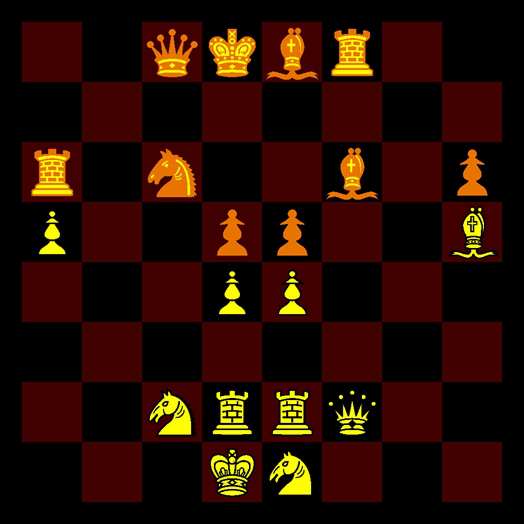

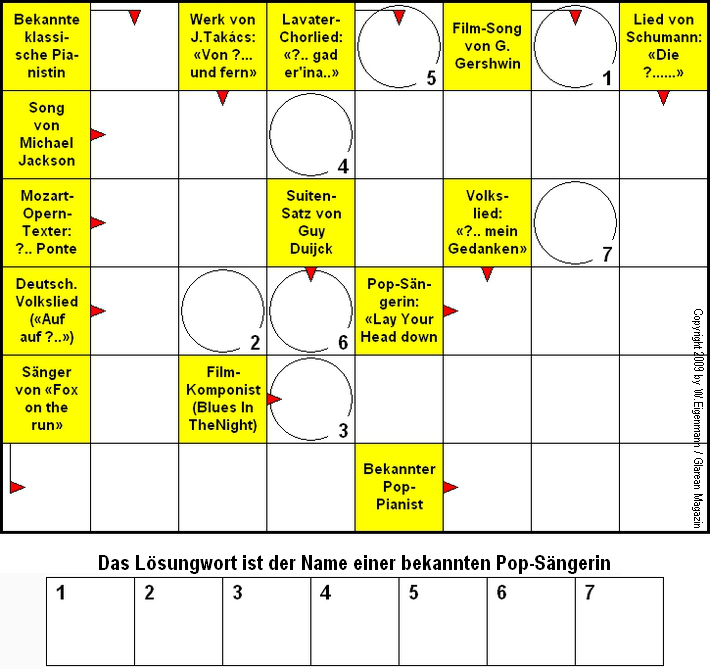
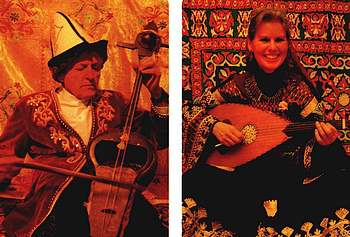

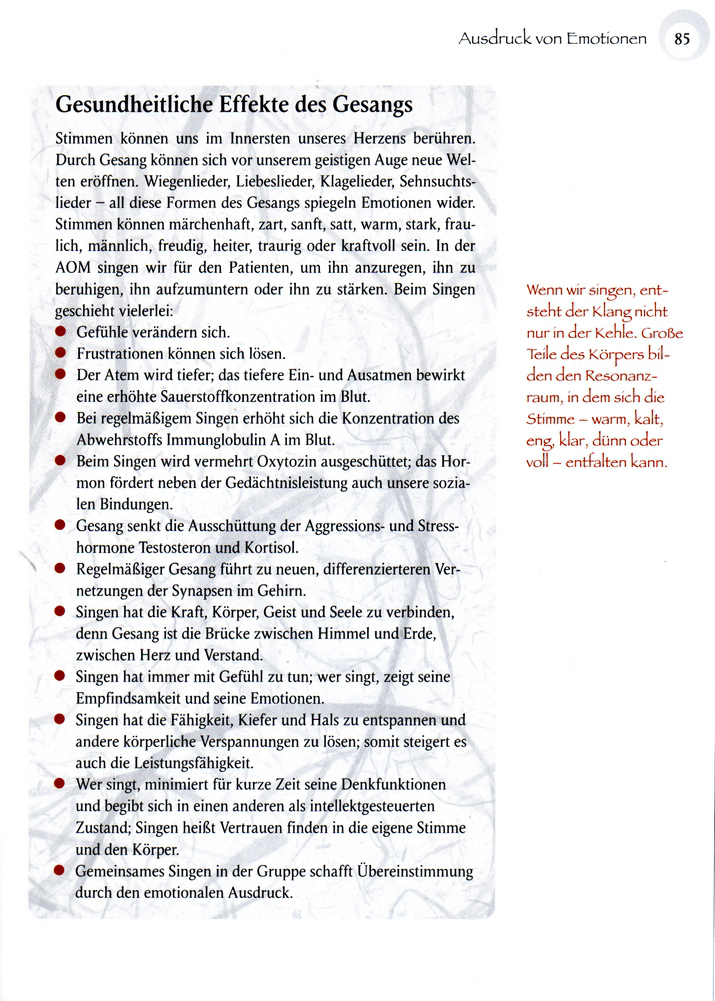
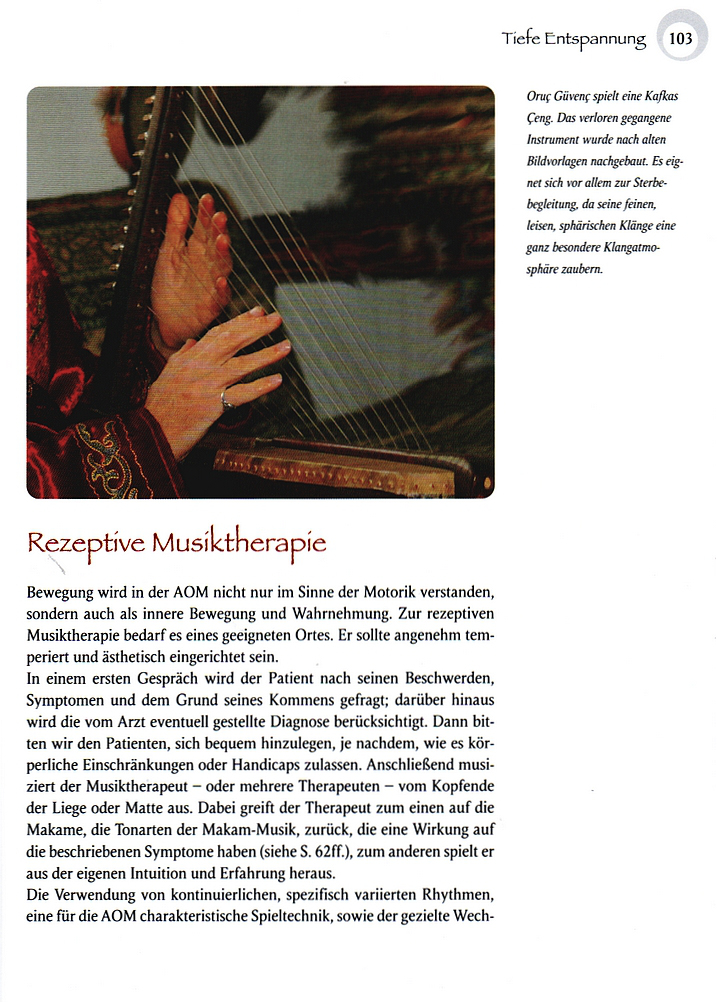










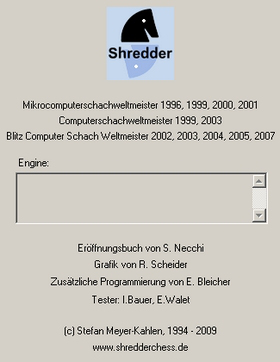





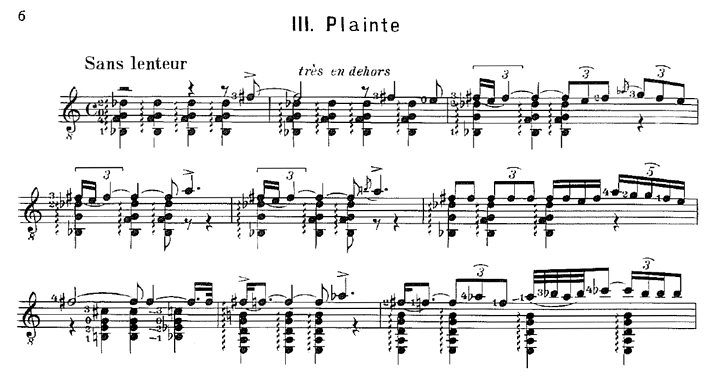

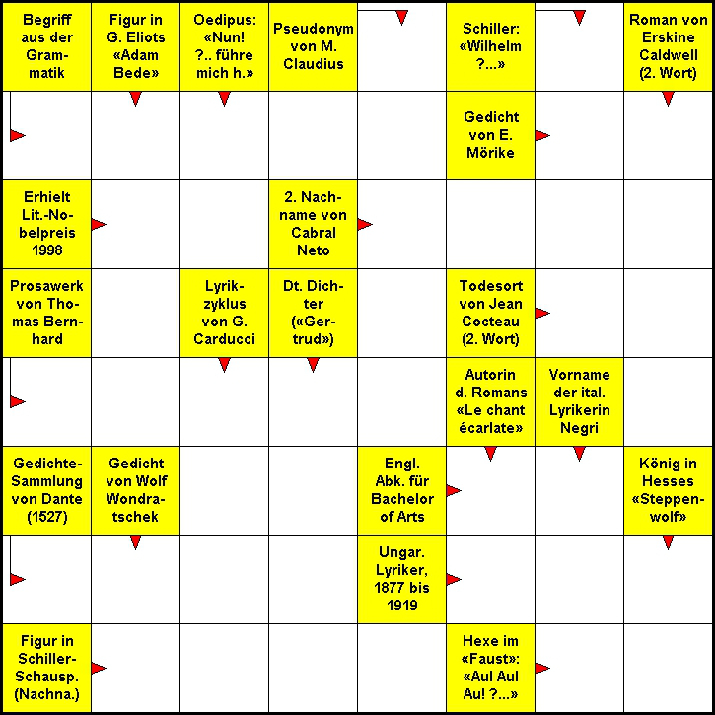
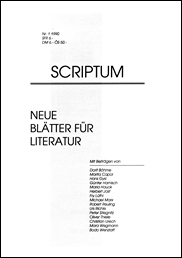
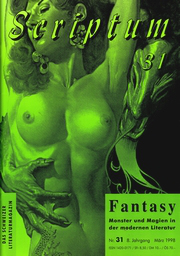








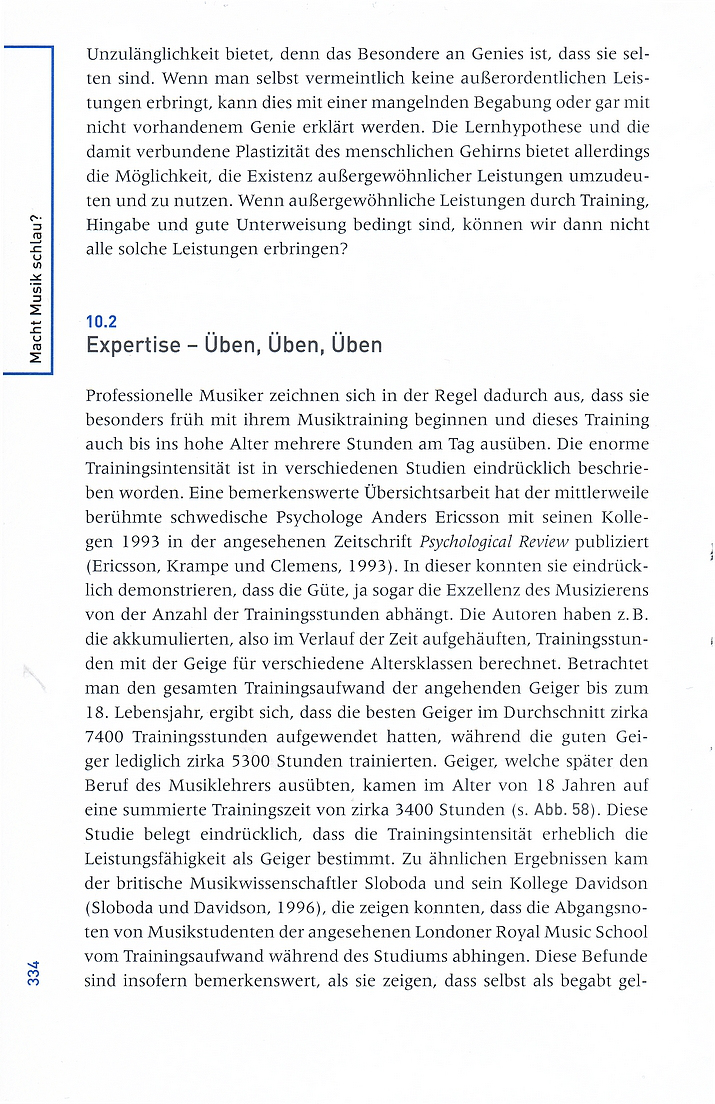
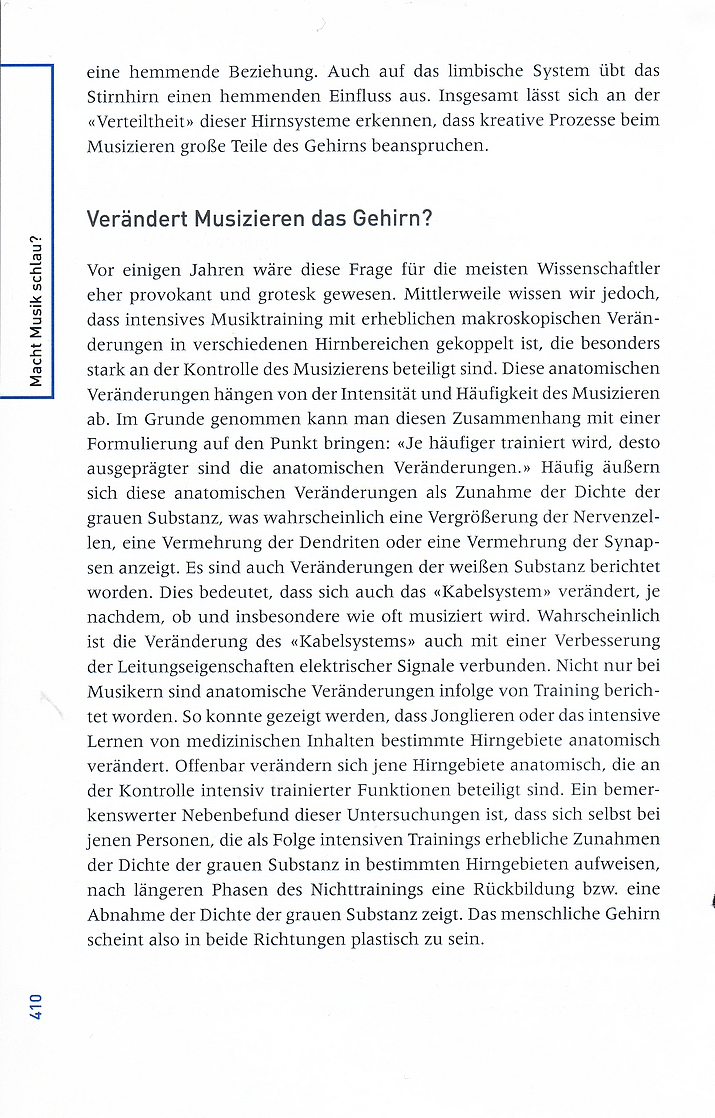





leave a comment