Eine göttliche Komödie
Unter den Danteanern von Florenz
von Elif Batuman
I. INFERNO
Beim Dante-Marathon in Florenz wird die gesamte Göttliche Komödie vorgetragen von Vorlesern in farbkodierten Jerseys, die mit den Nummern ihrer jeweiligen Gesänge verziert sind. Die Lesungen schreiten in konzentrischen Kreisen voran: In den Randbezirken der Stadt beginnt alles mit der Hölle, und es endet auf den Stufen des Doms mit dem Paradies. Im Frühjahr des Jahres 2009 – und trotz meiner dürftigen italienischen Sprachkenntnisse – nahm ich an diesem Marathon teil. Mit meinem infernoroten Jersey mit der Nummer 33 las ich den Gesang, in dem Dante und Vergil den gefrorenen Höllenboden überqueren, wo Verräter ihre Strafe finden. Sie treffen auf Graf Ugolino und Erzbischof Ruggieri: »Als zwei Erfrorn’ ich sah in einem Loche, / So daß ein Haupt, als Hut, das andre deckte.«.[1] Es stellt sich heraus, dass dies bedeutet, Graf Ugolino ist gerade dabei, den Kopf des Erzbischofs zu verzehren.
Ich erfuhr erstmals von dem Dante-Marathon durch eine Studentin in einem Dissertations-Workshop, den ich in Stanford gab. Die Studentin, eine aufstrebende Opern-Sopranistin, schrieb eine Abschlussarbeit über Vokalisierung bei Dante. Im Seminar sprach sie in einem stimmbandschonenden, emotionslosen Flüsterton. Erst viel später hörte ich sie singen – die vollkommen fremde Stimme, so rein und doch so wissend, entfaltete sich wie ein prächtiges, nicht endendes Gewebe aus ihrem winzigen chinesischen Körper.
Georgia hatte sich für den Marathon während eines Auslandssemesters in Florenz angemeldet. Als ich das Bildmaterial auf ihrem iPhone ansah, war ich zutiefst beeindruckt von der Atmosphäre aus bürgerlicher Buße. Der Bürgermeister von Florenz fand sich ein und rezitierte aus dem Inferno. Ein Schauspieler in einer Dante-Tracht streifte umher und erklärte, wie großartig es sei, wieder zu Hause zu sein.
Am nächsten Tag ging ich zu einem Vorsprechen für den Marathon, in einem kleinen Theater einige Kilometer entfernt am anderen Ufer des Arno. Ich wurde begleitet von meiner lieben Freundin Marilena, die in der Graduate School meine Kommilitonin gewesen war. Heute lebt Marilena in Sizilien, wo sie begonnen hatte, eine Dissertation über Dantes Präsenz in der Poetik von Ossip Mandelstam zu schreiben. Dante war ein äußerst wichtiger Dichter für Mandelstam, der viele Jahre im Exil verbracht hatte, bevor er in einem sibirischen Arbeitslager starb (seine letzten niedergeschriebenen Worte bestanden aus einer Nachricht an seine Frau, in der er um wärmere Kleidung bat), und der oft Gelegenheit fand, sich zu fragen, »wieviele Sohlen, wieviel Rindsleder, wieviele Sandalen Alighieri während seiner dichterischen Arbeit auf den Ziegenpfaden Italiens durchgelaufen hat.«[2]
Wir saßen auf den besonnten Stufen des Foyers und lasen uns abwechselnd unsere Gesänge vor: Marilena mit ihrer wunderschönen, strengen südlichen Intonation, und ich mit meinem amerikanischen Akzent, der mich niemals verlässt, in keiner Sprache.
»Sie klingen, als hätten Sie Angst«, sagte der Regisseur.
»Ich habe Angst«, sagte ich.
Der Regisseur schien die Situation zu überdenken.
»Nutzen Sie Ihre Angst«, folgerte er. »Verwenden Sie Ihre Unschuld als eine Stärke, nicht als eine Schwäche.«
Der Regisseur hatte Theateranthropologie studiert. Seine Abschlussarbeit beschäftigte sich mit tarantismo, der Kultur der Tanzwut, die die Bisse einer Tarantel zu heilen versucht, indem sie die Tarantella auftanzt. Er teilte den Gesang auf uns beide auf, wir sollten ihn abwechselnd lesen. Ich, mit meiner Unschuld, bekam alle Zeilen, die von den verhungernden Kindern gesprochen werden. Gaddos Worte: »Mein Vater, ach! was hilfst du mir nicht!« Anselmuccios Worte: »Blickst mich ja so an, was hast du, Vater?« Und sogar die mehrstimmigen Worte: »Du umgabst uns / Mit diesem Jammerfleisch, nimm es uns wieder.«[3]
»Betonen Sie ›du‹«, sagte der Regisseur, »du umgabst uns / Mit diesem Jammerfleisch, nimm es uns wieder.«
Jorge Luis Borges hielt die Einladung zu diesem Hungermahl, gesprochen von allen vier Kindern gleichzeitig, »fast im Chor«,[4] für eine der sehr wenigen Ungereimtheiten in der gesamten Komödie. Dante konnte eine solche Ungereimtheit unmöglich versehentlich erzeugt haben, und so muss es seine Intention gewesen sein, dass diese Zeile unglaubwürdig klingt. Nach Meinung von Borges wollte Dante unseren Argwohn wecken, um uns glauben zu machen, dass die Kinder vielleicht nichts dergleichen gesagt hatten – dass Ugolino es erfunden hatte. Warum? Nun, wenn er ein Kannibale war, könnte er eine Lüge erfunden haben, »die das längst begangene Verbrechen rechtfertigen soll.«[5]
In einer Seitenstraße in der Nähe des Museums, das auf dem Fundament des Gebäudes errichtet worden war, in dem Dante vielleicht geboren wurde, kann man die Kirche besuchen, in der der neunjährige Dichter möglicherweise den ersten flüchtigen Blick auf Beatrice erhaschte. Manche finden es seltsam, dass Dante beteuerte, sich in Beatrice verliebt zu haben, als sie acht Jahre alt war; sie versuchen sich herauszureden, indem sie sagen, dass Mädchen in den alten Zeiten schneller erwachsen wurden. Allerdings denke ich, es ist einer der schönsten Aspekte in Das neue Leben, dass Dante Beatrice das erste Mal sieht, wie sie in ihr geschmackvolles, purpurrotes Kleid gehüllt ist, »gegürtet und geschmückt, wie es ihrer zarten Jugend geziemte.«[6]
Jahre später, nachdem Beatrice einen Bankier geheiratet hatte und gestorben war, erscheint sie Dante in einem Traum, um ihn zu tadeln, dass seine Gedanken um andere Frauen kreisen. Sie erscheint nicht als die 18-jährige Schönheit, die seine Augen zum letzten Mal erblickt hatten, sondern in ihrem kleinen purpurnen Kleid und »im selben zarten Alter, in dem ich sie zum ersten Mal erblickt hatte.«[7] Für mich ergibt das eine ganze Menge Sinn. Wenn ich verliebt bin, ist es immer eine Quelle großer Traurigkeit zu wissen, dass ich meinen geliebten Menschen niemals als Kind sehen werde – dass ich niemals dieses weiche Haar berühren werde, in diese leuchtenden Augen schauen oder diesen kleinen Körper halten werde, so eingebündelt und lieb.
Im Innern der winzigen, erdrückenden Kirche wurde ein Medley klassischer Musik über unsichtbare Lautsprecher in den Raum geleiert. An den Wänden hingen einige wirklich furchtbare Gemälde von Dante und Beatrice, offenbar recht neuerliche Fabrikationen. In der Nähe eines Anschlagbretts mit Fotografien eines Freiwilligen-Abendessens quoll ein riesiger Korb vor Papierschnipseln über. Dies waren Briefe an Beatrice. Marilena war der Meinung, es sei falsch, Beatrices Post zu lesen, doch ich konnte mich nicht losreißen.
»Cara Beatrice, hilf mir dabei, morgen vor der Person, die mir am meisten bedeutet – Walter –, die ganze Wahrheit zu entfalten und in sein Herz zu gelangen.«
»Cara Beatrice, mein Name ist Agnese Bizzarri. In letzter Zeit habe ich häufige und sehr verstörende Auseinandersetzungen mit meinen Eltern. Seit langer Zeit schon habe ich nun keine Gefühle von Liebe erlebt ...«
Auf einem Zettel, auf Russisch bekritzelt, stand geschrieben: »Hilf mir meine Liebe zu finden – in diesem Leben.«
Am Morgen des Marathons holten wir unsere Jerseys in einem Wohnwagen in der Nähe des Doms ab. Man sollte die Jerseys über sein Hemd binden. Eine freiwillige Helferin beäugte uns hinter ihrem Klemmbrett. »Hat Ihnen niemand gesagt, dass Sie rote Hemden anziehen sollen?«
Wir gingen zu Zara, um uns rote Hemden zu kaufen. In der Abteilung für Sportbekleidung war es unbegreiflich heiß, der Raum kochte vor Menschen und war auf diabolische Weise von einer gigantischen Intelligenz strukturiert worden, die längst in unsere Seelen gespäht hatte, uns verurteilt hatte und jeden von uns dazu brachte, unserem Willen nach unserem jeweiligen, ganz speziell erbärmlichen Schicksal zu folgen – diejenigen, die nach ärmellosen Stehkragenpullovern mit Leopardenmuster suchten, wurden exakt durch die Suche nach ärmellosen, halben Stehkragenpullovern mit Leopardenmuster bestraft, während ein irgendwie anderes Schicksal jene ereilte, die in einem parallelen Kreis des Geschäfts nach »nautischen« Hemdkleidern suchten. Die Luft war voller Ellbogen und den einzigartigen Klingeltönen Tausender Mobiltelefone. Durch dieses Getümmel wanderten wir, angezogen von jedem Fetzen roten Stoffs.
Eine Stunde später – in einem eleganten, roten Leinen-V-Ausschnitt beziehungsweise einem roten Viskose-Tanktop – standen Marilena und ich in der Piazza della Repubblica unter der ganzen Glut der Sonne und spähten mit zusammengekniffenen Augen auf einen gigantischen Fernsehbildschirm. Es war eine Live-Übertragung des Marathons. Irgendwo in der Stadt las ein sehr alter Mann die ersten Gesänge der Hölle. Beifälliges Murmeln zog sich durch die Menge: »Foà, Foà«, und manchmal auch »Foie Gras« – ich schätzte, ein Spitzname des 95 Jahre alten Filmstars Arnoldo Foà. Einige Meter von Marilena und mir entfernt, plauderte der Präsident der Universität Florenz mit einer noch wichtigeren Person, die mir vorgestellt wurde als »der Präsident der Präsidenten«.
Der Marathon war wesentlich komplizierter, als wir beide ursprünglich gedacht hatten. Die gesamte Göttliche Komödie würde nicht nur einmal gelesen werden, sondern dreimal, und an verschiedenen Orten der Stadt würden Lesungen parallel stattfinden, einem raumzeitlichen Schema folgend, das kaum weniger vielschichtig war als Dantes Kosmologie.
Die »neun Danteschen Wurfscheiben-Sphären«,[8] hatte Mandelstam die kristallinen Sphären des Himmels genannt.
Es sprach jemand über einen berühmten Metzger aus Chianti, der alle Gesänge des Infernos vortragen kann, während er Bistecca alla Fiorentina aus der Lende eines Weidochsen herausschneidet.
Hitzegebeutelt machten sich Marilena und ich auf den Weg durch die Stadt zum Chiostro dello Scalzo, wo unsere Lesung stattfinden sollte. Fresken von Andrea del Sarto, jedes in einem traumgrünlichen Ocker gehalten, stellten Szenen aus dem Leben von Johannes dem Täufer dar. In der Wüste predigte Johannes zu einer Menschenmenge konvertierter Juden, deren Gesichter ein pflanzengleiches Leuchten verströmten. Am Ende der Menschenmenge stand die Figur Dantes, unverwechselbar mit seiner Lorbeerkrone, seiner Hakennase und seinem mürrischen Ausdruck. Was immer es war, das Johannes sagte, auf den großen Dichter machte es offenbar wenig Eindruck.
Kurz darauf hatte sich eine kleine Gruppe auf dem Kreuzgang angesammelt, und das Licht von del Sarto spiegelte sich auf ihren Gesichtern und ließ sie leuchtend erscheinen, detailreich, menschlich, wie liebevoll gezeichnete Nebenfiguren.
Wir nahmen unsere Plätze an den Mikrofonen ein und Marilena begann, die grausamen Eröffnungszeilen des 33. Gesangs zu lesen:
Den Mund erhob vom grausen Mahl der Sünder,
Abwischend an den Haaren ihn des Hauptes,
Das am Genick er übel zugerichtet.[9]
Sechs Terzette darauf übernahm ich, wenn Ugolino von dem Verrat durch Ruggieri erzählt hat und anschließend seine Einkerkerung in dem Käfig beschreibt:
Ein Enges Loch im Umkreis jenes Käfigs,
Der jetzt nach mir den Namen trägt des Hungers,
Und andere dereinst noch muß umschließen,
Er hatte manchen Mond durch seine Öffnung
Mir schon gezeigt, als unheilvoll ein Schlummer
Den Schleier mir zerriß vor meiner Zukunft.[10]
Der Marathon endete mit einer choralen Lesung des letzten Gesangs aus dem Paradies vor dem Dom. Es dauerte eine Weile, bis all die 650 Leser, von denen die meisten Schulkinder waren, in die vierreihige Tribüne gestopft worden waren, und im Anschluss dankten die Organisatoren des Festivals ungefähr einer Milliarde italienischer und europäischer Sponsoren. Eine Lehrerin hinter mir stieß mich nachdrücklich an und verlangte, dass ich einen Schritt hinuntertrete. »Sie sind sehr groß«, klagte sie. Ich wies sie darauf hin, dass es nichts gab, wohin ich hinuntertreten könnte, und ich bot ihr an, Plätze zu tauschen. Sie schnaubte, schüttelte den Kopf und begnügte sich damit, mir ihren Ausdruck von Paradiso XXXIII in den Nacken zu stoßen. Die Ausdrucke waren mit Pausen und Betonungen markiert worden, um es 650 Menschen zu ermöglichen, im Einklang zu lesen.
Schließlich nahm der Regisseur seinen Platz ein, hob die Hände und riss sie in einer schwungvollen Bewegung herunter. »Vergine Madre!«, riefen wir alle aus. »Figlia del tuo figlio! Umile e alta più che creatura!« Und trotz der Hitze und der Papierschnittwunde in meinem Nacken, trotz der Tatsache, dass mir die Pausen bei der Probe am Vortrag willkürlich und unnatürlich vorgekommen waren und trotz der hinteren Plätze, die sowohl Jungfräulichkeit als auch Demut auf der Liste meiner kulturellen oder persönlichen Werte besaßen, war es unmöglich, nicht von der Schönheit und der Rätselhaftigkeit der Sprache davongetragen zu werden – jungfräuliche Mutter, Tochter deines Sohnes –, und vor allem von dem geisterhaften, hohen Gleichklang, der in der Dämmerung Dantes unsterbliche Zeilen verkündete: »Doch schon schwang um mein Wünschen und mein Wollen, / Wie sich gleichförmig dreht ein Rad, die Liebe, / Die da die Sonne rollt und andere Sterne.«[11]
Aus dem Amerikanischen von Jan Wilm
Der Beitrag ist ein Auszug aus Elif Batumans Text „Eine göttliche Komödie“. Er erscheint in voller Länge in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift „Neue Rundschau“.
[1] Dante Alighieri, Die göttliche Komödie, übers. v. Philalethes (König Johann von Sachsen), S. 136.
[2] Osip Mandelstam, ›Gespräch über Dante‹, in: Gespräch über Dante: Gesammelte Essays 1925–1935. Übers. v. Ralph Dutli. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1994. S. 118.
[3] Ebd., S. 138.
[4] Jorge Luis Borges, ›Das falsche Problem mit Ugolino‹, in: Die letzte Reise des Odysseus: Essays. Übers. v. Gisbert Haefs. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1992. S. 219.
[5] Ebd., S. 219.
[6] Dante Alighieri, Das neue Leben, übers. v. Hannelise Hinderberger, Zürich: Manesse, S. 5.
[7] Ebd., S. 74.
[8] Ossip Mandelstam, ›Hab verirrt mich am Himmel – was nun?‹, in: Die Woronescher Hefte. Letzte Gedichte: 1935–1937, übers. v. Ralph Dutli, Zürich: Ammann Verlag, S. 187.
[9] Dante Alighieri, Die göttliche Komödie, übers. v. Philalethes (König Johann von Sachsen), S. 137.
[10] Ebd.
[11] Ebd., S. 426.
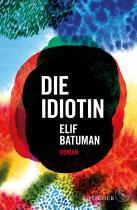
›Die Idiotin‹ ist ein unvergesslicher Roman, der am Elite-College Harvard spielt - von einer der originellsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur: Elif Batuman.
New Jersey, 1995: Selin, Tochter türkischer Immigranten, jung, hinreißend und ahnungslos, zieht aus, um in Harvard Literatur zu studieren. Die College-Wohnheime sind mit Albert Einstein-Postern und Lavalampen dekoriert, das Internet ist noch jung und die nächtlichen E-Mails, die ihr Ivan, der ungarische Mathestudent, schickt, sind ebenso bezaubernd wie unverständlich. Aber Selin manövriert sich tapfer durch die ersten Stürme der Erwachsenenjahre. Sie reist mit ihrer Freundin Svetlana nach Paris, lernt Russisch und Taekwondo – und dass die Liebe flüchtig ist. Ein Buch über die magische Zeit des Erwachsenwerdens und das Porträt einer jungen Frau, die auszieht, um ihren Platz in der Welt zu suchen – hellwach und feinsinnig erzählt.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /